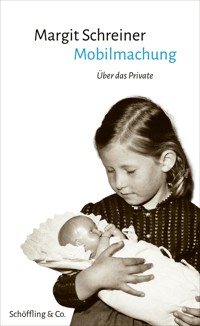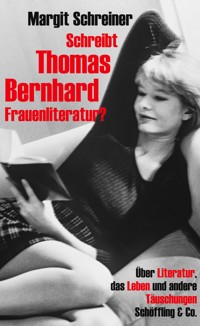17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In ihrem ersten Erinnerungsbuch Vater. Mutter. Kind. Kriegserklärungen erzählt Margit Schreiner von der siebenjährigen Margit, die sich ein Dackelmädchen namens Bella erfindet, das nie von ihrer Seite weicht. In Mütter. Väter. Männer. Klassenkämpfe besetzt ein paar Jahre später ein Maharadscha ihre Fantasien, während das Mädchen ihm als Panther zu Füßen liegt. Doch auch diese wunderbare Zeit endete irgendwann, »und ich saß an meinem Schreibtisch und löste Rechenaufgaben«. Aus der Entfernung des siebten Lebensjahrzehnts beobachtet und beschreibt Margit Schreiner lakonisch und mit viel Empathie das Mädchen, das sie einmal war: das aufs Gymnasium geht, neue Freunde findet, sich politisiert, erste Erfahrungen mit der Sexualität macht und schließlich die Schule beendet. »Ich hatte es ja schon in meiner Kindheit geahnt, dass die Tatsache, eine Frau zu sein, mit ununterbrochenen Demütigungen einhergehen würde. Aber dass es so weit gehen würde ...« Auch für dieses Buch gilt, was Anton Thuswaldner in Literatur und Kritik feststellte: »Schreiner ist die Aufmüpfigkeitskönigin der österreichischen Literatur.« Gespannt erwartet man nach der Lektüre die Fortsetzung des immer turbulenter werdenden Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Zitat
Der Slogan der …
Autorenporträt
Kurzbeschreibung
Impressum
Mütter. Väter. Männer.Klassenkämpfe
Ich suchte, das Lieben liebend, was ich lieben könnte.
Augustinus, Bekenntnisse
Der Slogan der 68er-Bewegung »Alles Private ist politisch« schien haargenau zu meiner Situation zu passen. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen: Mein Vater hatte meine Mutter geheiratet, damit sie ihm ihre Arbeitskraft zur Reproduktion seiner Arbeitskraft zur Verfügung stellte. Dafür musste mein Vater die Arbeitskraft meiner Mutter erhalten, indem er sie ernährte.
Aber davon später.
Alles wäre leichter gewesen, wenn man die Sache mit der Pubertät auf den Punkt gebracht hätte. Nur dass der Punkt in dieser Angelegenheit entsetzlich peinlich war. Es gab anscheinend keine Worte dafür, die nicht peinlich gewesen wären. Nicht einmal Meyers Lexikon fand sie. Allein das Wort »Geschlechtsreife« ist ja schon eine Zumutung. Grauslich irgendwie. Das Geschlecht, das reift, stellt man sich schnell einmal wie das Hinterteil eines Pavians vor, das knallrot wird und anschwillt. Oder wie überreife Früchte, die vom Baum fallen und am Boden zermatscht vor sich hin gären. Dazu kommen Ausdrücke wie Fortpflanzungsorgane, noch dazu funktionsfähige, Achsel- und Schamhaare.
Deshalb schämen wir uns in dieser Zeit ununterbrochen. Es gibt schließlich nichts Unangenehmeres als zu beobachten, dass andere beobachten, wie unsere sekundären Geschlechtsmerkmale sichtbar werden. Ein Übergriff sondergleichen. Am liebsten würden wir im Boden versinken. Wenn dann noch hinzukommt, dass die sekundären Geschlechtsmerkmale gar nicht so sichtbar werden, wie sie sollten, weil uns beispielsweise, wenn wir weiblich sind, kein Busen wächst, oder wenn wir männlich sind, kein Bart, wird alles noch peinlicher, als es ohnehin schon ist. Da reicht es dann schon aus, versehentlich zu stolpern oder sich öffentlich zu verschlucken, um zu wünschen, man wäre nie geboren worden.
Aufgrund der fatalen Verschleierung der Tatsache, dass die Pubertät auf der Geschlechtsreife beruht, weichen Eltern, Schulen und ähnliche Institutionen, die dafür keine direkten Worte finden, auf die Hormone aus. Auch heute noch. Die Müdigkeit und die Langeweile, die angesichts des herrschenden Gesellschaftssystems jeden vernünftigen Menschen befallen müssen, sobald er nachzudenken beginnt, werden in der Zeit zwischen dem elften und dem achtzehnten Lebensjahr lapidar auf die Hormone zurückgeführt. Ebenso die Weigerung, Sonntagsspaziergänge im Familienkonvoi zu unternehmen. Berechtigte Forderungen werden denunziert als Aggressionen, freie Entscheidungen als Launen, eigene Meinungen als Respektlosigkeiten.
Jedermann glaubt, einem Jugendlichen in dieser Zeit besonders strenge Regeln abverlangen zu müssen. Das Gegenteil ist der Fall. Einen heranwachsenden Menschen sollte man in Ruhe lassen. Er soll so lange schlafen können, wie er will, und wenn er sein Zimmer nicht aufräumen, die Zähne nicht putzen und die Unterhose nicht wechseln will, so sollte man das akzeptieren. Es gibt schließlich wichtigere Dinge im Leben.
Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie lange der Mensch schon gegen seine Natur kämpft. Allein der Entschluss zum aufrechten Gang war eine krasse Fehlentscheidung. Sie hat durch die Länge der Wirbelsäule zwangsläufig zum Verlust aller Würde geführt. Wäre er auf allen vieren geblieben, hätte er diese Fortbewegungsart verfeinern können und müsste nicht, wie die meisten Menschen, die ich auf der Straße sah, mit hängenden Schultern und gekrümmtem Rücken dahinschleichen. Viele Menschen strecken beim Gehen den Bauch und den Kopf nach vorne, so dass sie gegen den Schwerpunkt, den gewichtigsten Mittelpunkt ihres Körpers, ankämpfen müssen und deshalb die Beine, dem Diktat des Bauches folgend, nachziehen, anstatt umgekehrt den ausholenden Schritten der Beine zu folgen, die schließlich von selbst wissen, wo sie hinwollen. Oder sie ziehen den Bauch bewusst ein, was ihrem ganzen Gang eine Steifheit gibt, die geradezu lächerlich ist. Wer den Bauch ein- und die Schultern hochzieht, muss den Oberkörper vorlehnen und den Hintern rausstrecken, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Er watschelt. Sogar die Kinder, die nach anfänglichen schauderhaften Versuchen endlich unter der Aufsicht überheblicher Erwachsener auf die Beine kommen und zunächst die Vorteile des aufrechten Ganges kennenlernen und wieselflink ihren Beinen folgen, haben die Anmut eines halbwegs natürlichen Ganges spätestens mit der Einschulung verlernt. Springen und Hüpfen sind das Erste, das Kinder verlieren. Was ja kein Wunder ist, weil man ihnen viel zu schwere Schultaschen umhängt, die sie nach hinten ziehen, so dass sie, wenn sie nicht dagegensteuern, unweigerlich auf den Rücken fallen und liegen bleiben würden wie Käfer, die auf dem Boden zappeln. Das Gewicht der mit sinnlosem Zeug vollgestopften Schultaschen erhöht sich aufgrund der vielen Unterrichtsfächer noch einmal im Gymnasium.
Während ich meinen letzten Versuch unternahm, der sogenannten Pubertät und all den Widerwärtigkeiten, die damit verbunden waren, zu entkommen, meckerte meine Mutter den ganzen Tag herum, weil ich – wie ein Baby, sagte sie – auf dem Boden lag oder auf allen Vieren ins Badezimmer kroch. Ich kroch aber nicht, sondern ich schlich. Und zwar auf eine ganz bestimmte Art und Weise, die mich viel Training kostete. Ich hatte eine ungeheure Kraft. Wenn ich ganz langsam schlenderte oder schlich, musste ich diese Kraft im Zaum halten. Viel leichter wäre es naturgemäß für mich gewesen, mit ein paar wenigen kräftigen Sprüngen das Badezimmer zu erreichen, aber das wäre zu einfach gewesen. Es ging darum, ganz bewusst jeden einzelnen Muskel des Körpers zu aktivieren. Dieser, alle Kraft beinhaltende, aber nicht ausspielende Gang begeisterte mich. Meine Mutter nicht. Sie behauptete, ich wischte den Boden mit meiner Kleidung auf und machte mich damit schmutzig, was ein völliger Blödsinn war, weil sie selbst immer sagte, ihre Wohnung sei so sauber, dass man vom Boden essen könne. Genau das hätte ich gerne versucht. Ich hätte wahnsinnig gerne rohes Fleisch in einem goldenen Napf auf dem Boden serviert bekommen und dann versucht, ob meine Zähne, wenn ich mich sehr bemühte, das Fleisch zerreißen könnten. Eigentlich war ich sicher, dass ich es könnte, aber meine Mutter, der es aufgrund ihrer neuen Diät vor Fleisch besonders grauste, ließ nicht zu, dass ich es probierte. Überhaupt hatten sich meine Eltern eisern mit den sogenannten Professoren des Gymnasiums verbündet und waren entschlossen, dass ich die dortigen Anforderungen erfüllen sollte, statt auf allen vieren durch die Wohnung zu schleichen. Ein ungeheurer Verrat, wenn man bedenkt, dass sie mich einmal lauthals bewundert hatten, als ich krabbeln, gehen, sprechen, lesen und rechnen gelernt hatte. Auf einmal war es nicht mehr ich, die das alles zustande gebracht hatte, sondern es waren irgendwelche verkrümmten Gestalten, die für meine Ausbildung zuständig sein sollten. Sie nannten mein Verhalten »regressiv«. »Sie regrediert, weil sie im Gymnasium überfordert ist«, sagte mein Vater. Ich schlug sofort in seinem Fremdwörterbuch nach. Dort stand: »Regression die (lat.; -en/-en): Rückgang des Meeres und Auftauchen des Festlandes (geolog.) *Rückfall in entwicklungsgeschichtl. oder seelische Frühstadien (biol.).« Selbstverständlich war das Gegenteil der Fall. Kein Kleinkind hat die seelische und körperliche Kraft, den Gang eines Panthers zu imitieren. Und im Gymnasium war ich nicht über-, sondern unterfordert. Ich wurde wieder einmal total missverstanden.
Aber es gab 1964 auch Lichtblicke. Die Winterolympiade fand in Innsbruck statt. Unsere tapferen Soldaten hatten wegen des damals akuten Schneemangels 20000 Eisblöcke für die Bob- und Rodelbahnen und 40000 Quadratmeter Schnee für die Pisten herangeschafft. Meine Mutter, eine große Anhängerin des alpinen Schilaufes sowie von Autorennen, Fußballmeisterschaften und Boxkämpfen, fieberte den Schirennen entgegen. Während sie auf unserer schlammfarbenen Couch oder auf dem überdimensionierten kackfarbenen Fernsehsessel saß und die Schirennen verfolgte, hatte ich Zeit für meine ausgefeilte Metamorphose.
Der Maharadscha war weiß gekleidet. Seine Kleidung aus Brokat war über und über mit Brillanten besetzt. Auch auf dem Kopf trug er einen schneeweißen Turban, der in der Mitte, über der Stirn, von einer handtellergroßen Brosche aus Smaragd zusammengehalten wurde, aus der ein Büschel weißer Federn ragte. Wenn er auf seinem juwelenbesetzten goldenen Thron saß, lag ich zu seinen Füßen. Oft schlenderten wir durch die fünfhundertsechs Räume seines Palastes. Jedes Zimmer war mit einer anderen Seidentapete ausgestattet. Wenn uns danach war, lagen wir auf den dicken Teppichen eines goldenen Zimmers, manchmal war uns auch nach Violett. Am meisten liebte der Maharadscha aber die Farbe Lindgrün. Ich zog Pink vor. Manchmal lagen wir eng nebeneinander auf den Teppichen, manchmal legte er auch seinen Kopf auf meinen Bauch. Der Maharadscha liebte mich. Er war der Einzige, der mich streicheln durfte. Er war noch sehr jung, hatte aber schon die Bürde seines Reiches zu tragen. In seinem Land waren überall gefährliche Krisenherde, was ihn jedoch nicht beunruhigte. Er runzelte deshalb noch lange nicht seine Stirn wie mein Vater bei den Nachrichten im Fernsehen. Seine Stirn war immer glatt und freundlich. Er war ein überaus mutiger Mensch und ein furchtloser Kämpfer. Wenn er seine Ratgeber vor dem Thron versammelte, lag ich immer zwischen ihm und den Ratgebern auf meinem rosa Teppich. Ich war jederzeit bereit, die Ratgeber zu zerfleischen, sollten sie meinem Maharadscha widersprechen. Sobald kein Schirennen im Fernsehen übertragen wurde, verhielt sich meine Mutter mir gegenüber total kontraproduktiv. Sie ging so weit, mich mitten in einer Kriegsversammlung zu blamieren, indem sie mich an meine Hausaufgaben erinnerte. Ich hasste diese Frau. Andrerseits musste ich ihren Mut anerkennen, in eine Versammlung von bis zu den Zähnen bewaffneter Krieger zu platzen, die sie jederzeit hätten erdolchen können.
Nachdem ich ihren Fernsehsessel mit großer Mühe zum Thron für meinen Maharadscha umgestaltet hatte – Kissen, Seidentücher, Zierdecken, alles musste sorgfältig drapiert werden, bevor er endlich Platz nehmen konnte –, setzte sie sich während des Slaloms für Damen einfach auf den Maharadscha. Beinahe wäre ich ihr an die Kehle gesprungen. Ich war bereits in den Anschleichmodus gegangen, hatte meine Brust so tief gesenkt, dass der Bauch beinahe den Boden berührte, und alle meine Muskeln in Schultern, Oberschenkeln, Gesäß und Bauch waren angespannt. Ich sprang nur nicht los, weil der Maharadscha unter meiner Mutter abwinkte. Mit ungeschickten Lakaien gab er sich gemeinhin nicht ab. Während meine Mutter Traudl Hecher mit schrillen Schreien anfeuerte, quetschte er sich unter meiner Mutter hervor, legte seine linke, beringte Hand auf meinen Kopf, und wir schlenderten langsam in mein Kinderzimmer, das diesmal das blaue Zimmer war. Vom blauen Zimmer aus hatten wir einen weiten Blick über den Ganges. Ich sprang auf das Fensterbrett, und wir blickten auf die vorbeifahrenden bunten Boote und prächtigen Schiffe in Drachenform mit goldenen Zacken und die am Ufer dahinziehenden, mit Gewürzen und Seidenstoffen voll beladenen Kamele. Meine Mutter, die uns, nachdem Traudl Hecher nur eine Bronzemedaille im Slalom gewonnen hatte, nachgeschlichen war wie ein falscher Ratgeber, versuchte mich vom Fensterbrett zu meinem Schreibtisch zu zerren. Wieder verlagerte ich mein Gewicht nach vorne, senkte die Schulter und spannte alle Muskeln des Körpers an, bereit zum tödlichen Sprung. Gott sei Dank begann dann das Interview mit Traudl Hecher im Fernsehen, und meine Mutter lief rasch aus meinem Zimmer. Wobei sie ihre Ansicht lautstark verkündete, dass die Zeit der Traudl Hecher vorbei war. »Soll sie das Schifahren doch endlich aufgeben, wenn sie es nicht kann«, schrie sie, und mein Maharadscha zuckte zusammen, weil er so eine vulgäre Ausdrucksweise nicht gewöhnt war. Die Inder sind nämlich wahnsinnig höflich und drücken ihr Missfallen nie auf diese Weise aus. Aber meine Mutter war zu dieser Zeit eben besonders nervös. Zu mir sagte sie dauernd, dass ich ein besonders schwieriges Kind sei. Sicherlich lag es an ihrer neuen Diät. Sie trank den ganzen Tag nur Fruchtsäfte und behauptete, dass mein Vater und ich ihre Diät mit unserer Gefräßigkeit gefährdeten. Aber ein Panther braucht einfach Fleisch. Mein Vater, der in der Verwaltung der Vöest arbeitete, auch. Wenn sie uns zusah, wie wir abends Fleischsalat oder Essigwurst aßen, verzog sie das Gesicht. Das konnte aber meinen Appetit nicht hemmen. Mein Vater seufzte oft und sagte, er verstehe gar nicht, warum meine Mutter unbedingt abnehmen wolle. Du bist doch gar nicht dick, sagte er dann, was aber nicht stimmte. Meine Mutter war so dick wie die verfressenen Ratgeber meines Maharadschas, deren seidene Pluderhosen am Bund ihren riesigen Bauchumfang betonten. So wie die Gummizüge der Faltenröcke, die meine Mutter selbst genäht hatte, ihren Bauchumfang betonten.
Was mir an unserem Palast besonders gefiel, waren die vielen Säulen und Säulchen und dahinter und dazwischen Nischen, in denen man sich verstecken konnte. Der Maharadscha und ich haben viel Zeit in den höhlenartigen Nischen verbracht und den entfernten Klängen seiner zweihundert musizierenden Frauen aus dem Harem gelauscht. In der Höhle unter meinem Bett hatte er mir auch den Ärger mit seinen vielen Erziehern anvertraut. Sein Stolz begehrte dagegen auf, vorgeschrieben zu bekommen, was er zu tun oder zu lassen hatte. Andererseits ließen ihm sein Ehrgefühl und seine Erziehung keine Wahl, als die Rolle zu erfüllen, die er sich nicht selbst ausgesucht hatte. Als meine Mutter eines Tages, während ich mich mit dem Maharadscha über Pflichterfüllung unterhielt, sogar versuchte, mich unter der Couch hervorzuzerren, um mich endlich zur Vernunft zu bringen, worunter sie verstand, mich in die stickige Welt des österreichischen Kleinbürgertums der sechziger Jahre zurückzuholen, wusste ich, dass meine Tage als schwarzer Panther gezählt waren. An dem Nachmittag, als Karl Schranz nur Zweiter hinter Egon Zimmermann in der Abfahrt geworden war, starb ich. Eine der Haremsfrauen war eifersüchtig auf die Liebe des Maharadschas zu mir und vergiftete mich mit verdorbenem Fisch. Als der Maharadscha mich leblos auf meinem rosa Teppich liegen sah, warf er sich über mich und weinte bitterlich. Er schwor, niemals wieder jemanden so zu lieben wie mich, und zerriss seine Kleidung. Den prächtigen Turban schleuderte er quer durch das lindgrüne Zimmer, den Smaragd warf er aus dem Fenster in den Ganges. Mein Vater hätte niemals seine Kleidung zerrissen, und meine Mutter hätte ihren Schmuck auf gar keinen Fall aus dem Fenster geschmissen, wenn ich gestorben wäre. Ich kam zu dem Schluss, dass sie mich nicht liebten. Wenn sie mich nur ein bisschen geliebt hätten, dann hätte mein Vater mich jeden Abend freiwillig ins Bett getragen, und nicht nur, wenn ich mich an ihm festklammerte und ihn nicht mehr losließ. Und meine Mutter hätte nicht hinterher gemeckert, dass ich zu alt sei, um von meinem Vater ins Bett getragen zu werden. Kaum war er mich los, las er ihr stundenlang aus Stifters Bunten Steinen vor.
Nach meinem Tod verfiel der Maharadscha. Er wurde täglich blasser und blasser, auch dünner, fast durchscheinend. Sein Gang wurde schwerfällig. Schließlich starb er vor Kummer. Ich erschrak über die Stärke seiner Liebe. Als meine Mutter von der Siegesfeier für Egon Zimmermann, die im Fernsehen übertragen worden war, zurück in mein Zimmer kam, hatte das prächtige Begräbnis bereits stattgefunden (der schwarze Panther lag im goldenen Grabmal neben dem Maharadscha), und ich saß an meinem Schreibtisch und löste Rechenaufgaben. Später am Nachmittag tat es mir dann sehr leid, dass der Maharadscha und ich tot waren. Ich hätte doch genauso gut das Spiel eine Weile unterbrechen können und nur dann weiterspielen, wenn meine Mutter nicht in Reichweite gewesen wäre. Gerade jetzt, wo die Olympiade in vollem Gange war, hätte sie gar keine Zeit gehabt, sich um mich zu kümmern. Aber es war zu spät. Ich hatte begriffen, dass es nie einen Weg zurück gibt und dass alles, was mir noch bevorstand, jenseits meiner Vorstellungskraft lag. Das Meer hatte regrediert, und das felsige Festland war aufgetaucht.
Ich war harten Zeiten ausgesetzt. Meine Eltern hatten mich nach der Volksschule 1964 ausgerechnet im Wirtschaftskundlichen Realgymnasium angemeldet, mit Handarbeiten und Kochen als Pflichtfächer. Für so etwas muss man geboren sein. Ich war es nicht. Niemand fragte damals seine Kinder, in welche Schule sie gehen wollten. Dazu kam, dass meine Eltern diese lächerliche Schule nicht einmal deshalb gewählt hatten, damit ich später eine tüchtige Hausfrau würde, sondern weil sie der Ansicht waren, im Wirtschaftskundlichen Realgymnasium würde von allen Gymnasien die geringste Anforderung an den Schüler gestellt. Was hieß, dass sie mich für zu blöd hielten, um ein normales Gymnasium zu besuchen. Keine ideale Voraussetzung, um eine gute Schülerin zu werden.
Ich selbst hatte es nach dem Wechsel von der Volksschule endgültig satt, mich unter den unwürdigsten Bedingungen in eine Schule zu schleppen, in der ich Tag für Tag unterschätzt wurde. Niemand von den Lehrern im Gymnasium, die sich jetzt Professoren nannten, kam auf die Idee, dass jemand aus eigenem Antrieb Interesse an irgendeinem Unterrichtsgegenstand haben könnte. Deshalb wurden wir ständig aufgerufen, abgeprüft, mussten Schularbeiten schreiben oder die Tafel löschen. Es war demütigend. Zu Hause war ich, wie erwähnt, mit einer Mutter konfrontiert, die jeden Monat eine neue Diät ausprobierte und deshalb mit ihren Nerven am Ende war. Mein Vater runzelte während der Nachrichten im Fernsehen allabendlich die Stirn und sprach von einem gefährlichen Krisenherd in Vietnam. Da ich zu stolz war, meine Eltern zu fragen, wo Vietnam lag und wieso es ein gefährlicher Krisenherd war, blätterte ich stundenlang erfolglos in Meyers Lexikon herum, wo Vietnam nicht einmal erwähnt wurde. Ich war enttäuscht, denn in Meyers Lexikon war sogar eine Karte des nördlichen und südlichen Sternenhimmels bis 25 Grad nördlicher beziehungsweise südlicher Deklination abgebildet. Ebenso die Spuren des Kaninchens, des Hasen, der Katze, des Rehs, des Dachses, des Fischotters, des Fuchses, des Marders, des Iltis, des Rot- und Damwilds sowie des Hermelins im Schnee. Auch die Funktionen von Owens sechsarmiger verbesserter Flaschenblasmaschine, der Mauser Selbstladepistole oder die verschiedener Feuerungsanlagen hatten sich mir erst nach dem Selbststudium von Meyers Lexikon erschlossen. Unübertroffen waren jedoch die Bildtafeln von Tieren, Bäumen und Blumen in den prächtigsten Farben. Nie werde ich die Entdeckung der Tiefseefische vergessen, die ihr Gebiss außerhalb des Maules haben oder an der Stirn Laternen mit sich herumtragen, damit sie in der absoluten Finsternis der tiefsten Meere etwas sehen. Alles, was ich wusste und bestaunte, hatte ich aus Meyers Lexikon gelernt. Und nun erwies es sich zum ersten Mal in meinem Leben als vollkommen unbrauchbar. Meine Frustration war kaum noch zu überbieten. Viel später wurde mir klar, warum. Unsere Ausgabe von Meyers Lexikon war 1926 erschienen.
Meine Lage hatte sich, genau wie in meinen finstersten Vorstellungen, mit dem Wechsel von der Volksschule ins Gymnasium nicht verbessert, sondern rundum verschlechtert.
Ich hasste die Professoren im Gymnasium nicht, ich verachtete sie. Sie alle hatten einmal studiert und verschleuderten nun ihr Leben an uns. Die Biologieprofessorin zum Beispiel hätte nach dem Studium nach Afrika gehen und wie Dian Fossey die Verhaltensweisen der Berggorillas aufzeichnen und ihr Leben im Kampf gegen Wilderer opfern können. Der Geographieprofessor hätte, statt sich mit seiner Solariumsbräune vor uns aufzuspielen, eine neue Theorie des Vulkanismus aufstellen und zu ausbrechenden Vulkanen in aller Welt reisen können. Unsere dicke Turn- und Psychologielehrerin hätte nach dem Sportstudium, als sie sicherlich noch schlank war, für die Turnolympiade trainieren und ihre Fähigkeiten zeigen können, statt später dickliche Schüler zurechtzuweisen, wenn sie kraftlos in der Sprossenwand hingen. Nur für die Deutschprofessorin hätte es keine Alternative gegeben. Für eine Schriftstellerin war sie zu oberflächlich. Wie alle Deutschlehrer, die ich später noch kennenlernte, besuchte sie niemals eine Dichterlesung und las in ihrer Freizeit Krimis. Und was hätte jemand, der Germanistik studiert hat, schon werden können, außer Schriftsteller oder Lehrer? Wenn sie montags zur Klassentür hereinstürmte – sie gab sich gerne dynamisch – und von ihren Erlebnissen am Wochenende erzählte, war das nur peinlich. Offenbar hatte sie, obwohl sie zaundürr und meiner Meinung nach außerordentlich unansehnlich war, einen Mann ergattert – »mein Freund« –, der Motorrad fuhr. Die Frau glaubte tatsächlich, uns damit beeindrucken zu können, dass sie hinter ihrem Freund auf dem Motorrad gesessen hatte und zwischen dem Salzburgring und Hallein durch das Wiestal gebrettert war. Mein einziger Trost war, dass wenigstens meine Freundin Gabi, die schon in der Volksschule neben mir gesessen hatte, auch jetzt wieder neben mir in der Bank saß.
Die Frustration der Lehrer, die darauf bestanden, »Professor« genannt zu werden, zu beobachten, war eigentlich das Abstoßendste an der Schulzeit.
Die Musiklehrerin, eine Frau, die nur Strickkleider trug und uns in der Musikstunde, meistens am Ende des Schultages, an dem jeder Schüler durch den Terror der Professoren bereits an seinem absoluten Limit angelangt war, Mozart oder Bach oder Haydn oder Bruckner auf dem Plattenspieler vorspielte, wobei die meisten von uns vor sich hin dämmerten, verstieg sich zu der Überzeugung, uns durch Anekdoten über ihre Schlamperei daheim sozusagen aufzuwecken. Einen anderen Grund kann ich mir nicht vorstellen, wieso sie uns immer wieder zwischen den Musikstücken von dem Geschirr in ihrer Badewanne erzählte, das sie angeblich nur einmal in der Woche mit der Dusche reinigte, nachdem sie über alles Geschirrspülmittel geleert hatte.
Die kleine Zeichenlehrerin, die sich aufgrund ihrer Piepsstimme nicht durchsetzen konnte – wir hörten sie meist gar nicht, wenn sie etwas sagte –, drohte uns damit, die Klasse zu verlassen, wenn es zu laut wurde. Als ob das jemanden gestört hätte.
Die Chemielehrerin, eine besonders humorlose Person mit dicker Nase und blondem Haarknoten im Nacken, sprach am liebsten über Körperhygiene. Wenn Prüfungen anstanden, ging es darum, sie geschickt auf ihr Lieblingsthema zu lenken, und sie vergaß jede Prüfung. Man musste nur die Nerven haben, die unappetitliche Schilderung der Folgen mangelnder Unterleibspflege anzuhören.
Die Mathematiklehrerin hatte keine gröberen Macken, bis auf die Tatsache, dass sie eben Mathematik unterrichtete. Ich bin heute noch überzeugt, dass Mathematik mich interessiert hätte, wenn nur irgendjemand imstande gewesen wäre, zu erklären, dass es sich dabei nur um durch logische Definitionen selbst geschaffene abstrakte Strukturen handelt, die mittels der Logik auf ihre Eigenschaften und Muster untersucht werden. Aber die Lehrerin bestand auf der realen Gültigkeit von Zahlen, was natürlich grober Unsinn ist und nur den ausgesprochenen Streber zu größerem Eifer anspornte. Ich hatte bereits in der Volksschule an dem banalen Handel von »Wenn zwei Äpfel je fünfzig Groschen kosten, wie viele Birnen, die jeweils zwanzig Groschen kosten, kann ich dafür eintauschen?« gezweifelt. Auf so primitive Weise ködern sie die Kinder, um ihnen später unverständlichste Gleichungen als objektive Sachverhalte vorzusetzen. Gleichungen sind immer Behauptungen und Lösungen nur bedingt wahr. Wieso hat uns in der Volksschule niemand gesagt, dass der Handel in der Realität nichts als Betrug und, später im Gymnasium, dass alles Abstrakte nur ein Gleichnis ist?
Handarbeiten war mein absolutes Horrorfach, nahm aber in dem Wirtschaftskundlichen Realgymnasium, das meine Eltern für mich ausgesucht hatten, eine wichtige Rolle ein. Nicht, was die Noten betraf – in dem Fach bekam sowieso jede eine Eins oder Zwei –, sondern was die Zeit betraf. Vier Stunden in der Woche strickten, stickten, häkelten oder nähten wir. Beziehungsweise strickten, stickten, häkelten oder nähten eben nicht, sondern versuchten, Stricken, Sticken, Häkeln oder Nähen vorzutäuschen, um dann daheim unsere Mütter oder Großmütter stricken, sticken, häkeln oder nähen zu lassen. Mir lagen alle vier Handarbeiten gar nicht. Beim Stricken, Sticken und Häkeln verkrampfte ich mich so, dass ich Schweißhände bekam, wodurch die Handarbeiten – meistens in Weiß oder Pastell, wir mussten beispielsweise weiße Kopfkissenbezüge mit weißem Garn besticken, rosarote Waschlappen stricken, hellblaue Eierwärmer häkeln – sich grau verfärbten. Das Nähen war fast noch schlimmer. Mir war die Nähmaschine an sich ein Rätsel. Auf unglaublich komplizierte Weise musste nämlich ein Ober- und ein Unterfaden in die Nadel der Nähmaschine eingeführt werden. Von unten und oben kam dann normalerweise je ein Faden aus einer Spule auf der Nähmaschine und einer Spule unter der Nähmaschine. Bei mir nicht. Versuchte ich, die verschiedenen Wege, die der jeweilige Faden nehmen muss, über Häkchen und Rollen von oben und aus dem Spulbehälter unten, durch die Öffnung neben der Nadel zu ziehen und dann in die Nadel einzufädeln, hakte garantiert irgendetwas, der Faden ließ sich nicht bewegen oder riss sogar ab, oder die beiden Fäden von oben und unten verwickelten sich. Mir wird heute noch ganz schlecht bei der Vorstellung, so eine Nähmaschine nähbereit zu machen. Manchmal kam dann die Handarbeitslehrerin bzw. die Handarbeitsprofessorin und fädelte Ober- und Unterfaden ein. Aber das nützte auch nichts. Das Nähen selbst war nicht einfacher. So eine Nähmaschine rattert los, wenn man sie erst einmal in Bewegung versetzt, und hält sich an keine Vorgaben. Meine Nähte waren schief oder verliefen in irrem Zickzackkurs quer über das Kopfkissen. Ich musste also, über das Wäschestück gebeugt, stundenlang vortäuschen, eine gerade Naht nach der anderen zu nähen, um das Ganze zu Hause meiner Mutter zu übergeben, die in unserem sogenannten Kabinett neuerdings ein Tischchen mit versenkbarer Nähmaschine stehen hatte. Meine Mutter strickte und stickte und häkelte auch alle meine anderen Werkstücke aus den Handarbeitsstunden neu.
Besonders günstig für mich war, dass meine Mutter, ziemlich genau mit meinem Eintritt ins Wirtschaftskundliche Realgymnasium mit dem Schwerpunkt auf Handarbeiten, einen Nähkurs bei Tante Steffi besuchte.
»Jetzt, wo du ins Gymnasium gehst, habe ich Zeit dafür«, sagte meine Mutter und machte sich an die Anschaffung der versenkbaren Nähmaschine. Sie besuchte den Nähkurs alle zwei Wochen an einem Mittwoch um fünf Uhr nachmittags und kam dann erst etwa gegen neun Uhr abends nach Hause. Ich habe mir das so genau gemerkt, weil mein Vater und ich an diesen Abenden unser Abendessen selbst zubereiteten. Anfangs war mein Vater deshalb nicht besonders begeistert von dem Nähkurs meiner Mutter. Aber dann aßen wir am Mittwoch immer Frankfurter Würstel, die meine Mutter selten auftischte, weil sie sie für ungesund hielt. Wir aßen die Frankfurter Würstel mit sehr viel süßem Senf von Mautner Markhof, den meine Mutter ebenfalls für gesundheitsschädlich hielt. Mein Vater trank an diesem Abend statt einem meistens zwei oder drei Flaschen Gösserbier, ich trank Cola, was sonst verboten war.
Lange Zeit wusste ich nicht, wie ich eigentlich mit Tante Steffi verwandt war. Später sollte sich herausstellen, dass ich gar nicht mit ihr verwandt war. Meine Mutter vertraute mir eines Tages an, dass Tante Steffi eine Schwester ihres ersten Mannes war, mit dem sie nur drei Wochen verheiratet gewesen war, bevor er im zweiten Weltkrieg fiel.
Tante Steffi hatte übrigens einen Sohn, Cäsar. Cäsar hieß eigentlich Franz und war Tänzer. Cäsar war sein Künstlername. Ich habe ihn nie kennengelernt, weiß aber von meiner Mutter, dass er im Linzer Landestheater tanzte. Was mir sehr imponierte. Der Nähkurs der Tante Steffi hatte nur vier oder fünf Kursteilnehmer, was meiner Mutter, die sich anfangs mit dem Nähen sehr schwertat, entgegenkam. »Die Steffi bringt mir von der Pike an alles bei«, sagte sie oft nach dem Nähkurs zu meinem Vater, der dann meistens die Stirn runzelte. Der Nähkurs meiner Mutter bei Tante Steffi hatte für mich nur einen entscheidenden Nachteil. Meine Mutter probierte alles frisch Gelernte an mir aus. Das erste Werkstück war eine Schürze. Meine Mutter zeichnete den Plan für die Schürze zuerst mit weißer Schneiderkreide auf dem hellblauen Stoff mit den kleinen roten Rosen ein. Ich musste den Stoff spannen, damit die Schneiderkreide nicht abrutschte. Dann schnitt sie die Teile mit der scharfen Schneiderschere auseinander und heftete sie mit Heftfaden aneinander. Bereits zu dem Zeitpunkt kam es zur ersten von einer langen Reihe von Anproben. Besonders lästig war, dass ich mich während der Anprobe nicht bewegen durfte, weil sonst entweder der Heftfaden riss oder ein Schürzenteil verrutschte, so dass die Teile später im schlechtesten Fall falsch zusammengenäht wurden, womöglich wieder aufgetrennt werden mussten, was wiederum viele neue Anproben, die jeweils ewig dauerten, zur Folge hatte.
Meine Mutter nahm es mit dem Nähen sehr genau. Wenn sie am Boden vor mir kniete, um den Saum abzustecken, kam es ihr auf jeden Millimeter an. Sie maß den Abstand vom Boden mit einem Schneidermaßband, im Mund eine Reihe von Stecknadeln (selbstverständlich mit den Stecknadelköpfen nach innen), die sie dicht an dicht in den Saum steckte, wobei sie die Augen zusammenkniff, um besser sehen zu können. War alles abgemessen und abgesteckt, musste ich mit den vielen Nadeln im Stoff so vorsichtig wie möglich aus den lose zusammengehefteten und mit Stecknadeln zusammengesteckten Teilen des Werkstücks klettern, weil der Heftfaden sonst gerissen wäre oder ich mich mit den vielen Stecknadeln gestochen hätte. Meine Mutter überwachte alles mit Argusaugen. Sehr lästig. Andrerseits entwickelte sie mit der Zeit eine solche Fertigkeit im Nähen, dass sie alle meine Handarbeitsarbeiten im Wirtschaftskundlichen Gymnasium schließlich vorbildlich erledigte.
Mein Vater besuchte zum Ausgleich wöchentlich einen Turnverein.