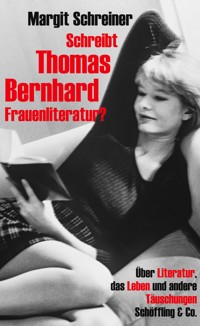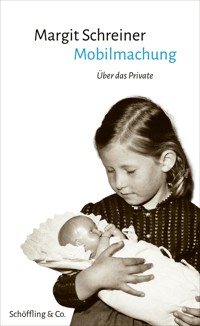
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Jedes Neugeborene lebt vor der Erfindung der Zeit. Ich fühlte bereits nach den ersten paar Zellteilungen, dass etwas Großartiges entstanden war, und wanderte in Form einer winzigen Brombeere zur Gebärmutter, in der ich mich einzunisten gedachte. Ich muss gestehen, dass ich ihre neutrale Liebenswürdigkeit, mit der sie mir ein kuscheliges Plätzchen schuf, der späteren, doch sehr von Launen gesteuerten wirklichen Mutter vorzog.« Nach Vater. Mutter. Kind. Kriegserklärungen (2021) und Mütter. Väter. Männer. Klassenkämpfe (2022) erkundet die große österreichische Erzählerin Margit Schreiner auf ihre unnachahmliche Weise das Private. Ausgehend von ihren allerersten Lebensjahren in einer kleinbürgerlichen Stadt derFünfzigerjahre fabuliert die Autorin überaus humorvoll und mit wie immer kritischem Blick auf Geschlechterverhältnisse vom Erleben als Embyro, Säugling und Kleinkind. Sie betreibt dabei keine reine Nabelschau, sondern reflektiert gleichzeitig klug über Menschwerdung und Menschheitsgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Motto
Meine Eltern hatten …
Autor:innenporträt
Kurzbeschreibung
Impressum
Motto
»So war denn, was ich mir dachte, nicht formlos eigentlich durch das Nichtsein jeglicher Form, sondern nur im Vergleich mit formvolleren Dingen, und das strenge Denken sagte mir auch, ich müsste, wenn ich mir das gänzlich Formlose vorstellen sollte, auch den letzten Rest von Form noch hinwegdenken. Das aber vermochte ich nicht. (…) Mein Verstand gab es auf, hierüber meinen Geist zu befragen, der erfüllt war von Bildern geformter Körper, die er nach Willkür mannigfach vertauschte. Da richtete ich auf die Körper selbst mein Augenmerk und schaute tiefer in ihr Wandelwesen, wodurch sie aufhören, zu sein, was sie gewesen, und anfangen zu sein, was sie nicht waren. Und ich kam auf die Vermutung, eben dieser Übergang von Form zu Form vollziehe sich durch ein formloses Etwas hindurch, nicht über ein reines Nichts hinweg.(…) Ja, der wandeligen Dinge Wandelwesen selber ist es, das hinfähig aller der Formen ist, worein wandelige Dinge sich wandeln. Und was ist es, dieses Wandelige? Ist es Geist? Ist es Körper?«
Augustinus, Bekenntnisse
Meine Eltern hatten …
Meine Eltern hatten mich wirklich gewollt. Sie hatten sogar jahrelang auf mich hintrainiert. Die erste Version meiner Selbst überlebte keine drei Monate. Sie brachte es nicht einmal zu einer Fehlgeburt. Die zweite Version schaffte es bis zum fünften Monat und starb, als meine Mutter in eine ungesicherte Baugrube fiel. Die dritte und vorletzte Version überlebte die eigene Geburt nicht. Sie hatte den Fehler gemacht, sich vor der Geburt nicht zu drehen und war in Steißlage geblieben, was ich ihr nicht verdenken kann. Ich weiß, was es bedeutet, sich auf so engem Raum zu drehen. Der Fehler hatte beim Arzt gelegen, der den Ehrgeiz entwickelte, das Baby während der Geburt zu drehen. Was nicht gelang. Vor die Entscheidung gestellt, das Kind oder meine Mutter zu retten, entschied er sich für meine Mutter.
Auch mit mir hatte meine Mutter einen Unfall. Wir waren im fünften Monat, als sie nach einer Aufführung des Brucknerchors, in dem meine Eltern sangen, über die Treppe des Landestheaters in Linz stolperte und einen Treppenabsatz hinunterrollte. Es sei ihr irgendwie gelungen, sagte meine Mutter später zu mir, auf dem Rücken zu landen. Trotzdem habe mein Vater sie anschließend ins Krankenhaus zu den Barmherzigen Brüdern gebracht, wo diese allerdings festgestellt hätten, dass alles in Ordnung war. In der Nacht darauf, sagte meine Mutter, hätte ich derart gestrampelt, dass sogar mein Vater zum ersten Mal meine Bewegungen in ihrem Bauch gespürt hätte.
Erinnerung wird durch Schmerz evoziert. Dort, wo es wirklich wehtut, trifft er ins Zentrum. Der Rücken schmerzt. Der Körper speichert Traurigkeit wie der Waldboden das Wasser. Das hat nichts mit persönlichen Erinnerungen zu tun. Wir alle sind traurige Tiere.
Ich liege auf dem Rücken, die Beine hochgelagert, um die Wirbelsäule zu entlasten. Ausgelöst durch die Entlastung des Rückens, sinken die Schultern, die Arme, die Wirbelsäule zwischen den Schultern in den Boden, während der Schmerz aufsteigt und der Erinnerung Platz macht. Auch das frische Grün einer Wiese kann das bewirken, ein diesiger, aber greller Himmel, tellergroße Blüten am Strauch. Eine Glocke läutet, kein Blatt weht, so schwer ist die Luft.
Mein entlasteter Körper erinnert sich vage an die Zeit im Urmeer, als sich anorganische Stoffe in der heißen dunstigen Suppe, durchdrungen von Blitzen und Eruptionen, entwickelten und miteinander verbanden, um Leben zu ermöglichen.
Tatsächlich wissen wir gar nichts. Alles, was von Belang ist, bleibt uns verschlossen. Leben entsteht genauso wie unser Sonnensystem, gleicht der Entstehung anderer Sonnensysteme, Galaxien. Wir wissen nichts. Nur der Körper spürt manchmal den langen Weg, den wir zurückgelegt haben. In ihm ist alles gespeichert.
Das Leben als Einzeller war einfach. Das Meer war abgekühlt, die Blitze wurden weniger. Es kam nur darauf an, getragen zu werden von warmem Wasser und seine Nahrung entweder selbst herzustellen, zum Beispiel durch Photosynthese, oder von außen zu beziehen. Die Entwicklung zum Mehrzeller ergab sich fast von selbst. Jede Zelle hatte ihre Aufgabe. Unsere Zellen spüren noch ihre Vergangenheit, als sie nicht in Verbänden lebten, auch wenn der Körper sich nur mehr schwach daran erinnert. Viel deutlicher ist dem Körper die Zeit als Fisch in Erinnerung, als er, schwerelos im Wasser schwimmend, mit einem einzigen kräftigen Stoß seiner Schwanzflosse vom nassen Blau ins trockene Blau flog, einen weiten Bogen ziehend, zurück ins klare Wasser. Auch das Atmen war damals leichter. Algen und kleinere Fische strömten mühelos in den geöffneten Mund. Wären wir doch Fische geblieben, Wasser im Wasser schwebend. Nichts würde uns fehlen. Wir würden genug riechen, genug sehen und unsere Seitenlinien wären empfindlicher für jeden Reiz, als der menschliche Körper es je war oder sein wird. Das diffuse Licht unter Wasser würde ausreichen, um Bewegungen zu erkennen, und wir vermehrten uns leichthin, indem wir Perlen ins Meer streuten, über die andere ihren Samen – einen Zaubertrank – verströmten. Zumindest hätten wir in den Sumpfgebieten bleiben können, wo der Übergang von Flüssig und Fest noch so fließend war wie in uns selbst.
Der Fisch aber, die zukunftsträchtigere Spur suchend, kriecht mühsam ans Land, Beeren- und Pilzgerüchen folgend, Moos, Wurzeln, Würmern, Käfern, warmem Holz, feuchtem Laub, heißem Sand, Stein, kaltem Eis. Aus dem schmelzenden Eis brechen winzige Flechten, nach dem Regen wuchern Pflanzen in der Wüste, zwischen vermoderndem Laub schießen Pilze hervor, auf sandigem Boden verbreiten sich Heidelbeeren und Preiselbeeren. Er schnüffelt nach Morcheln und Trüffeln, gräbt nach schmackhaften Wurzeln. Das Wühlen in der Erde wird ihm erhalten bleiben, auch wenn er sich längst nach den leuchtenden Früchten an Bäumen und Sträuchern zu strecken beginnt.
Der erste Versuch des aufrechten Ganges fand möglicherweise zu früh statt. Zu viel anderes fehlte noch. Der Saurier konnte durch die Stellung seiner Beine weite Strecken auf zwei oder vier Beinen zurücklegen. Er war schnell und ausdauernd. Die meisten anderen Reptilien konnten dagegen nur kriechen und mussten lange Ruhepausen einlegen, um Kraft zu sparen.
Beim Dinosaurier befinden sich die Beine senkrecht unter dem Körper. Das verschafft ihm ungeheure Vorteile, er siegt und herrscht Millionen von Jahren überall, wächst ungehindert in die Länge und Breite, probiert alles aus: Gehen, Laufen, Kriechen, Robben, Klettern, Fliegen. Kann sich für keine Form entscheiden und wuchert über sich hinaus, wird zweiundvierzig Meter lang und fünfzig Tonnen schwer oder hat, wenn er sich zum Fliegen entschließt, eine Flügelspannweite von zehn Metern. Als Pflanzenfresser ist er besonders groß, als Fleischfresser besonders flink. Er hat einen langen Hals oder einen krummen Rücken mit Stacheln, eine Schnauze oder einen Schnabel oder ein Maul. Er frisst mitunter Steine zur Verdauung. Teilweise brütet er, teilweise nicht, jagt im Rudel oder allein. Zur Verteidigung wird ebenfalls alles ausprobiert: Hörner, Schuppen, Stacheln, dreißig Zentimeter lange Klauen, fünfzehn Zentimeter lange Zähne. Auch dieses Tier haben wir in uns, manchmal bäumt unser Körper sich auf und glaubt, alles beherrschen zu können, bis er die Schmerzen im Nacken, in den Armen und Beinen, in den Hüften spürt und Mühe hat zu atmen. Das Tier wird in seine Schranken verwiesen. Es stirbt aus. Zunächst sind es nur Lichtfluten, dann Explosionen. Feuer, Wasser und Luft wirbeln durcheinander, verbrennen, überschwemmen, fegen alles hinweg. Die Sonne verdunkelt sich. Auf der Erde wird es kalt. Vieles stirbt aus. Einiges erholt sich wieder, bildet sich neu, vermag erst ohne die Konkurrenz riesiger Saurier zu bestehen. Kleine Säugetiere, unsere direkten Vorfahren, nachtaktiv und flink, entwickeln sehnige Greifarme. So huschen wir nachts von Baum zu Baum und gebären stehend Lebendiges. Nach Millionen von Jahren richten wir uns wieder auf. Diesmal sind wir besser gerüstet: Unsere Arme sind länger, haben Hände mit fünf Fingern, von denen jeder einzelne beweglich ist. Statt Krallen haben wir Fingernägel. Wie sehr ein beweglicher Daumen unsere Entwicklung vorwärtstreibt, erstaunt uns. In der Baumkrone hockend, starren wir auf unsere Hände. Unten auf der Erde watscheln wir. Wir können uns zwar aufrichten, bleiben aber unsicher.
Wir werden den aufrechten Gang erlernen. Die schmerzhafte Krümmung der Wirbelsäule ertragen. Die langsame Verlagerung des Gewichts auf zwei Füße.
So erleben wir fruchtbare Tage. Auf dem Boden und hoch in den Bäumen. Alles zu unserer Verfügung. Die Pflanzen und die Tiere. Wir werden zum Allesfresser. Weithin gefürchtet. Betört vom Geruch frischen Blutes, von den Düften der Blüten, von gärenden Früchten auf dem Boden. Der erste Rausch. Das Weiterziehen von Ort zu Ort, nirgends lange bleibend. Veränderte Landschaften ziehen durch die Sinne. Flugs verändert sich der Standort. Die Früchte sind im Süden süßer als im Norden. Die Wirbelsäule streckt sich immer wieder dem Baum entgegen, auf dem die Orangen aufplatzen. Der süße Saft rinnt in den geöffneten Mund. Vergiss nie dieses Glück, sagt die Wirbelsäule. Und vergiss nie, dich im Glücksrausch umzusehen nach deinen Feinden.
Auf der Erde wird es wärmer. Die Wälder schrumpfen, Savannen entstehen. Jetzt kommt es darauf an. Noch sind wir zu klein und zu schwach, um watschelnd in der Savanne zu überleben. Wir brauchen Überblick, Schnelligkeit und Ausdauer. Tiefgreifende Veränderungen des Skeletts werden nötig. Aber auch aufrecht gehen zu können, genügt nicht. Wir müssen laufen lernen. Dazu reichen die Veränderungen im Skelett nicht. Das neue Lebewesen muss auch die neue Wärme abgeben können, um es aufzunehmen mit den großen Tieren und aufbrechen zu können auf lange Wanderungen. Andere Tiere, die ihre Wärme nur über die Zunge abgeben, sind zwar auf kurzen Strecken schneller als wir, aber mit den Schweißdrüsen, die sich in uns bilden, sind wir dem schnellsten Kurzstreckenläufer überlegen. Wir müssen nicht mehr mühsam durch den Mund hecheln, wenn uns heiß wird.
Lauf, wenn du kannst. Wenn du nicht laufen kannst, geh, wenn du nicht gehen kannst, kriech, wenn du nicht kriechen kannst, lieg. Wenn du nicht mehr liegen kannst, stirb, sagt der Fuß, der dich trägt. Wenig Fläche für diese Last. Immer um Gleichgewicht bemüht. Viele Länder, um sie zu ergehen. Wälder, Wüsten, Steppen, Dickicht. Die Haare fallen aus mit der Zeit. Sie schützen nicht mehr vor Hitze und Kälte. Sie werden ersetzt durch Felle anderer Lebewesen, die noch auf dem Boden kriechen oder in den Bäumen hocken. Die wilde Jagd beginnt! Wer den aufrechten Gang nicht lernen muss, hat Kraft, um zu springen, zu hüpfen, zu klettern, zu fliegen. Mit dem aufrechten Gang lässt die Kraft der Arme nach. Finger können sich nicht mehr lange an Äste klammern. Pranken verkümmern zu kraftlosen Händen, die aber in der Lage sind, millimetergenaue Tätigkeiten zu verrichten.
Meine Arme durchzieht der Schmerz der Reduktion. Bald werde ich meinen linken Arm nicht mehr heben können. Die feine Motorik der Hände lässt nach. Schon berühren sich nur mehr mit Mühe Daumen und kleiner Finger der linken Hand. Hilfsmittel werden erfunden. Stöcke, Knüppel, Steinklopfer, Mörser, Speere. Mammuts sterben aus, Schweine schrumpfen auf kleineres Maß. Es beginnen die Kämpfe um die besten Weideplätze. Die Toten werden bestattet.
Die Zähne, einst imstande, rohes Fleisch aus dem Leib halbtoter Tiere zu reißen, zerbröckeln. Wer die Zähne verliert, verhungert. Es muss zu weiteren Hilfsmitteln gegriffen werden. Weicheres Brot, gekochte Wurzeln und Knollen, gebratenes Fleisch. Dafür ist Feuer nötig. Zuerst nur zufällig eingefangen nach einem Blitzschlag oder Vulkanausbruch, dann gehütet, und erst viel später selbst entzündet. Die Geschichte beginnt, sich in die Länge zu ziehen. Es geschieht längst nichts mehr Neues. Alles Weitere sind nur Verfeinerungen der Jagdtechnik und ihrer Werkzeuge.
Muss sich denn alles wiederholen? Und jeder einzelne von uns mit der Geburt erneut aus dem Wasser mühselig ans Land kriechen, um dort immer wieder neue Angst und neuen Schrecken zu verbreiten?
Ich verweigerte diesen archaischen Akt und beschloss, wie ein Vogel aus dem Wasser in die Luft zu fliegen.
Meine Geburt war großartig. Ich musste mich nicht ein bisschen anstrengen. Der Bauch meiner Mutter wurde aufgeschnitten und ich wurde vorsichtig aus der Hülle gehoben, die mich viele Monate beherbergt hatte. Man trug Handschuhe und Masken, um mich nicht irgendwelchen Krankheitskeimen auszusetzen. Das ebenso kundige wie rasche Durchschneiden meiner Nabelschnur erleichterte mich ungemein. Endlich ungebunden. Gleich danach wurde ich in herrlich klarem, lauwarmem Wasser gebadet. Schließlich hatte ich die letzten Monate in einer mehr und mehr trüben Lacke verbringen müssen. Väter durften damals noch nicht Hand anlegen und ich war froh darum. Mein Vater hatte ja überhaupt keine Erfahrung mit Neugeborenen und hätte mich, wer weiß, gleich nach meiner Geburt ertrinken lassen. Später sollte sich meine Skepsis bewahrheiten, als er in unserer Badewanne vergaß, meinen Kopf zu stützen, sodass dieser rücklings ins Wasser kippte.
Wegen meiner damals noch außergewöhnlichen Geburt – nicht umsonst nennt man das Verfahren Kaiserschnitt – war ich nicht wie andere Neugeborene völlig verrunzelt und geschlaucht, sondern rosig und entspannt. Alle Anwesenden waren begeistert. Mein Vater, dem ich frisch gebadet und gewickelt vorgeführt wurde, fasste die allgemeine Begeisterung schließlich in Worte. Ich sähe aus wie ein appetitliches Marzipanschweinchen, sagte er, und alle fanden die Bezeichnung treffend. Ich selbst auch.
Mein Vater hatte sich, den Fotos von der Verlobung meiner Eltern nach zu schließen, in eine hübsche, moderne, aufgeschlossene junge Frau verliebt. Sogar in eine mit Erfahrungen. Meine Mutter war bereits einmal verheiratet gewesen, ihr erster Mann war im Zweiten Weltkrieg gefallen. Das Foto täuschte. Mit der Zeit hatte sich herausgestellt, dass die hübsche, aufgeschlossene junge Frau mit einschlägigen Erfahrungen eine unsportliche, ängstliche Person ohne jegliche Erfahrungen, aber mit vielen romantischen Ideen im Kopf war. Meine Mutter hatte immer schon einen Hang zur Verstellung. Weshalb, weiß ich nicht. Vielleicht hat sie als junge Frau – 1914 geboren – im Kino zu viele deutsche Propagandafilme gesehen, in denen die deutsche Frau als glückliche Ehefrau und Mutter dargestellt wurde. Jedenfalls posierte meine Mutter auf den alten Fotos genau so, wie sie sich wohl eine aufgeschlossene junge Frau, die sie aber nie war, in der jeweiligen Situation vorstellte. Im Dirndlkleid an einen Felsen gelehnt, den Blick sehnsüchtig zu einem Berggipfel erhoben, im Badeanzug mit Badekappe im seichten Meer stehend, den Blick sehnsüchtig auf den Horizont gerichtet, unter dem Christbaum sitzend, mich als Baby im Arm, den Blick sehnsüchtig auf mich gerichtet. In Wirklichkeit sehnte sie sich aber weder nach den Bergen, noch nach dem Meer, noch nach mir. Der Blick meiner Mutter auf den Fotos ist jeweils ein verschwommener, fast glasiger Blick, als hätte sie Fieber oder wäre bekifft. Ich weiß nicht, wie lange mein Vater brauchte, um diese Illusion zu durchschauen. Sicherlich geschah es noch nicht in den ersten zwei Jahren ihrer Ehe. Genau da war mein Vater im entscheidenden Nachteil. Erstens war auch er schon einmal verheiratet gewesen, war aber, im Gegensatz zum Schicksalsschlag, der meine Mutter in ihrer ersten Ehe unverschuldet ereilt hatte, schuldig geschieden worden, und zweitens arbeiteten sie wohl verbissen an dem Kinderwunsch meiner Mutter. Als das Kind – also ich – endlich da war, brachen die Illusionen schlagartig zusammen. Angeblich hat mein Vater das Kinderzimmer, in dem ich in meinem weißen Steckkissen in einer weißen Wiege lag, zugesperrt und über dem Schlüssel unter dem Kopfpolster geschlafen, damit meine Mutter nicht immer in das Kinderzimmer eilte, sondern, wenn ich schrie, bei ihm im Schlafzimmer liegen blieb. Der Mann musste jahrelang furchtbare Angst gehabt haben, seine Frau zu verlieren, was jedoch unvermeidbar war. Als er das nach drei oder vier Jahren einsah, wandte er sich mir zu und von seiner Frau ab. Meine Mutter war froh darüber. Ich glaube nicht, dass sie jenseits ihres Kinderwunsches an Sexualität interessiert gewesen war. Mein Vater schon.
Ich wurde in einer außergewöhnlich kalten Nacht Ende März 1953 gezeugt. Meine Eltern hatten abendgegessen. Danach stellte meine Mutter, einen Stapel Wäsche auf dem Tisch neben sich, das Bügelbrett im Wohnzimmer auf. Mein Vater holte Stifters Nachsommer aus dem Bücherregal. Während meine Mutter bügelte, las er laut ab der Seite weiter, bei der er am Vorabend aufgehört hatte. Draußen schneite es. Mein Vater las vor, wie der sogenannte Gastfreund, ein gewisser Freiherr von Risach, seinen jungen Besucher Heinrich zu einem Rundgang durch das Rosenhaus einlädt. Von da an werden seitenlang die kleinen und kleinsten Details des Hauses beschrieben, als ginge es darum, eine für immer gültige Inventarliste zu erstellen. Meiner Mutter gefiel der Nachsommer. Davon abgesehen, dass sie den Namen Freiherr von Risach mochte – sie assoziierte von Anfang an den Schauspieler O. W. Fischer mit ihm –, war im Roman alles gut angeordnet, alles hatte seinen Platz, seinen Zweck und seinen Sinn, nichts war willkürlich, zufällig oder beliebig. Die Liebe war wie eine Rose, unbefleckt, rein und keusch. Um zehn Uhr gingen meine Eltern in ihr unbeheiztes Schlafzimmer, in dem nur ein großes Bett mit dunkelbraunem Holzverbau und ein riesiger dunkelbrauner Kasten standen. Mein Vater legte sich auf meine Mutter und verschaffte sich Zutritt. Meiner Mutter tat das sehr weh, da ihre Vagina von der vorherigen Totgeburt vollständig vernarbt war. Der Mann, der anschließend mein Vater werden sollte, konnte darauf keine Rücksicht nehmen. Durch die vielen vergeblichen Versuche, ein Kind zu zeugen, war seine Potenz gefährdet. Er stieß hart zu. Meine Mutter biss die Zähne zusammen, weil sie mich unbedingt empfangen wollte. Bereits als sich sein Samen in ihr ausbreitete, wusste sie, dass es diesmal klappen würde, und drehte sich von meinem Vater weg auf die andere Seite des Bettes.
Letztendlich bleibt die Zeugung ein ungeheurer Zufall. Wenn man bedenkt, dass die Eizelle einer potentiellen Mutter nur zwölfmal im Jahr gerade einmal vierundzwanzig Stunden lang bereit ist, die Samenzelle eines potentiellen Vaters aufzunehmen, und dass viele potentielle Mütter nicht zwölfmal im Jahr in einem häufig nicht einmal berechenbaren beliebigen Zeitraum vierundzwanzig Stunden lang potentielle Väter zur Verfügung haben, und wenn man dann weiterhin bedenkt, dass so eine Samenzelle außergewöhnlich langsam und orientierungslos im Leib der potentiellen Mutter herumirrt, ist es ein Wunder, dass es überhaupt je dazu kommt. Bereits hier zeigt sich die problematisch verschwenderische Haltung potentieller Väter, die ja bei jeder Ejakulation mit, sagen wir einmal, ungefähr zweihundert Millionen Samenzellen aufwarten, von denen es dann, kommt es wirklich darauf an, nur einige wenige den lächerlich kurzen Weg zu den Eileitern schaffen, wo die um etwa hundert Mal größere Eizelle bereits ungeduldig wartet. Und auch das kurze Stück müssen sie sogar gelockt werden, durch Zuckerstoffe aus Gebärmutterhals und Muttermund. Ohne sie würden sie besinnungslos im Kreis schwimmen. Und auch trotz Lockstoffen schwimmt ein großer Teil der Spermien in die falsche Richtung, peilt den nicht befruchtungsbereiten zweiten Eierstock an oder ertrinkt in der säurehaltigen Lösung. (Abgesehen davon, dass viele unter den Millionen Samenzellen zwei Köpfe oder keinen Kopf haben und keinen oder mehrere Schwänze.) Haben die Samenzellen auch noch die letzten Millimeter unbeschadet geschafft, zappeln sie nun vor der großen Eizelle herum. In Aufklärungs- sowie populärmedizinischen Büchern heißt es meistens, dass die schnellste und stärkste Samenzelle es schafft, sich Eintritt in den weiblichen Zellkern zu verschaffen. Falls von Schnelligkeit bei einem Tempo von etwa zehn Minuten für eine Strecke von zwei bis drei Zentimetern überhaupt die Rede sein kann. Das Missverständnis wird der Tatsache geschuldet sein, dass die Verfasser von Aufklärungs- bzw. populärwissenschaftlichen Büchern, so wie die Verfasser von Büchern im Allgemeinen, in der Regel männlich sind. In Wirklichkeit entscheidet allein die Eizelle, welches Spermium sie einlässt, indem sie die zähe Hülle des Zellplasmas öffnet und nach dem Einlass des Auserwählten schnell wieder schließt. Dann wird behauptet, der Vater bestimme das Geschlecht des potentiellen Kindes. Das ist irreführend: Die Chromosomen der weiblichen Zellen sind nämlich ausschließlich weiblich. Nur die männlichen Samenzellen können sich nicht recht entscheiden und produzieren X- sowie Y-Chromosomen. Im Moment der Vereinigung kommt es jedenfalls zum Urknall. Was bedeutet, dass die genetischen Informationen des mütterlichen und väterlichen Zellkerns durch Vereinigung zu einer neuen Erbinformation führen. Der Bauplan eines neuen, eigenständigen Menschen ist damit entstanden.
Apropos Urknall: Wahrscheinlich bildet er die Grenze unseres bildlichen Denkens. Das können wir uns gerade noch vorstellen: Ein Punkt mit großer Dichte, der explodiert und sich rasend ausdehnt zu einem Weltall. Wie aber entsteht dieser Punkt mit großer Dichte? Etwas kann nicht aus nichts entstehen. Auch die Theorien von den Parallel-, Multi- oder Megauniversen ändern daran nichts. Auch nicht die Quantenfelder nach der relativistischen Theorie, die ja auch nicht nichts sind, sondern etwas. Der Urknall kann nicht der Anfang allen Lebens gewesen sein. Außer er wäre der in der Unendlichkeit gerade letzte Urknall von unendlich vielen Urknall-Ereignissen gewesen, die wir mit unserem Leben nicht einmal für eine Nanosekunde unterbrechen. Ein ununterbrochenes Entstehen und Fast-Verschwinden. Bis jetzt. Dazu müssten wir uns vorstellen können, dass es keinen Anfang und kein Ende gibt.
Der Ausgangspunkt unseres Denkens ist aber letztlich nur die Zeitspanne zwischen unserer eigenen Geburt und unserem eigenen Tod, zwischen unserem Anfang und unserem Ende, zwischen Etwas und Nichts. Unglaublich, wie weit die Berechnungen durch die Menschen, die, bezogen auf die Entstehung des Weltalls, erst so kurz auf dem Planeten sind, letztlich reichen können. Milliarden Jahre zurück bis zu diesem einen Punkt mit unglaublich hoher Dichte.
Die Erfindung eines Gottes muss an unserem Zeitbegriff liegen. Gemessen an unserem kurzen Leben. Nur so können wir es verwalten. Jenseits des Menschen, jenseits von Etwas und Nichts, jenseits von Anfang und Ende, jenseits jeder möglichen Begrenzung kann der Mensch nichts mehr verwalten. Wir sind Teil der Natur und können sie – als einziges Tier dieses Planeten – beobachten und willentlich verändern, aber wir können nicht über sie hinaustreten. Der Begriff Unendlichkeit überschreitet unsere Vorstellungskraft, auch wenn wir imstande sind, ihn in unsere Berechnungen einzubeziehen. Wie war das mit den zwei Parallelen, die sich im Unendlichen treffen? Wir sind ausgezeichnete Rechner. Das gehört zum Inventar der Verwaltung unseres kurzen Lebens. Auch die Raum-Zeit-Krümmung ist »nur« eine Berechnung. Deshalb ist auch Einstein auf Gott gekommen. Da forscht und rechnet einer sein Leben lang auf dem höchsten Stand unseres Wissens und kommt letztlich zum selben Schluss wie die brave Hausfrau in der Kirche, auch wenn die statt an eine Formel an den alten weißen Mann mit dem langen Bart denkt. Weil es nämlich ganz egal ist, wie man es nennt, denkt man an das Ungeheuerliche, vielleicht auch Wunderbare, das so ungeheuer oder wunderbar ist, gerade weil es über uns hinausgeht. Allerdings sagt es viel über uns aus, wenn wir, was über uns hinausreicht, für wunderbar halten. Auch die Bewertung jeglicher Erscheinungen scheint unserem kurzen Lebenszeitfenster gemäß. Wir müssen uns orientieren: heiß oder kalt, essbar oder giftig, gut oder böse, gewöhnlich oder wunderbar. Toleranz an sich ist tödlich.
Jedes Neugeborene lebt vor der Erfindung der Zeit. Ich fühlte bereits nach den ersten paar Zellteilungen, dass etwas Großartiges entstanden war, und wanderte in Form einer winzigen Brombeere zur Gebärmutter, in der ich mich einzunisten gedachte. Wie der Name schon sagt, war sie meine erste Mutter, die mich auf die Geburt vorbereitete. Ich muss gestehen, dass ich ihre nicht personenbezogene, neutrale Liebenswürdigkeit, mit der sie mir ein kuscheliges Plätzchen schuf, der späteren, doch sehr von Launen gesteuerten wirklichen Mutter vorzog. Naturgemäß musste ich, bevor ich mein Ziel erreichte, vielfach Gefahren bezwingen, um nicht in irgendeiner schleimigen Eileiterfalte stecken zu bleiben. Die Einnistung in die Gebärmutterschleimhaut selbst war auch nicht gerade ohne. Es galt, den Platz zu finden, an dem ich neun Monate lang wachsen, träumen und mich wohlfühlen würde. Außerdem musste ich mich um meine Versorgung kümmern. Man glaubt ja gemeinhin, so ein Fötus habe nichts anderes zu tun, als gemütlich im Wasser zu schweben und sich von der Plazenta ernähren zu lassen. Kaum jemand fragt sich, wie die Plazenta eigentlich entsteht. Als wäre sie immer schon da, oder als würde sie von einer potentiellen Mutter stillschweigend ihrem potentiellen Kind zur Verfügung gestellt. So ist es aber keineswegs. Abgesehen davon, dass die Plazenta das am wenigsten erforschte Organ des Menschen ist, weiß man zumindest, woraus sie besteht: aus embryonalem und mütterlichem Gewebe. Teile meiner eigenen Zellkugel wuchsen nämlich an der Gebärmutter fest. Meine Träume in der Zeit, in der die Plazenta ihre Funktion aufnahm, waren leicht und luftig. Einerseits wie abstrakter Expressionismus, andererseits ungeheuer figural. Ich träumte in allen Erscheinungen ihre dahinterstehende Form. Ich träumte Berge, Seen, Meere, Sterne und Sonnen anderer Galaxien. Ich träumte von Pflanzen, die ich nach meiner Geburt nie sehen würde, von Tieren ungeheurer Größe, die heute längst ausgestorben sind, von fragwürdigen Geschöpfen. Ich träumte vom Glück, von gleißendem Licht und der Wandlungsfähigkeit alles Seienden. Ich war nach meiner Geburt nie mehr in einem Zustand derartiger Hellsichtigkeit. Dabei war ich ja erst im Entstehen. Was würde noch kommen, wenn ich mich weiterentwickelte?