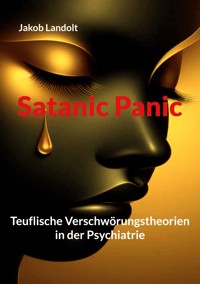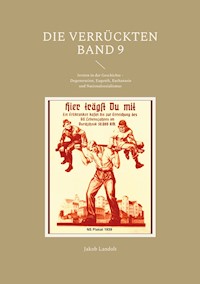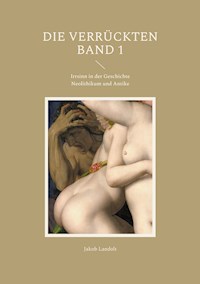Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Die Verrückten - Irrsinn in der Geschichte
- Sprache: Deutsch
Einführung Band 5: Beschrieben wird eine quasi noch vorpsychiatrische Zeit: Willis, Locke, Stahl und Cheyne. Vermutlich erstmals mit William Battie wurden die unmenschlichen Bedingungen in einer sehr frühen Psychiatrischen Klinik in England (Bedlam) beschrieben und auch politisch beantwortet. Mit Batties Bedlam gehen wir näher ein auf die damaligen Behandlungsmethoden dieser allerersten Verwahranstalten, die der Ausgrenzung der Irren und von anderen Subjekten aus der Gesellschaft dienten. Es folgen Beschreibungen weiterer Persönlichkeiten: Cullen, Whytt, Tuke, Mesmer und Brown. Ab etwa der vorletzten Jahrhundertwende, um 1800, erwachte die Psychiatrie und wurde allmählich zu einer eigenständigen medizinischen Disziplin. Dieser von den anderen Wissenschaften sich entwickelnde Medizinzweig wirkte lange Zeit abgeschlagen und ausgegrenzt. Es drohte ihm das Dasein eines nicht anerkannten (medizinischen) Forschungszweiges. Man unterschied bald in Verwahrpsychiatrie und Universitätspsychiatrie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis:
Band 5: Vorpsychiatrische Zeit
Thomas Willis 1621-1675
Thomas Sydenham 1624-1689
John Locke 1632-1704
Georg Ernst Stahl 1659-1734
Georg Cheyne 1671-1743
Bedlam und William Battie 1703-1776
Die Behandlungsmethoden der Verwahranstalten William Cullen 1710-1790 (Albrecht von Haller 1708-1777)
Robert Whytt 1714-1766
William Tuke 1732-1822
Franz Anton Mesmer oder der animalische Magnetismus 1734-1815
John Brown 1735-1788
Ausblick auf Band 6
Literatur und Quellen
Einführung Band 5.
Beschrieben wird eine quasi noch ,vorpsychiatrische‘ Zeit: Willis, Locke, Stahl und Cheyne.
Vermutlich erstmals mit William Battie wurden die unmenschlichen Bedingungen in einer sehr frühen Psychiatrischen Klinik in England - Bedlam - beschrieben und auch politisch beantwortet. Mit Batties Bedlam gehen wir näher ein auf die damaligen, teils grausemen Behandlungsmethoden dieser allerersten Verwahranstalten, die der Ausgrenzung der Irren und von anderen ,Subjekten‘ aus der Gesellschaft dienten.
Es folgen Beschreibungen weiterer Persönlichkeiten: Cullen, Whytt, Tuke, Mesmer und Brown.
Ab etwa der vorletzten Jahrhundertwende (1800) erwachte die Psychiatrie und wurde allmählich zu einer eigenständigen medizinischen Disziplin. Dieser von den anderen Wissenschaften sich entwickelnde Medizinzweig wirkte lange Zeit abgeschlagen und ausgegrenzt. Es drohte ihm das Dasein eines nicht anerkannten (medizinischen) Forschungszweiges. Man unterschied bald in Verwahrpsychiatrie und Universitätspsychiatrie.
Vorpsychiatrische Zeit
Thomas Willis
Thomas Willis Fotoherkunft: wikipedia
Nachparacelsischer Iatrochemiker des 17. JH. Gründungsmitglied der Royal Society of London. Anglikaner, Royalist.
Britischer Arzt und Hirnforscher (Neuroanatom). Oxford. Professor für Naturgeschichte, Begründer,Vater der Neurologie (Nervensystems). Rückschlüsse auf psychische Krankheiten.
Geboren: 27. Januar 1621, Great Bedwyn, Wiltshire Oxford Gestorben: 11. November 1675, London, England
Aus: Wikipedia
Etwa in der Mitte des 17. Jahrhunderts erfrechten sich immer mehr Ärzte und Wissenschaftler, die humoralpathologische Säftelehre des Galen wie auch vereinzelte Ideen des Hippokrates - die mit dem herrschenden Christusglauben im Einklag standen - in einen Glaubenszweifel zu ziehen.
Das war für die damalige Epoche jedoch keineswegs neu, denn solche Zweifel hatten lange vor ihnen auch andere geäussert (etwa Paracelsus um 1530). Aber die Zeit war nun reif für den Aufstand gegen den Klerus, gegen die (von ihm abhängige) Volksmeinung und gegen die total überkommenen alten Medizinkonzeptionen des Mittelalters und der beginnenden Neuzeit.
Viele aufständische Forscherpersönlichkeiten, Mediziner, Physiker, Astronomen und Philosophen, wurden jedoch teils hart von der Kirche und von zivilen Gerichten gemassregelt und in die Schranken gewiesen. Einige mussten unter Todesdrohungen von ihren Meinungen und Überzeugungen, von ihrem ,Irrtum‘ abschwören (Galileo Galilei) und sich erneut zum christlichen Glauben bekennen, wollten sie nicht exekutiert, auf dem Scheiterhaufen verbrannt, geköpft oder einer peinlichen Befragung in der Folterkammer unterzogen werden. So sehr versuchte man, diese modernen Denker zurückzubinden und wieder unter Gottes einengende Obhut zu stellen.
Es war wirklich in erster Linie der christliche Glaube der katholische Kirche, der den Fortschritt und die Moderne be- oder ganz verhindern wollte. Man spürte wohl instinktiv, dass alttestamentarischer Glaube, aber auch die neutestamentliche Jesusfrömmigkeit an Einfluss verlieren würde, wenn christliche Gemeinschaften wissenschaftliche Fortschritte machen würden. Ihr Gespür betrog sie nicht. Aber man hatte die Rechnung ohne die bravouröse Lehrtätigkeit der Jesuiten gemacht, die viele junge Männer für Neues und für die Wissenschaft begeistern konnten.
Als nun um 1650 herum der Hexen- und Teufelsglaube von Kirche und Volk bei den wissenschaftsorientierten Eliten immer schlechter ankam, war es ein beginnendes Besinnen, das Verbrennen von Hexen und Wahnsinnigen für unsinnig und als gegen das Göttliche gerichtet zu erklären. Bis jedoch das endgültige Aus für diese menschenverachtenden Machenschaften (Verurteilungen wegen Hexerei, Teufelspakt und dadurch Bestrafung mit Wahnsinn, Inquisition, Verbrennungen, Köpfen) eintrat, benötigte die Menschheit nochmals rund einhundert Jahre. Althergebrachte Verwurzelungen von Glaubensinhalten (auch politische) waren so schnell nicht aus den Volksgemeinschaften auszureissen und sie sind es noch heute nicht.
Zu dieser Zeit glaubte man auch nicht mehr so stark an den Einfluss der Gestirne und von Planetenkonstellationen, die Einfluss auf den menschlichen Organismus haben und ursächlich für eine Manie oder Depression verantwortlich sein sollten. Sondern man wurde immer überzeugter, dass die Manie wie die Melancholie im Körper des betroffenen Menschen entstanden sein musste. Ein Einfluss der Gestirne auf das Schicksal und auf den Charakter eines Menschen, inkludierend auch auf die Seele oder Psyche, wurde nun immer stärker bezweifelt. Die Ursache von Wahnsinn ortete man innerhalb der organischen Natur. Die astrologische resp. astronomische Ursachenzuschreibung erhielt eine immer schwächere Gewichtigkeit.
Aber das Sezieren von Menschen stand nach wie vor vielerorts unter schwerster Strafe der klerikalen wie der weltlichen Gerichte und wehe, man liess sich dabei erwischen. Paracelsus und viele weitere Alchemisten und Gelehrte lebten bereits vor einhundert Jahren recht gefährlich, griffen Galen'sche Ideen und Axiome trotzdem teils frontal an und wagten sich auch unter Todesstrafe, wie ein Leonardo da Vinci, an menschliche Leichen, die sie aus lauter Neugierde heimlich sezierten.
Auch die Zeit Thomas Willis kannte noch immer genug Ärzte, die der Humorallehre sehr überzeugt anhingen und bei Hunderten von Krankheiten noch immer ein Übermass an schwarzer Galle diagnostizierten und therapeutisch zum Aderlass (Blutegel) rieten.
Aber Willis hatte ,Glück‘, ein Bürgerkrieg wütete zwischen den Royalisten (König Karl l.) einerseits und Anhängern des englischen Parlamentes andererseits (1642-1649). Willis schloss sich den Royalisten an, musste aber sein bis anhin 5 Jahre dauerndes Arztstudium zwischenzeitlich wegen diesen politischen Unstimmigkeiten unterbrechen, was sich nach dem Krieg aber eben als Glücksfall für ihn darstellte.
Er hatte sich vor dem Krieg bereits 1637 am Christ Church College in Oxford eingeschrieben, wobei diese Lehranstalt bisher einen eher konservativen und traditionsbewussten Ruf innehatte. Man studierte bisher noch immer Hippokrates und Galen. Als jedoch Willis mit dem Studium begann, rief man just zu dieser Zeit einen neuen, progressiveren Lehrplan für Medizin ins Leben. Hin und wieder standen nun, zu Willis Glück, auch Leichensektionen auf dem Tagesprogramm, denen er mit grossem wissenschaftlichen Eifer beiwohnte.
Während des Krieges befreundete er sich unter anderen auch mit William Harvey (1578-1657) an, dem Entdecker des Blutkreislaufes. Harvey vertrat den experimentellen Anatomen. Er knüpfte Kontakte zu weiteren Forscherpersönlichkeiten, beispielsweise zum Chemiker Robert Boyle (1627-1692).
Nach dem Krieg fand Willis dann grosse Unterstützung in König Karl l. Er wurde für seine Loyalität dem Königshaus gegenüber als ausgebildeter Arzt anerkannt und durfte eine Praxis eröffnen. In Oxford schloss er sich weiteren modern denkenden Wissenschaftskollegen an und begann seine Forschertätigkeit mittels moderner, experimenteller Methoden.
Grössen wie Franzis Bacon (1561-1626), Galileo Galilei (1564-1624), Thomas Hobbes (1588-1679) und René Descartes (1595-1650) waren ihm sicherlich nicht unbekannt. Zudem war er Zeitgenosse von John Locke (1632-1704) und Thomas Sydenham (1624-1689).
Willis liess sich beeinflussen vom neu entstandenen mechanistischen Weltbild (Weltanschauung) eines René Descartes, dessen These darin bestand, dass nur Materie existiere und somit der menschliche Geist oder Wille nicht erklärbar sei in Bezug auf Immaterielles (religiöses!) sondern eben nur auf Materielles.
Und diese Materie galt es von den Menschen zu erforschen, weil der Mensch gemäss Genesis 1,27 ein Ebenbild Gottes war. Menschen hatten sich demnach die Erde (Natur) zum Untertan zu machen. Somit wurde theologisch begründet, warum der Mensch eine Verfügungsgewalt gegenüber der Natur habe und sezieren dürfe. Das Verbot der Sektion durch die Kirche wurde sozusagen aus diesen Überlegungen heraus aufgehoben, die Kirche wurde mit ihren eigenen Glaubenssätzen geschlagen.
Jede Leichenöffnung konnte nun auf diese ,mechanistische‘ Art begründet werden. Alle Materie, auch der menschliche Körper, wollte erforscht und verstanden werden. Die Zeit der wissenschaftlichen Rationalität, resp. das mechanistische Weltbild brach an. Man sezierte nun auch Gehirne und suchte darin Verbindungen zum menschlichen Geist, zum Verstand und zur Psyche.
15 Jahre nach dem Ende des Bürgerkrieges veröffentlichte Thomas Willis 1664 sein bahnbrechendes Werk ,Cerebri anatome', worin er, bebildert, das Gehirn und spezielle die Nerven des Menschen detailliert beschrieb. Somit galt Willis als der Begründer der Neurologie, indem er diesen Begriff auch gleich prägte.
Willis begründete damit auch die Neurosenforschung, die bald mit George Cheyne (1641-1743), William Cullen (1710-1790) und Robert Whytt (1714-1766) fortgeführt wurde.
René Descartes hatte den menschlichen Geist mit der körperlosen Seele gleichgesetzt. Die Seele verlieh dem Menschen das Bewusstsein, die sittliche Verantwortung und die Unsterblichkeit. Sie war immateriell. Man konnte sie weder erkennen, noch konnte man sie lokalisieren. Aber man vermutete ihren Sitz damals in der Zirbeldrüse (Epiphyse), also inmitten des Gehirns.
Thomas Willis verwarf jedoch die Zirbeldrüsentheorie des Descartes und lokalisierte seinerseits die Seele in der medulla oblongata.
Die Idee des Descartes, dass der menschliche Geist als solcher niemals krank werden konnte, war sehr interessant. Gemäss Descartes aber auch gemäss Newton war die Seele per Definition als solche nämlich unverwundbar und daher führten sie den Wahnsinn sowie alle psychischen Krankheiten nicht auf eine Krankheit der Seele zurück, sondern auf entsprechende körperliche (Nerven)- Läsionen. Der Körper (das Materielle) war krank, nicht die Seele. Wahnsinn war ein Leiden, eine Krankheit des Körpers. Die körperliche Krankheit jedoch drückte sich via Seele (Psyche) aus.
Noch heute werden gegen Geisteskrankheiten Medikamente eingesetzt, die nur auf den Körper einwirken, etwa auf die Hormonproduktion oder auf Stoffwechselvorgänge des Gehirns und des Nervensystem und wirken somit nur indirekt auf den Geist resp. die Psyche (auf Seelisches) des Menschen. Die Seele (Psyche) und der Körper bilden zwar eine Dualität, bleiben trotzdem in einer unzertrennlichen Ganzheit resp. Einheit.
Aus: Thomas Willis, cerebri anatome, 1664https://archive.org/
Anders klingt die Wirkungsweise an, wenn man sich nicht das medikamentöse, sondern das psychotherapeutische Geschehen vor Augen führt. Es kommuniziert resp. interagiert rein auf der seelischen oder psychischen Ebene zwischen zwei Menschen - zwischen Therapeut und Patient - wobei sie sich gegenseitig beeinflussen. Dieses ,immaterielle' Wirkungsverfahren zeigt trotzdem nachweisbare körperliche, biologische und hormonelle Veränderungen, die nur durch sprachliche Interventionen, durch Suggestion oder durch manuelle Berührungen entstehen!
Die Interventionen der Therapeuten wirken also sowohl vom Körper auf die Psyche, wie auch umgekehrt. Es existiert eine Einheit/Verbindung zwischen Soma und Psyche. Dies mochten Willis, wie auch ein Descartes bereits damals erkannt haben, als sie in der Zirbeldrüse resp. in der medulla oblongata den Sitz der Seele verordneten.
Hier ist anzumerken, dass jeder weitere wissenschaftliche Diskurs nur dann sinnvoll und zielführend sein kann, wenn endlich und abschliessend in einer breiten Übereinstimmung definiert werden kann, was Seele und Psyche denn eigentlich sei oder zu sein hat. Je schwammiger die Seelenbegriffe sind, mit denen wir ,psychotherapeutisch' arbeiten und psychologisch operieren, desto unklarer sind die Resultate jedes Diskurses.
Die Axiome jeder Psychiatrie oder Psychologie müssen als fest, allgemeingültig und als unveränderbar anerkannt sein, ansonsten haben Diskussionen wenig Sinn. Allzu leicht könnte man sich die Frage stellen, von was genau wir eigentlich reden, wenn wir von Psychischem reden.
Willis versuchte die verschiedenen geistigen Funktionen bestimmten Bereichen des menschlichen Gehirns zuzuordnen. Damit schuf er ein neues Medizinkonzept, welches dem bisherigen humoralpathologischen Medizinkonzept gegenüber stand und es ablöste.
Thomas Willis entdeckte den nach ihm benannten Arterienring, den Circulus arteriosus cerebri, der die Blutversorgung des Gehirns sicherstellte. Auch beschrieb er das Syndrom des Restless-Legs, das Syndrom der unruhigen Beine. Ebenso beschrieb er als erster die Krankheit Myasthenia gravis, die Muskelschwäche.
Was nicht so bekannt ist, sind verschiedene Verdienste Willis bei der Beobachtung des Schwachsinnes, der Epilepsie und der schizoaffektiven Verstimmungen. Willis war überzeugt davon, dass die Hysterie keine Erkrankung der Gebärmutter sei, sondern eine Gehirnkrankheit. Aus vielen humoralchemischen Erklärungen psychischer Krankheiten vergangener Kapazitäten wurden mit Willis nun funktionelle Krankheiten, bei denen im Hirn keine materiellen Schädigungen sichtbar waren.
Auch die heute noch gültige Nummerierung der Hirnnerven führte auf Willis zurück. Auch beschrieb er das Corpus striatum (Streifenhügel), den Thalamus opticus (Sehhügel), den Pons (Brücke, Querwulst) sowie das Corpus mamillare (Mamillarkörper).
Eine Art psychologisches Konzept entwickelte Willis in Bezug auf den ,spiritus animalis', also den menschlichen Geist, der bereits von Descartes beschreiben wurde. In vielem folgte Willis jedoch eher Vesalius als Descartes. In seiner Vorstellung war dieser spiritus animalis eine Art feiner Wind oder auch eine besonders aktive Flamme, die durch feine Nervenschläuche weitergeleitet wurde. Die Cerebrospinalflüssigkeit war für ihn das Vehikel.
Dieser spiritus animalis entstand nach ihm in der Grosshirnrinde und zog sich nach getaner Arbeit wieder dorthin zurück. Er entdeckte auch im Hirn eine Art von Kreislauf (analog dem Blutkreislauf), jedoch kam dieser ohne Muskelpumpe des Herzens aus. Beim Rückzug legte der spiritus animalis alle gewonnenen Sinneseindrücke in verschiedene Hirnfächer ab und speicherte sie dort: wobei Willis nun der Grosshirnrinde den Sitz des Gedächtnisses zuordnete, wo dies bislang im dritten Ventrikel verordnet worden war.
Willis fiel auf, dass der Menschen im Vergleich zu Tieren eine auffällig grosse Grosshirnrinde hatte und ordnete ihr daher viele neue Funktionen zu, wie etwa das Gedächtnis. Vieles deutete Willis nun um, auch wenn nicht alles richtig war. So übernahm er Begriffe wie Wahrnehmung, Vernunft und Gedächtnis, verteilte sie jedoch im Hirn um, nicht mehr wie seine Vorgänger von vorne nach hinten, sondern von oben nach unten. Die Vorstellungskraft etwa verordnete er ins Gebiet der der weissen Hirnsubstanz. Das Zentrum jeder geistigen Substanz verlegte Willis in die Hirnmitte.
Willis prägte, wie erwähnt, den Begriff der Neurologie und betrachtete nicht als solcher, sondern quasi als ,Psychiater‘ viele Geisteskrankheiten als organische Krankheiten des Gehirns. Daher gehörten die Geisteskranken nach Willis in die Hände von Ärzten und nicht in die von Priestern.
Bald folgte sein zweites und weitere Werke, welches sich erneut um Neurologie handelte.
Bild : Pathologiae Cerebri et Nervosi Generis Specimen, 1667
Thomas Sydenham
Thomas Sydenham Fotoherkunft: wikipedia, Mary Beale (1689)
Arztstudium in Oxford, Begründer der empirisch-klinischen Medizin. Früher Nosologe. Erforscher von Infektionskrankheiten. Beschreibung der Chorea minor. Befasste sich auch mit neurologischen und psychiatrischen Krankheiten, Epilepsie und Hysterie. Sein berühmter Assistent war John Locke (Arzt, Phil.).
Geboren: 10. September 1624, Wynford Eagle, England Gestorben: 29. Dezember 1689, London, England
Aus: Wikipedia
Thomas Sydenham diente bereits als 18-Jähriger (1642) im siegreichen Heer des Britischen Parlamentes unter Oliver Cromwell, wie auch sein Vater und seine Brüder und war somit ein Gegner König Karls l., auf dessen Seite damals Thomas Willis kämpfte. 1645 bis 1648 absolvierte er ein kurzes Medizinstudium und wegen der Kriegswirren erhielt er bereits nach kurzer Zeit den Grad eines Bachelor of Medicine, ähnlich wie bei Willis. 1651 folgte er einem neuerlichen Ruf Cromwells auf das Schlachtfeld und betätigte sich dort als praktischer Wundarzt. Ab 1659 wird ihm ein Studium in Montpellier nachgesagt, aber das bleibt fraglich.
Nach dem Krieg eröffnete er eine Praxis in London im Stadtteil Westminster und bewies sich auch dort vor allem als guter Praktiker, der viel auf die persönliche Erfahrung setzte und ungern nur ein theoretisch gut ausgebildeter Gelehrtenarzt war. Ein eifriger Student war er deshalb vermutlich nie gewesen, dafür ein unorthodoxer Rebell. Die damalige Medizinausbildung war desolat, jedoch im Umbruch begriffen und zudem gab es keinen Unterricht in klinischer Medizin.
Von vielen Ausbildungsteilen distanzierte er sich inhaltlich und traute mehr seinen eigenen Beobachtungen am Patienten als an den damaligen medizinischen Theorien der von Galen beeinflussten Lehrbücher. Damit war er also keineswegs ein Stubengelehrter, sondern vielmehr ein autodidaktischer Kliniker, der durch die Praxis (empirisch, aus Erfahrung und Beobachtung) lernte.
Sydenham war davon überzeugt, dass die Natur imstande war sich selbst zu heilen und zu therapieren (Vertrauen auf Selbstheilungskräfte). In diesem Sinne dachte er wie ein Hippokratiker und förderte hippokratisches Wissen. Oft empfahl er ein abwartendes und beobachtendes Vorgehen. Sein Vorbild war daher wirklich auch Hippokrates, aber auch der Empirismus des kürzlich verstorbene Philosophen Francis Bacon, also die Erfahrung als Erkenntnisquelle! Seine eher skeptische und empirische Grundhaltung als Arzt und Mensch zusammen mit seinem auf Erfahrung aufgebauten Wissen, seine vorurteilsfreie Denkweise erwiesen sich nun als sehr segensreich für die Entwicklung der Medizin in dieser Zeit.
Heute gilt Sydenham als einer der Begründer der klinischen Medizin, quasi mit einer nosologischen Grundhaltung. Es ging ihm um eine möglichst systematische Beschreibung von Krankheiten. Sein Wirken war vielfältig. Von ihm sind folgende Werke und Arbeiten bekannt:
Klassische Beschreibung und Unterscheidung der Podagra (Gicht) vom Rheumatismus (1683). An der Gicht litt er selber sein Leben lang.
Sydenham war selbst stark Nierenkrank und litt an Blutharn und an schmerzhaften Gichtattacken. Er musste zur Kur, therapierte sich aber selber mit Litern von leichtem Bier, damit die ,scharfen und heissen Säfte in den Nieren gekühlt und verdünnt würden', die den Nierenstein verursacht hatten.
Der Tractatus de Podagra et Hydrope aus dem Jahre 1683, eine Abhandlung über die Gicht und die Wassersucht gehörte zu den Klassikern der Medizinliteratur. Darin beschrieb er seine Theorien zur Ursache der Gicht und ihren Behandlungen, einschliesslich Ausführungen zu nützlichen Diäten.
Benennung und Beschreibung der Chorea Sydenham (Chorea minor), eine infektiös-toxische, durch Streptokokken hervorgerufene, degenerative Nervenkrankheit (Hirnveränderung), die hypotone Muskelerkrankung, auch Veitstanz genannt. Symptome sind Muskelzuckungen im Bereich des Gesichts, des Rachens und der Extremitäten, wobei vor allem Kinder bis zur Pubertät betroffen sind (1686).
Beschreibungen der Pleuritis, Pneumonie, des Croup und Erysipel.
Erforschung versch. Infektionskrankheiten wie Masern, Scharlach und Windpocken. Entdeckte die Übertragung des Typhus durch Fliegen.
Behandlung der Malaria mit der Chinarinde (Chinin). Die Malaria wütete damals um London, vor allem in der Sumpflandschaft um den St. James Park herum.
Betrieb Studien über verschiedene Fiebertypen sowie
Studien über epidemische Krankheiten. Er veröffentlichte Abhandlungen über Pocken, Masern, Ruhr und Syphilis.
Einsatz von Opium zur Schmerzreduktion.
Beschreibung der ,chlorosis' (Blutarmut infolge Eisenmangels).
Beschäftigung mit neurologischen und psychiatrischen Krankheiten wie Epilepsie und Hysterie. Auch Männer konnten an der Hysterie (,Hypochondriasis‘) erkranken, nicht nur Frauen. Die Ursache der Hysterie sah er in einer Schwächung (Krise) der Tiergeister (animal spirits).
Zur Hysterie der Frauen wäre zu sagen, dass man damals dieses weibliche Leiden nicht sehr ernst nahm und der Krankheit etwas Mysteriöses anhaftete, ,sie sei nur dunkel und schwer zu erkennen'. (Dr. Rohatzsch, Thomas Sydenham‘s sämtliche medizinische Schriften, 1839, Band ll, S. 84) Man dachte auch, sie sei keine echte Erkrankung, sondern wolle den Arzt nur täuschen. Immerhin sah man als Therapie die Stärkung des Blutes durch eine wässrige Suspension mit Eisenspänen und Teeblättern. Eine weitere Therapie der Hysterie sah Sydenham im Reiten von Pferden. Seine Therapien galten als naturverbunden.
Interessanterweise handelt Sydenham die Hysterie unter der Gallenkolik ab (Kolik, Anfall von krampfartigen Leibesschmerzen, A. d. A.). In dem Sinne wurde damals eine Kolik als ein dramatisches, sehr schmerzhaftes Geschehen angesehen, welches mittels heftiger Theatralik vorgetragen wurde und an schmerzhaftem Leiden kaum auszuhalten war. Die Krankheit, so Sydenham, begann mit Fieber und betraf auch Jünglinge, die ein sanguinisches und biliöses (gallenartig) Temperament hatten.
Die Betroffenen berichteten über grosse Schmerzen im Gedärme. Der Kranke gab die Schmerzen mit einer kläglichen Miene und starkem Wimmern zu erkennen. Sydenham setzte sowohl Purgiermittel wie auch Brechmittel dagegen ein, oft gefolgt von Aderlass und der Abgabe von Schmerzmitteln (Narkotika).
Wir sehen, dass auch Sydenham noch inmitten des Lehreinflusses eines Galen stand und die Kranken dementsprechend den Temperamenten und Säften zuordnete. Er verordnete therapeutisch eine grosse Menge mit Bier versetzter Milch, bis die Kranken erbrachen, empfahl das Purgieren mit Klistieren und hin und wieder auch den Aderlass.
Dann beschrieb er die Koliken der Hysterischen. Nun bezog er sich aber auf die Krankheit der Frauen, welche eine ,gewissen Gattung von Mutterbeschwerden‘ plagen würden. ,Frauen von zartem und schwachen Körper werden vorzüglich von diesem Übel befallen, wie auch jene, die schon früher an einem Mutterzustande gelitten haben, oder (was sehr oft zu geschehen pflegt) welche bei einer schweren und mühevollen Geburt wegen der Grösse des erzeugten Kindes ihre mütterlichen Kräfte zu sehr erschöpft haben, und daher kaum frei bleiben. Diese Krankheit sitzt zuerst um die Gegend des Magens, bisweilen auch etwas tiefer, wobei der Schmerz nicht milder ist, wie bei der Kolik und der Gedärmverwicklung (Darmgicht), auf welches heftiges Erbrechen folgt, und bald grüne, bald gelbe Materialien ausgeworfen werden. Hinzu kommt noch (was ich oft beobachtet habe) eine grössere Kleinmüthigkeit und Verzweiflung, als bei irgend einer anderen Krankheit...
Wenn nun schon alle Zufälle gewichen sind, und die Kranke sich genug wohl zu seyn glaubt, bringt die geringste Bewegung, sie mag von Zorn oder Schmerzen herrühren, von welchen in diesem Falle die Frauen sehr leicht ergriffen werden, fast den vorigen Schmerz wieder zurück, was auch vom Spaziergange oder irgend einer andern Leibesübung, die zu bald unternommen worden, gesagt werden muss, weil dadurch die Dämpfe in einem zarten und schwachen Körper aufsteigend gemacht werden.'
Er vermutete auch den Blasenstein als Ursache dieser Koliken bei Frauen, vor allem bei solchen Frauen, die zu verschiedenen Mutterschmerzen geneigt stünden. Aber er unterschied die Gallenkolik von der Mutterkolik. Er schrieb:,Auch wird die Vernunft der Erfahrung beistimmen, welche diese Krankheit mehr derUnruhe und unordentlichen Bewegung der Geister, als der üblen Beschaffenheit der Säfte zuschreiben wird,nämlich wenn wir jene Umstände berücksichtigen, von welchen sie hauptsächlich ihren Ursprung hat, wie grosse und ungewöhnliche Blutflüsse, heftigere Gemüths- und Leibesbewegungen, und anderes der Art.'
Weiter beschrieb er, dass diese Krankheit (Kolik der Hysterischen) ohne Lebensgefahr sei. Diese Krankheit, sowohl bei Hypochondrischen (Männern A. d. A.), wie bei Hysterischen, ändere sich oft in eine Gelbsucht.
Sydenham äusserte sich in einem Brief an einen Arzt, dass diese hysterische Krankheit nur dunkel und schwer zu erkennen sei, weswegen auch die Heilung schwierig sei. An diesen hysterischen Ausbrüchen litten, so Sydenham, die meisten Frauen.,Denn die wenigsten Frauenzimmer, welche die Hälfte des Menschengeschlechts bilden, sind von jeder Gattung diese Zustände gänzlich befreit, wenn man jene ausnimmt, welche an schwere Arbeiten gewöhnt sind und ein härteres Leben führen.'
Er bezichtigt auch bestimmte Männer der Hysterie.,Ja man findet sogar viele unter jenen Männern, welche sitzend zu arbeiten und unter Büchern sich aufzuhalten pflegen, dass sie mit derselben Krankheit befallen werden'.Männer rückt er eher in die Nähe der Hypochondrie, Frauen ordnet er der Hysterie zu. Sie sei mehr den Übeln der Gebärmutter ausgesetzt. Er ordnete aber das hysterische Geschehen nicht nur der Gebärmutter zu, sondern auch andern Ursachen.
So ergreife das Geschehen manchmal den Kopf und bewirke den Schlag, der sich oft in einer Lähmung der halben Seite endet (Apoplexie A. d. A.), wie bei alten Leuten. Das rühre daher, ,weil die Rinde des Gehirns mit einer Menge von Schleim angefüllt ist, wodurch den Lebensgeistern oder dem Nervensafte der Weg in die hohlen Gänge (Liquor, Ventrikel A. d. A.) versperrt wird, durch welche Ursache der Schlag, welcher sich bei hysterischen Frauen trifft, keinenswegs zu entfliehen scheint, weil er dieselben häufig gleich nach der Geburt, nachdem sie eine grosse Menge Blutes verloren haben, überfällt. Vielmehr kommt es entweder von einer schweren Geburt, oder irgend einer heftigen Gemüthsbewegung.'
Manchmal erzeugt die Hysterie schreckliche Krämpfe, die der fallenden Sucht sehr ähnlich sind, wobei der Unterleib und die Herzgrube gegen die Gurgel zu aufschwillt und die Kranke, die sonst von mittelmässigen Leibeskräften ist, so ihre Kräfte anstrengt, dass sie durch Hilfe der Umstehenden kaum gehalten werden kann; indessen spricht sie ungereimte Sachen mit gebrochener Stimme, und schlägt sich auf die Brust. Frauenzimmer, welche zu dieser Gattung, die man insgemein Muttererstickung nennt, sehr geneigt sind, haben grösstenteils ein sanguinisches Temperament und ein starkes mannbares Aussehen.'
Sydenham sprach auch von hysterischem Husten, von Herzklopfen, von Nierensteinen in diesem Zusammenhang, wie auch von Rückenschmerzen. Zudem berichtete er von von einer merkwürdigen Kälte der äusseren Teile des Körpers dieser hysterischen Frauen (ev. kalter Schweiss und Durchblutungsstörungen A. d. A.) während des hysterischen Anfalls, welche erst nach geendigtem Paroxismus'