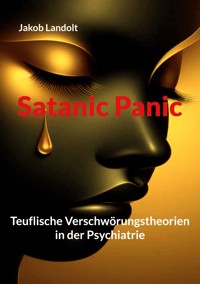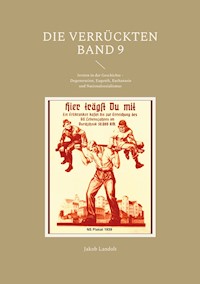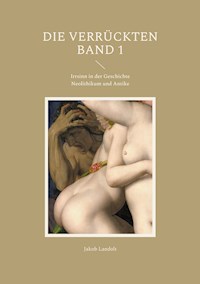Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Band 7: Pioniere der Psychiatrie Politische Umwälzungen und neue Armen- und Fürsorgegesetze trieben die psychiatrische Forschung ab 1800 voran. Man führte landesweit in ganz Europa mehrere Irrenzählungen durch. Erste psychiatrische Monumentalbauten wurden erbaut. Ihre Innenleben schwankten zwischen therapeutisch-medizinischen Einrichtungen und reinen Verwahrungs- und Ausgrenzungsanstalten. Die therapeutische Ohnmacht der Psychiatrie war eklatant. Erste Professuren für Psychiatrie wurden geschaffen. Die Forensik stand in den Startlöchern. Die Pioniere der Psychiatrie von damals hiessen: Heinroth, Horn, Hayner, Jacobi, Nasse, Schneider, Conolly, Damerow, Flemming, Roller, Griesinger und Gudden. Dieser Band berichtet auch über die brachialen Therapiemethoden (Horn und Schneider) der damaligen Psychiatrie, über die sog. Non-Restraint-Bewegung resp. über die unmenschlichen Zwangsbehandlungen (Conolly) und über das Leben und den Tod Ludwigs ll. des Königs von Bayern (Gudden).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis:
Band 7: Pioniere der Anstalts-Psychiatrie
Einführung in diesen Band
Pioniere der Anstalts-Psychiatrie
(
ab ca. 1800)
Johann Christian Heinrich Heinroth 1773-1843
Anton Ludwig Ernst Horn 1774-1848 und seine
Therapiemethoden
Karl Georg Neumann 1774-1866
Christian August Fürchtegott Hayner 1775-1857
Carl Wigand Maximillian Jacobi 1775-1858
Ernst Gottlob Pienitz 1777-1853
Friedrich Christian Nasse 1778-1851
Gottlieb (Gottlob) Heinrich Bergmann 1781-1861
Peter Joseph Schneider 1791-1871
Peter Willers Jessen 1793-1875
John Conolly 1794-1866 und die
Non-Restraint-Bewegung
Joseph Guislain 1797-1860
Heinrich Phillipp August Damerow 1798-1866
Carl Friedrich Flemming 1799-1880
Christian Friedrich Wilhelm Roller 1802-1878
Wilhelm Griesinger 1817-1868
Bernhard von Gudden 1824-1886 und der
Fall König ,Ludwig ll
. von Bayern
Ausblick
Einführung Band 7:
Um 1800 erwachte die Psychiatrie endgültig und wurde konsequent zu einem eigenständigen medizinischen Zweig. Die Erforschung der Seele, aber auch Volkszählungen, insbesondere Irrenstatistiken sowie neue Armen- und Fürsorgegesetze trieben die universitäre Forschung und den Anstaltsbau voran. Erste gewichtige Lehrbücher über das Fachgebiet der Psychiatrie wurden verfasst, die von Medizinern gelesen und auch für gerichtliche Fragestellungen (Forensik) zurate gezogen wurden. Erste Professuren für Psychiatrie entstanden.
Ab ungefähr Mitte dieses Jahrhunderts (1850) forcierte man vielerorts den Bau von neuen Irren-, Heil- und Pflegeanstalten, flankiert und befördert von Armen-, Fürsorge- und Krankengesetzen und fundamentiert und begründet von landesweiten Irrenzählungen. Konzipiert wurden diese Bauten anfänglich, die oft Monumentalbauten waren, als Verwahrungs- und Aussonderungsanstalten für Psychischkranke, Randständige und z. B. für Alkoholkranke. Anfänglich stand der Verwahrungscharakter dieser Irren im Vordergrund und entsprach der hiesigen Politik und Volksmeinung. Man holte die Irren und Randständigen von der Strasse, entlastete damit finanzschwache Gemeinden und sorgte sich gleichzeitig um einen gesunden und militärisch schlagkräftigen, religiösen und moralischen Volkskörper.
Mit der Zeit erfuhren diese Irrenanstalten jedoch immer mehr den Charakter von therapeutischen und medizinischen Einrichtungen, allerdings blieb ihnen lange Zeit, teils bis heute der Charakter der Arbeitserziehung und Ausgrenzung. Die Mauern, die meistens um solche Anstalten aufgestellt worden waren, wurden teils erst in den 70er Jahren des (nächsten) 20. Jahrhunderts (1970) geschliffen, sprich abgebaut. Meist begleitet von einem festlichen Akt.
Die Versorgung und Therapierung der Irren und Verrückten wurde also immer konsequenter vorangetrieben, obwohl ärmere Gegenden resp. Landesteile sich diesen Luxus lange nicht leisten konnten. So gab es Landesteile, in denen der Bau einer Irrenanstalt erst um 1900 in Erwägung gezogen werden konnte. Bis dahin genügten für die Versorgung von Randständigen, Bettlern, Landstreichern, Nichtsnutzen und Arbeitsscheuen wie auch von Irr- und Blödsinnigen sog. Korrektionsanstalten (Armenhaus, Zuchthaus, Arbeits- und Erziehungsheim), die diesen ,Gestrandeten‘ mit Arbeitserziehung (Zwangsarbeit), Gottesfürchtigkeit und moralischer Erziehung zu einem rechtschaffenen Leben verhelfen sollten.
Manche bestehende Institutionen hatten bisher sowohl als Arbeitserziehungsanstalten, wie auch als Zuchthäuser und Armenhäuser und Institutionen zur Versorgung von unsittlichen Randständigen (Bettlern, Taugenichtsen, Arbeitsscheue, Landstreichern und Herumtreibern usw.) gemäss ihrem ,inhaftiertem‘ Klientel funktioniert, das damit aus den Gemeinden und aus der Bettelei entfernt wurde. Nun endlich erkannte man immer klarer, dass die eigentlich Irren und Psychischkranken in solchen ,Multifunktions-Anstalten‘ im Grunde genommen falsch platziert worden waren. Irresein erhielt endlich den Status der Krankheit.
Viele Psychiater dieser Zeit gelten heute noch als Pioniere dieser frühen Anstalts-Psychiatrie. Zu erwähnen seien hier - neben den im Band 6 bereits erwähnten Pionieren Pinel, Esquirol, Reil und Langermann - vor allem Heinroth, Jacobi, Nasse, Schneider, Conolly, Roller, Morel, Griesinger und Gudden (Gutachter des kranken und verschwendungssüchtigen bayrischen Königs Ludwig II.), um nur einige wenige zu nennen. Gefolgt von namhaften Persönlichkeiten wie Charcot, Meynert, Binswanger, Kraepelin, Freud, Bleuler sowie Wagner-Jauregg, Adler, Jung, Jaspers und Schneider.
Eugenisches Gedankengut machte sich früh breit. Einer der ersten Verbreiter solcher rassistischen Gedanken war der britische Anthropologie Francis Galton (1822-1911), der mit seinen Schriften dazu beitrug, dass man nun eine Verbesserung der Eigenschaften der menschlichen Rasse ins Auge fasste. Aber auch Darwin leistete darin seinen Anteil (siehe Band 9).
In diesem Band wird auch Conollys ,Non-Restraint-Bewegung‘ näher beschrieben. Non-Restraint oder auch No-Restraint meinte zu Deutsch: ,keine Zwangsmassnahme‘. Es handelte sich dabei um ein frühes und vielbeachtetes Behandlungskonzept resp. um eine Maxime, die auf jede Form einer mechanischen Zwangsbehandlung von Irren verzichtete.
Allerdings blieb die Non-Restraint-Bewegung vielerorts leider nur Theorie. Die Psychiatrie teilte sich im 19. Jahrhundert auf in Anhänger der Psychiker und der Physiker. Die Therapien beider dieser Richtungen jedoch bedienten sich starker, heftig wirkender Formen, ob nun von einem Psychiker oder von einem Physiker verordnet. (Zu den Therapien siehe Band 5 und Band 6 dieser Reihe)
Pioniere der frühen (Anstalts-) Psychiatrie
Wir beendeten Band 6 mit Dominique Esquirol, der ebenfalls zur den Pionieren der Psychiatrie gezählt werden muss. Esquirol, wie sein Ziehvater und Lehrer Pinel ,befreiten die Irren von ihren Ketten‘, nachdem die Französische Revolution und ihre politisch-gesellschaftlichen Auswirkungen auch das französische Irrenwesen erfasst hatte und dort nun nach politischen und gesetzlichen Neuerungen verlangte. Die Zeit war auch reif geworden für neue, spezifische Anstaltsbauten für Irre, deren Tore fortan nur noch den irregewordenen Patienten (aber auch Alkoholikern und Liederlichen) offen stehen sollten.
Es gab zwar bereits seit längerer Zeit Einrichtungen für Menschen mit einer psychischen Krankheit (Bedlam, Hôpital de la Salpêtrière), doch die Irren darin wurden unter unwürdigen Bedingungen zusammen mit Kriminellen und Asozialen aufgenommen und wie diese, straff und diktatorisch geführt und zum Teil sehr brutal behandelt. Deren Wärter waren oft ehemalige Soldaten, grobschlächtige Haudegen oder, je nach Gebieten auch Landjäger mit polizeilichen Funktionen. Auf ihre seelischen Bedürfnisse wurde wie bei den Strafgefangenen und Schwerverbrechern keine Rücksicht genommen. Im Gegenteil, sie wurden sogar oft genau wie die Schwerverbrecher (Mörder, Vergewaltiger) behandelt.
Das militärisch strenge Regime in diesen Erziehungsanstalten mit ihrem Verwahr- und Gefängnischarakter, das in erster Linie den Kriminellen, sozial Randständigen und Asozialen galt und eigens für diese staatsfeindlichen Elemente und Kreaturen eingerichtet und praktiziert wurde, fand selbstverständlich auch Anwendung auf die ebenfalls darin ,inhaftierten‘ Seelenkranken.
In verschiedenen europäischen Ländern reifte nun, teilweise ausgelöst durch die Französische Revolution und später durch die napoleonische Ära, endlich die Zeit für eine Verbesserung und Spezialisierung des Betreuungswesens für Geistigkranke. Das bedeutete gleichzeitig die Trennung der Irren von den übrigen Verbrechern, Arbeitsscheuen, Bettlern und Armengenössigen. Sie erhielten langsam nun eine ,irrenspezifische Behandlung‘ in Irrenhäusern, die je nach ideologischer Ausrichtung in dieser Zeit ab 1800 von Psychiatern als ,Psychiker‘ oder ,Physiker‘ entwickelt und praktiziert wurde.
Die Zeit war nun geboren für eine Trennung in Armen-, Arbeits-, Zucht- oder Tollhäuser. Dienten früher noch solche Verwahrungs- und Aussonderungsbauten der Säuberung bestimmter Stadtteile und Strassen von ,diebischem und räuberischem Gesindel‘ durch die ,medizinische Polizey‘, erwachten nun politische Kräfte, die immer vehementer eine ,Sonderbehandlung‘ für Tolle und Irre und geeignete Anstalten für die Versorgung dieser Irren forderten.
Vermutlich im Geiste der Aufklärung und angetrieben durch die Auswirkungen der Französischen Revolution und der darauffolgenden napoleonischen Ära reifte in vielen, eine Erneuerung des Spital- und Gefängniswesens anstrebenden Köpfen die Einsicht (Regierungen, Gemeinden), dass das ,Irrenklientel‘ in diesen althergebrachten Gefängnissen, Armen- und Erziehungsanstalten falsch aufgehoben und darin nichts mehr zu suchen hatte.
Man schlug nun vor, die Geisteskranken, Irren und Tollen in spitalähnliche Anstalten zu stecken, um sie dort krankheitsspezifischer behandeln und sie aus der Gesellschaft besser ,isolieren‘ zu können. Sichtbar wurde dieser Gedanke der Isolierung und gesellschaftlichen Ausgrenzung durch den Bau von gefängnisartigen Irrenhäusern, umfasst von hohen Mauern rund um diese Anstalten, die erst viel später endlich einen Rückbau erfuhren. Diese Irrenanstalten hatten lange Jahrzehnte den Charakter von Ghettos (gesellschaftlicher Zitadellen).
Erst rund einhundert Jahre später, ab der zweiten Hälfte des 20.ten Jahrhundert (1970/1980), brüsteten sich dann Irrenhausdirektoren und Politiker damit, diese ,ausgrenzenden‘ und inzwischen, wegen besseren medikamentösen Therapien unnötig gewordenen Begrenzungsmauern (die teils über drei Meter hoch waren) geschliffen und dadurch endgültig entfernt und die Psychiatriebauten ,entghettofiziert‘ zu haben.
Waren die Zucht-, Armen- und Irrenhäuser in vielen Gebieten bisher eine Einheit gewesen (sie standen als Komplex beieinander), so zerfielen sie nun und spezialisierten sich in einerseits Zuchthäuser, Armenhäuser und andererseits in Irrenanstalten. Ob sich die Lage der Irren dadurch verbesserte, mag dahingestellt sein, denn das Irrenhauswesen und die dazugehörige medizinische und teilweise auch universitäre Psychiatrie musste sich erst entwickeln. Sie stand noch ganz an ihrem Anfang, erhielt nun aber Aufschwung.
Seltsamerweise nahm nun die (statistisch eruierte) Anzahl armer Geisteskranker in dieser Zeit um 1800 merklich zu, was vermutlich auch einer gesellschaftlichen Umwälzung, einer zunehmenden Industrialisierung mit spezifischer Arbeitsteilung, einer Verstädterung und auch einer Umwälzung in der Landwirtschaft geschuldet war, die zu einer Landflucht führte, also zu einer Abwanderung der Landbevölkerung in die Städte. Darin verarmten die Menschen und verelendeten seelisch.
Aber die ,Zunahme‘ der Irren in der Gesellschaft (aus statistischer Sicht) mag auch daher rühren, dass diese Irrenstatistiken ungenau waren und sie nosologische Probleme enthielten. Sie erweckten bei den Politikern aber den Eindruck, als sei in diesen Zeiten eine starke Zunahme von psychisch kranken Personen festzustellen. Dahinter mag auch zum Teil eine veränderte gesellschaftliche Wahrnehmung psychischer Krankheiten stehen.
Zudem wussten nicht alle mit der Exploration beauftragten Ärzte (für einen Bezirk zustehende Mediziner) die vielen Krankheitserscheinungen, die psychischer Natur waren, exakt und genau genug zu unterscheiden und zählten auch Kretine und Blödsinnige und Verwahrloste und Verelendete und sonstige (Alkohol) -Kranke zu den Psychischkranken. (Nosologie: Lehre von den Krankheiten; systematische Beschreibung und Einordnung von Krankheiten)
Auch die Terminologie war keineswegs einheitlich, genauso wenig wie die Pathologie (insbesondere die Psychopathologie) wie auch die Symptomatologie. Über die Ätiologie der psychischen Krankheiten (Ursachen) wusste man noch weniger.
Denn die meisten Mediziner, die sich an der statistischen Erhebung von Irren beteiligten, waren keine ausgebildeten und erfahrenen Psychiater. Die damalige psychiatrische Wissenschaft steckte noch tief in ihren Anfängen.
Die in England beginnende Industrialisierung (ca. ab 1750), die kurz darauf auch das europäische Festland erreichte, forderte einen gesellschaftlichen Tribut. Die Arbeiter waren zu Beginn rechtlos, ohne Altersvorsorge und ohne medizinischen Schutz. Einzig die Industriepatrone konnten soziale Sicherheiten einführen, aber man hatte sich als Arbeitnehmer diesen Patronen vollkommen zu untergeben. Diese Unterjochung führte z. B. dazu, dass man den Arbeit gebenden Patron erst um Erlaubnis fragen musste, wenn man beispielsweise heiraten wollte. Ohne das Einverständnis des Industriepatrons ging gar nichts. Dies bot gesellschaftlichen Zündstoff.
Bald tauchte am gesellschaftlichen Horizont auch der sog. Pauperismus auf, der sich ca. zwischen 1780 und 1850 immer stärker bemerkbar machte. (Pauperismus: Massenarmut des 19. Jahrhunderts, die zur Verelendung und zu sozialen Unruhen führte).
Einige Psychiater der frühesten Stunde, wie ein Johann Christian Reil, ein Esquirol und Pinel und noch etwas früher ein Battie und Tuke hatten bereits Ideen für Musteranstalten für Psychischkranke entwickelt und teils auch erbaut, sodass in den Köpfen von Politikern, Würdenträgern und Räten etc. der Zeit um 1800/1850 alsbald ein neuer Anstaltstypus reifte, der gleichzeitig Männer und Frauen in ihren Mauern einschliessen und darin ,therapieren‘ konnte.
Beginnen wir mit dem Pionier Johann Christian Heinrich Heinroth, der bestens dafür geeignet war, solche Ideen für einen modernen Anstaltsbau zu entwickeln und den behördlichen Gremien vorzuschlagen. So etwa wurde die ,Heil- und Pflegeanstalt für Irre beiderlei Geschlechts, Schloss Sonnenstein‘ im Jahre 1811 ins Leben gerufen und war die zweite Anstalt, neben der vorgängig gebauten in Bayreuth. Sie sollte eine Musteranstalt für das deutsche Sachsen werden. Sonnenstein gehörte damit zu den frühen Anstaltsbauten.
Es war dann eine königliche, staatliche Kommission zur Beförderung der Straf- und Versorgungsanstalten Sachsens, die den Zeitpunkt als gekommen ansahen, endlich eine Verbesserung der Betreuung von Geisteskranken voranzutreiben und diese von den übrigen ,Pfleglingen‘ (Zuchthäusler, Arme, Schwache, Erziehungsbedürftige etc.) zu trennen. Dies führte in der Folge dazu, dass am 8. Juli 1811 eine Heil- und Verpflegungsanstalt für Irre beiderlei Geschlechts im ,Schloss Sonnenstein‘ eröffnet und in Betrieb genommen wurde. Eine sehr frühe Irrenanstalt in Deutschland.
Es gehörten zum Schloss Sonnenstein ausreichend Ländereien für das Arbeiten der Irren in der Landwirtschaft. Darin stand auch ausreichend Wasser zur Verfügung und sogar eine eigene Poststelle. Diese Irrenanstalt sollte eine Musteranstalt werden, welche weitum bekannt und als Vorbild für weitere Anlagen werden sollte. Sie wurde nach den Ideen von Reil (1759-1813), von Heinroth (1773-1843) und von Esquirol (1772-1840) gestaltet und konzipiert und war für damalige Begriffe eine der modernsten und progressivsten Irrenanstalten.
Man nahm sich Reil als Vorbild bezgl. der Organisation, besonders, was neben dem Personellen auch speziell die pharmazeutischen und psychischen Kurmethoden anbelangte. Erster Direktor wurde Pienitz (siehe dort), gefolgt von Hayner (siehe dort).
Es mag sein, dass in diesem Band nicht alle wichtigen Psychiater dieser Zeit zu Wort kommen oder einige nur kurz erwähnt werden. Man möge dies verzeihen. Es steckt keine Absicht dahinter, die Auswahl der Exponenten ist der Eingrenzung des Werkes (Anzahl der Seiten) geschuldet. Verwiesen wird aber gleichzeitig auf Band 8 dieser Reihe mit weiteren Psychiaterpionieren dieser frühen Stunden.
In diesem Band aufgeführt sind Beschreibungen über die Non-Restraint-Bewegung. Es geht um ein mildes und eher abwartendes Vorgehen innerhalb der Therapien. Die Behandlungen im Sinne des Non-Restraint waren eher schonender Natur, man therapierte die Patienten vorsichtiger und geduldiger und möglichst ohne Anwendungen von äusserem Zwang, wenn es irgendwie ging.
Einige Behandlungsformen waren bereits ,psychotherapeutisch‘ angelegt oder hatten wenigstens einen psychotherapeutischen Charakterzug. Man verordnete auch vermehrt diätetisch-hygienische Massnahmen und unterstützte auch die eigenen Selbstheilungsfähigkeiten des Körpers.
Bereits Stahl, 1659-1734 (siehe Band 5) plädierte auf seine Weise für ein gewisses Non-Restraint-Denken und setzte gewisse ,Kontrapunkte‘ gegen die damals üblichen und weitverbreiteten Rosskuren in der Behandlung von Irren.
Das Non-Restraint war ein Behandlungskonzept in der Psychiatrie, die möglichst auf körperliche Zwangsmassnahmen zu verzichten versuchte. Mehr davon jedoch erst bei John Conolly.
Johann Christian Heinrich Heinroth
Bild htps://www.wikipedia.org/
Johann Christian Heinrich Heinroth
Fotoherkunft: wikipedia
Lutheranischer Pietist, Anthoropologe, Militärarzt, Psychiater, erster deutscher Professor für psychische Therapie 1819. Professor für psychische Heilkunde. Versuch einer anthropologischen Begründung der Psychiatrie. Leib und Seele als Einheit. Psychische Krankheit als Ausdruck der Sünde, Selbstheit und Abfall von Gott. Anhänger des Brownianismus. Vertreter der Psychiker.
Geboren: 17. Januar 1773, Leibzig, Deutschland
Gestorben: 26. Oktober 1843, Leipzig
Aus: Wikipedia
Heinroth, im Jahre 1805 nach Studium und ärztlicher Tätigkeit promoviert, wurde der erste deutsche Professor für psychische Therapie (1811). Dieser neu gegründete Lehrstuhl bestand bis 1848. Später wurde er Professor für psychische Heilkunde (1819). Im Jahre 1827 wurde er ordentlicher Professor für psychische Medizin.
Dieser neue Lehrstuhl in Leipzig ab 1811 war bedeutsam für die Medizingeschichte, insofern, dass dadurch eine starke wissenschaftlich orientierte Entwicklung von Lehre, Forschung und Patientenbetreuung in der Nervenheilkunde in Gang gesetzt wurde. Es war der sächsische König Friedrich August l., der diesen neuen Lehrstuhl einrichten liess. Besetzt wurde diese neu errichtete Professur erstmals von Johann Christian Heinrich Heinroth (1811).
Diese Lehrstuhlgründung kann man als den Beginn der akademischen Psychiatrie des Abendlandes einstufen. Die Universitätspsychiatrie wurde möglich durch eine allgemeine Universitätsreform, die der sächsische König befürwortete. Zugleich entstand ein neues Versorgungssystem für die Irren. Heinroths Interesse für psychisch kranke Menschen kam dem Lehrstuhl entgegen, auch wenn er einige anthroposophisch-theologische Überlegungen in sein Psychiatriewerk einfügte, die aus heutiger Sicht moniert werden können. Trotzdem machte Heinroth einen Anfang in der europäischen Psychiatriegeschichte.
Heinroth als erster ,Vollzeitpsychiater‘ unterrichtete in Psychiatrie beispielsweise zum Thema: ,Einführung in die Heilung des Gemüts‘ und verfasste bald auch einige gewichtige Lehrwerke, die nachfolgend angegeben sind. Darunter finden sich Lehrwerke, die eigens für angehende Irrenärzte verfasst wurden oder ein System der psychisch-gerichtlichen Medizin (erste Forensik) beschreiben:
1. ,Heinroth: Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens oder der Seelenstörungen und ihrer Behandlung, Teil 1 und 2 (1818)'
2. ,Heinroth: Lehrbuch der Seelengesundheitskunde zum Behuf academischer Vorträge und zum Privatstudium, Teil 1 (1823 ) und Teil 2 (1824)'
3. ,Heinroth: Anweisung für angehende Irrenärzte zur richtigen Behandlung ihrer Kranken (1825)'
4. ,Heinroth: System der psychisch-gerichtlichen Medizin (1825)'
5. ,Heinroth: Anti-Organon oder das Irrige der Hahnemanschen Lehre im Organon der Heilkunst (1825)'
6. ,Heinroth: Die Psychologie als Selbsterkenntnislehre (1827)'
7. ,Der Schlüssel zu Himmel und Hölle im Menschen; oder ueber moralische Kraft und Passifität. Ein Beitrag zur Seelenheilkunde (1829)'
Sein Lehrstuhl beförderte die irrenärztliche Ausbildung stark. Die Sachsen hatten in dieser Zeit die Nase vorn, denn ähnliche Entwicklungen folgten in Berlin, Erlangen und in Jena erst in den 1840er Jahren. Nur Bayreuth war noch früher.
Eigentlich war Heinroth, genau wie Reil, Arzt in einem Gefängnis und hatte mit Irren direkt eher wenig Begegnung. Aber dadurch, dass Heinroth auch als Hausarzt in einer städtischen Zucht-, Waisen- und Versorgungsanstalt praktizierte, ermöglichte sich ihm darin auch die direkte Beobachtung und eine von ihm persönlich eher selten praktizierte Behandlung von Irren, wobei auch der klinische Unterricht vor Ort nicht zu kurz kam. Die Entwicklung einer universitären Psychiatrie nahm hier ihren Anfang und über Jahrzehnte ihren Fortgang (bis 1848).
Beeinflusst wurde Heinroth durch den lutherisch geprägten Pietismus. Sein psychiatrisches Krankheitskonzept war daher geprägt von einem christlichen Weltbild der Sünde und Selbstschuld, welches sich nach Gesichtspunkten der romantischen Medizin orientierte.
Seine Ideen der moralischen Therapie, die noch dem Brownianismus verpflichtet waren, beeinflussten die sich in der Gründung befindende Heil- und Pflegeanstalt Schloss Sonnenstein. Das von Heinroth im Jahre 1818 veröffentlichte ,Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens oder der Seelenstörungen und ihre Behandlung‘, galt quasi als Gründungsdokument der (psychischen) Psychiatrie. Heinroth lässt sich darin als Psychiker erkennen, im Gegensatz zu den Irrenärzten, die sich zu den Physikern (Somatikern) einreihen lassen.
Ab den 1830er Jahren begann nämlich ein vehementer Kampf zwischen Vertretern dieser beiden Hauptgruppen, also zwischen Psychikern und Physikern in der Psychiatriegeschichte. Heinroth zählt man heute zu den Psychikern. Er war der romantischen Medizin sehr nahe. Seine Haltung als Arzt war jedoch nicht psychologischer, wie man der Einteilung nach annehmen könnte, sondern eher moralistischer Art.
Die Unterscheidung resp. die Zweiteilung in Psychiker und Physiker ist eigentlich nicht haltbar, denn in der Wahl der Therapien zeigten beide ,Kontrahenten‘ eine sehr grosse Übereinstimmung. Und innerhalb beider Standpunkte galt übereinstimmend, dass die Seele eine vom Körper unabhängige Existenz haben müsse.
Aber um diesen Zeitpunkt (1820) erstarkten die ,Somatiker‘ (Physiker) und versuchten die Theorien der Psychiker zu torpedieren und infrage zu stellen. Die Somatiker waren der Ansicht, resp. verfochten die These, dass psychische Krankheiten nur Begleitsymptome oder Folgeerscheinungen körperlicher Defekte seien. Ein kranker Körper ermögliche einen kranken Geist. Rein geistig-psychologische Krankheitsbilder gäbe es somit keine oder nur wenige. Alles sei körperlich (somatisch) bedingt.
Sie lehnten vehement auch die Meinung der Psychiker (Heinroths) ab, dass bei den Geisteskrankheiten abzuklären sei, ob sie an ihrer Krankheit eine Selbstschuld trügen. Die Somatiker wollten die Irren somit vor jeglicher moralischen Selbstverantworung befreien resp. sie vor dem Vorwurf, der eigenen Mitschuldigkeit entlasten. Im Speziellen versuchten die Somatiker die in der Irrenbehandlung der damaligen Zeit praktisch durchgeführten, mechanischen Zwangstherapien zu mildern oder gar ganz abzuschaffen. In deren Praxis sah dies, wie bereits gesagt, jedoch äusserst kontrovers aus, denn auch die Somatiker bedienten sich beispielsweise der grausamen Cox’schen Schaukel, den folterähnlichen Wasserbädern oder den Zwangsjacken.
Selbst die Therapie mittels dem Drehstuhl war in beiden Lagern gerne angesagt. Man dachte, Heilung vollziehe sich vorzüglich per Schocktherapie.
Die damaligen Therapien in den Irrenhäusern (resp. Mehrzweckhäusern) waren genauso wie die frühen Bauten und hygienischen Einrichtungen überaus menschenverachtend. Der Geist der Aufklärung war um 1820 noch nicht angekommen. Das Therapiekonzept (beider Kontrahenten-Parteien) bestand darin, die erkrankten Seelen der Irren durch physische Gewalt zu erschüttern (zu schocken), damit eine Heilung sich vollziehen könne.
Daher kamen sowohl Peitschen, Stöcke, Fixierstühle und Fixierbetten zum Einsatz, wie auch der oben abgebildete, berüchtigte Drehstuhl. Darin drehte man die Irren um ihre eigene Achse so lange, bis sie ohnmächtig wurden und ihnen das Blut aus dem Mund und aus der Nase tropfte. Man drehte sie weiter bis zur Ohnmacht.
Weitere brutale Methoden waren das Eintauchen in eiskaltes Wasser, die Pein des Dauerbades, die Verabreichung von Brech- und Abführmitteln, das lange Auspeitschen mit Brennnesseln und auch das berüchtigte Haarseil. Sogar der Einsatz und die Anwendung von galvanischem Strom, die sich wie eine Elektroschocktherapie anfühlte, fehlte nicht.
Die Psychiker verordneten viele dieser schrecklichen Zwangstherapien im Namen (der Herstellung) der Vernunft, der Ordnung und der Sittlichkeit, therapierten die Irren also in einem bestrafenden und moralistischen Sinne. Die Erkrankung der Seele war ihnen gemäss durch die Irren selbstverschuldet, hatten sich diese doch von Gott abgewandt und sich gegen ihn versündigt. Für deren Heilung verordnete man ,pädagogische Massnahmen‘. Das waren nichts Weiteres als ,moralische‘ Behandlungen, die die Form von Züchtigung und Grausamkeit annahmen.
Die Somatiker (Physiker) jedoch nahmen dies so nicht hin und verwiesen darauf, dass Geisteskranke (z. B. in der Rechtsprechung) ebenfalls als unzurechnungsfähig zu gelten hätten. In diesem Sinne glaubten viele Psychiker anders als die Somatiker und richteten ihre Therapien und Zwangsmassnahmen darauf aus, dass die Irren als zurechnungsfähig anzusehen seien.
Die Physiker (Somatiker) wehrten sich gegen diese Vorstellungen der Psychiker (Heinroth), dass ,die Verleugnung der Vernunft und Moral, die ungezügelten Leidenschaften und die Sünde, resp. die Versündigung (gegen Gott)‘ die Quellen aller psychischen Krankheiten seien. Sie wehrten sich somit gegen die Vorstellung (der Psychiker), dass jeder Wahnsinn ein selbst verschuldeter Zustand und jeder Wahnsinnige ein Kind des Teufels sei! So wie das Heinroth proklamierte.
Heinroth selbst zählte sich gerne zu den Psychikern, aber auffällig war doch, dass er in seiner Lehrmeinung doch eine ganzheitliche Auffassung der Seelenstörungen vertrat und somit den Psychischkranken (Körper), resp. dessen Seelenstörungen (Seele) als eine ,Einheit‘ betrachtete, die die gesamte Person umfasste. Psyche und Soma als Einheit. Dies hatte etwas Psychosomatisches an sich und fiel bei Heinroth auf. Allerdings kann man ihn deswegen nicht als frühen ,Psychosomatiker‘ betrachten.
Aber Heinroth pflegte ganz offensichtlich psychosomatische Gedankengänge, die sich offenbarten in seinem Leib-Seele-Konzept und auch in den von ihm dargestellten Vorstellungen von der Ätiologie und Pathogenese psychischer Störungen, die in seinen Werken immer wieder thematisiert wurden. Ausgehend von der Psyche anerkannte Heinroth eine gegenseitige Beeinflussung von Körper und Psyche. Eine Lehrmeinung, die heute noch Gültigkeit hat.
Für Heinroth galt der Leib als ein Instrument der Seele. Seine Gegner sahen dies konzeptuell anders. Zwar anerkannten beide eine Verknüpfung von Leib und Seele, aber gemäss den Physikern folgte die (kranke) Seele den (kranken) Funktionen des körperlichen Organismus. Beide Parteien lokalisierten die psychischen Grundfunktionen in den Bauchorganen, dies betraf aber nur die niederen, triebhaften psychischen Funktionen.
Man nahm das Vorhandensein eines immateriellen und unsterblichen Seelenanteils an. Dieser Seelenanteil, resp. die Seele an sich, konnte ihrer Meinung nach in ihrem Ursprung (Kern, Wurzel) nicht erkranken bzw. dem Einfluss der schädlichen (körperlich verursachten) Triebe nicht gänzlich erliegen. ,Dieser Kern sei die menschliche Vernunft, der Geist des Menschen, der sich am Gewissen orientiere. Dabei argumentierten die „Somatiker“ Nasse und Jacobi keineswegs organpathologisch im Sinne einer „Gehirnpsychiatrie“ und lehnten sowohl Galls als auch Soemmerrings Gehirnlehren ab.
Ein wichtiges Anliegen waren die „Freiheit“ der Seele und ihre Bedrohung durch die psychische Störung. Damit verbunden war die Schuldfrage. Im Hinblick auf Kants „praktische Vernunft“ ging es den Psychiatern beider Lager um eine moralische Bindung der geistigen Freiheit, eine sich selbst beschränkende Freiheit.
Während Nasse und Jacobi in der psychischen Störung einen Ausdruck von biologisch-organismischen Vorgängen erblickten, bestand für Heinroth die seelische „Beschränkung“ in einer vernunftlosen Entgrenzung, einer Schrankenlosigkeit der Seelenvermögen, die zur „Unfreiheit“ führte.
Heinroth stützte sich (eher implizit) auf die Auffassung, wonach Krankheit als Folge der Sünde zu verstehen sei (wobei der Begriff „Sünde“ nur sehr vereinzelt in seinen Schriften auftaucht), und behauptete somit eine Verbindung von Krankheit und Laster. Doch ein solcher moralischer Aspekt ist bei allen psychiatrischen Richtungen festzustellen.' (Schott&Tölle, Geschichte der Psychiatrie, Beck Verlag München, S. 54, 55)
Heinroth war somit zur Überzeugung gelangt, dass Geisteskrankheiten aufgrund der in Sünde gefallenen körperlosen Seele entstanden seien. Es bestehe ein lebensgeschichtlicher Zusammenhang. Die Seele habe gesündigt und müsse nun dafür bezahlen. Somit war für ihn eine Geisteskrankheit eine ,reine‘ Seelenkrankheit, die aufgrund einer gottgewollten Unfreiheit entstanden sei. Somit hatten nach ihm Seelenkrankheiten keine entsprechenden körperlichen Ursachen oder solche standen zumindest nicht im Vordergrund. Aber sehr wohl einen lebensgeschichtlichen Zusammenhang.
Diese Meinung Heinroths hat auch heute insofern noch immer eine gewisse Ausstrahlungskraft bei der Frage, ob man durch ungesunde Lebensweisen (Alkohol, Drogen etc.) nicht willentlich in Kauf nehme, nicht nur den Körper, sondern wenigstens indirekt, auch den eigenen Geist zu schädigen.
Immerhin kennen wir bei starken Alkoholikern eine Tendenz, bei übermässigem Gebrauch dieses Suchtmittels eine Form von alkoholischer Demenz zu entwickeln. (Hirnorganische Leistungsverminderung im Sinne einer Beeinträchtigung des Gedächtnisses, kognitive Leistungsverminderung, Nivellierung der Persönlichkeit, Persönlichkeits- und Wesensveränderung, emotionale Stimmungsschwankungen, Angstzustände, Depressionen, Halluzinosen mit Wahninhalten usw. können durchaus Folgeschäden bei übermässigem Alkoholabusus sein.)
Neben sozialen und somatischen Problemen führt ein ungesunder Lebenswandel nachweislich also auch zu psychischen Problemen. Allerdings kann man hier diese psychischen Probleme als bedingt durch soziale und somatische betrachten, auch als Folge eine körperlichen Suchtgeschehens.
So einfach es klingen mag, war Heinroth der Überzeugung, dass die Sünder (sprich: die Seelenkranken) von Gott, dem Allmächtigen, mit dem Verlust ihrer Willensfreiheit bestraft worden seien. Somit waren die Irren für ihre sündhaften Taten selbst verantwortlich und hatten entsprechend alle Folgen ihres Fehlverhaltens selbst zu tragen.
Die Seelenstörung der Irren sei, so Heinroth, eine direkte Folge des Abfalls von Gott und der ,heiligen Vernunft‘. Dies war für ihn das Böse und Teuflische schlechthin. Eine Vererbung von Seelenkrankheiten (!) lehnte er daher ab und blieb dieser Möglichkeit eher skeptisch gegenüber. Vielmehr war nach ihm jede seelische Krankheit selbst erworben und selbst verschuldet.
Jeder Mensch besitze eine individuelle und einzigartige Seele, die ihm bei seiner Geburt neu vergeben werde, so Heinroth. Eine ,Seelenwanderung‘ resp. eine ,seelische Vererbung‘ von Geistesstörungen war für ihn somit ausgeschlossen, immerhin eine gewisse körperliche Vererbung vielleicht möglich. Und eine neu vergebene Seele (bei der Geburt) war sicherlich rein und ohne Erbmakel und trug in sich keine Altlasten. (ggs. Karma Gedanken des Hinduismus, Buddhismus und Jainismus)
Was in der heutigen Zeit bei manchen Menschen ein Kopfschütteln auslöst, war in der damaligen gottesfürchtigen Zeit nicht aussergewöhnlich. Dieses ,Sünden- und Seelendenken‘ war weit verbreitet, nicht nur innerhalb des Klerus, sondern ganz allgemein im gläubigen Volk. Und als lutherischer Pietist kam Heinroth diesen Gedanken gewohnheitsbedingt nahe. Dies mag man ihm daher verzeihen.
Zugegebenermassen drängt sich der Verdacht auf, dass Heinroth hier in eine Ecke gestellt wird, die ihm nicht gebührt. Heinroth war nämlich auch ein anthropologisch denkender Psychiater der ersten Stunde, der sich vertieft den Gründen psychischer Krankheit näherte, und zwar auf seine moralistisch-religiöse Weise. Ihn leichtfertig auf die Seite der reinen Psychiker zu stellen, wird seinen Schriften somit nicht ganz gerecht.
Mit der Schuldfrage verbunden, war die Frage der „Freiheit“ der Seele. Man konnte annehmen, dass die Seele durch eine psychische Störung bedroht wurde. Alles verband man damals recht eng mit der Schuld- und Sündenfrage, was sicherlich dem zeitgeistigen, religiösen Denken geschuldet war. Gleichzeitig könnte man auch für Heinroth sagen, dass er die psychischen Störungen nicht nur als Folge eines Sündeverhaltens, sondern als Folge einer Schwäche sah (Charakterschwäche). Zu Heinroths Zeiten, wie auch noch heute, ordnete man eine Schwäche zwar durchaus auch der Sünde zu. Ein sündiger Mensch gilt denn auch in religiösen Kreisen noch heute als schwach.
Er fixierte sich denn auch nicht allein auf die Schuldfrage, oder darauf, Reue und Busse zu tun, sondern auch auf die unterstützende Stärkung der noch vorhandenen guten und gesunden Seelenkräfte. Dazu verwendete er auch viele über das Somatische wirkende Mittel, die indirekt auf die Psyche der Irren wirken sollten.
Um dies zu verdeutlichen, hier ein Auszug aus seinem Werk:
Heinroth, Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens, 1818, S. 25
Es war in dieser Zeit verbreitet und üblich, das Leben und die Seelenkrankheiten stark unter religiösen und sündhaften Aspekten zu sehen. Diesen Pietismus als Ausdruck eines engen evangelikalen Glaubens sollte man daher per se auch nicht voreilig verurteilen, aber in Betracht ziehen.
Sünde, so die Konsequenz des Denkens vieler Köpfe dieser Zeit und auch noch des nächsten Jahrhunderts, entstand durch Laster, Abkehr von Kirche und Gott, durch unsoliden, morallosen und liederlichen Lebenswandel, sexuelle Entgleisung, kriminelles Vergehen und unrechtem Verhalten etc. Dieses Denken mag man durchaus als Vorbedingung für die kommenden Lehren der Entartung und des Rassismus sehen, wenn man es will. Sie führten direkt in die seelische Krankheit, so die Meinung unserer Urgrossväter. Und gesellschaftlich waren sie wie ein Übergang in die Eugenik.
Um jegliche Sünde zu vermeiden und um seelengesund zu bleiben, hatte man somit ein lasterfreies Leben zu führen (durch gute Lebensführung) und eine positive Einstellung zum Leben einzunehmen und selbstverständlich - und dies war sehr wichtig - dabei möglichst Gott zugewandt zu sein. Man hatte arbeitsam zu sein, in Dankbarkeit zu leben, selbstbewusst zu sein, in einem gesunden sozialen Umfeld (Milieu) eingebettet zu sein, sich gesund zu ernähren und man hatte körperlich aktiv (sprich: arbeitsam) zu sein.
Um nur einige rechte Verhaltensweisen aufzuführen. Zur gesunden Ernährung gehörte beispielsweise jeglicher Verzicht auf Alkohol, Nikotin und Drogen etc. Man erwartete von den Menschen eine positive Grundeinstellung zum Leben, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Alles andere könne zu einer psychischen Instabilität führen.
Heinroth betrachtete geistige Störungen also aus dieser pietistisch-lutherischreligiösen Sicht. In seinem Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens (1818) schrieb er: [...] denn wenn auch der ganze Leib, der durchaus Seelenorgan ist, Veranlassungen zu Seelenstörungen geben kann: So ist es bey weitem in den meisten Fällen nicht der Leib, sondern die Seele selbst, von welcher unmittelbar und zunächst, ja ausschliesslich die Seelenstörungen hervorgebracht und durch diese erst mittelbar die leiblichen Organe affizirt werden.' (Heinroth, Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens oder der Seelenstörungen und ihrer Behandlung. Band 1, 1818, S. 39/40)
Mit ,affizieren‘ meinte Heinroth ,reizen, krankhaft verändern‘. Somit war ihm gemäss der Körper bei einer Seelenstörung zwar beteiligt, jedoch nur in dem Sinne, dass die Seele quasi initial resp. anfänglich erkranke und die Störung dann auf den Körper ,affiziere‘, resp. diesen befalle. Die Seele selbst also war es, die unmittelbar und zunächst und ausschliesslich die Seelenstörungen hervorbrachte und dann auch den Leib befiel und im Mitleidenschaft zog. Der Leib hingegen funktionierte immerhin als Seelenorgan.
Somit outete sich Heinroth eindeutig der Gilde der ,Psychiker‘ zugehörig, wie es auch ein Karl Ideler tat. Bei seinen Ausführungen berief sich Heinroth auch auf Melchior Adam Weikard, der das Werk ,Der philosophischen Arzt‘ verfasst hatte (1790) und der die Anliegen der Psychiker darin mit seinen Ausführungen bestärkte, auch was die Assoziationspsychologie anbelangte. Weikard war wiederum ein Anhänger John Browns (dieser wiederum Anhänger Cullens) und dessen Ansatzes der Heilungstheorie der asthenischen und sthenischen Krankheiten (Brownianismus).
Brownianismus: Konzept der Erregung. Die mittlere Erregung galt als gesund und bei Krankheit wurde therapeutisch mittels Reizen entweder stimuliert oder sediert. (Siehe Band 5 dieser Reihe)
Heinroth lobte den brownianischen Ansatz des Gegensatzpaares ,Aufregung vs. Unterdrückung‘. In Heinroths: ,Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens, 1818‘ steht:
,Da John Brown wohl Recht hat, dass kein Leben ohne Erregbarkeit, und keine Erregung ohne Reize statt finde: so wäre es thöricht, anzunehmen, dass alles war Reiz, und äusserer Reiz heisst, auch böse sey. (Heinroth, Lehrbuch Art. 176, S. 219)
Mit diesem Spruch versuchte er sich vor den Unterstellungen seiner Gegner zu lösen, dass seine brutalen erzieherischen Züchtigungen nur bösartiger therapeutischer Natur seien. Ein Sturz ins kalte Wasser, die Auspeitschungen mit Brennnesseln, die Zwangsjacken usw. seien therapeutisch also nicht bösartiger Natur, so die Erklärung Heinroths. Er wusste, dass man ihm das vorhielt. Daher meinte er auch gleichzeitig, dass seine Behandlungsmethoden nur in kurativer Absicht angewendet würden, auch wenn die erzieherische Natur in ihnen gut sichtbar waren.
Oft wird in der Literatur auch vermutlich fälschlicherweise angegeben, dass der Begriff ,Psychosomatik‘ durch Heinroth gebildet worden sei. Und wirklich findet man bei genauer Durchsicht seiner Werke einen Vermerk, der dies belegt: ,Gewöhnlich sind die Quellen der Schlaflosigkeit psychisch-somatisch, doch kann auch jede Lebenssphäre für sich allein den vollständigen Grund derselben enthalten.') (Heinroth, Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens, Band 2, Art. 313, S. 49).
Heinroth zog also den Körper, resp. das Körperliche in seine Überlegungen mit ein. Manche Wissenschaftler sehen ihn daher als ,Gründervater der Psychosomatik‘. Zwar vertrat er die Meinung, dass die Seelenkrankheiten alle ihre Ursachen in der Seele selbst hätten, wobei er auch die ,Seelengeschichte‘, resp. die Biographie des Patienten in das Krankheitsbild einbezog: ,[...] dass wir eben hier den Blick nicht auf Einzelheiten werfen, sondern auf dem gesamten Menschenleben in allen seinen Beziehungen fest halten müssen. Das Einzelne ist nichts ohne das Ganze, und dieses nichts ohne die bindende Idee.‘ (Heinroth, Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens, Band 1, Art. 157, S. 185)
Heinroth ging durchaus bereits heuristisch vorbei seiner Tätigkeit als Seelenarzt. Und dieses Geschäft der Technik auf ihrer ersten Stufe, oder das erste Glied der Technik, weil es sich mit Auffindung der Heil- oder vielmehr der Behandlungsmethoden beschäftiget, wird billig Heuristik genannt.' (Heinroth, Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens, Band 1, Art. 381, S. 60 und 61) ,[...] und erscheint als Heilmittel-Lehre.'
Daraus entwickelt sich, so Heinroth, auch die Gesetzgebung, die psychisch Kranken gilt (Nomothetik). Im Gegensatz zur idiographischen Vorgehensweise, versuchte er mit seiner nomothetischen Methode einen anderen Zugang zur Wirklichkeit (der Psychiatrie). (Nomothetik, gesetzgebendes Recht)
Das Buch, welches er dazu verfasste, hiess ,System der psychisch-gerichtlichen Medizin oder theoretisch-praktische Anweisung zur wissenschaftlichen Erkenntnis und gutachtlichen Darstellung der krankhaften persönlichen Zustände, welche vor Gericht in Betracht kommen‘. Es handelte sich somit um ein frühes forensisches Werk. (Heinroth, System der psychischen gerichtlichen Medizin, Leipzig 1825)
Gewidmet ist dieses Buch ,Dem Allerdurchlauchtigsten, Grossmächtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Friedrich August, Könige von Sachsen.‘
Im Vorwort machte Heinroth darauf aufmerksam, dass er Grundzüge seiner im Buch behandelten Ideen bereits in seinem Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens 1818 vorgezeichnet habe und er seine Gedanken hier vervollständigen wolle. Die Literatur über die psychisch-gerichtliche Medizin oder wie es auch oft hiess: über rechtliche Erkenntnisse und Gutachten in peinlichen Fällen, oder Beiträge zur gerichtlichen Arzneiwissenschaft, war um die Zeit um 1820 nur spärlich vorhanden.
Gemäss Inhaltsverzeichnis ging es um die Frage, ob jemand persönlich zurechnungsfähig sei und unterschied in persönliche Freiheit und persönliche Unfreiheit bei den Irren. Darin wurden Zeichen beschrieben, die den unfreien, resp. den freien Zuständen zugeschrieben werden. (Psychisch-gerichtliche Zeichenlehre, als Semiotice psychico-forensis). ,Da der Mensch seine Freiheit, als Thatsache nur durch Verstand und Willen behauptet: so sind alle Äusserungen des in seiner Thätigkeit gehemmten Verstandes und Willens, so fern sie nicht erheuchelt und ein Werk der Verstellung sind, Kennzeichen der unfreien Zustände überhaupt, oder allgemeine Zeichen unfreier Zustände.‘ (Heinroth, System der psychischen gerichtlichen Medizin, Art 66)
Es ging also um die Frage der Zurechnungsfähigkeit der Irren, die beispielsweise eine Straftat begangen hatten. Darin beschrieb Heinroth auch ,Zeichen‘ der erheuchelten unfreien Zustände (ab. S. 336) Darin heisst es in Art. 85 ,Nicht selten werden krankhafte Zustände der Person erheuchelt oder simulirt, um der Todesstrafe oder anderen Körperstrafen, oder auch langer Gefangenschaft zu entgehen, auch wohl blos, um gewisser bürgerlicher Verbindlichkeiten überhoben zu seyn. Es werden dann meist solche Zustände erheuchelt, deren Symptome sehr auffallend, und, dem Scheine nach, leicht nachzuahmen sind: nahmentlich Wahnsinn, Verrücktheit, Melancholie und Blödsinn.
Der Verdacht des Betruges entsteht aber, wenn der angeblich Unfreie schon von Seiten seines verschmitzten oder boshaften Charakters bekannt ist, wenn er sich schon früher irgend ein erwiesenes Verbrechen hat zu Schulden kommen lassen, wenn der Vortheil der gelungenen Verstellung klar am Tage liegt, und wenn die frühere gesunde physische und psychische Beschaffenheit des Individuums erwiesen ist. Auf bestimmte Weise aber verräth sich der Charakter der Simulation theils durch allgemeine, theils durch besondere Zeichen.‘ (Heinroth, System der psychischen gerichtlichen Medizin, Art 85)
In den von Heinroth beschriebenen allgemeinen Zeichen der (Simulation) steht in Art. 86: ‘Die allgemeinen Zeichen sind: wenn sich das, der Simulation verdächtige Individuum gegen Hunger und Durst, Kälte oder Hitze empfindlich zeigt; wenn es bei Ankündigung oder Anwendung schmerzhafter Mittel in Verlegenheit und Angst geräth; endlich, wenn es in der Einsamkeit belauscht, sich ganz vernünftig zeigt, und überhaupt die Rolle der angenommen Krankheit nicht durchzuführen weiss. (Heinroth, System der psychischen gerichtlichen Medizin, Art 86)
Die simulierte Unfreiheit wird dann von Heinroth vermutet, wenn durch häufige Beobachtungen bestätigt, der Wahnsinnige, der Melancholische, der Verrückte, der Blödsinnige, der Tolle wie auch der Willenlose, einen bedeutenden Grad von Stumpfheit und Unempfindlichkeit gegen alle diese (drohenden, gewaltankündigenden) äusseren Anregungen besitzt, sodass zwar die Wirklichkeit unfreier Zustände nicht immer durch diese Stumpfheit, allein die Erheuchelung solcher Zustände allezeit durch eine lebhafte Erregbarkeit hinsichtlich der Reize, beurkundet (festgestellt) wird.
So sei dies zuweilen der Fall bei Ankündigung (Drohung) von blasenziehenden Mitteln, oder gar bei der Drohung mit dem glühenden Eisen. So sei es auch der Fall mit Brechmitteln, von welchen Personen einen besonderen Abscheu hätten. Aus heutiger Sicht erscheinen uns diese Drohungen wie Foltermethoden.
Ein eine psychische Krankheit simulierender Verbrecher könne sein Heucheln nur dann gut spielen und vortragen, wenn er vorgängig den Charakter einer bestimmten Krankheit, die er erheuchelt, sehr gut studiert, resp. schauspielerisch eingeübt habe (Rollenspiel). In der Regel machen das Menschen aber nicht, sodass ihr geheuchelter Wahnsinn, sprich ihr Schauspiel, im Auge der Betrachter meistens als geheuchelt und nachgeahmt und unecht durchfällt. Nicht einmal Ärzte, die sich lange Zeit der Irren annehmen, so Heinroth, könnten diese Krankheitssymptome (Verrücktheit) schauspielerisch überzeugend simulieren und vortragen.
Umgekehrt ist auch gefahren. Ein wirklich Irrer, Verrückter, Melancholiker kann ein vernunftgemässes, gesundes Denken und Handeln auch nicht, wenigstens nicht über einen längeren Zeitraum, vorspielen resp. simulieren. Irgendwann bricht seine Verstellung durch und man erkennt klar seine Verrücktheit resp. seine Depression. Einzig an Schizophrenie erkrankte Menschen können ,Gesundheit‘ vorgaukeln und haben die Fähigkeit, sich über einen längeren Zeitraum gut zu verstellen. Aber auch sie stehen in Gefahr, sich irgendwann in ihrem kranken Sinne zu äussern, resp. zu verhalten. Etwa durch ihre Paranoia.
‘Da die unfreien Zustände aller Art, durch Blicke, Gebehrden und Bewegungen, durch Worte oder Handlungen, in jedem Falle auf bestimmte Weise zu erkennen sind, so dass ein jeder unfreier Zustand gleichsam seine eigenthümliche Physiognomie hat: so ist jeder erheuchelte unfreie Zustand daran zu erkennen, dass die vorgespiegelten Zeichen mehr oder weniger mit den wirklichen Zeichen bestimmter psychisch-krankhafter Zustände nicht übereinstimmen, sondern ihnen widersprechen. Jeder solcher Widerspruch verräth die Simulation; und es würde die genaueste Kenntniss der persönlichen Krankheiten dazu gehören, ihren wahren Charakter ohne Widerspruch durchzuführen'. (Heinroth, System der psychischen gerichtlichen Medizin, Art 73)
Die psychisch-gerichtliche Medizin, heute Forensik genannt, wurde offenbar zu dieser Zeit um 1800 immer wichtiger. So befasste sich Heinroth im vierten Abschnitt seines Lehrwerkes mit der ,psychisch-gerichtlichen Ausfertigungslehre, der Ars instrumentaria psychico-forensis'. Er beschreib die Bestandteile und die Erfordernisse des psychisch-gerichtsärztlichen Gutachtens, den möglichen Fehlerhaftigkeiten eines solchen Gutachtens und wie man mit Akten, mit Zeugen und mit ärztlichen Autoritäten und mit der Ausfertigung von Gutachten umzugehen hatte.
In der Psychiatrie war man damals gespalten zwischen zwei Wissenschaftstypen. Die eine war die Geschichts- und Geisteswissenschaft, die andere die Naturwissenschaft. Die eine verstand die Dinge, die andere erklärte die Dinge (oder versuchte sie zu verstehen und zu erklären). Heinroth sprach in diesem Zusammenhang von ,psychisch-ärztlicher Nomothetik‘.
Die damalige Problematik, eine erste Wissenschaft der Psychiatrie zu entwickeln, soll in unserem Zusammenhang aber nicht weiter verfolgt werden, dies würde die Absicht dieses Bandes sprengen. Heinroth jedenfalls verfügte bei seinem Amtsantritt als Professor für psychische Therapie noch über kein eigentliches Psychiatriesystem, sondern musste dafür erst Grundlagen erschaffen, schrieb er doch auf S. 63 desselben zitierten Buches: ,Es gibt überhaupt bis jetzt kein eigentliches System der Psychiatrie, am wenigsten aber in diesem, von uns aufgefassten Sinne. Wir haben, in dem Standpunkte und den Richtungen, welche wir dieser Wissenschaft und Kunst gegeben haben, zugleich ein Massstab für alle bisherigen Bemühungen, die Seelenstörungen zu erkennen und zu behandeln; und es ist für unsere hier gegebene Ansicht förderlich, ja nothwendig, zu zeigen, wie beschränkt und einseitig, wie oberflächlich und zerrissen, ja wie schief nicht selten die Begriffe von der Erkenntnis und Behandlung des gestörten Seelenlebens bei den Theoretikern und Praktikern alter und neuer Zeit dastehen, und wie es überall nur die Materialien, namentlich die Beobachtungen sind, die wir für unsern Zweck benutzen konnten.'
Heinroth stand sozusagen ganz am Anfang der ,Psychiatrie‘ und versuchte seinen Beitrag dazu zu leisten. Daher wird man ihm nicht gerecht, wenn man ihn heute einseitig als jenen Arzt betrachtet, der Seelenkrankheit nur als Sünde resp. als Ausdruck eines sündhaften Verhaltens sah und verstand.
Auch Henry F. Ellenberger sah es ähnlich, wenn er schreibt: ,Johann Christian August Heinroth wird heute oft lächerlich gemacht als der Mann, der verkündete, der Hauptgrund für Geisteskrankheiten sei die Sünde. [...] Heinroth war ein sehr gelehrter Mann, ein hervorragender Kliniker und Urheber einer vollständigen Theorie der menschlichen Psyche in gesunden und kranken Tagen.
Zu seinen vielen Werken zählt auch ein Lehrbuch, das mit einer Beschreibung der menschlichen Seele im Normalzustand beginnt. Er schildert hier die Entstehung der verschiedenen Grade des Bewusstseins, zuerst die des „Selbstbewusstseins“ durch die Konfrontation mit der äusseren Realität, dann die des eigentlichen „Bewusstseins“ durch eine Konfrontation mit dem „Selbstbewusstsein“ und schliesslich die des Gewissens, dieses „Fremdlings in unserem Ich“.
Das Gewissen hat seinen Ursprung weder in der Aussenwelt noch im Ich, sondern in einem „Über-Uns“, das Heinroth anscheinend mit der Vernunft und einem Weg zu Gott gleichsetzt. Nach Heinroth ist Gesundheit gleich Freiheit, und Geisteskrankheit ist eine Einschränkung oder ein Verlust an Freiheit. Dieser Verlust der Freiheit ist eine Folge der „Ich-Sucht“ und verschiedener Leidenschaften.' (Henry F. Ellenberger. Die Entdeckung des Unbewussten, Diogenes, 2005, S. 300 und 301)
Mit den Begriffen von ,Ich‘ oder ,Über-Uns‘, von ,Fremdling in unserem Ich‘ oder ,Selbstbewusstsein‘ und auch ,Ich-Sucht‘ könnte man Heinroth als Vater vieler Ideen (und psychoanalytischen Vorstellungen) Siegmund Freuds ansehen, nahm er diesem doch etliche seiner (Freuds) später postulierten Begriffe vorweg.
Die grosse Diskrepanz zwischen Somatikern und Psychikern nahm ihren Lauf in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die moralischen Positionen der Psychiker, die sowohl Gott wie die Sünde des Menschen ins Spiel ihrer Argumente brachten, wurden von den Somatikern vehement angegriffen und belächelt. Es entbrannte ein Streit zwischen diesen beiden Auffassungen, was denn eine psychische Krankheit sei resp., wie sie entstünde. Besonders Friedrich Nasse und auch Carl Wigand Maximillian Jacobi lieferten dem Psychiker Heinroth eine handfeste Polemik. Beide wurden alsbald zu Leitfiguren der Somatiker.
Jene Psychiater, die sich zu den Somatikern zählten, lehnten jedes moralische Herangehen und jeden sündhaften Blick auf die Irren ab, verneinten eine Beteiligung von Sünde und moralischer Schuld am Irresein kategorisch. Sie verwiesen konsequent auf den Körper (das Somatische) des Wahnsinnigen, der erkrankt sein musste und der diese krankhaften, geistigen Symptome hervorbrachte. Sie betrachteten den Irren als rein körperlich erkrankt, somit musste auch sein Körper, resp. seine Biologie in den Mittelpunkt jeder Seelen-Forschung gestellt werden. Psycho- und soziogenetische Krankheitsbedingungen lehnten sie ab.
Die heutige medizinisch-pharmakologische Forschung geht übrigens genau diese Richtung. Man versucht geistige Gesundheit durch (chemische) Pharmakologie wieder herzustellen. Psychische Therapien (Psychoanalyse, Gesprächstherapie, Musiktherapie etc.) sollen diese pharmakologischen Bemühungen jedoch assistierend unterstützen. Diese nehmen direkt jedoch keinen Bezug zur Chemie (z. B. keinen Bezug zur Hormonen oder Botenstoffen).
Dieser Blickwinkel war zu einseitig, denn der sog. ,ganzheitliche Blick‘ seitens der Psychiker auf die Irren, wie ihn ein Heinroth hatte, also der Einbezug einer möglichen sozio- und psychogenetischen Ursache von Geisteskrankheiten war somit nicht oder nur marginal gestreift Gegenstand des psychiatrischen Denkens der Somatiker.
Die Somatiker diskreditierten somit den moralisch-sündhaften und ganzheitlichen Blick der Psychiker auf die Wahnsinnigen und deren Krankheitsursachen, vergassen gleichzeitig aber, selbst einen solchen (unmoralischen) Blick auf eine mögliche geistige, moralische oder soziogenetische Ursache von psychiatrischen Krankheiten zu werfen. Die Folge war, dass sie diesen möglichen und interessanten Forschungszweig sträflich vernachlässigten. Dies rächte sich später.
Der Lieblingsgegner der Somatiker hiess: Johann Christian Heinrich Heinroth! Aber Heinroth war nicht ein Niemand, sondern damals der wohl bedeutendste lebende Repräsentant des Psychiatriegeschehens in den zehner- und zwanziger Jahren des frühen 19. Jahrhunderts.
Sein ,psychosomatischer‘ Blick war zu seiner Zeit der wohl Ganzheitlichste, denn er versuchte den Verrückten sowohl in einem psychischen, somatischen wie biographischen Zusammenhang zu analysieren und zu verstehen. Er forderte dazu auf, sehr aufmerksam zu sein, was den Lebenslauf der Seelengestörten anbelangte.
Melancholie, Wahnsinn und auch Manie waren für Heinroth auch das Resultat seines Gesamtlebens (Biographie) und dieses konnte für den religiösen Heinroth auch diabolischer Art und die kranke Seele somit ,ausgeartet‘ sein. Heinroth sprach denn auch vom ,ausgearteten Seelenleben', welches wieder zur Norm zurückgeführt werden müsse. (Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens, Band 1, Art. 56, S. 43)
Diese Betrachtungsweise kannte man von Urzeiten, schon Hippokrates vertrat die Vorstellung von einer Einheit, bzw. Ganzheitlichkeit von Körper, Seele und Geist. Somit war bereits Hippokrates in einem gewissen Sinne ein Psychosomatiker.
Dennoch war Heinroth sehr anfällig, trotz dieses ganzheitlichen Denkens, seine ganzheitlich-medizinischen Vorstellungen in den Dienst gewisser moralischer (frömmlerisch-pietistischer) Vorstellungen zu stellen, gerade was sein religiös gefärbter Blick der ,Sünde‘, resp. des ,sündhaften Verhaltens und dessen Folgen‘ betraf.
Man kann Heinroth daher durchaus auch missionarischen Eifer unterstellen, weil er im Dienste seiner moralischen Religiosität die Ursache vieler Irrenkrankheiten auf deren sündhaften (biografischen) Lebensvollzug zurückführte. Aber Heinroth war gefangen in seiner (pietistisch-engen) Gläubigkeit und konnte dieser auch als Mediziner und Forscher nicht entkommen. Dies könnte auch ein fragliches Licht werfen auf sog. ,religiöse‘ Psychiater oder auf Geistliche, die sich Irren annehmen. Vermutlich ist das Aussenvorlassen von Religion in der psychiatrischen Praxis ein erfolgversprechenderer Weg. Allerdings ist der Mensch auch ein religiöses Wesen mit Hang zu Übersinnlichem (Metapsyche). Vielleicht sollte die Arbeit dahin gehen, gewisse ,Abhängigkeiten‘ abzubauen und sich von moralisch-religiösen Anschauungen zu distanzieren.
Dies lässt sich belegen. In seinem Werk (Heinroth, Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens, Band 1, S. 379) formulierte er folgenden ominösen Satz: ,Man sage, was man wolle, aber ohne gänzlichen Abfall von Gott gibt es keine Seelenstörung. Wo Gott ist, ist Kraft, Licht, Liebe und Leben; wo Satan ist, Ohnmacht, Dunkel, Hass, und überall Zerstörung.‘
Nach ihm gab es also ohne gänzlichen Abfall von Gott keine Seelenstörung. Dies wäre eine solche ,Abhängigkeit‘, von der sich Heinroth hätte lösen sollen. Nach ihm waren alle Irren somit von Gott abgefallen, und zwar gänzlich. Dies so zu formulieren und auch zu glauben, war wohl seiner Herkunft und seiner pietistischen Gesinnung und Gläubigkeit geschuldet. Heute wirkt diese Meinung religiös befremdend.
Psychiatrische Wissenschaft und enge Gottesgläubigkeit enthalten immerhin also den Keim einer (moralischen) Friktion, wenn Schuldzuweisungen und die Begrifflichkeit von Sünde mit ins Spiel kommen. Immerhin gab und gibt es auch gläubige Psychiater, deren persönlicher Glaube den Wissenschaften der Psychiatrie und Psychologie nicht in den Weg kommen, wenigstens nicht in einem augenfälligen Sinne.
Weiter schrieb Heinroth, ebenfalls auf S. 379: ,Ein böser Geist also wohnt in den Seelengestörten; sie sind die wahrhaft Besessenen. Es ist schon gesagt, dass diese Ansicht absurd erscheinen wird; sie ist aber nicht absurder als die, welche die aufrichtig in Sinn und Wandel nach der Wahrheit Strebenden, Kinder Gottes nennt. Kurz, wir setzen das Wesen der Seelenstörungen in die Gemeinschaft der menschlichen Seele mit dem bösen Princip, ob individuell geistig oder nicht, bleibe hier an seinen Ort gestellt. [...] Und dies ist die vollständige Erklärung der Unfreyheit der Unvernunft, in welcher alle Seelengestörte befangen sind.'
Heinroth versuchte somit den Leser zu warnen vor seelischen Krankheiten als Folge einer schlechten Lebensmoral mit Versündigung. Täte dies heute ein Psychiater oder Priester, gälte dies als Kunstfehler. Im Gegenzug verhiess Heinroth eine seelische Gesundheit, wenn diese moralischen (religiösen) Regeln eingehalten würden.
Heinroth zog einige psychiatrische Praxiserfahrung aus dem ,Armen-, Zucht-, Waisen- und Versorgungshaus St. Georgen‘ in Leipzig, wo er als Arzt fungierte und war somit keineswegs nur ein Theoretiker der Psychiatrie. Allerdings nahm diese Institution, die sehr früh, nämlich im Jahre 1212 gegründet worden war und eigentlich Hospital St. Georg hiess, damals den Charakter einer ausgrenzenden Institution an. Ihre ursprüngliche Funktion, ihr einstiger Zweck wurde insofern umgestaltet, als dass sie zu Heinroths Zeiten gerne auch Wahnsinnige zur Verwahrung und Versorgung aufnahm und sie gleichzeitig von der Gesellschaft ausgrenzte. Man kann nur hoffen, dass dahinter keine religiösen Meinungen wirkten.
In dieser Zeit gab es übrigens die weitum verbreitete Meinung, die Irren dieser aufkommenden Psychiatrie in ,heilbare‘ und in ,unheilbare‘ einzustufen. Mit fatalen Folgen für die Unheilbaren. Diese Unheilbaren wurden in entsprechenden Häusern oder Abteilungen im eigentlichen Sinne nur noch verwahrt, aus der Gesellschaft ausgegrenzt, nur grundversorgt und ohne die Unterstützung durch psychiatrische Irrenärzte völlig sich selbst überlassen. Damit waren diese ,Unheilbaren‘ von jeglichen therapeutischen Heilungsversuchen ausgeschlossen und vegetierten vor sich hin.
Die als ,heilbar‘ Eingestuften erfuhren Pflege und Heilungsversuche durch Irrenärzte und wurden in weniger geschlossenen Einrichtungen und mit mehr persönlichen Freiheiten und Annehmlichkeiten therapiert. Sie wurden meistens auch zu gewissen (Feld- und Haus-) Arbeiten herangezogen und galten dafür als ,arbeitsfähig‘.
Aber das Georgenhaus, wie man es im Volksmund nannte, war auch ein Arbeitshaus (Arbeitserziehungsanstalt). Den darin ,untergebrachten‘ psychisch Kranken sowie den ,unwilligen und ungeratenen Menschen‘ diente es zur Verrichtung verschiedener (Zwangs-)Arbeiten, wie etwa der Farbengewinnung und der Herstellung von Farbhölzern.
Diese Durcheinandermischung des Zweckes den Georgenhauses mochte Heinroth dazu verleitet haben, sich Gedanken über einen neumodischen Anstaltsbau für Irre zu machen. Denn in Band 2 seines Lehrbuches von den Störungen des Seelenlebens (1818) beschrieb er in der 4. Abteilung ab Seite 310 von der ,Psychisch policeylichen Nomothetik', wie die Organisation der Irrenhäuser zu sein hätte wie auch von der Einrichtung eines solchen modernen Irrenhauses. Ganz speziell referierte er im Kapitel ,Von der Irrenanstalt als Heilanstalt' (S. 317):
,Insbesondere aber gilt von der Heilanstalt, dass nur solche Kranke in sie aufgenommen oder wenigstens nur solche behalten werden, deren Heilung noch zu hoffen steht, und dass zu dieser Heilung, in somatischer und psychischer Hinsicht alle nöthigen Anstalten getroffen werden, wozu besonders die Einrichtungen sowohl zur Beschäftigung als zur Erholung, Zerstreuung und zum Vergnügen der Kranken gehören; in welchen Beziehungen eine weit grössere Mannichfaltigkeit Statt finden muss, als in einer blossen Versorgungsanstalt.‘
Zweierlei Bemerkungen seien hier angefügt. Erstens erstaunt, dass Heinroth - eigentlich als Psychiker eingestuft - hier von einer Heilung ausgeht, die sowohl in somatischer als auch psychischer Hinsicht alles Nötige zu unternehmen hätte. Somit beinhalteten seine Interventionen auch somatische Eingriffe und nicht nur psychische. Und zweitens sprach Heinroth die Unterscheidung zwischen noch heilbaren Irren an, im Gegensatz zu unheilbaren Kranken, die nicht in eine solche Irrenanstalt gehörten. Diese Auffassung entsprach durchaus seiner Zeit, in der man diese beiden Heilbarkeiten voneinander unterschied.
Heinroth sah in einer modernen Heilanstalt auch eine Art von Erziehungsinstitution. In ihr verkehrten seiner Meinung nach auch Lehrer und Handwerksmeister, die zuständig waren für Musik, Zeichenkunst, Naturgeschichte, Physik und Gymnastik. Nicht fehlen durften ohnehin die Berufe z. B. des Schneiders, Schuhmachers und der Zimmerleute.
Zu dieser Idee der Erziehung gesellte sich bei Heinroth auch der Gedanke, möglichst frühzeitig prophylaktisch (auf die zukünftigen Irren) einzuwirken. Er wollte dadurch verhindern, dass es erst gar nicht zu einer Erkrankung kommen konnte. Daher vertrat er die Meinung, dass durch eine richtige Erziehung von Kindern (zu einer guten Lebensführung) solche Krankheiten abgewendet werden könnten und sprach daher nicht nur die Eltern an oder Erzieher, sondern auch ,psychische Ärzte‘.
Daher verfasste Heinroth auch ein Werk oder eher eine Warnschrift zu diesem Thema mit dem Titel: (Von den Grundfehlern der Erziehung und ihren Folgen, 1828). Auch Heinroth reihte sich in die Reihe der Eltern und Erzieher ein, ganz speziell als psychischer Arzt, denn er war der Meinung, dass sein:
,Geschäft dem des Erziehers nahe verwandt ist. Allein eine täglich wachsende Erfahrung hat ihn belehrt, dass die Störungen des Seelenlebens um so weniger zu heben sind, je tiefer sich ihr Ursprung zurück in die erste Jugend verliert, je mehr folglich der Mangel an Erziehung oder falsche Erziehung Antheil an ihnen haben.' (Vorwort) ,Die Seele der Erziehung ist die Religion, und die Seele der Religion das Christenthum.'
Darin unterschied Heinroth in die erste und zweite Erziehung. Die erste war jene der Eltern, die zweite die religiöse Erziehung, die ihm für die Prophylaxe von Geisteskrankheit noch weit wichtiger war als die erste, auch wenn diese als Urgrund ebenfalls wichtig war. In diesem Werk behandelte er die Pädagogik sehr umfassend. Im vierten Kapitel ,Von der irreligiösen Erziehung und ihren Folgen (S. 333-374) schrieb er quasi als Schlusswort:
,[...] und wie noch weit mehr die, welche sich selbst durch thörichtes Leben verwahrloset haben, weil ihnen der Leitstern fehlte, der sie auf richtiger Bahn gehalten hätte: die echte Religion? Wenn die Folgen ihres irreligiösen Thuns und Treibens, wenn Noth, Elend und Schande, wenn Kummer und Verzweiflung über sie hereinbricht, wenn ihr ganzer Lebenshimmel von Wolken umnachtet ist, durch die kein heiterer Sonnenstrahl der Hoffnung, dieser grossen Trösterin der Menschheit, mehr dringt? Wenn kein Retter mehr da ist?
Dann zeigen sich die Folgen der irreligiösen Erziehung in ihrer grässlichsten Gestalt. Die Noth und die Verzweiflung erzieht Verbrecher und Mörder, wenn dies nicht schon die Macht der Leidenschaften und Laster gethan hat; und nicht von Gott gehalten und getragen, - an den sie sich ja nicht halten können - stürzen die Unglücklichen aus dem Lichtreiche der Vernunft in die Finsterniss der Vernunftberaubtheit, und werden eine Beute des Wahnsinns oder der Melancholie, der Verrücktheit oder der Tollheit, und zuletzt des Blödsinnes, wenn sie nicht vorher, vom blinden Zerstörungstrieb überwältiget, diese Jammerscene des Lebens durch Selbstmord geendiget haben.‘)
Nun wird deutlich, weshalb Heinroth polemisch heftig von einem Nasse und Jacobi angegriffen wurde. Auch aus diesen Textzeilen wird deutlich, wie sehr Heinroth die Entstehung von psychischen Krankheiten wie Wahnsinn, Melancholie, Verrücktheit, Tollheit und Blödsinn mit dem Abfall vom richtigen christlichreligiösen Glauben und der Abwendung von Gott verband und sich dadurch als eingefleischter, religiös abhängiger ,Psychiker‘ outete. Solche Aussagen Heinroths mussten unweigerlich polemisch geführte Reaktionen seitens der Somatiker provozieren.
Kehren wir jedoch nochmals kurz zurück auf das Kapitel ,Von der Irrenanstalt als Heilanstalt'. Keineswegs fehlen durfte in einer solchen Irrenanstalt die Gelegenheit zum Spiel. So schlug er eine Kegelbahn oder einen Billardtisch zur Zerstreuung der Irren vor. Zudem musste auch im kalten Winter genug getan werden für die Zerstreuung und Erholung der Wahnsinnigen (S 318, 319). ,Der wesentlichste Lehrer und Meister aber ist der Arzt, der alle jene Beschäftigungen und Spiele nach Umständen und Bedürfniss anordnen und leiten muss und in dessen Anordnungen sich ein Jeder zu fügen hat.‘
Melancholie (oder Depression)
Heinroth gebührt auch Achtung, weil er eine vielleicht zufällige Neufassung des Depressionsbegriffes versuchte. Er füllte ihn mit einem psychopathologischen Inhalt. Die Melancholie definierte er als eine ,Depression‘ des Gemüts. Die Depression war nach ihm ein Übermass an Passivität (aus brownianischer Sicht). In seinen nosologischen Ausführungen unterteilte er die Seelenkrankheiten in verschiedene Gattungscharakter:
Erste Ordnung, erste Gattung:
1. Wahnsinn
Erste Ordnung, zweyte Gattung:
2. Verrücktheit
Erste Ordnung , dritte Gattung:
3. Tollheit
Zweyte Ordnung, erste Gattung:
4. Melancholie.
Zweyte Ordnung, zweyte Gattung:
5. Blödsinn
Zweyte Ordnung, dritte Gattung:
6. Willenlosigkeit
Zu Punkt 4:
Melancholie
.
Charakter: Unfreyheit des Gemüths mit Depression der Empfindungen und der Phantasie; schwermüthige Insichselbstversunkenheit.
Heinroth bezeichnet die Depression auch als Melancholia simplex, deren:
,1.Spezifischer Charakter.Gemüthslämung, d. h. Unfreyheit des Gemüths mit Niedergeschlagenheit, Insichversunkenheit, und Brüten über irgend einen Gegenstand des Verlustes, der Trauer, des Schmerzes, der Verzweiflung. Unruhige, ängstliche, hastige Beweglichkeit, oder bewegungsloses Hinstarren mit Unempfindlichkeit gegen jedes andere Interesse als das des befangenen Gemüths, unter Seufzen, Weinen und Wehklagen.
2. Vorläufer. Bey dem Temperament, wovon der kranke Zustand den Namen hat, auch wohl bey sanguinischem und pflegmatischem Temperament, wovon dem ersten die Freund, den andern der Reiz des Lebens genommen ist, im Ganzen: bei einer Gemüthsbestimmung, wo keine Kraft des Widerstandes vorhanden, Niederdrückung des Gemüths durch irgend einen schweren Verlust oder durch die Furcht des Verlustes, und den dadurch entstandenen Kummer, stellt sich allmählig ein stilles, verschlossenes, zurückgezogenes Wesen ein, der Krankheitscandidat verliert Appetit und Schlaf, magert ab, wird furchtsam und scheu, oder argwöhnlich, zieht sich von der Gesellschaft seiner Freunde und Bekannten zurück, verliert die Lust zu den gewohnten Geschäften, versinkt immer tiefer in sein düsteres Brüten; und so ereilt ihn die Krankheit.
3. Verlauf. Nach Verschiedenheit der Individuen ist das erste Stadium verschieden. Einige beginnen mit einer Art von Stumpfsinn oder Erstarrung. Bey Einigen sollte man, nach dem Beginnen des Anfalls, glauben, die Krankheit gehe auf Manie aus; bei Andern auf Wahnsinn; bey Andern auf Narrheit: so sehr sind Einige, nachdem der Moment gänzlicher Unfreyheit eingetreten, ungestüm, zänkisch, zum Schlagen geneigt; Andere in Träumen, die ihnen vor den Augen zu schweben scheinen, verloren; wieder Andere ausgelassen lustig, unter lächerlichen Gebehrden u. s. w. Aber bald zeigt die Melancholie ihren wahren Charakter; die Wildheit, das Träumen, das Lachen, verliert sich und macht der Niedergeschlagenheit, der Insichgekehrtheit, dem Trübsinn und Weinen Platz. Die Kranken sitzen starr, stumm, murmeln vor sich hin, seufzen aus tiefster Brust, vergiessen Thränen, ringen die Hände, und nehmen von nichts, was um sie herum vorgeht, Notiz; sie hören auf keine Stimme, selbst die ihrer besten Freunde nicht: so sehr sind sie in dem Brüten über den Gegenstand ihre Leides verloren.
Dieser Zustand dauert unbestimmte Zeit; Wochenlang, auch wohl über den Monat hinaus. Endlich scheint der Krampf gleichsam, welcher das Gemüth überfallen, nachzulassen, die Kranken scheinen sich wieder zu erholen; und das zweyte Stadium beginnt. Die Kranken zeigen wieder einige Empfänglichkeit für das, was ausser ihnen vorgeht, gefragt antworten sie wieder, wiewohl kurz und einsylbig, sie nehmen leichter, als vorher, Nahrung zu sich, sie gehen scheinbar ruhiger umher, nur die Nächte sind noch nicht ruhig, die Kranken werfen sich grösstentheils schlaflos auf ihrem Lager hin und her.
Jetzt wird es deutlicher, was an ihnen nagt; sie klagen laut über den Gegenstand ihres Verlustes, ihres Kummers; aber dieser Gegenstand wird bald der einzige Punkt, um den sich ihre Gedanken, ihre Worte bewegen. – Und hier ist es Zeit, die gewöhnliche falsche Vorstellung, dieman sich von fixer Idee mach, zu berichtigen. Nehmlich es ist allerdings eine sogenannte fixe Idee, welche solchen Kranken auf der Seele lastet. So beobachtet der Verf. Täglich eine Frau, welche sich unaufhörlich mit dem Unglück ihres Mannes und ihrer Kinder beschäftiget, darüber klagt, seufzt und weint, und sich deshalb selbst als die unglücklichste Person fühlt, welcher nicht zu helfen sey: - und Mann und Kinder befinden sich sehr wohl, besonders seitdem sie von dem Quälgeist befryt sind, der ihnen keine ruhige Stunde liess. – Nun ist es allerdingst etwas Widersinniges, sich mit dem eingebildeten Unglück eines Andern herumzutragen; es fragt sich aber, liegt der Fehler, wie man gewöhnlich meint, wenn von fixen Ideen die Rede ist, im Verstande?
Wir sagen: nein! [...] Der Verstand hat hier nichts gefehlt, hat nicht ausgeschweift, hat sich nicht in Meditationen und Speculationen verloren. Es ist das Gemüth, welches ursprünglich von irgend einer deprimirenden Leidenschaft ergriffen ist, und, dieser zu Folge, weil sie die herrschende Empfindung ist, den Verstand zur Festhaltung bestimmter Vorstellungen und Begriffen nöthigt.
Nicht diese letztern demnach sind es, welche Wesen und Form der Krankheit bestimmen; die Krankheit ist wegen der fixen Idee keine Verstandeskrankheit; der Verstand ist nur im Dienst des kranken Gemüths; und so ist jene Definition der Melancholie ganz falsch, welche will, dass das Wesen derselben in der fixen Idee beruhe.
Diese letztere kann da seyn, kann aber auch fehlen, wenigstens nicht geäussert werden, und die Melancholie bleibt doch, was sie ist: Gemüthsdepression, Insichversunkenheit des Gemüths, Losgerissenheit desselben von der ganzen Welt, ohne an etwas Besserem, als die Welt ist, zu hängen: denn dies wäre der vollkommenste Zustand, dahingegen der melancholische der elendeste ist.‘ (Heinroth, Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens, Band 1, S. 333)
Dies sind wichtige, frühe psychopathologische Aussagen, die Heinroth hier beschrieb. Eine noch genauere psychopathologische Beschreibung der Melancholie (Depression), die zu jener Zeit in der psychiatrischen Literatur verfasst wurde, muss noch gefunden werden.
Heinroth beschrieb bei der Melancholie noch deren semiotischen, diagnostischen und prognostischen Momente. Im Teil der Diagnostik betitelte er die Melancholie ganz klar als: Depression. Er war einer der ersten, der dieser Begriff verwendete.
(Heinroth, Lehrbuch der Seelenstörungen des Seelenlebens, Band 1, S. 335)
Allerdings mag die Erwähnung der Begriffes ,Depression‘ auf einen Übersetzungsfehler zurückzuführen sein. Er oder ein Übersetzer, der Cullens Werk ins Deutsche transferierte, übersetzte den cullenschen Begriff des ,Collapse‘ (Zusammenbruch) mit ,Depression‘ (Niederdrücken). Es wurde versucht, dem Begriff ,Aufregung‘ (Excitement) ein Gegenteil zuzuordnen und nannte dieses ,Depression‘. Heinroth machte keine Anstalten, seinen quasi von ihm neu kreierten Begriff als neuen Krankheitsnamen (nosologisch) zu etablieren oder bekannt zu machen. Zudem verwendete er den Begriff ,Depression‘ auch nicht anstelle der - oder Ersatz von - Melancholie, jedoch in seinem Buche mindestens 25-mal.
Heinroth beschrieb die Melancholie (Depression) als Tiefsinn (Melancholie) sowie auch als Blödsinn (im Sinne der Geistesdepression) und auch als Willensdepression. Das war eine nosologische Einteilung, die sich nicht durchsetzen konnte. Insofern, dass sich die Melancholie mit dem Blödsinn verband und vermischte.
Damals war das Thema Blödsinn noch buchfüllend, so auch zu finden im zweiten Teil seines Werkes: (,Störungen des Seelenlebens, Teil 2, dritter Abschnitt, Kurlehre, ab Artikel 388.)
Titel: Behandlung der Formen der Gattung: Blödsinn.
Im nächsten Artikel, dem Artikel ,Blödsinn mit Melancholie‘ (anoia melancholica), beschrieb er die Kur dieser Form von Krankheit. Darin heisst es: ,Erstes Moment der Behandlung: Hier sind die aufregenden und belebenden Mittel angezeigt: freye Luft, besonders die Landluft, das Flussbad, die zweckmässige, gemischte, oder abwechselnde Anwendung von roborantibus und nervinis, kräftige Nahrungsmittel, frisch gemolkene Milch, ein gutes, kräftiges Bier, vor allem guter, alter Wein, wenns vertragen wird. (S. 227)
Prognostisch sah er die Depression (Melancholie) so: ,Je länger die Krankheit gedauert, je tiefer sich die Vorstellung des Unglücks dem Gemüth eingegraben hat, je näher die Krankheit der Narrheit, der Albernheit, dem Blödsinn ist: desto weniger ist Hoffnung zur Genesung vorhanden.‘ (Heinroth, daselbst, S. 335).