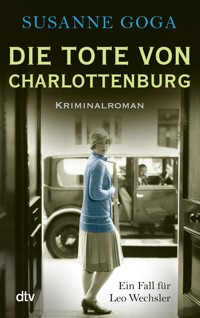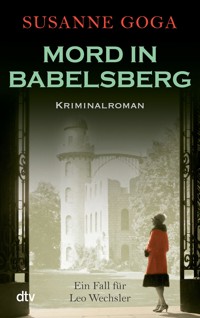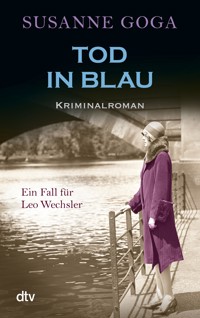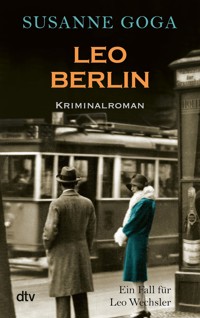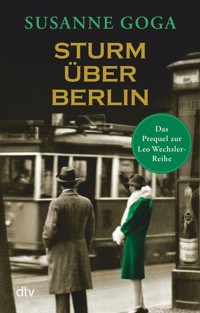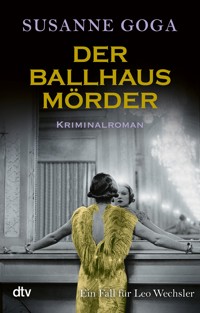7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Geschwisterpaar und der große Traum vom Leben
Rheinland 1919. Die Geschwister Thora und Hannes Bernrath entstammen einer wohlhabenden Fabrikantenfamilie aus Mönchen-Gladbach und stehen einander sehr nah. Sie leben in bewegten Zeiten von Krieg, Revolution und Besatzung. Thora nutzt die neue aufregende Zeit, um ein Schauspielstudium in Düsseldorf zu beginnen, während Hannes, der eigentlich Architektur studieren wollte, nach seiner Rückkehr von der Front orientierungslos ist. Eines Tages wird Hannes wegen Mordverdachts verhaftet, schweigt aber beharrlich. Im Zimmer ihres Bruders findet Thora einen Gedichtband von Eichendorff, in dem die Worte »Adler« und »Vulkan« markiert sind. Sie begibt sich auf die Suche nach dem Rätsel, das sich dahinter verbirgt. Und erfährt vom geheimen Leben ihres Bruders. Thora begreift, dass sie mit allen Mitteln darum kämpfen muss, ihn aus dem Gefängnis zu befreien ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
Thora, es gibt etwas, das ich Dir nie erzählt habe und auch sonst niemandem. Es ist also kein Zeichen von Misstrauen, denn wenn ich mich überhaupt einem Menschen anvertraut hätte, dann Dir. Aber ich konnte es nicht. Oder vielleicht wollte ich es auch nicht, weil es zwischen uns so bleiben sollte, wie es immer war. Aber es gibt tief in jedem Menschen etwas, das ihn ausmacht und bewegt und das er für sich bewahren muss.
Die Autorin
Susanne Goga wurde 1967 in Mönchengladbach geboren und lebt dort bis heute. Die renommierte Literaturübersetzerin und Autorin reist gern – mit Vorliebe auch in die Vergangenheit. Das spiegelt sich in ihren überaus erfolgreichen historischen Romanen wider. Für die Kriminalreihe um Leo Wechsler taucht sie ein ins Berlin der 1920er-Jahre, für viele ihrer Romane begab sie sich immer wieder ins geschichtsträchtige 19. Jahrhundert. Das Rheinland nach dem Ersten Weltkrieg war die Inspiration für ihren neuesten Roman bei Heyne.
Lieferbare Titel
Der verbotene Fluss
Das Haus in der Nebelgasse
Die vergessene Burg
Das Geheimnis der Themse
Glasgow Girls
SUSANNE GOGA
Die wilden Jahre
ROMAN
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Originalausgabe 11/2025
Copyright © 2025 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR)
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Redaktion: Hanna Bauer
Umschlaggestaltung: t.mutzenbach design unter Verwendung von akg-images / Universal Images Group / Underwood Archives, akg images / brandstaetter images / Photoinsitut Bonartes / Shutterstock.com (Bernulius)
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-31922-9V001
www.heyne.de
Dem Düsseldorfer Schauspielhaus,
das mir wunderbare Orte zum Schreiben bietet,
und seinen Menschen, die mich inspiriert haben
und denen dieser Roman so viel verdankt
»Der Meinige?«
»Auf ewig
Und in des Worts verwegenster Bedeutung.«
Friedrich Schiller, Don Karlos
Prolog
Es war August. Er stand auf dem Hof und schaute zum Feld hinüber. Der Weizen war reif und golden und wogte in der Brise. Die Sonne schien seit Tagen beharrlich. Sie hatten den Raps eingebracht und wollten heute mit der Getreideernte beginnen. Dass man sein Land überfallen hatte, bekümmerte ihn, doch er tat die Arbeit, wie sie von fünf Generationen vor ihm getan wurde.
Beim Aufwachen hatte er gespürt, dass heute ein guter Tag für die Ernte war, und nun wartete er auf seinen Sohn. Er war erst elf, aber anstellig und ging seinem Vater tüchtig zur Hand. Er hatte eine kleine Sense für Louis anfertigen lassen. Der Junge war sehr geschickt, jedoch noch zu klein, um das große Gerät zu bedienen.
Die Sonne brannte schon auf der Haut und ließ die Luft flimmern. Drückende Hitze kündigte sich an, war beinahe greifbar wie ein schweres Tuch, das sich über das Land breitete. Er schloss einen Moment die Augen und stellte sich vor, es gäbe keinen Krieg.
Seufzend drehte er sich zum Haus, rief nach Louis und Marie, seiner Frau. Keine Antwort. Sie hatten doch besprochen, dass heute der Weizen anstand. Sein Blick fiel auf den Wald. Er wusste, dass sein Junge gern dort spielte, wenn ihm die Arbeit auf dem Hof ein bisschen Zeit ließ, dass er in dem schmalen Bach, der sich durch die Felder wand, einen kleinen Damm aus Steinen angelegt hatte und manchmal ganz still dasaß und hoffte, ein Reh zu beobachten.
Er würde Louis wohl suchen müssen. Als er sich dem Wald näherte, ertönten plötzlich Schüsse, zerrissen die frühmorgendliche Stille.
Dort, am Waldrand, ein Trupp Soldaten, Kragen und Schulterklappen mit bunten Paspeln, die sich vom Feldgrau der Uniformen abhoben, Schnurrbärte und Mützen.
Sein Herz hämmerte, schien geradewegs aus seiner Brust zu springen. Er traute sich nicht, nach seinem Sohn zu rufen, bewegte sich geduckt ins Unterholz. Es war wieder still, er hörte nur das Zwitschern der Vögel, die ihn hoch oben im Gezweig zu verspotten schienen.
Eine Frau schrie gellend auf. Dann noch ein Knall.
Er rannte los, Zweige peitschten ihm ins Gesicht und rissen seine Haut auf, doch er spürte es nicht.
Düsseldorf, Dienstag, 1. April 1919
Thora saß aufrecht im Bett, ans geschnitzte Kopfende gelehnt. Etwas hatte sie aus dem Schlaf gerissen. Sie konnte sich nicht erinnern, ob es ein Traum gewesen war oder ein Geräusch. Sie horchte, in der Wohnung war es still. Auch von draußen war nichts zu hören, keine Schüsse oder Schreie wie so oft in den vergangenen Monaten. Kein Fußgetrappel von der Poststraße, keine Lastwagen, nichts, das von Schlägereien oder Polizeieinsätzen zeugte. Auch die Glocken der nahen Maxkirche hatten sie nicht geweckt. Und doch schlug ihr Herz heftig, sie spürte es in der Kehle und konnte kaum schlucken. Sie wollte aufstehen und ans Fenster treten. Vielleicht half die kühle Morgenluft, die über die zartgrünen Baumwipfel im Spee’schen Park herüberwehte. Dabei fiel ihr Blick auf den Nachttisch und den geöffneten Brief, der darauf lag.
Als sie gestern aus dem Theater heimgekommen war, hatte er auf ihrem Schreibtisch gewartet. Frau Hendricks, die Vermieterin, legte die Post immer dorthin. Der Brief trug den vollständigen Namen und die Adresse des Absenders, wie es die belgischen Besatzer vorschrieben. Die Bevölkerung war angehalten, möglichst Postkarten zu verwenden, doch Hannes hatte den Anschein von Diskretion, den ein Brief bot, vorgezogen.
Thora hatte die Schrift erkannt, bevor sie den Namen las, und den Umschlag hastig aufgerissen. Sie und Hannes konnten einander selten schreiben, weil der Postverkehr zwischen der besetzten und der unbesetzten Zone zeitweilig ganz verboten gewesen war. Darum war diese Nachricht umso kostbarer.
München-Gladbach, den 29. März 1919
Liebe Thora,
jeden Tag verfluche ich die Besatzung, die es uns so schwer macht, einander zu besuchen. Selbst das Briefeschreiben ist mühselig geworden. Aber Du sollst endlich wissen, wie es mir geht, und ich hoffe sehr, dass wir uns bald wieder umarmen können. Auch muss ich Dich um Verzeihung bitten, aber davon mehr, wenn wir uns sehen.
Es fällt mir nicht leicht, in mein altes Leben zurückzukehren. Dass ich bei Papa in der Firma arbeite, als wäre es immer noch 1913, zeigt mir umso nachdrücklicher, wie sehr sich die Welt verändert hat. Und ich mich mit ihr. Wenn ich in den Spiegel schaue, komme ich mir bisweilen fremd vor, auch wenn die größten Veränderungen gar nicht äußerlicher Natur sind.
Papa und ich haben unsere Abmachung, und an die muss ich mich halten: Ich arbeite einige Monate für ihn und überlege mir, ob ich im Herbst nach Aachen an die Technische Hochschule gehe. Die Geschäfte laufen langsam wieder an, und er ist verhalten optimistisch, was die Zukunft angeht. Das macht es nicht leichter, mich für das Architekturstudium zu entscheiden.
Doch davon will ich gar nicht schreiben. Ich muss Dir etwas anvertrauen, das mich glücklicher und zugleich verzweifelter macht, als ich es mir je hätte ausmalen können, das mich in höchste Höhen hebt und dann wieder in den tiefsten Abgrund stürzt. Das mag rätselhaft klingen, Thora, aber ich muss zu jemandem ehrlich sein, und niemand hat meine Ehrlichkeit mehr verdient als Du. Ich habe Dir unendlich viel zu erzählen, Dinge, die ich seit Jahren tief und still in mir getragen habe und die ich Dir nicht auf Papier mitteilen kann.
Ich habe lange mit mir gerungen, doch Du musst und sollst es erfahren. Meine Hand zittert beim Schreiben.
Wir sehen uns bald, versprochen.
Dein Hannes
Der Brief war sonderbar, und diesen Eindruck hatte Thora wohl mit in ihre Träume genommen. Er war voller überschwänglicher Gefühle und rätselhafter Andeutungen, doch was gänzlich fehlte, war Hannes’ liebevoller, gutmütiger Spott, die Leichtigkeit, mit der sie einander früher begegnet waren. Was sollte sie ihm verzeihen? Worin war er nicht ehrlich gewesen? Welche inneren Kämpfe hatte er ausgetragen?
In einem hatte Hannes völlig recht: Er hatte sich verändert, aber wie lange schon? Gewiss nicht erst in den letzten Monaten. Dafür musste sie viel weiter zurückgehen.
München-Gladbach, August 1914
Thora fühlte sich einsam, als sie vom Bahnhof nach Hause ging. Die Menschen um sie herum waren begeistert, begegneten dem Kriegsausbruch nach wie vor mit Überschwang und Zuversicht, doch sie selbst empfand anders. Wie sollte sie sich darüber freuen, dass sie im Krieg waren? Dass junge Männer zu Hunderttausenden in Kasernen einrückten oder gleich nach Belgien an die Front geschickt wurden?
Viele Jungen, mit denen sie zur Schule gegangen war, tauchten plötzlich in Uniform auf der Straße auf, waren in Bäckereien und Cafés, in den Parks und bei Festen in Feldgrau zu sehen. Thoras Eltern sprachen beim Essen davon, wer sich wieder freiwillig gemeldet hatte. Ihr Vater war zurückhaltender als manch anderer, doch auch er konnte seinen Stolz auf die jungen Soldaten nicht verbergen. Und ihre Mutter? Die begegnete dem Ganzen mit einem Gottvertrauen und einer Leichtgläubigkeit, die Thora bis aufs Blut reizten.
Sie las die Zeitungen, die verkündeten, dass dieser Krieg gerecht und von Gott gewollt sei, dass Deutschland sich verteidigen müsse, da es sich nur gegen die barbarischen Feinde von außen zur Wehr setze.
Barbarische Feinde? Sie dachte an die Sandfords, eine Familie wie ihre, mit der sie herrliche Urlaubstage verbracht und deren Sohn Tom sich in ihr Herz gestohlen hatte. Sie versuchte zu verstehen, was in den letzten Wochen mit der Welt, ihrer Welt, geschehen war, doch es gelang ihr nicht. Es kam ihr vor, als würde man ihr etwas vorenthalten, als zeigten die Zeitungen nicht das ganze Bild, als präsentierten sie ihr eine Geschichte, in der grobe Lücken klafften. Fast wie ein Rätsel, das man zum Zeitvertreib löste, nur war dies hier keine Spielerei.
Bereits nach kurzer Zeit sah man die ersten Frauen in Schwarz, Väter, die gedrückt und stolz zugleich über die Straße schritten. Namen wurden genannt, die Leute redeten von Gefallenen, als würden diese Männer einfach tot umkippen wie ein morscher Baum. Dass man so wenig über die Umstände erfuhr, machte es nur schlimmer.
Thora wusste wenig über das Kriegshandwerk, doch wenn sie an Kanonen und Bomben und Gewehre und Bajonette dachte, war ihr klar, dass niemand, der damit in Berührung kam, einfach tot umfiel. Und das Wissen, alles nur verschleiert und beschönigt zu erfahren, quälte sie umso mehr.
Sie hatte sich für die Erfrischungsstation am Bahnhof gemeldet, wo Essen und Getränke an Soldaten ausgegeben wurden, die zur Front aufbrachen. Sie wollte sich damit ablenken, denn zu Hause zu sitzen, Bücher zu lesen und unablässig an das zu denken, was jenseits der Grenze geschah, erschien ihr unerträglich. Die Kämpfe fanden in Belgien statt, aus dessen Seebädern noch vor wenigen Wochen scharenweise Urlauber heimgekehrt waren. Am Bahnhof konnte Thora sich wenigstens ein bisschen nützlich machen, auch wenn es wehtat, die lodernde Begeisterung in den Gesichtern der Männer zu sehen.
Auf die Eisenbahnwaggons hatte man mit Kreide verwegene Sprüche gekritzelt: Ausflug nach Paris. Auf Wiedersehen auf dem Boulevard. Auf in den Kampf, mir juckt die Säbelspitze. Thora fragte sich, ob das alles wirklich ein Spaziergang würde, ein Krieg von wenigen Wochen, der bis Weihnachten gewonnen wäre, sodass alle wieder mit ihren Familien vereint wären und gemeinsam feiern würden.
Sie konnte mit niemandem darüber sprechen. Hannes verkroch sich seit Tagen unter dem Dach, wo er sich eine Art Atelier eingerichtet hatte. Ihr Vater war entsetzt gewesen, als er ihm eröffnet hatte, er wolle nicht in die Firma eintreten, sondern Architektur studieren. Ihr Großvater hatte die Spinnerei Bernrath und Sohn gegründet, und Vater hoffte, Hannes werde die Tradition fortsetzen.
Er war grenzenlos enttäuscht, hatte immer wieder den Kopf geschüttelt und »Was machst du nur, mein Junge?« gesagt. Dass Papa nicht wütend, sondern traurig war, hatte Thora getroffen. Natürlich stand sie auf der Seite ihres Bruders, wie immer, aber es war schwer gewesen, ihren Vater so niedergeschlagen zu sehen.
Vater und Sohn hatten einen Kompromiss geschlossen: Hannes würde bis zum Herbst in der Firma arbeiten und währenddessen Material für eine Mappe zusammenstellen, mit der er sich um einen Studienplatz bewerben könnte. Ihr Vater hoffte wohl insgeheim, dass er es sich noch anders überlegen würde, doch Thora ahnte, dass Hannes sich entschieden hatte.
Gestern hatte er erzählt, die Mappe sei fast fertig, hatte sie ihr aber nicht zeigen wollen, weil er sehr streng mit sich war und immer daran zweifelte, dass seine Arbeiten gut genug waren.
Thora war so in Gedanken, dass sie selbst überrascht war, als sie plötzlich vor der Haustür stand. Der Weg vom Bahnhof in die Hohenzollernstraße war ihr so vertraut, dass ihre Schritte sie ganz automatisch dorthin lenkten. Als sie die Tür aufschloss, hörte sie Schritte von drinnen, laut und hallend. Dann stand ihr Hannes gegenüber – in Uniform. Es waren seine glänzenden Stiefel auf den Fliesen gewesen, die sie gehört hatte.
Sie tastete nach der Türklinke, wollte sich festhalten, weil sie ihre Beine nicht mehr spürte. Er trat rasch auf sie zu und hielt sie fest, damit sie nicht umkippte.
»Hannes, du kannst nicht …«
Er legte Thora den Arm um die Schultern und zog sie halb mit sich ins Wohnzimmer. Zum Glück war niemand da, denn sie wollte mit ihm allein sein. Sie musste ihm das ausreden, das war doch Unsinn, dass Hannes, ihr sanfter Bruder, eine graue Uniform trug und diese Stiefel, die wie Donnerschläge auf dem Boden hallten.
Er drückte sie aufs Sofa und kniete sich vor sie, legte ihr die Hände auf die Beine. »Ich muss es tun«, sagte er nur.
»Nein. Das musst du nicht. Du willst Architekt werden. Die schießen nicht auf andere Menschen.« Sie wusste, dass sie schrecklich naiv und ängstlich klang, was sie gar nicht sein wollte. Aber Hannes in dieser fremden Aufmachung, dieser Verkleidung vor sich zu sehen, tat grausam weh.
Er fuhr sich durch die Locken und lächelte. Das Lächeln erreichte seine Augen nicht. »Ich habe Papa enttäuscht, als ich mich gegen die Firma entschieden habe. Darum ist mir, als wäre ich ihm etwas schuldig.« Er suchte nach den richtigen Worten. »Wenn ich schon nicht sein Nachfolger werde, wie er es erwartet und gehofft hat, kann ich ihm wenigstens auf diese Weise entgegenkommen. Er soll stolz auf mich sein, sich nicht für mich schämen müssen. Wenn andere stolz auf ihre Söhne sind, soll er es auch sein.«
»Ihm entgegenkommen?« Das klang nicht nach dem jubelnden Heldenmut, mit dem sich andere junge Männer ins Soldatenleben stürzten. Es erinnerte eher an eine geschäftliche Abmachung, dachte Thora und überlegte verzweifelt, wie sie ihn noch umstimmen konnte, während die Angst ihre Kehle eng machte. »Bist du wirklich davon überzeugt? Es ist ein sehr großer Schritt.«
Thora sah den Schmerz in Hannes’ Augen. Dann wandte er den Kopf ab, als wollte er sein Inneres vor ihr verbergen.
»Bitte rede mit mir.«
Er schaute über die Schulter zur Tür, wie um sich zu vergewissern, ob sie noch allein waren, und blickte ihr dann offen in die Augen. »Nein, wirklich überzeugt bin ich nicht. Und ich habe Angst. Aber ich kann Papa nicht noch einmal enttäuschen.«
Sein Tonfall ließ keinen Zweifel: Es war das Letzte, was er dazu sagen würde. Er hatte sich entschieden. Und nichts, was Thora sagte oder tat, würde daran etwas ändern.
Düsseldorf, Dienstag, 1. April 1919
Thora faltete den Brief, schob ihn wieder in den Umschlag und legte ihn in die Nachttischschublade. Die Unruhe, die sie aus dem Schlaf gerissen hatte, war immer noch da. Wie gern hätte sie sofort mit Hannes gesprochen, so wie früher, als sie nur an seine Tür klopfen musste oder – als Kind – einfach ins Zimmer gestürmt war. Im Dezember, kurz nach Kriegsende, war er ins Elternhaus zurückgekehrt, doch durch die Besatzung des Rheinlandes war eine neue Grenze zwischen ihnen gewachsen. Thora wohnte in Düsseldorf, wo sie eine Schauspielausbildung absolvierte. München-Gladbach hingegen war vom belgischen Militär besetzt, und sie konnte nicht mehr ohne Weiteres nach Hause fahren, zumal das Theater sehr viel Zeit in Anspruch nahm. Also musste sie warten, bis sie wieder von Hannes hörte.
Sie las ein wenig und stand pünktlich um sieben auf. Heute war Montag, und der begann mit Technikunterricht bei Frau Dalands, früh um acht im Foyer des Schauspielhauses. Es war eigentlich eine unchristliche Zeit für Theatermenschen, die häufig sehr spät ins Bett kamen und am nächsten Morgen dementsprechend später anfingen, doch für die Schauspielschüler galt das ganz offensichtlich nicht.
Sie sprang aus dem Bett, wusch sich über der Schüssel und zog einen wadenlangen Rock und eine Bluse an. Dann steckte sie den Kopf aus dem Fenster, um die Temperatur zu prüfen, und streifte spontan den grauen Wollpullover mit dem Zopfmuster über, der, so kam es ihr vor, immer noch nach Hannes roch. Sie hatte ihn aus seinem Schrank genommen, nachdem er sich zur Armee gemeldet hatte, und nie wieder zurückgelegt. Seither trug Thora den Pullover bei kaltem Wetter und fühlte sich dabei, als wäre Hannes ihr ganz nah.
Ihre Mutter hatte sie anfangs missbilligend angesehen und gesagt, es gehöre sich nicht, dass eine junge Frau Männerkleidung trage. Irgendwann hatte sie jedoch aufgegeben und nur noch schicksalsergeben genickt, wenn Thora in dem geliebten Pullover erschien.
Die Witwe Hendricks erwartete sie mit besorgter Miene im Esszimmer: »Ist Ihnen nicht wohl, Fräulein Thora? Sie sehen ein bisschen blass aus.«
»Danke, alles gut. Ich habe nur schlecht geschlafen.«
Die Vermieterin schenkte ihr Muckefuck ein. »Keine schlimmen Nachrichten, hoffe ich? Da war doch dieser Brief. Heutzutage kommt ja selten Post von drüben, da rechnet man schon mit dem Schlimmsten.«
Kurios, dachte Thora, dass das andere Rheinufer jetzt drüben sein sollte, ein entlegener Ort, der einem fremd geworden war.
Die Witwe war fürsorglich, aber auch neugierig, und Thora verfluchte ihren aufmerksamen Blick ebenso wie die Tiraden, in denen sie dem Kaiser nachtrauerte. »Der Brief war von meinem Bruder, kein Grund zur Sorge.« Eher hätte sie sich die Zunge abgebissen, als Frau Hendricks etwas Persönliches anzuvertrauen. Dann würde sie keine Ruhe mehr geben und immer wieder nachfragen. Das Zimmer mit Aussicht auf den Spee’schen Park war wunderschön und erschwinglich, die Vermieterin in Fragen der Moral nachsichtiger, als Thoras Eltern lieb gewesen wäre, doch sie musste auf der Hut sein, wenn ihr privates Leben privat bleiben sollte.
»Heute Nacht hat es wieder Unruhen gegeben«, seufzte die Witwe und sah zu, wie Thora sich rasch ein Brot schmierte, das sie unterwegs zu essen gedachte. »Ich frage mich, wie das weitergehen soll. Den Frieden habe ich mir anders vorgestellt.«
Sie hatte nicht ganz unrecht. War es wirklich Frieden, wenn man sich einen Passierschein ausstellen lassen musste, um die eigenen Eltern zu besuchen? Wenn man keinerlei Lebensmittel von daheim mit nach Düsseldorf nehmen durfte, weil die belgischen Besatzer es verboten? Wenn man beträchtliche Umwege in Kauf nehmen musste, um die lächerlich kurze Strecke von Gladbach nach Düsseldorf zurückzulegen?
Als Thora sich vor zwei Jahren Hals über Kopf ins Schauspielhaus verliebt hatte, war die Welt eine andere gewesen. Natürlich hatte sie jeden Tag um Hannes gebangt, doch in der Heimat erlebte man vor allem die Folgen des Krieges, nicht die Kämpfe selbst. Die passierten fern von hier, in Flandern und Russland. Die verwundeten Soldaten strömten in die Lazarette, doch im Rheinland blieb es friedlich. Und nun, da der Krieg endlich beendet war, wurde der Alltag beherrscht von Schießereien, Streiks, Barrikaden und Demonstrationen.
Die Witwe Hendricks erwartete offenbar keine Antwort, sondern hielt ihr eine Papiertüte hin. »Für das Brot.« Sie kannte ihre Pappenheimer, da sie nicht zum ersten Mal an Schauspielschüler vermietete, die morgens gern auf den letzten Drücker die Wohnung verließen und kauend zum Schauspielhaus eilten.
Thora schob das Butterbrot in die Tüte, trank den Muckefuck aus und nickte im Gehen. »Danke, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag.«
Sie zog die Wohnungstür hinter sich zu und eilte die Treppen aus dem zweiten Stock hinunter. Unten im Hausflur kam ihr Pitter, der Neffe von Frau Hendricks, entgegen, die Wangen rot, in der Hand einen Knüppel, und trat breitbeinig vor sie hin. »Guten Morgen, Fräulein Thora. Soll ich Sie begleiten, damit Sie auf der Straße sicher sind?«
Pitter hielt sich für einen Furcht einflößenden Kämpfer, er konnte vor Kraft kaum laufen. Aber sie hatte es eilig und war nun wirklich nicht auf den Schutz eines Siebzehnjährigen angewiesen, der sich vor ihr großtun wollte.
»Danke, Pitter, das ist nett von dir, aber ich komme schon zurecht.«
»Nehmen Sie sich vor den Roten in Acht, die sind nicht anständig Frauen gegenüber«, rief er ihr nach, wobei er die Enttäuschung in seiner Stimme nicht ganz verbergen konnte.
Thora lief nach draußen und atmete die frische Frühlingsluft ein. Sie brauchte acht Minuten bis zur Kasernenstraße. Der Weg war inzwischen so vertraut, dass sie ihn blind hätte gehen können und kaum länger unterwegs gewesen wäre. Sowie sie um die letzte Ecke bog, sah sie schon das zinnenbewehrte Bühnenhaus aufragen, das wie eine mittelalterliche Burg anmutete. Sie ging seit sieben Monaten dort ein und aus, doch das Theater hatte nichts von seinem Zauber eingebüßt.
Thora zerknüllte die Papiertüte und steckte sie in ihre Ledertasche, in der sie Reclam-Hefte und Bücher bei sich trug. Sie überquerte die Straße und wollte gerade durchs Tor gehen, das von zwei steinernen Säulen flankiert wurde, da eilte ein Mann mit wehendem Mantel an ihr vorüber.
Als Thora eintrat, stand er beim Pförtner und fragte mit einer recht hellen Stimme, wo der Raum für den Technikunterricht zu finden sei.
Herr Lohkamp, der Pförtner, betrachtete ihn ein wenig zweifelnd und zwinkerte Thora zu. »Da ich mal annehme, dass Sie mich nicht in den April schicken wollen und hier richtig sind, gehen Sie doch einfach mit Fräulein Bernrath. Die kennt sich aus.«
Der Mann drehte sich um. Blonde Haare, glatt an den Kopf gekämmt, gut gekleidet, einen Schal mehrfach um den Hals geschlungen, als wäre tiefster Winter. Seine auffällig hellblauen Augen schienen sie zu durchdringen. Dann lächelte er und sagte mit einer angedeuteten Verbeugung: »Ich bin der neue Schüler. Heute ist mein erster Tag.«
»Freut mich. Ich bin Thora Bernrath.«
»Gustav Gründgens.«
»Machen Se lieber schnell«, riet Herr Lohkamp, »wir haben fast acht.«
Elsa Dalands, die Lehrerin, war streng mit allen, die zu spät kamen; der frühe Unterrichtsbeginn war für sie weder Erklärung noch Entschuldigung. »Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen den Weg«, sagte Thora und eilte los. »Man kann sich hier ganz schön verlaufen.«
Zügig führte sie den jungen Mann durch die labyrinthischen Gänge, treppauf, treppab, durch Türen mit Aufschriften wie Nur für befugte Personen. Sie genoss es zu zeigen, wie gut sie sich auskannte. Herr Gründgens folgte ihr in einem Meter Abstand und verzichtete auf Konversation.
Thora war verwundert, dass zum 1. April ein neuer Schüler aufgenommen wurde, da das Schuljahr grundsätzlich im September begann.
»Sie kennen sich wirklich bestens aus«, sagte Gründgens, als Thora stehen blieb und die Tür zum Foyer öffnete.
»Das lernen Sie auch noch«, sagte sie freundlich, aber ein wenig distanziert.
Der weite runde Raum mit der Kuppeldecke wurde außerhalb der Vorstellungen auch für den Schauspielunterricht genutzt. Das ganze Theater diente dem Unterricht, hier lernte man immer und überall und bewegte sich vom ersten Tag an dort, wo auch die fertig ausgebildeten Schauspieler tätig waren.
Frau Dalands war bereits da und machte eine einladende Armbewegung. »Fräulein Bernrath, besser spät als nie.«
Thora setzte sich auf den freien Stuhl neben ihrer Freundin Hilde, die sie neugierig ansah und zu Herrn Gründgens nickte. »Wer ist das?«
Sie stellte die Tasche ab und zog den warmen Pullover aus. »Ein Neuer.«
Hilde hob die Augenbrauen. »Ob er so viel kann, dass sie ihn zum April genommen haben?«
Thora zuckte mit den Schultern. »Es könnte auch daran liegen, dass er ein Mann ist.«
Hilde schmunzelte. »An denen herrscht natürlich Mangel. Es ist reichlich unbefriedigend, wenn wir die Liebesszenen immer unter uns Mädchen spielen müssen. Allerdings weiß ich nicht, ob er mir gefällt. Der sieht aus wie ein kalter Fisch.«
Thora presste die Hand vor den Mund, um ihr Lachen zu unterdrücken.
Frau Dalands klatschte in die Hände und sah sich in der Runde um. »Ich darf Ihnen einen neuen Mitschüler vorstellen, Herrn Gustav Gründgens aus Oberkassel. Er hat bereits Theatererfahrung gesammelt und wird sich gewiss gut in die Gruppe einfügen. Nehmen Sie sich einen Stuhl, dann wollen wir beginnen.«
Eine halbe Stunde später runzelte Frau Dalands bedenklich die Stirn. Sie hatte den neuen Schüler die üblichen Stimmübungen absolvieren lassen und schien ganz und gar nicht zufrieden mit dem, was sie hörte.
»Sie wissen hoffentlich, dass Sie einiges nachzuholen haben.« Elsa Dalands schaute Gründgens sorgenvoll an. »Ich muss sagen, Ihre hastige Sprechweise behagt mir gar nicht. Wenn Sie auf der Bühne so reden, wird niemand im Publikum Sie verstehen.«
Er blickte betreten auf seine gefalteten Hände. »Ich werde mir alle Mühe geben, Frau Dalands. Es ist mein allergrößter Wunsch, Schauspieler zu werden, und wenn ich dafür vierzehn Stunden am Tag arbeiten muss, werde ich das tun.«
»Falls er Dumont und Lindemann in die Hände fällt, arbeitet er wohl eher achtzehn Stunden«, flüsterte Hilde.
Den Rest des Unterrichts verbrachten sie mit den bereits bekannten Sprechübungen, die täglich praktiziert werden mussten, bis sie einem in Fleisch und Blut übergingen.
Am Ende des langen Unterrichtstags zog Thora gerade den grauen Pullover über und setzte die Mütze auf, als Paul Kemp von hinten rief: »Wer ist heute Abend im Storch dabei? So ab sieben?«
»Ich bin raus«, sagte Renée, eine Mitschülerin, die demnächst zum Ensemble gehören würde und schon größere Rollen spielte. »Wir geben heute Madame Legros. Danach bin ich zu müde. Macht euch einen netten Abend.«
»Ich komme mit«, sagte Thora spontan. Vielleicht täte es ihr ganz gut, sich von dem Brief abzulenken, der wie ein Schatten auf ihr lag. Allein in ihrem Zimmer würde sie die ganze Zeit draufstarren und sich fragen, was mit Hannes los war.
Hilde nickte. »Ich bin auch dabei.«
Paul schaute zu Gründgens, der ein wenig Abstand hielt und sich gerade eine Zigarette anzündete. »Und du?«, fragte er formlos.
»Ist das die Wirtschaft Ecke Camphausenstraße und Derendorfer Straße?«
»Ja, das Vereinslokal vom Laetitia, da geht’s immer lustig zu.«
»Danke, ich komme gern«, sagte er ein wenig scheu.
Und so kam es, dass am Abend eine ganze Gruppe Schauspielschüler lachend und schwatzend in die Gaststätte Zum Storch einfiel.
Nachdem die Wirtin sie herzlich begrüßt hatte, begaben sie sich ins sogenannte Sitzungszimmer, das sich im ersten Stock befand und mit skurrilen Gegenständen eingerichtet war, die Kunststudenten auf Studienreisen zusammengetragen hatten: Masken, Skulpturen, Gemälde, aber auch Haushaltsgegenstände wie irdene bemalte Töpfe und gefährlich aussehende Messer. Eingerichtet hatte man den Raum mit dem Chorgestühl und der Kanzel einer ehemaligen Kapelle, und Thora hatte sich bei ihrem ersten Besuch lebhaft an die sonntäglichen Kirchgänge mit Hannes und den Eltern erinnert gefühlt.
Bald war ihr jedoch klar geworden, dass es hier respektlos und unkonventionell zuging, vor allem, wenn Studenten der Kunstakademie dazukamen. An diesem Abend waren sie aber unter sich.
Als alle saßen, hob Gründgens die Hand. »Da heute mein erster Tag an der Schule ist und ihr mich alle so freundlich empfangen habt, gebe ich eine Runde Bier aus. Es freut mich, mit euch an dieser illustren Stätte zu lernen.«
Alle klatschten, die Männer schlugen ihm kameradschaftlich auf die Schulter.
»Die Dalands sagt, du hättest Bühnenerfahrung?«
Gründgens zündete sich eine Zigarette an und hielt die Schachtel in die Runde. Er nahm einen tiefen Zug. »Vor meinem ersten Kampfeinsatz wurde ich durch ein dummes Missgeschick verletzt und kam ins Lazarett. Danach hörte ich von einem Fronttheater in Saarlouis und habe mich sofort beworben.« Er grinste verschämt. »Möglicherweise habe ich nicht die ganze Wahrheit über meine schauspielerischen Erfahrungen gesagt. Oder sie ein wenig ausgeschmückt.«
Im Gelächter, das folgte, brachte die Wirtin das Bier und stellte einen Korb mit Brötchen auf den Tisch. Alle langten zu, aber Thora fühlte sich unbehaglich. Sie dachte an Hannes, der mehr als vier Jahre in der Armee verbracht und unzählige Schlachten erlebt hatte, der verwundet worden war und auch jetzt, Monate nach Kriegsende, noch nicht der Mensch war, den sie von früher kannte. Und es vielleicht auch nie wieder werden würde.
Hilde bemerkte ihre Verstimmung und kniff ihr ein Auge. »Der hört sich gern reden«, flüsterte sie ihr ins Ohr.
Gründgens schob den leeren Teller beiseite. »Das mag leichtfertig klingen, aber Theater bedeutet mir alles.« Er sah Thora an, als hätte er gespürt, was sie dachte. »Und wie ist es bei Ihnen – dir?«
Thora schob die Gedanken an ihren Bruder beiseite und suchte nach einer Antwort, die am besten ausdrückte, was sie empfand. »Wenn ich im Theater bin, kann ich alles Schwere vergessen, das mich am Boden hält, und fliegen.« Sie wusste nicht, woher die Worte gekommen waren.
»Das hast du schön gesagt.« Für einen Moment wirkte er in sich versunken, bevor sich wieder die kühle, belustigte Maske davorschob.
Die anderen hatten den kurzen Austausch nicht bemerkt, sondern witzelten über die Sparsamkeit von Direktor Lindemann, der angeblich jede Stecknadel vom Boden aufhob und alle im Theater dazu anhielt, nichts zu verschwenden.
»Neulich habe ich mitbekommen, wie er Frau Dumont angeblafft hat, weil sie wieder sündhaft teuren Stoff in München bestellt hat«, sagte Hilde. »Da ist er richtig laut geworden.«
»Ich glaube, er ist ihr so ergeben, dass er zwar bellt, aber niemals beißen würde«, warf Paul Kemp ein. »Wenn es hart auf hart kommt, frisst er der Frau Direktor aus der Hand.«
Thora bekam das Gespräch nur mit einem Ohr mit, weil ihre Gedanken zu dem Brief und der Frage zurückgekehrt waren, was sich hinter den Worten ihres Bruders verbergen mochte. Der Drang, Hannes zu sehen und in Ruhe mit ihm zu sprechen, war überwältigend. Nur lebten sie im Grunde in verschiedenen Ländern, und der Rhein war die streng bewachte Grenze, die sie trennte.
Natürlich hatte sie gewusst, dass mehr als nur die dreißig Kilometer Weg zwischen ihr und ihrer Familie liegen würden, wenn sie an die Hochschule für Bühnenkunst ging, doch ihr Wunsch hatte alles andere in den Schatten gerückt. Thora hatte die Entscheidung nie bereut, und ihre Worte an Gründgens waren ehrlich gewesen. Das Gefühl, ganz in eine Rolle einzutauchen und jemand zu werden, der nichts mit ihr gemein hatte, war unvergleichlich. Die vielen Unterrichtsstunden, das Auswendiglernen daheim und die abendlichen Auftritte forderten ihre ganze Kraft, erschöpften sie aber nicht, sondern trieben sie voran, weil sie ein klares Ziel vor Augen hatte.
Heute aber hatte Thora erkannt, dass sie keine Ruhe finden würde, bis sie Hannes gesehen und mit ihm gesprochen hatte. Also musste sie nach Hause fahren, egal wie.
Düsseldorf, Samstag, 5. April 1919
So bald, wie Thora gehofft hatte, konnte sie dann doch nicht nach Gladbach fahren. Eine Kleindarstellerin fiel aus, für die sie einspringen musste, und der Text wollte über Nacht gelernt sein. Auch ging der Unterricht für sie weiter, da wurden keine Ausnahmen gemacht. Der Brief lag weiterhin auf ihrem Nachttisch, und sie las ihn morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Schlafengehen, doch er verriet nicht mehr als beim ersten Mal.
Schreiben konnte sie Hannes nicht, da er ihr seine Geheimnisse nur mündlich anvertrauen wollte. Private Telefongespräche ins besetzte Gebiet waren untersagt, die Leitungen zudem immer wieder gestört. Sie hätte bei ihrem Vater in der Firma anrufen müssen, wo Hannes nicht ungestört sprechen konnte. Gleiches galt für sie in Düsseldorf, denn die Witwe Hendricks besaß kein Telefon.
Thoras Unruhe wuchs mit jedem Tag. Am Samstag hielt sie es nicht länger aus, nahm allen Mut zusammen und fragte Louise Dumont nach dem Unterricht, ob sie den kommenden Montag frei haben könne.
Die Direktorin verschränkte die Arme und musterte sie nachdenklich. »Ihre Leistungen sind sehr gut, Fräulein Bernrath. Dass Sie so spontan eingesprungen sind und sich ganz auf die Rolle eingelassen haben, lässt auf innere Festigkeit und Konzentration schließen. Allerdings scheinen Sie besorgt, und das wirkt sich auf die Arbeit aus. Also fahren Sie bitte nach Hause, damit Sie wieder einen freien Kopf bekommen. Abgelenkte Schülerinnen kann ich nicht gebrauchen. Erledigen Sie, was zu erledigen ist, und kehren frisch und munter zu uns zurück.«
Als Thora den Unterrichtsraum verließ, räusperte sich jemand neben ihr. Es war Hilde, die das Gespräch offenbar mitgehört hatte.
»Du willst nach Hause?«
»Ja, ich muss dringend zu meinem Bruder.« Mehr sagte sie nicht, weil sie ihre Unruhe nicht in Worte fassen konnte.
Hilde schien etwas in ihrem Gesicht zu lesen und schaute sie mitfühlend an. »Hast du nicht gehört, dass ein Generalstreik kommt? Manche aus dem Theater machen auch mit, Bühnenarbeiter, vielleicht noch andere. Gestern haben sie schon den Spielplan geändert, zweimal Raub der Sabinerinnen statt Donna Diana und Sommernachtstraum. Und ob Schneider Wibbel heute gespielt wird, steht auch noch in den Sternen.«
»Die Änderungen habe ich mitbekommen«, sagte Thora verwundert, »aber ich dachte, jemand sei krank geworden.«
»Nein, es ist wegen des Streiks. Wer weiß, ob du morgen überhaupt aus Düsseldorf wegkommst«, sagte Hilde besorgt. »Vielleicht sperren sie mal wieder die Brücke. Und ob ab Oberkassel eine Straßenbahn fährt, ist auch nicht sicher.«
Thora war es mittlerweile gewöhnt, dass der Alltag ständig unterbrochen wurde und man improvisieren musste, weil sich von einer Minute zur anderen alles ändern konnte. Doch dass es sie gerade jetzt traf, wo sie unbedingt Hannes sehen wollte … Sie presste die Lippen aufeinander, um die Tränen zurückzuhalten. Hilde legte ihr tröstend die Hand auf den Arm.
Gründgens kam dazu und schaute sie fragend an. »So betrübt?«
Da kam ihr eine Idee, verrückt zwar, aber nicht ganz unmöglich. »Du wohnst doch in Oberkassel.«
»Ja.«
»Wie kommst du denn jeden Tag über die Brücke? Ist es sehr mühsam?«
Er zuckte mit den Schultern. »Ich habe einen Dauerpassierschein, der macht es leichter. Aber die Kontrollen sind nach wie vor sehr streng.« Er hielt inne. »Was hast du vor? Ich sehe so ein Funkeln in deinen Augen.«
»Oje«, warf Hilde ein, »das Funkeln kenne ich, und es verheißt nichts Gutes.«
»Ich werde mit dem Rad nach Hause fahren«, verkündete Thora forsch und mit mehr Zuversicht, als sie tatsächlich empfand.
»Mitten durchs besetzte Gebiet?«, fragte ihre Freundin entsetzt. »Da streunen sicher überall belgische Soldaten herum. Das ist zu gefährlich.«
Gründgens schien hingegen zu erkennen, dass ihr Entschluss unverrückbar feststand. »Ich hoffe, du hast ein passables Fahrrad.«
Thora biss sich auf die Lippe. Genau das war der Haken. Bei Frau Hendricks im Hinterhof stand ein altes Rad, das sie benutzen durfte. Es hatte Pitter gehört, der zum Geburtstag ein neues bekommen hatte. Das Rad war verrostet und mehr als einmal notdürftig geflickt, sie war noch nie längere Strecken damit gefahren. Sie konnte nur hoffen, dass die alte Kiste unterwegs nicht schlapp machte.
»Kaiser-Wilhelm-Ring 18.« Wasserblaue Augen, ein verhaltenes Lächeln. »Du kannst meins geliehen haben. Das stand im Keller, während ich beim Militär war, und wurde gut instand gehalten. Aber pass drauf auf, ich hänge an dem Ding.«
Thora konnte ihr Glück kaum fassen und nickte dankbar. »Das ist wirklich nett von dir, Gustav. Ich bringe es heil zurück, versprochen.«
Am Sonntagmorgen um sechs kämpfte sich Thora aus dem Bett, wusch sich, zog Hannes’ Pullover, einen alten Rock und knöchelhohe Stiefel an, packte Wäsche und Kamm ein. Dann ging sie in die Küche, um sich ein Brot zu schmieren, und verließ leise die Wohnung. Sie holte das alte Fahrrad vom Hof und schob es auf die Straße, in der einen Hand das Brot, die Ledertasche, in der sie gewöhnlich ihre Schulsachen trug, schräg über der Schulter. Es war so frisch, dass ihr Atem wolkte, und sie war froh über die Mütze, die sie über die Ohren ziehen konnte.
Thora hatte vereinbart, dass Gründgens ihr um halb acht das Rad an die Haustür bringen würde. Natürlich würde sie unter normalen Umständen nie so lange für die Strecke brauchen, aber sie musste die Brückenkontrolle mit einrechnen.
Sie stieg auf und fuhr vorsichtig los. Das Rad quietschte bedenklich, aber wenn sie nicht zu heftig in die Pedale trat, schaffte sie es hoffentlich heil nach Oberkassel. An der Maxkirche bog sie nach rechts in die Benrather Straße und dann nach links in den Hindenburgwall. Vor dem eleganten Hotel Breidenbacher Hof standen schon die Portiers und halfen früh eintreffenden Gästen beim Aussteigen. Ein Page schob einen Gepäckwagen herbei, und Thora staunte im Vorbeifahren, dass es in diesen ungewissen Zeiten immer noch Menschen gab, die sich ein so teures Hotel leisten konnten.
Thora warf einen Blick in den Hofgarten, dessen Bäume das erste zarte Frühlingsgrün trugen. Wie gern würde sie dort einmal mit Hannes sitzen und ihm aus einem Stück vorlesen, das sie gerade lernte. Wenn der Sommer kam, fühlte sich das Leben unbeschwerter an, und so würde es auch diesmal sein, sagte sie sich. In wenigen Stunden wäre sie daheim und könnte mit Hannes reden und sich vergewissern, dass es ihm gut ging und die Welt nicht gänzlich aus dem Takt geraten war.
Das Ratinger Tor leuchtete weiß zu ihrer Rechten, dann beschrieb die Straße einen weiten Bogen in Richtung Rhein. Vor ihr tauchte der Torturm der Brücke auf und mit ihm die belgischen Soldaten.
Thora hatte bisher kaum mit ihnen zu tun gehabt. Sie war, kurz nachdem das belgische Militär in Gladbach einmarschiert war, nach Düsseldorf gezogen, wo man für gewöhnlich keine Besatzungssoldaten zu sehen bekam. Sie hatte natürlich von ihren Eltern gehört, wie es war, unter fremder Besatzung zu leben, von den hohen Ansprüchen, die die belgischen Offiziere stellten, von den beschlagnahmten Wohnungen und Häusern, von Demütigungen und Anzeigen, weil Leute gegen die Regeln verstoßen hatten. Doch der Krieg war vorbei, immerhin, und wie es aussah, würde es in absehbarer Zeit auch einen Friedensvertrag geben. Ihr Herz schlug schneller, als sie das Fahrrad auf den Kontrollposten zuschob, und ihre Hände schlossen sich fester um den Lenker.
Ein Soldat mit langem Mantel und Helm kam auf sie zu, stützte sich auf sein Gewehr und musterte sie unverhohlen. Dann sagte er auf Deutsch: »Ihren Ausweis!«
Sie hielt ihm den Pass hin, der in Gladbach von der Polizeiverwaltung ausgestellt und von der belgischen Sûreté Militaire gestempelt und mit ihrem Bild versehen war. Er studierte das Dokument, schaute kritisch von ihr zur Fotografie und wieder zurück.
»Was ist der Zweck Ihres Besuchs?«, fragte er mit starkem Akzent.
»Ich möchte meine Familie in Gladbach besuchen.«
Er nickte zum Fahrrad und zog die Augenbrauen hoch. »Damit?«
Thora wurde ein bisschen ruhiger. Er wirkte nicht unfreundlich. »Ich muss nur auf die andere Rheinseite damit. Dort wohnt ein Bekannter, der mir sein Fahrrad leiht.«
Er gab ihr den Pass zurück und deutete auf die Brücke. »Sie kennen die Vorschriften. Auf dem Rückweg dürfen Sie keine Lebensmittel mitführen. Das gilt auch für Druckerzeugnisse und Zeitungen. Darauf stehen hohe Strafen.«
»Ich weiß. Danke.«
Sie stieg auf und fuhr zwischen den Straßenbahnschienen und dem schmalen Gehweg entlang.
Der Wachposten am anderen Ufer warf nur einen flüchtigen Blick auf ihren Pass, da man sie beim leisesten Verdacht gar nicht erst auf die Brücke gelassen hätte. Als sie den Torturm hinter sich gelassen hatte, bog sie nach links in den Kaiser-Wilhelm-Ring mit seinen herrschaftlichen Häusern. Neben ihr erstreckten sich die weiten Oberkasseler Wiesen.
Thora entdeckte das rote Haus mit der Nummer 18, das mit den schön geformten Fenstern und der schmuckreichen Fassade ziemlich prächtig wirkte. Bevor sie anhalten konnte, ertönte ein durchdringender Pfiff, und Gustav schob ein glänzendes Fahrrad aus der Haustür.
Thora stieg ab und sah verlegen von der Klapperkiste zu seinem eleganten Gefährt. »Guten Morgen. Und das willst du mir wirklich anvertrauen?«
Er schob sich die blonden Haare aus dem Gesicht und zuckte mit einer Schulter. »Versprochen ist versprochen. Also nimm schon, bevor ich es mir anders überlege.«
Sie tauschten die Räder, und er sah zum Himmel. »Immerhin scheint es trocken zu bleiben. Gute Fahrt.«
»Danke noch mal, für alles.«
Doch die Haustür war schon hinter ihm ins Schloss gefallen.
Was gut war, da ihr erst jetzt auffiel, dass Gustavs Fahrrad eine hohe Stange besaß, während die alte Kiste, mit der er im Haus verschwunden war, deutlich besser zu besteigen war. Zum Glück waren die Röcke in den letzten Jahren deutlich kürzer geworden; ihrer reichte bis zum Schienbein. Dennoch schaute sie sich gründlich um, bevor sie den Rock hochzog, die Strümpfe entblößte und ein Bein über die Stange schwang.
Thora hatte sich die Strecke in einem Straßenatlas angesehen, der bei Frau Hendricks im Regal stand, und sich die wichtigsten Straßen und Abzweigungen notiert. Sie würde bis Neuss und von dort aus über die Dörfer bis nach Hause fahren und hoffen, dass sie keinen belgischen Soldaten begegnete. Zwar war es nicht verboten, durch die Gegend zu radeln, doch als sie den Rhein überquert hatte, war es ihr vorgekommen, als beträte sie ein fremdes Land.
Sie kam zügig voran. Zum Glück war der Weg nach Neuss gut ausgeschildert, doch sie wusste auch, dass das erste Stück am einfachsten war.
Thora radelte dahin, den Wind im Gesicht, zog dann und wann die Mütze tiefer, damit sie nicht verloren ging. Die Bewegung brachte sie ins Schwitzen, und als die Sonne durch die Wolken brach, träumte sie sich zurück in eine unbeschwertere Zeit, in den letzten sorgenfreien Urlaub in England. In die Tage mit Tom.
Bowdon, Manchester, Mai 1914
Der Flieder stand in voller Blüte, duftende Dolden in Lila und Weiß, die sich im schon warmen Maiwind wiegten. Sie saßen im Garten der Sandfords in bequemen Korbstühlen mit bunt gemusterten Kissen, vor ihnen auf dem Tisch das zart geblümte Teeservice und die Etagere mit hauchdünnen Sandwiches und kleinen Kuchen. Die Familien waren seit vielen Jahren befreundet, die Männer enge Geschäftspartner.
Thora liebte die Villa in Bowdon. Sie stand fernab der Fabriken von Manchester, denen die meisten Familien, die hier lebten, ihren Wohlstand verdankten. Daheim in Gladbach war alles viel kleiner und gedrängter, da konnte man vom eigenen Garten die rauchenden Schornsteine sehen. Die Sandfords hatten sich ihre eigene Welt im Grünen erschaffen, in der rote Backsteinmauern, ratternde Maschinen und schlechte Luft nicht existierten. Natürlich fuhr Papa täglich mit Mr. Sandford in die Stadt, um wichtige Gespräche zu führen und eben jene ratternden Maschinen zu inspizieren, doch sie selbst besichtigte entweder die Sehenswürdigkeiten oder amüsierte sich mit Tom und Hannes im Garten. Die Bernraths besuchten die Sandfords nicht zum ersten Mal, doch waren es diese fliederduftenden Tage im Mai, deren unbeschwerte Leichtigkeit ihr für immer im Gedächtnis bleiben sollte.
Nach dem Tee stand Tom auf und nickte ihr auffordernd zu. »Lass uns spazieren gehen, bevor ich platze.«
Als Thoras Mutter nicht protestierte, sondern unbekümmert weiter mit Mrs. Sandford plauderte, stand sie auf und griff nach ihrem Strohhut.
Sie schlenderten nebeneinander her, der Rasen ein weicher Teppich unter ihren Füßen, während die Stimmen der Familien hinter ihnen verklangen. Thora spürte, wie Tom sie im Gehen anschaute und dass seine Hand sehr nah neben ihrer hin- und herschwang.
Tom und seine Schwester Julia hatten ein deutsches Kindermädchen gehabt, das ihnen schon früh die Sprache beigebracht hatte. Schon als Kinder hatten sie in diesem Garten miteinander gespielt, oft kleine Theaterstücke aufgeführt, die Thora selbst verfasst hatte. Sie verteilte auch die Rollen und versuchte, möglichst gerecht zu sein, damit alle ihren Augenblick im Rampenlicht bekamen. Sie spielten in einem Theaterzelt aus Bettlaken, die sie an die Bäume hängten, und verwandelten sich in Ritter und Prinzessinnen, während die Väter im Arbeitszimmer ernste Gespräche über neue Absatzmärkte führten. Wenn sie mit den Proben fertig waren, mussten die Herren Bernrath und Sandford ihre Geschäfte unterbrechen und sich ansehen, was ihre Kinder auf die Bühne zauberten.
Sie waren nahezu unbemerkt erwachsen geworden. Darum war Thora anfangs auch etwas befangen gewesen, als Tom sie vom Bahnhof abgeholt hatte – er sah jetzt wie ein Mann aus, nicht mehr wie der Junge, mit dem sie Theater und Verstecken gespielt hatte. Er war größer und breitschultriger geworden, auf seinen Wangen wuchsen rötlich-blonde Stoppeln. Seine Stimme klang tief und voll, und das Lachen schien in seinem Brustkorb zu vibrieren. Doch es dauerte nicht lange, bis sich die alte Nähe wieder eingestellt hatte.
Thora warf Tom einen kurzen Blick zu und spürte, wie sich eine angenehme Wärme in ihr ausbreitete. Sie fragte sich, ob das wohl Liebe sei. Sie kannte das Gefühl nur aus Romanen, und ob man sich auf die verlassen konnte … Doch ihr Herz schlug schneller, wann immer Tom sie ansah. Es fühlte sich vertraut an. Er war ihr vertraut, schon immer, doch etwas hatte sich unbemerkt verändert.
»Ich komme im Herbst eine Weile nach Deutschland«, sagte er unvermittelt.
Thora blieb stehen und sah ihn überrascht an. »Auch zu uns?«
Die Sandfords waren schon bei ihnen zu Besuch gewesen, aber sie konnte sich kaum daran erinnern. Nun stellte sie sich vor, wie sie Tom ihre Stadt zeigen würde, das Münster, die elegante Kaiser-Friedrich-Halle, die Geschäfte in der belebten Krefelder Straße. Sie könnte auch mit ihm nach Düsseldorf fahren, die Stadt war weltläufiger als Gladbach, und sie könnten dort ins Theater oder in die Oper gehen, über die Königsallee oder am Rhein entlangspazieren.
»Natürlich. Mein Vater möchte, dass ich seine deutschen Geschäftsfreunde besser kennenlerne, bevor ich in die Firma eintrete. Aber ihr seid viel mehr als Geschäftsfreunde, und darum gönne ich mir ein paar angenehme Tage bei euch, bevor ich weiterreise.«
Sie setzten ihren Weg langsam fort. »Das wäre schön«, sagte Thora leise.
Warme Finger legten sich um ihre Hand und zogen kaum merklich daran. Sie drehte sich zu Tom, sah aber nicht ihn an, sondern an sich hinunter auf ihr weißes Kleid und die hellblauen Schuhe, die darunter hervorschauten. Jetzt ging ihr Atem doch schneller, sie legte die freie Hand auf seine und drückte sanft, um ihn zu ermutigen. Dann schaute sie hoch und sah in seine braunen Augen, die wie Bernstein schimmerten. Er lächelte, beugte sich langsam vor und küsste sie behutsam auf den Mund. Es war kein leidenschaftlicher Kuss, eher ein Versprechen.
Sie hatten so viel Zeit, dachte Thora. Vor dem Schlafengehen würde sie Hannes davon erzählen, wie sie ihm immer alles erzählte, denn er war der beste Bruder der Welt. Und Toms Freund.
Natürlich würde er sie aufziehen und ein paar respektlose Bemerkungen machen, wie es seine Art war, aber sie wusste auch, dass er sich ehrlich für sie freuen würde. Und im Herbst, wenn Tom zu Besuch kam, würden sie Ausflüge machen und tanzen und Kuchen essen, und wenn sie mit ihm allein sein wollte, würde Hannes ihr ein Alibi geben. So nannte man das doch in Kriminalromanen.
München-Gladbach, Sonntag, 6. April 1919
Als Thora den Bahnhof von Gladbach erreichte, verstärkte sich das Gefühl, in einem anderen Land zu sein. Denn hier, kaum dreißig Kilometer von Düsseldorf entfernt, patrouillierten Männer in belgischen Uniformen. Es war schwer zu begreifen, dass ihre Heimat so zerrissen war. Die Stadt, die sie genau zu kennen glaubte und in der sie fast ihr ganzes Leben verbracht hatte, schien ihr zu entgleiten.
Ein Soldat pfiff durchdringend, was womöglich auf ihren hochgezogenen Rock zurückzuführen war, doch die anderen beachteten sie nicht weiter.
Als Thora die kleine Grünanlage auf dem Bahnhofsvorplatz sah, fühlte sie sich ein wenig heimischer. Straßenbahnen fuhren klingelnd vorbei, Menschen, die vom Kirchgang kamen, spazierten an den Geschäften entlang, alles wirkte friedlich, wie in früherer Zeit. Einen Moment lang konnte sie sich einreden, dass es an diesem Bahnhof nie eine Verbandsstation gegeben hatte, dass sie ihren Bruder hier nie an die Front verabschiedet und im Heimaturlaub begrüßt hatte.
Auf den ersten Blick hatte sich kaum etwas verändert, und die scheinbare Beständigkeit ließ ihr die Illusion noch eine Sekunde länger. Sie schaute im Vorbeifahren in die Schaufenster, in denen sich feine Lederwaren und Seifen, Wäsche und Zigarren stapelten, als wollte man diskret verbergen, dass es am Wesentlichsten mangelte – an Lebensmitteln.
Als sie nach rechts in die Bismarckstraße bog, bemerkte Thora einen Bettler auf dem Boden, an die Hauswand gelehnt, die Krücken neben sich, die umgeschlagenen Hosenbeine wie leere Beutel auf dem grauen Straßenpflaster. Er streckte nicht die Hand aus, sprach die Vorübergehenden nicht an, hatte nur die Hand leicht auf der Krempe des verschlissenen Hutes, der mit der Öffnung nach oben neben den verhüllten Beinstümpfen ruhte.
Thora hielt an, stieg ab und legte ihm einige Münzen in den Hut, worauf er sich mit leiser Stimme bedankte. Sie sah den Mann flüchtig an. Er war ihr unbekannt, und doch fühlte sie einen Stich im Herzen. Wie froh sie war, dass ihr Bruder unversehrt aus dem Krieg zurückgekommen war.
Der Gedanke an Hannes trieb sie schneller voran. Nun, da sie fast zu Hause war, schlug ihr Herz sehr heftig. Vor ihr tauchte die Kaiser-Friedrich-Halle auf, eingerahmt vom ersten Frühlingsgrün des Kaiserparks.
Früher war sie mit Hannes dorthin gegangen, um Verstecken zu spielen, bevor es ihm zu peinlich wurde, sich mit seiner kleinen Schwester zu zeigen. Einmal hatte er sich so gut versteckt, dass Thora ihn nicht hatte finden können, und sie hatte sich auf den Weg gesetzt und furchtbar geweint. Eine Dame mit großem Blumenhut war vorbeigekommen und hatte sie mitleidig angesprochen. Hannes hatte das von seinem Versteck aus beobachtet und sich nicht mehr getraut herauszukommen, weil er – nicht zu Unrecht – fürchtete, von der Spaziergängerin ausgeschimpft zu werden. Also hatte er zugesehen, wie die Dame Thora an die Hand genommen und über die Straße nach Hause begleitet hatte. Am Abend hatte es ein gewaltiges Donnerwetter gesetzt, und Hannes hatte ihr seine Portion Pudding gegeben, um die Missetat wiedergutzumachen.
Als Thora endlich in die Hohenzollernstraße bog, sah sie das vertraute Haus mit dem Erker, der sich wie eine grüßende Hand über den Gehweg wölbte. Sie sprang vom Rad, konnte es kaum erwarten, ihre Eltern zu umarmen und ganz rasch nach oben zu ihrem Bruder zu laufen.
Sie klingelte und hörte Schritte, dann öffnete Auguste, das Dienstmädchen, die Haustür. Sie wich einen Schritt zurück und sah Thora überrascht an. »Fräulein Thora, wir wussten nicht – guten Morgen, kommen Sie doch herein. Ich stelle das Rad gleich auf den Hof.«
Sie trat in den Flur mit den vertrauten bunten Fliesen in Rot, Grau, Gelb und Schwarz. Als Kind war sie das Muster manchmal mit dem Finger nachgefahren und hatte sich dabei vorgestellt, sie selbst würde den Boden so schön bemalen.
Es war ungewöhnlich still im Haus. Ihre Eltern besuchten jeden Sonntagmorgen die Messe und müssten um diese Zeit eigentlich bereits zurück sein. Denkbar, dass Papa zum Frühschoppen gegangen war, aber ihre Mutter eilte meist geschäftig umher, ordnete hier etwas, gab dort eine Anweisung fürs Sonntagsessen. Heute jedoch war nichts zu hören.
»Wo ist meine Mutter?«
Erst jetzt bemerkte Thora, dass das Hausmädchen bedrückt wirkte. Sie hatte den Finger in ihre Schürze gebohrt und wickelte den Stoff verlegen um den Finger.
»Was ist denn los, Auguste?«
In diesem Moment erklangen Schritte auf der Treppe, und ihre Mutter kam herunter. Thora lief ihr entgegen und warf sich in ihre Arme. »Ich bin so froh, wir haben uns so lange nicht gesehen!«
Noch während sich die Arme ihrer Mutter um sie legten und sie den vertrauten Geruch von Lavendel einatmete, spürte sie, wie hart und angespannt Mamas Körper war. Etwas stimmte nicht.
Thora löste sich vorsichtig aus der Umarmung, nahm die warmen Hände ihrer Mutter und trat einen Schritt zurück, um sie anzusehen. Sie wirkte nicht krank, aber müde und besorgt.
»Was ist denn? Sag es mir doch.«
Wortlos nahm Mama ihr Mütze und Mantel ab und hielt beides dem Hausmädchen hin. »Bring uns bitte Tee, Auguste.« Dann ergriff sie Thora sanft am Arm und schob sie zur Treppe. Die honigfarbenen Stufen mit dem roten Läufer waren ihr noch nie so lang erschienen, und sie glaubte, ihren eigenen Herzschlag zu hören.
Im Wohnzimmer ging ihre Mutter zum Erker, wo ein kleiner Tisch mit zwei lindgrün bezogenen Stühlen stand, von dem aus man auf den Kaiserpark und die Kaiser-Friedrich-Halle gegenüber blickte. Hier las oder stickte sie gern, doch als Thora sich nun mit ihr dort hinsetzte, wirkte die Situation plötzlich seltsam ernst und feierlich.
»Es ist gut, dass du gekommen bist«, sagte ihre Mutter. »Wir hätten dir sonst ein Telegramm geschickt.«
Eine Faust bohrte sich in Thoras Magen. Auf einmal gerann die unbestimmte Angst, die sie seit Hannes’ Brief verspürt hatte, zu einem harten Klumpen, um den herum sie kaum noch atmen konnte.
»Was ist passiert? Ist etwas mit Papa?« Doch noch während sie das fragte, wusste sie, dass es nichts mit ihrem Vater zu tun hatte. »Es geht um Hannes, oder?«
Der Gesichtsausdruck ihrer Mutter nahm die Antwort vorweg. Etwas Schreckliches musste geschehen sein, Möglichkeiten zuckten blitzschnell durch Thoras Kopf: Hannes hatte einen Unfall erlitten, die Kriegsverletzung war wieder aufgebrochen, er war tot.
»Er ist vorgestern Abend nicht nach Hause gekommen.«
Thora brauchte einen Moment, um sich aus ihren dahinrasenden Gedanken zu befreien. Sie begriff zuerst nicht, was sie hörte. »Wie bitte?«
Ihre Mutter schaute sie ernst an, so wie früher, wenn Thora sich irgendwohin geträumt hatte, während man mit ihr sprach. »Dein Bruder ist am Freitagmorgen aus dem Haus gegangen und seither nicht zurückgekommen. Papa ist in der Firma und versucht, telefonisch etwas herauszufinden.«
»Wo wollte Hannes denn hin?« Sie verstand immer noch nicht ganz. »Er arbeitet doch bei Papa in der Firma.«
Ihre Mutter wirkte jetzt ungeduldig. »Er hatte sich den Freitag freigenommen und nur gesagt, er habe etwas vor. In diesen Zeiten wäre er nie über Nacht weggeblieben, ohne es uns zu sagen, schon gar nicht zwei Nächte lang.«
Thora dachte sofort an den Brief, an Hannes’ Andeutungen, die vage und dramatisch zugleich klangen. Sie versuchte, sich an die genauen Worte zu erinnern. Ich habe Dir unendlich viel zu erzählen, Dinge, die ich seit Jahren tief und still in mir getragen habe und die ich Dir nicht auf Papier mitteilen kann. Ich habe lange mit mir gerungen, doch Du musst und sollst es erfahren. Keine Andeutung, worum es dabei gehen könnte, nur diese Sätze, die so viel und doch so wenig sagten. Und er hatte sich glücklich und verzweifelt zugleich genannt.
Sie erinnerte sich an ein Gespräch im vergangenen Dezember. Sie war gerade beim Packen gewesen, weil sie nach Düsseldorf zurückkehren wollte, wo das Theater und ihr Zimmer bei der Witwe Hendricks warteten. Thora hätte gern mehr Zeit mit ihrem Bruder verbracht, aber niemand wusste, was passieren würde, wenn die Belgier erst in der Stadt wären. Sie fürchtete, in Gladbach festzusitzen und den Platz an der Schauspielschule zu verlieren.