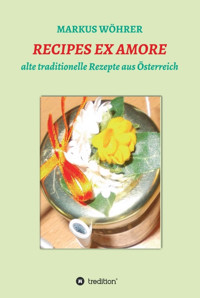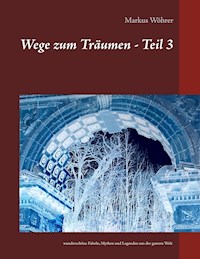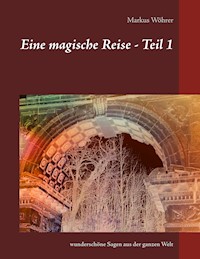Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Jedes Volk hat seine spezifische Art, geschichtliche Ereignisse in Legenden oder Symbole umzusetzen, und gewiss weicht oft am Ende die Legende erheblich von dem eigentlichen Geschehen ab. (Marion Hedda Ilse Gräfin Dönhof) Im zweiten Teil widme ich mich Sagengeschichten einiger indigener Völker, germanischen Sagen, normannischen Sagen, römischen Sagen, Sagen der Antike, keltischen Sagen, Sagen aus dem Mittelalter, gotischen Sagen, Sagen aus Persien und den Abschluss bilden Sagen aus der Türkei. Teil 3 meiner Sagenbuchreihe wird von mir mit der Hand geschrieben. Ich möchte wieder zurück zum Schreiben von Büchern wie es einige große Autoren in früheren Zeiten, wo es noch keine Computer oder Schreibmaschinen gegeben hat, gemacht haben. Das Buch wird von mir mit Schreibfeder geschrieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine magische Reise – Teil 2
wunderschöne Sagen aus der ganzen Welt
Im zweiten Teil widme ich mich Sagengeschichten einiger indigener Völker, germanischen Sagen, normannischen Sagen, römischen Sagen, Sagen der Antike, keltischen Sagen, Sagen aus dem Mittelalter, gotischen Sagen, Sagen aus Persien und den Abschluss bilden Sagen aus der Türkei.
Teil 3 meiner Sagenbuchreihe wird von mir mit der Hand geschrieben. Ich möchte wieder zurück zum Schreiben von Büchern wie es einige große Autoren in früheren Zeiten, wo es noch keine Computer oder Schreibmaschinen gegeben hat, gemacht haben. Das Buch wird von mir mit der Schreibfeder geschrieben.
Wer träumt nicht von einer „Weltreise“?
Viel Spaß beim Reisen und beim Träumen!
Inhaltsverzeichnis
Indianer
Aus dem Sagenkosmos der Wyandot-Indianer
Der See des Stein-Pumas
Die Entstehung des Reiches
Die fünf Nationen
Iskodä und der Präriejunge…
Der rote Schwan
Die Geschichte eines Rotfuchses
Mitscha Makwe
Germanische Sagen
Die Schlacht vor Raben
Tannhäuser
Lohengrin
Gudrun
Siegfried und Kriemhild
Normannische Sagen
Baldurs Tod
Vom Anfang der Welt
Die Götterdämmerung (Ragnarök)
Römische Sagen
Die Gründung Roms
Der Kampf der Horatier und Kuriatier
Der Auszug zum heiligen Berg
Sagen der Antike
Virgil im Korb
Der Tod des Virgil
Keltische Sagen
Warum Usnechs Söhne das Land verließen
Warum Art der Einzige genannt wurde
Mittelalter
König Rother
Gotische Sagen
Beowulf
Persien
Kaiser von Persien
Türkei
Asena-Legende
Üselek
Oguzname
Manas-Epos
Indianer
Indianer ist die im Deutschen verbreitete Sammelbezeichnung für die indigenen Völker Amerikas (ausgenommen die Eskimovölker und Aleuten der arktischen Gebiete), sowie der amerikanischen Pazifikinseln. Ihre Vorfahren haben Amerika in frühgeschichtlicher Zeit von Asien aus besiedelt und dort eine Vielzahl von Kulturen und Sprachen entwickelt. „Indianer“ ist dabei eine Fremdbezeichnung durch die Kolonialisten, eine entsprechende Selbstbetitelung der weit über zweitausend Gruppen besteht nicht.
-Info von Wikipedia-
Aus dem Sagenkosmos der Wyandot-Indianer
Menabuscho hatte einst einen Hirsch geschossen und wusste nun nicht, von welcher Seite er eigentlich anfangen sollte, ihn zu essen.
„Fang ich vom Kopf an“, sprach er zu sich selbst, „so sagen die Leute, ich habe ihn kopfwärts gegessen; fange ich an der Seite an, so sagen sie, ich habe ihn seitwärts gegessen und fange ich beim Schwanz an, so lachen mich alle aus und rufen: Menabuscho hat seinen Hirsch schwanzwärts gegessen.“
Während er sich so mit diesen unnützen Gedanken beschäftigte, kam ein stürmischer Wind auf und die Zweige eines nahen Baumes rieben so geräuschvoll aneinander, dass Menabuscho ärgerlich wurde und beschloss, die lärmenden Äste abzuhauen. Er kletterte also auf den hohen Baum; doch kaum war er oben angelangt, da lief ein Rudel hungriger Wölfe herbei, und fraßen den fetten Hirsch vor seinen Augen, ohne dass er es hätte verhindern können.
Seit jenem Tage sagen die alten Medizinmänner: „Wenn du ein leckeres Stück Fleisch besitzt, so kümmere dich nicht um Nebensachen.“
Der See des Stein-Pumas
Dieser Sage nach gab es vor langer Zeit am Titicaca-See ein sehr fruchtbares Tal, in dem die Menschen glücklich und zufrieden miteinander lebten. Neid, Hass, Tod und Missgunst kannten sie nicht. Sie litten weder Hunger noch Not. Die Götter der Berge, die Apus, beschützten das Volk. Als Gegenleistung verlangten sie nichts weiter, als ein Verbot zu respektieren: Niemand sollte zu keinem Zeitpunkt in die Berge wandern, wo das heilige Feuer loderte.
Keiner der glücklichen Bewohner kam auf die Idee, die Götter zu hintergehen und sich Zugang zu dem Feuer zu verschaffen. Doch dem Teufel, der sein Dasein in Dunkelheit fristen musste, sagte diese Harmonie überhaupt nicht zu.
Er begann, Unfriede unter den Menschen zu säen und sie heraus zu fordern: „Habt ihr keinen Mut? Traut ihr euch nicht, das heilige Feuer aus den Bergen zu holen?“
Er setzte den Menschen solange zu, bis sie sich eines Morgens in die Berge aufmachten. Doch schon nach kurzer Wanderung wurden sie von den Göttern überrascht, die sie wegen ihres Ungehorsams bestrafen wollten:
Sie hetzten Tausende von Pumas auf die unglücklichen Männer. Diese flehten den Dämon um Hilfe an, der sich aber nicht blicken ließ. Als der Sonnengott Inti dieses Trauerspiel mit ansehen musste, vergoss er bittere Tränen. Es waren so viele, dass sich nach 40 Tagen das ganze Tal mit Wasser gefüllt hatte. Nur ein Mann und eine Frau konnten sich im Boot vor der Überschwemmung retten. Als die Sonne wieder aufging, erblickten sie einen riesigen See. In den Fluten trieben die leblosen Körper der Pumas, die sich in Steinstatuen verwandelt hatten. Das ist auch der Grund, warum sich der Titicaca-See „See der Stein-Pumas“ nennt.
Die Entstehung des Reiches
Von einer Reise nach Tambotoco brachte Manco Cápac ein heiliges Objekt mit, das aussah wie ein Vogel und „Inti“ oder auch „Bruder“ genannt wurde.
Jeder Inca war in Besitz eines ähnlichen heiligen Gegenstandes, der an die Nachkommen weitergegeben und in einem aus Stroh geflochtenen Kasten aufbewahrt wurde.
Fünf Generationen durften diese Kiste nicht öffnen. Der vierte Herrscher des Königreiches Cusco, Mayta Cápac, dessen Mutter ihn schon nach drei Monaten zur Welt gebracht haben soll, tat es schließlich.
Kaum aus der Kiste befreit, fing der Vogel „Inti“ an, mit ihm zu sprechen und ihm Ratschläge zur Kriegsführung zu erteilen.
Tatsächlich war Mayta Cápacs Regierungszeit geprägt von Kämpfen um die Stadt Cusco, die sein Volk mit den Nachbarn, den Allcahuiza, führte.
In Chroniken wird er als großer Krieger beschrieben, der auch weiter entfernte Gebiete wie den Titicaca-See, Potosi und Arequipa einnahm. Zwar blieb sein Herrschaftsgebiet auf das Cusco-Tal beschränkt, doch er besiegte schließlich seine Feinde, die Allcahuiza.
Auch seine Nachkommen führten Kriege – und das in größerem Stil: Die Inka eroberten immer neue Ländereien und unterdrückten in ihrer Blütezeit fast 250 Völker:
Wie der Vogel prophezeit hatte, war durch die Kriegsführung der Inka ein riesiges Imperium entstanden.
Die fünf Nationen
Als Owäneo, der Große Geist, Aekänischiodschensi oder die Erde aus dem Wasser entstehen ließ, sagte er zu seinem himmlischen Bruder: "Lass uns einige rote Menschen machen, die das schöne Land bewohnen mögen!"
Darauf bestreute er die Felsen von Onondaga mit rotem Samen, der in kurzer Zeit zu Würmern wurde, in die sich später die vielen umherirrenden Zwerggeister versteckten. Dann wurde die Erde von den Wolken bewässert und von der Sonne schön gewärmt, so dass die kleinen Würmer mit den Geisterchen darin recht prächtig wuchsen, Arme und Beine bekamen und sich aus der Erde hervorarbeiten konnten. Schon nach neun Monaten wurden perfekte Knaben und Mädchen daraus, die Owäneo mit einem warmen Mantel umhüllte und mit Milch aus seinen Fingernägeln tränkte.
So pflegte er sie sorgfältig neun Sommer lang. In den nächsten neun Sommern lehrte er sie die Kunst des Lebens, schuf Bäume, Pflanzen und Tiere für sie und berief sie dann zu einer großen Versammlung ein.
"Hört!" redete er sie an. "Ihr seid fünf Nationen, denn ihr seid fünf Händen voll Samen entsprungen. Ihr seid alle Brüder und Schwestern, und ich bin euer Vater, der euch großgezogen hat.
Mohawks, ich habe euch kühn und tapfer gemacht; euch gehört das Korn der Erde.
Senecas, ihr seid fleißig und gewerbsam; ihr sollt die Bohnen haben.
Oneidas, ihr seid geduldig und still; euch sollen die Nüsse und die übrigen Baumfrüchte gehören. Cayugas, ihr seid stark und großmütig; die Wurzeln sind euer Eigentum.
Onondagas, ihr seid weise, gerecht und beredsam; euch habe ich Melonen und Trauben zur Nahrung gegeben.
Der Tabak und die Tiere des Waldes, des Flusses und der Luft gehören euch gemeinsam. Ihr seid die besten Menschen der ganzen Erde, deshalb habe ich euch auch das beste Land gegeben, das ihr so lange bewohnen sollt, als es die Sonne bescheint, der Mond erleuchtet und der Himmel mit Regen tränkt. Wenn ihr mich liebt und euch gegenseitig in Not und Elend beisteht, so werde ich euch stets beschützen und eure Heimat gegen die fremden Kinder anderer Götter verteidigen. Die Körper, die ich euch gegeben habe, werden mit der Zeit alt und unbrauchbar werden; aber ich kann nicht immer bei euch sein und euch ständig mit neuen versehen; ich habe euch daher so eingerichtet, dass ihr selbst neue schaffen könnt."
Darauf wickelte sich der Große Geist in eine lichte Wolke und schwebte pfeilschnell der Sonne zu.
Iskodä oder der Präriejunge, der Sonne und Mond besuchte
An einem allerliebsten Sommermorgen gingen fünf junge Männer und ein zehnjähriger Knabe namens Iskodä in aller Früh auf die Jagd. Sie hatten schon einen ziemlich bedeutenden Weg hinter sich, als die Sonne plötzlich aufging.
"Wie nahe sie ist", sagte der älteste von ihnen. "Wahrlich, es muss eine Kleinigkeit sein, sie noch heute zu erreichen, und wenn ihr mich begleiten wollt, so gehe ich hin."
Damit waren denn auch alle einverstanden; sogar der Kleine musste mitgenommen werden, weil er drohte, nach Hause zu gehen und es den Eltern zu sagen. Sie machten sich also auf die Reise und marschierten immer nach einer Richtung, aber sie kamen der Sonne nicht näher. Sie marschierten tagelang und waren am Abend ihrem Ziel geradeso nahe als am Morgen. Zuletzt nahmen sie also ihren Weg mehr nach Waban oder Osten, dem Platz des Lichts, aber da überraschte sie plötzlich der Winter.
Sie bauten nun eine Hütte, räucherten den nötigen Vorrat von Fleisch und lebten im Allgemeinen recht sorgenlos. Keiner war unzufrieden, und keiner verlor den Mut, sogar dann nicht, nachdem sie noch einige weitere Winter in denselben Verhältnissen verlebt hatten. Eines Tages kamen sie an einen breiten, nach Osten ziehenden Fluss, dem sie mehrere Tage folgten, bis sie zuletzt an einem großen See standen, der ohne Ufer zu sein schien. Einige tranken daraus, spuckten aber das Wasser gleich wieder aus und riefen: "Schiwitagan-Abo! (Salzwasser)"
Sie standen am Ozean. Während sie so das endlose Wasser betrachteten, kam es ihnen vor, als entstiege die Sonne dem Meer auf der entgegengesetzten Seite.
"Fasst Mut", sagte der älteste, "und lässt uns um den See herumgehen."
Das taten sie denn auch, aber bald sahen sie sich vor einem breiten Fluss, der ihnen im Weg war. Sie bauten nun eine kleine Hütte und zündeten ein Feuer an, und während sie dabeisaßen und allerlei Pläne hinsichtlich der Weiterreise schmiedeten, fragte einer, ob denn noch niemand von ihnen von der Kunst, wie man auf dem Wasser geht, geträumt habe. Aber er erhielt nur stummes Kopfschütteln zur Antwort.
Am anderen Morgen sagte der Älteste: "Ich habe diese Nacht einen merkwürdigen Traum gehabt: Mein Schutzgeist erschien mir und befahl, südwärts zu wandern; dort würde ich an einen Fluss mit hohen Ufern kommen, in dem eine Insel sei, die mir entgegenkäme."
Darauf wurde beschlossen, nach Süden zu gehen. Nach kurzer Zeit waren sie an dem besagten Fluss, und eine kleine Insel steuerte langsam auf sie zu.
"Das ist ein böser Manitu, der uns verderben will!" riefen einige und wollten sich im Wald verstecken, aber der Anführer beredete sie, dass sie blieben. Danach kam eine Gestalt von der Insel auf sie zu, die sah aus, als hätte sie Flügel, mit denen sie ständig im Wasser plätscherte, worauf sich alle ängstlich im Dickicht verkrochen, um so aus sicherem Versteck den fremden Ankömmling zu betrachten. Ein Mann erschien und rief ihnen einige Worte zu, aber sie verstanden diese nicht. Nun lud er die sechs Abenteurer ein, in sein Schiff zu kommen und mit ihm auf die Insel zu fahren, was sie auch nach kurzem Zögern taten. Auf dieser befanden sich eine Menge weißer Leute, deren Chief sie sehr aufmerksam und zuvorkommend behandelte. Dann mussten sie in ein größeres Schiff steigen, das himmelhohe Segel führte und pfeilschnell dahinschoß. Bald verloren sie das Land aus den Augen, und die schlimme Seekrankheit stellte sich ein, wovon sie jedoch bald wieder genasen. Während sie so von den mächtigen Wellen hin und her geschleudert wurden, erschien Iskodäs Schutzgeist und teilte ihm mit, dass die weißen Hutleute, auf deren Schiff sie sich befänden, lauter Freunde seien, die sie in ihr Land führen wollten. Auch würde er ihm bald seine Ohren öffnen, dass er sie verstehen könne.
Als sie nun dreißig Sonnenuntergänge auf dem Wasser umhergesegelt waren, schrien die Leute alle auf einmal "Land! Land!" und wechselten ihre Kleider. Kanonen donnerten von allen Seiten, und ein kleineres Schiff fuhr auf sie zu und brachte sie auf festen Boden. Dann nahm sie ein glänzender Wagen auf und fuhr sie in ein silberstrahlendes Zimmer zu einem alten Chief, der sie fragte, woher sie kämen und was eigentlich der Zweck ihrer Reise sei.
Sie erzählten ihm alles. Darauf setzte er ihnen in einer langen Rede die vielen Gefahren ihres Vorhabens auseinander und bat sie, diesen unglücklichen Plan aufzugeben; auch wohne nicht weit von hier ein mächtiger Manitu, der die Gedanken eines jeden Menschen kenne und alles aufbieten werde, sie zu vernichten.
"Vater", sagte Iskodä darauf, "unser Leben ist von keinem so großen Wert, als dass wir es nicht für unseren Plan einsetzen sollten. Sind wir nun einmal so weit gereist, so wäre es töricht, wenn wir jetzt wieder umkehrten." Nun bot ihnen der Chief an, sie wieder in ihre Heimat zurückzubringen; aber sie bestanden hartnäckig auf der Fortsetzung ihrer Reise. Darauf gab er ihnen viele wertvolle Geschenke, ließ ihre Säcke mit Lebensmitteln füllen, und jeder musste ein neues Gewand anziehen. Hierauf teilte er ihnen noch mit, dass sie schon nach drei Tagen die Rassel des bösen Manitu hören würden. Dann reisten sie ab. Die Tiere, die Vögel und die Bäume, die sie rundum sahen, waren ganz verschieden von denen ihrer Heimat, ebenso auch die Blumen und Feldfrüchte. Da ihre neuen Kleider bald zerrissen, so mussten sie ihre alten Lederanzüge wieder hervorsuchen. Die drei Tage aber, von denen ihnen der große Chief gesagt hatte, waren drei Jahre, und am Ende des dritten Jahres hörten sie auch wirklich die entfernten Töne einer großen Rassel. Da überraschte sie einst die Nacht auf einer weiten sumpfigen Ebene, wo sie sich schnell die trockenste Stelle auswählten, um sich ein wenig auszuruhen und zu erfrischen. Während des Essens ertönte das Instrument des Bösen Geistes so stark, dass der ganze Erdboden davon erzitterte. Nachdem sie sich wieder recht erholt hatten, gingen sie weiter und kamen in ein fein gebautes, hell erleuchtetes Haus, an dessen Tür sie ein alter Mann bewillkommnete.
"Es freut mich ungemein, meine Kinder", sagte er, "euch endlich bei mir zu sehen; ich weiß, wann ihr abgereist seid und wo ihr zuletzt geschlafen habt. Kommt herein, erzählt mir von eurem Land, und erquickt euch dabei an dem Besten, was ich euch zu bieten vermag."
Sie nahmen diese freundliche Einladung dankbar an und unterhielten dann den Alten, so gut sie es vermochten. Auch teilten sie ihm ihren Plan mit.
"Ich glaube nicht", sagte er darauf, "dass ihr alle wieder glücklich zurückkommt, aber da ihr bereits drei Viertel des Weges hinter euch habt, so will ich euch auch nicht mehr zurückhalten. Wenn ihr diesen Platz verlassen habt, werdet ihr bald ein donnerähnliches Geräusch hören, das dadurch entsteht, dass der Himmel ständig gegen die Erde stößt. Ihr müsst euch nicht fürchten und augenblicklich, sobald ihr bemerkt, dass sich der Himmel nach oben bewegt, in den dadurch entstandenen Zwischenraum springen. Dann werdet ihr in eine unfreundliche, schneeige Gegend kommen, die nur vom Mond schwach beleuchtet wird." Darauf entstand eine lange Pause.
"Ich habe euch nun", fuhr der Alte fort, "euer nächstes Reiseziel gesagt und möchte euch jetzt gern noch etwas fragen. Habt ihr nie von einem Bösen Geist gehört, der in eurem Land allerlei schreckliche Verwüstungen angerichtet hat, von denen sich noch heute dort die Spuren finden?" Die Fremden besannen sich eine Zeitlang und erwähnten dann, dass der einzige, von dem niemand etwas Gutes zu erzählen wisse, unter dem Namen Menabuscho bekannt sei.
"Das bin ich", sagte der Alte. "Ich bin an diesen Ort gezogen, um meine Schlechtigkeiten zu bereuen und diese durch ein gottgefälliges Leben wiedergutzumachen."
Die sechs Reisenden erschraken darüber fast zu Tode und zitterten wie Espenlaub.
"Seht ihr das kleine spitze Häuschen dort unten?" fragte der Alte nach einer Weile. "Teilt ihm eure Wünsche mit, und es wird euch günstige Antworten zuflüstern."
Der erste wünschte ewig zu leben und nie Not zu leiden. Die Antwort war befriedigend. Der zweite stellte denselben Wunsch mit demselben Resultat. Der dritte wollte nur etwas länger leben als gewöhnlich und besonders auf seinen Kriegsfahrten glücklich sein. Auch ihm wurde sein Wunsch gewährt; ebenso auch dem vierten, der sich dasselbe ausbat. Der fünfte und der sechste waren am bescheidensten, und sie begnügten sich mit der gewöhnlichen Lebensdauer und gutem Erfolg auf ihren Jagdzügen, damit sie immer imstande seien, ihre Eltern und die darbenden Verwandten zu ernähren. Danach machten sie sich zur Weiterreise fertig.
Sie hatten sich ein ganzes Jahr bei Menabuscho aufgehalten, trotzdem dieser sagte, es sei nur ein Tag gewesen.
Als sie vor seiner Tür standen, um Abschied zu nehmen, sagte er: "Wartet ein wenig, damit ich gleich die Bitte den zweien, die sich ein ewiges Leben ausbaten, erfüllen kann!" Darauf verwandelte er den einen in einen Felsen und den anderen in eine hohe Zeder. Die übrigen vier setzten unbelästigt ihre Reise fort, und in kurzer Zeit hörten sie das schreckliche Getöse des Himmels, der ständig gegen die Erde stieß. Fürchterliche Stürme erhoben sich, und die Wanderer hatten große Mühe, sich auf den Füßen zu halten. Die Sonne ging ihnen ganz dicht über den Köpfen weg. Die besagte Spalte wurde nun auch sichtbar, und jene, die sich mit der Erfüllung bescheidener Wünsche begnügt hatten, sprangen glücklich hindurch; die anderen aber zauderten noch eine Weile; währenddem aber stieß der Himmel plötzlich gegen die Erde und zerdrückte sie beide zu schwarzem Brei. Die zwei erfolgreichen Männer, als deren Anführer nun Iskodä galt, sahen sich in einem reizenden Land, das der Mond freundlich erleuchtete. Als sie etwas weitergegangen waren, begegneten sie einer allerliebsten Frau mit weißem Gesicht, die sich über ihre Ankunft recht herzlich freute. Es war nämlich Frau Luna. Diese versprach ihnen, sie ihrem Bruder - der Sonne -, sobald dieser von seiner Tageslaufbahn zurückkehre, vorzustellen; und sie hielt auch Wort. Als sie darauf einige Stunden hinter dem Sonnenbruder drein marschiert und dabei recht müde geworden waren, da er gewaltige Schritte machte, drehte sich dieser um und setzte sich ein wenig zur Ruhe.
"Ich konnte", fing er an, "vorher kein Wort zu euch sprechen, weil ich meinen Ruheplatz noch nicht erreicht hatte. Erzählt mir nun eure ganze Reise, und sagt mir auch den eigentlichen Grund, der euch zu mir geführt hat." Iskodä teilte ihm nun die ganze Geschichte mit und schloss zuletzt mit dem Wunsch, sie wieder wohlbehalten auf die Erde zu geleiten und, wenn er könnte, ihnen genaue Auskunft über ihre unglücklichen Brüder zu geben.
"Eure Gefährten", sagte der Sonnenbruder, "sind große Narren gewesen; warum haben sie sich auch das gewünscht, was nur Manitus besitzen können? Euch aber will ich angenehme und sorgenfreie Tage sehen lassen und euch sicher in eure Heimat geleiten." Dann setzte er sie in einen großen Korb und ließ sie an einem langen Seil herab zu ihren hochbetagten Eltern.
Der rote Schwan
Drei Kinder, von denen das älteste kaum Kraft besaß, um einen schwachen Bogen zu spannen, hatte der plötzliche Tod ihrer Eltern zu Waisen gemacht. Der Vater war ein Einsiedler gewesen, der sich schon in seiner Jugend von seinem Stamm getrennt hatte, um ein ruhiges und ungestörtes Leben zu führen. Es schien ein guter Manitu über diesen Knaben zu wachen; sie litten nie Not, und der älteste davon wurde sogar in ganz kurzer Zeit ein tüchtiger und glücklicher Jäger. Er lehrte diese Kunst auch seine beiden Brüder, die ebenfalls darin recht erfreuliche Fortschritte machten. Da sich nun jeder einen großen Köcher machen wollte, wozu sie starke Tierhäute brauchten, so gingen sie eines Tages auf Hochwild aus, und jeder schlug seinen eigenen Weg ein, weil jeder zuerst ein Tier erlegen wollte. Adjibwe, der Jüngste, konnte sich dieses Glückes rühmen; denn gleich danach, als er sich von den anderen getrennt hatte, lief ein wohlgenährter Bär an ihm vorbei, den er mit einem gutgezielten Pfeil niederstreckte. Während er nun mit dem Abziehen der Haut beschäftigt war, kam es ihm vor, als sähe er etwas Rotes über sich hin und her wehen. Er glaubte sich zu täuschen und rieb sich die Augen, aber die geheimnisvolle Erscheinung schwebte noch immer ganz deutlich vor ihm in der Luft hin und her. Auch hörte er eine fremde Stimme, die ihn ans Ufer des nahen Sees rief. Er folgte ihr und sah einen großen roten Schwan vor sich auf dem Wasser schwimmen. Da er in Schussweite war, so sandte er gleich einen Pfeil nach ihm, der ihn zwar traf, aber wirkungslos an ihm abprallte. Der zweite Pfeil hatte denselben Erfolg, und so verschoss er auf diese Art nach und nach seinen ganzen Vorrat, ohne dem Schwan nur den geringsten Schaden zuzufügen. Danach lief er nach Hause und holte die zurückgelassenen Pfeile seiner Brüder und verschoss sie ebenfalls vergebens. Da sah er denn den roten Schwan mit großen Augen an, und es fiel ihm ein, dass sein Vater einst gesagt hatte, er habe drei magische Pfeile in seinem Medizinsack stecken. Schnell holte er diese, und als er zurückkam, war der Schwan noch immer da. Der erste Pfeil flog vorbei; der zweite kam schon etwas näher, und der dritte flog dem Schwan mitten durch den Hals, worauf er sich erhob und dem Untergange der Sonne zu segelte.
Dies ärgerte nun den jungen Odjibwe ganz gewaltig, und da er wusste, dass seine Brüder nicht sehr glimpflich mit ihm verfahren würden, wenn die magischen Pfeile fehlten, so watete er ins Wasser, um sie wiederzuholen. Aber er fand nur zwei, denn der Schwan hatte den dritten weggetragen. Nun, dachte er, soweit kann er damit doch nicht fliegen, als dass ich ihn nicht mit Leichtigkeit einholen könnte.
Odjibwe war nämlich berühmt wegen seiner Schnelligkeit; er konnte so schnell laufen, dass ein von ihm abgeschossener Pfeil weit hinter ihm niederfiel. Er lief nun den ganzen Tag durch Wälder und Täler, über Berge und Prärien, ohne jedoch dem Schwan nahe zu kommen. Als er sich am Abend ein Schlafplätzchen suchte, kam es ihm vor, als würden in seiner Nähe Bäume gefällt; aber er konnte niemanden sehen und tröstete sich vorläufig mit dem Gedanken, dass der folgende Morgen diesen Umstand wohl näher erklären werde. Mit Aufgang der Sonne raffte er sich von seinem Lager auf. Sein Weg führte ihn auf einen steilen Hügel, von dessen Spitze er eine weit ausgedehnte Stadt vor sich erblickte.
Auf dem höchsten Punkt der Stadt stand der Wächter und schrie in einem fort: "Madschi Kokoho!" Dadurch wollte er nämlich die Leute aufmerksam machen, dass ein Fremder nahe. Gleich gingen einige dem jungen Mann entgegen und führten ihn in die Hütte ihres Häuptlings. Der alte Häuptling freute sich ungemein über den schmucken Jüngling und befahl seiner Tochter, ihm augenblicklich ein kräftiges Mahl zu bereiten, seine Mokassins zu trocknen und überhaupt ein sorgsames Auge auf ihn zu haben, "damit es", wie er sagte, "meinem lieben Schwiegersohn an nichts fehle." Diese Worte klangen doch dem jungen Odjibwe etwas zu kurios; so mir nichts dir nichts zum Schwiegersohn und Ehemann gemacht zu werden, ohne dass man ihn dabei auch nur mit einer Miene gefragt hätte, kam ihm doch etwas verdächtig vor.
Aber das Mädchen war schön, und so dachte er das eheliche Leben auf kurze Zeit schon aushaken zu können. Er begab sich also gemächlich zur Ruhe und erwachte am anderen Morgen etwas früher als gewöhnlich. Einige Fragen, die er an seine junge Frau richtete, blieben unbeantwortet, und als er ihr einen Kuss geben wollte, drehte sie ihm kalt den Rücken.
"Was willst du von mir?" fragte sie endlich voll Ingrimm. "Sage mir, mein liebes Kind, ist der rote Schwan schon vorübergeflogen? Ich verfolge ihn seit gestern; denkst du, dass ich ihn einholen werde?"
"Kwapadisid! - Dummkopf!" erwiderte sie mürrisch; aber sie gab ihm später doch die Richtung an, die er einzuschlagen habe, worauf denn der junge Mann seine trockenen Mokassins anzog und seine Reise fortsetzte. Als es wieder Abend geworden war, sah er abermals eine große Stadt vor sich, deren Wächter ebenfalls in den früher erwähnten Worten den Besuch verkündete. Odjibwe wurde wieder auf die liebenswürdigste Weise in die Hütte des dortigen Chiefs geführt und musste es sich gefallen lassen, als Gemahl eines noch schöneren Mädchens zu fungieren.
Doch dieses war etwas freundlicher - wenn auch nicht viel - und gab ihm auch am anderen Morgen die genaue Richtung des roten Schwans an. Während des Tages begegnete Odjibwe nichts Besonderes auf seiner Reise. Gegen Abend kam er an eine Hütte, durch deren halboffene Tür er einen alten Mann einsam am Feuer sitzen sah.
"Nischime", sagte dieser, "komm herein und trockne deine Kleider; ich will dir inzwischen etwas zu essen kochen!" Diese Einladung war Odjibwe recht erwünscht, denn er war müde, hungrig und durstig. Der Alte schien ein Zauberer zu sein, denn auf sein Kommando kam plötzlich ein großer, mit Wasser gefüllter Kessel zur Tür hereingelaufen, hängte sich ohne Beihilfe über das Feuer, und der Alte warf dann ein einziges Maiskörnlein nebst einer Heidelbeere hinein. Das ist eine schlechte Gelegenheit, deinen fürchterlichen Hunger zu stillen, dachte Odjibwe bei sich selber; doch als ihm der Zauberer winkte, munter zuzugreifen - siehe, da war der ganze Kessel bis an den Rand voll nahrhafter Speise, und trotzdem nun Odjibwe wie einer drauflos aß, der acht Tage gehungert hat, sah man ihn doch nicht leer werden. Als er satt war, gab der Alte dem Kessel wieder ein magisches Zeichen, und dieser verschwand wieder. Danach steckten sich beide ihre Pfeifen an, und Odjibwe musste den Zweck seiner Reise erzählen. Der Zauberer ermutigte ihn zwar in seinem Unternehmen, riet ihm jedoch, sich auf das Schrecklichste vorzubereiten, da noch keiner, der dem roten Schwan gefolgt sei, zurückgekehrt wäre. Am nächsten Tag werde er einem seiner Kollegen begegnen, der ihm weitere Auskunft geben werde. So kam es denn auch. Der