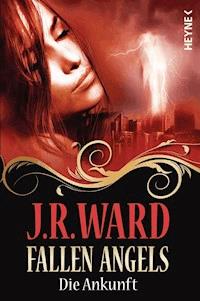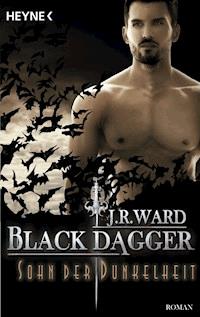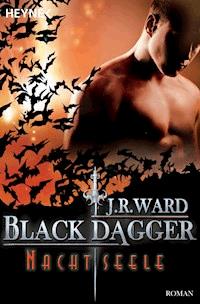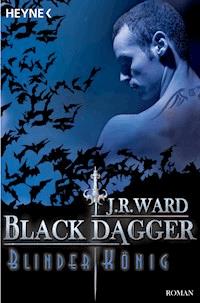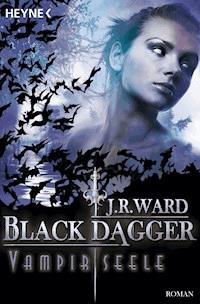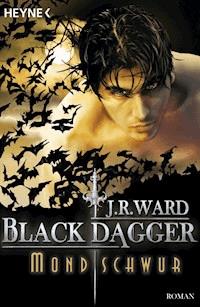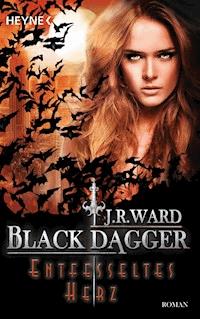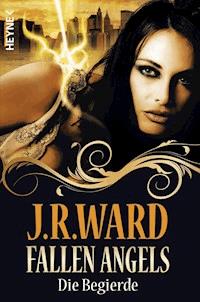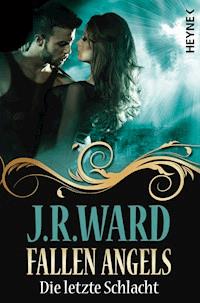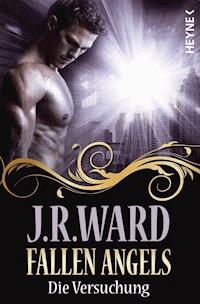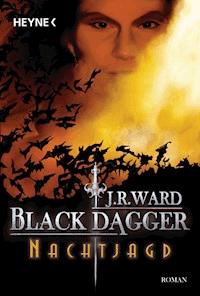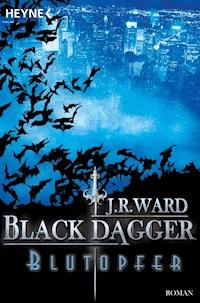Inhaltsverzeichnis
Widmung
Prolog
Eins
Zwei
Drei
Copyright
Für unseren Theo
Prolog
Dämon war so ein hässliches Wort. sahen
Und so verdammt retro. Die Leute hörten Dämon und sahen sofort ein Hieronymus-Bosch-Tohuwabohu vor sich oder - noch schlimmer - diesen bescheuerten Dante-Infernoquatsch. Ehrlich. Flammen und gemarterte Seelen, und alle sind am Heulen und Wehklagen.
Okay, die Hölle war schon einigermaßen kuschelig. Und wenn es dort einen Hofmaler gegeben hätte, dann wäre Bosch bestimmt ganz vorne mit dabei gewesen.
Aber darum ging es nicht. Der Dämon sah sich selbst eigentlich eher als Trainer des Freien Willens. Effektiver, moderner. Sozusagen das Wort zum Freitag.
Es ging ausschließlich um Einfluss.
Denn die Sache lag folgendermaßen: Die Beschaffenheit der Seele war dem menschlichen Körper mit seinen verschiedenen Bestandteilen nicht unähnlich. Die fleischliche Gestalt verfügte über eine Reihe verkümmerter Organe wie den Blinddarm, die Weisheitszähne und das Steißbein, die allesamt im besten Falle überflüssig, im schlimmsten aber in der Lage waren, das Funktionieren des großen Ganzen zu gefährden.
Genauso stand es mit der Seele. Auch sie schleppte nutzlosen Ballast mit sich herum, der ihre volle Leistungskraft beeinträchtigte. Nervige, scheinheilige, lose herumbaumelnde Schnipsel wie ein Blinddarm, der nur auf seine Entzündung wartet. Glaube und Hoffnung und Liebe … Besonnenheit, Mäßigung, Gerechtigkeit und Standhaftigkeit … dieser ganze unnütze Müll verstopfte das Herz mit zu viel Moral und stand dem angeborenen Wunsch der Seele nach Boshaftigkeit im Weg.
Die Aufgabe eines Dämons lag darin, den Leuten dabei zur Seite zu stehen, ihre innere Wahrheit erkennen und ausleben zu können, ohne von diesem ganzen Blödsinn vernebelt zu werden, der die Menschheit ablenkt. Solange alle ihrem innersten Kern treu blieben, liefen die Dinge praktisch von allein in die richtige Richtung.
Und in letzter Zeit hatte das mehr oder weniger auch funktioniert. Bei all den Kriegen auf der Welt und dem Verbrechen und der Umweltverschmutzung und dieser Finanzkloake namens Wall Street und den sozialen Ungleichheiten allerorten war die Lage so weit in Ordnung.
Aber das reichte nicht aus, und die Zeit wurde knapp.
Um einen Vergleich aus dem Sport zu bemühen - die Erde war das Spielfeld, und das Football-Match lief bereits seit Errichtung des Stadions. Die Dämonen waren die Heimmannschaft. Das Gastteam bestand aus Engeln, welche die Werbetrommel für diese Chimäre des Glücks rührten: den Himmel.
Dessen Hofmaler Thomas »Kitsch« Kincaid war, bei allem, was recht ist.
Jede Seele war quasi ein Quarterback auf dem Spielfeld, ein Teilnehmer am universalen Kampf Gut gegen Böse, und der Spielstand reflektierte den relativen moralischen Wert ihrer Taten auf Erden. Die Geburt war der Anstoß, und abgepfiffen wurde mit dem Tod - woraufhin das Ergebnis der einzelnen Seele zu der großen Strichliste hinzugefügt wurde. Die Trainer mussten an der Seitenlinie bleiben, durften aber unterschiedliche Mannschaften zu dem jeweiligen Menschen aufs Feld schicken, um den Verlauf der Dinge zu beeinflussen - und sie durften Auszeiten nehmen, um den Spieler zu motivieren und auf Kurs zu bringen.
Landläufig auch bekannt als Nahtoderfahrung.
Und genau hier lag das Problem. Wie ein Zuschauer, der ein Herbstspiel von einem kalten Plastiksitz aus verfolgte, mit zu vielen Hotdogs im Bauch und einem Parolenskandierer genau neben dem Ohr, schielte der Schöpfer längst heimlich zum nächstgelegenen Ausgang aus dem Stadion hinüber.
Zu viele Ballverluste. Zu viele Auszeiten. Zu viele Gleichstände, die zu viele unentschiedene Verlängerungen zur Folge hatten. Was einst als fesselnder Wettbewerb begann, hatte mittlerweile sichtlich an Reiz verloren, und die Mannschaften hatten ein Ultimatum gesetzt bekommen: Macht den Deckel drauf, Jungs.
Beide Seiten mussten sich also auf einen speziellen Spielmacher einigen. Auf einen Quarterback und sieben Spielzüge.
Statt einem endlosen Aufmarsch von Menschen blieben noch sieben Seelen im Ringen um Gut und Böse … sieben Chancen, um festzustellen, ob die Menschheit gut oder schlecht war. Ein Unentschieden war nicht zulässig, und es ging um … alles. Falls das Dämonenteam gewann, durfte es das Stadion und alle Spieler behalten, die es jemals gab oder geben würde. Und die Engel wurden auf ewig zu ihren Sklaven.
Dagegen war das Foltern menschlicher Sünder eine total öde Veranstaltung.
Sollten die Engel gewinnen, würde die gesamte Erde zu einem einzigen gigantischen Heiligabend werden, überrollt von einer alles umfassenden, erstickenden Woge von Glück und Wärme und Friede, Freude, Eierkuchen. In diesem abscheulichen Szenario würden die Dämonen vollkommen verschwinden, nicht nur aus dem Universum, sondern auch aus den Herzen und Köpfen der Menschheit.
Wobei - in Anbetracht des ganzen Trali-Tralas und Frohlockens war das noch das beste vorstellbare Ergebnis. Knapp vor der Vorstellung, wiederholt mit einem Essstäbchen ins Auge gestochen zu werden.
Die Dämonen hassten es zu verlieren. Das stand einfach nicht zur Debatte. Sieben Chancen waren nicht gerade viel, und das Gastteam der Engel hatte den metaphorischen Münzwurf gewonnen - das hieß, sie durften von sich aus auf den Quarterback zugehen, der die sieben »Bälle« spielen würde.
Ach, genau … der Quarterback. Wenig überraschend hatte diese Schlüsselposition zu ausgedehnten und hitzigen Diskussionen geführt. Am Ende jedoch war einer ausgewählt worden, einer, den beide Seiten akzeptabel fanden … einer, von dem beide Trainer erwarteten, er werde das Spiel gemäß ihren Werten und Zielen herumreißen.
Der arme Narr hatte keinen Schimmer, worauf er sich eingelassen hatte.
Allerdings waren die Dämonen nicht bereit, eine solch gewaltige Verantwortung auf die Schultern eines Menschen zu laden. Der freie Wille war immerhin formbar - was ja genau die Grundlage des ganzen Spiels darstellte.
Also schickten sie noch jemanden als Spieler mit aufs Feld. Das verstieß selbstverständlich gegen die Regeln, entsprach aber ihrem Wesen - und war außerdem etwas, wozu ihre Gegner nicht imstande waren.
Denn das war der entscheidende Vorteil, den die Heimmannschaft besaß: Das einzige Gute an den Engeln war, dass sie nie über den Rand rausmalten.
Das durften sie nicht.
Diese blöden Trottel.
Eins
»Die steht auf dich.«
Jim Heron hob den Blick von seinem Budweiser. Am anderen Ende des überfüllten, schummrigen Clubs, zwischen schwarz gekleideten, mit Ketten behängten Leibern, durch die dicke Luft von Sex und Verzweiflung hindurch, sah er die fragliche ›Sie‹.
Eine Frau in einem blauen Kleid stand unter einer der wenigen Deckenlampen des Iron Mask. Goldener Schein ergoss sich über ihr Brooke-Shields-braunes Haar, ihre Elfenbeinhaut und den Wahnsinnskörper. Sie war eine Erscheinung, ein strahlender Farbtupfer inmitten all der traurigen neo-viktorianischen Selbstmordkandidaten, schön wie ein Model, leuchtend wie eine Heilige.
Und sie starrte ihn tatsächlich an, obwohl Jim bezweifelte, dass sie wirklich auf ihn stand: Ihre Augen lagen tief im Schädel, was bedeutete, dass das darin funkelnde Begehren, welches seine Lungentätigkeit zum Stillstand brachte, auch einfach nur ein Nebeneffekt ihrer speziellen Kopfform sein könnte.
Oder wer weiß - vielleicht fragte sie sich schlicht und ergreifend, was sie eigentlich in diesem Laden verloren hatte. Womit sie schon zwei wären.
»Ich sag dir, die Frau steht auf dich, Alter.«
Jim warf Mr Superkuppler einen Seitenblick zu. Adrian Vogel war der Grund, warum er hier gelandet war, und das Iron Mask war definitiv Ads Baustelle: Er war von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet und an Stellen gepierct, in deren Nähe die meisten Menschen freiwillig keine Nadeln lassen würden.
»Ach was.« Jim nahm noch einen Schluck Bier. »Ich bin nicht ihr Typ.«
»Woher willst du das wissen?«
»Weiß ich eben.«
»Du bist ein Idiot.« Adrian fuhr sich mit einer Hand durch die schwarze Haarflut auf seinem Kopf, und die Strähnen legten sich sofort wieder brav in ihre Ursprungsposition, als wären sie gut dressiert. Hätte er nicht auf dem Bau gearbeitet und ein Mundwerk wie ein Matrose gehabt - man hätte ihn verdächtigen können, in der Frauenkosmetikabteilung zu wildern.
Eddie Blackhawk, der Dritte im Bunde, schüttelte den Kopf. »Nur weil er kein Interesse hat, ist er doch noch kein Idiot.«
»Sagst du.«
»Leben und leben lassen, Adrian. Das ist besser für alle.«
Eddie war mehr Biker als Goth, in seiner Jeans und den schweren Stiefeln wirkte er auf der Samtcouch ungefähr so fehl am Platze wie Jim; wobei er durch sein Kleiderschrankformat und diese eigenartigen rotbraunen Augen vermutlich nirgendwohin passte, außer vielleicht zu einem Trupp Proficatcher. Obwohl er seine Haare zu einem langen Zopf geflochten trug, veralberte ihn niemand auf der Baustelle, nicht einmal diese Dumpfbacken von Dachdeckern, die die größte Klappe von allen hatten.
»Also Jim, du bist ja auch nicht gerade gesprächig.« Adrian suchte die Menge ab, zweifellos auf der Suche nach einem blauen Kleid für sich selbst. Nachdem er die Tänzerinnen, die sich in Eisenkäfigen räkelten, eingehend betrachtet hatte, winkte er der Kellnerin. »Und nachdem ich jetzt einen Monat mit dir zusammengearbeitet habe, weiß ich, dass es nicht daran liegt, dass du dumm bist.«
»Ich hab eben nicht viel zu sagen.«
»Daran gibt’s ja an sich nichts auszusetzen«, brummelte Eddie.
Genau deshalb mochte Jim Eddie lieber. Der Bursche war ein weiteres Mitglied des Männervereins der Schweigsamen, er hätte nie ein Wort bemüht, wenn ein Nicken oder Kopfschütteln die Botschaft auch rüberbrachte. Wie er sich so gut mit Adrian angefreundet hatte, dessen Mundwerk keinen Leerlauf besaß, war ein Rätsel.
Und wie er mit dem Kerl sogar zusammenwohnen konnte, absolut unerklärlich.
Egal. Jim hatte nicht die Absicht, das Wie, Wo und Warum zu klären. Das war nicht persönlich gemeint. Die beiden waren sogar im Prinzip genau die Sorte trockene Klugscheißer, mit denen er zu einer anderen Zeit, auf einem anderen Planeten befreundet gewesen wäre. Aber hier und jetzt ging ihn ihr Mist nichts an, und er war nur mit ihnen ausgegangen, weil Adrian damit gedroht hatte, so lange zu nerven, bis er sich anschloss.
Letztlich lebte Jim nach dem Kodex der Einzelgänger und erwartete von anderen Leuten, dass sie ihn in Ruhe den einsamen Wolf spielen ließen. Seit dem Ende seiner Armeezeit vagabundierte er - in Caldwell war er nur, weil er hier zufällig das Auto angehalten hatte. Und sobald das Bauprojekt, an dem sie alle arbeiteten, abgeschlossen war, würde er sich auch wieder auf die Socken machen.
Tatsache war: In Anbetracht seines alten Chefs war es besser, immer in Bewegung zu bleiben. Es war nicht abzusehen, wann der nächste »Spezialauftrag« anstand und Jim wieder eingespannt wurde.
Jim trank sein Bier und dachte sich, wie gut es doch war, dass er nur seine Klamotten, seinen Pick-up und die kaputte Harley besaß. Klar, er hatte nicht gerade viel vorzuweisen für neununddreißig …
Ach du Scheiße … Er hatte das Datum vergessen.
Er war jetzt vierzig. Heute hatte er Geburtstag.
»Das will ich jetzt aber schon wissen.« Adrian beugte sich vor. »Hast du eine Frau, Jim? Lässt du deshalb das blaue Kleid sausen? Ich meine, mal ehrlich, die ist superscharf.«
»Gutes Aussehen allein bringt’s nicht.«
»Aber stören tut es auch nicht.«
Die Kellnerin erschien, und während die anderen eine weitere Runde bestellten, riskierte Jim einen schnellen Blick auf die Frau, um die es ging.
Sie wandte den Blick nicht ab. Zuckte nicht einmal mit der Wimper. Leckte sich einfach langsam über die roten Lippen, als hätte sie nur darauf gewartet, dass er wieder Blickkontakt herstellte.
Jim konzentrierte sich auf seine leere Bierflasche und rutschte auf dem Sitz herum. Er kam sich vor, als hätte ihm jemand glühende Kohlen in die Unterhose gesteckt. Es war lange, lange her bei ihm. Keine Durststrecke, nein, nicht einmal eine Dürreperiode. Eher schon die Sahara.
Und wer hätte das gedacht - sein Körper war durchaus willens, diese reine Handbetriebsphase zu beenden.
»Du solltest mal rübergehen«, sagte Adrian. »Dich vorstellen.«
»Mir geht’s hier prima.«
»Dann muss ich möglicherweise meine Einschätzung deiner Intelligenz noch mal überdenken.« Adrian trommelte mit den Fingern auf den Tisch, sein schwerer Silberring blitzte. »Oder zumindest die deines Sexualtriebs.«
»Bitte, tu dir keinen Zwang an.«
Adrian verdrehte die Augen, er schien eindeutig zu kapieren, dass Jim in Bezug auf das blaue Kleid nicht mit sich verhandeln ließ. »Ist ja gut, ich hör ja schon auf.«
Er ließ sich gegen die Lehne fallen, so dass er und Eddie jetzt beide in selber Pose auf dem Sofa lümmelten. Wie zu erwarten, konnte er nicht lange den Mund halten. »Habt ihr von der Schießerei gehört?«
Jim runzelte die Stirn. »Gab es etwa noch eine?«
»Mhm. Unten am Fluss wurde eine Leiche gefunden.«
»Irgendwie tauchen die gern mal dort auf.«
»Was wird nur aus dieser Welt«, sinnierte Adrian und kippte den letzten Schluck von seinem Bier hinunter.
»Die war schon immer so.«
»Glaubst du?«
Jim lehnte sich zurück, als die Kellnerin den Nachschub vor den Jungs abstellte. »Nein, das weiß ich.«
»Deinde, ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti …«
Marie-Terese Boudreau hob den Blick zum Gitterfenster des Beichtstuhls. Das Gesicht des Priesters jenseits des Sichtschutzes war zur Seite gewandt und lag im Schatten, dennoch wusste sie, wer er war. Und er kannte sie.
Daher wusste er auch nur zu gut, was sie tat und warum sie mindestens einmal pro Woche zur Beichte gehen musste.
»Geh, mein Kind. Gehab dich wohl.«
Als er die Klappe zwischen ihnen beiden schloss, überkam sie eine Panikattacke. In diesen stillen Momenten, wenn sie ihre Sünden offenlegte, wurde die entwürdigende Lage, in der sie gestrandet war, enthüllt; die Worte, die sie sprach, warfen ein helles Licht auf die entsetzlichen Dinge, die sie nachts tat.
Die hässlichen Bilder brauchten immer eine Weile, um wieder zu verblassen. Doch das Gefühl des Erstickens würde sich noch verschlimmern, wenn sie von hier weg und zu ihrem nächsten Bestimmungsort fuhr.
Sie ließ die Perlen und Glieder ihres Rosenkranzes in die Jackentasche gleiten und hob ihre Tasche vom Fußboden auf. Schritte rechts vor dem Beichtstuhl hielten sie vom Aufstehen ab. Da sie sich in ihrer Arbeit schon so entblößen musste, zog sie es an allen anderen Orten vor, unbemerkt zu bleiben.
Zudem hatte sie noch weitere Gründe, sich unauffällig zu verhalten, von denen nicht alle mit ihrer »Arbeit« zu tun hatten.
Als das Geräusch schwerer Ledersohlen wieder verklungen war, zog sie den roten Samtvorhang auf und trat hinaus.
Die St.-Patrick’s-Kathedrale von Caldwell war nur etwa halb so groß wie die in Manhattan, aber es reichte dennoch aus, um Ehrfurcht selbst in weniger streng Gläubigen hervorzurufen. Mit ihren gotischen Bögen, die an Engelsflügel gemahnten, und einer hohen Decke, die nur Zentimeter vom Himmel entfernt schien, fühlte sich Marie-Terese zugleich unwürdig und dankbar, unter diesem Dach verweilen zu dürfen.
Sie liebte den Geruch hier drinnen. Von Bienenwachs und Zitrone und Weihrauch. Herrlich.
An den Altären der Heiligen vorbei wand sie ihren Weg immer wieder um das Gerüst herum, das errichtet worden war, um die Mosaiken des Fenstergadens zu reinigen. Wie immer beruhigten sie die flackernden Votivkerzen und die gedämpften Scheinwerfer, die auf die reglosen Statuen gerichtet waren, und erinnerten sie daran, dass am Ende des irdischen Lebens ein immerwährender Friede wartete.
Vorausgesetzt, man kam an der Himmelspforte vorbei.
Die Seitentüren der Kirche waren nach achtzehn Uhr geschlossen, und wie üblich musste sie durch den Haupteingang gehen - was ihr wie eine Vergeudung der Pracht des majestätischen Portals vorkam. Die geschnitzten Flügel der Tür waren weit besser geeignet, die Hunderte von Leuten willkommen zu heißen, die jeden Sonntag zur Messe kamen … oder die Gäste feierlicher Trauungen … oder die tugendhaften Gläubigen.
Nein, sie war mehr der Typ Seiteneingang.
Zumindest war sie das jetzt.
Gerade, als sie ihr gesamtes Gewicht gegen das dicke Holz stemmte, hörte sie ein Flüstern ihres Namens und warf einen Blick zurück über die Schulter.
Da war niemand, soweit sie erkennen konnte. Es waren nicht einmal mehr Betende in den Bankreihen zu sehen.
»Hallo?«, rief sie laut, ihre Stimme hallte durch die Kirche. »Pater?«
Als keine Antwort erklang, kroch ihr ein kalter Schauer über den Rücken, und mit einem raschen Stoß warf sie sich gegen den linken Türflügel und rannte in die kalte Aprilnacht hinaus.
Den Kragen ihrer Wolljacke fest umklammernd, lief sie schnell weiter, ihre flachen Sohlen machten klack, klack, klack auf den Steinstufen und dem Bürgersteig, während sie zu ihrem Auto eilte. Sobald sie im Wagen saß, sperrte sie sämtliche Türen ab.
Keuchend sah sie sich um. Schatten kräuselten sich unter kahlen Bäumen auf dem Boden, und der Mond kam hinter dünnen Wolkenfetzen zum Vorschein. In den Häusern gegenüber bewegten sich Menschen hinter den Fenstern. Ein Kombi fuhr langsam vorbei.
Da war kein Verfolger, kein Mann in schwarzer Sturmhaube, kein lauernder Angreifer. Nichts.
Sie riss sich zusammen, überredete ihren Toyota anzuspringen und umklammerte fest das Lenkrad.
Nachdem sie in den Rückspiegel gesehen hatte, fädelte sie sich in den Verkehr Richtung Innenstadt ein. Das Licht der Straßenlaternen und der entgegenkommenden Autos blendete sie, flutete das Innere des Camrys und beleuchtete die schwarze Reisetasche auf dem Beifahrersitz. Darin befand sich ihre grauenhafte Uniform, und sobald sie einen Ausweg aus diesem Alptraum gefunden hätte, würde sie das Zeug verbrennen, zusammen mit dem, was sie im vergangenen Jahr jeden Abend am Körper getragen hatte.
Das Iron Mask war ihr zweiter »Arbeitsplatz«. Der erste war vor vier Monaten hochgegangen. Wortwörtlich.
Sie konnte nicht fassen, dass sie immer noch im Geschäft war. Jedes Mal, wenn sie die schwarze Tasche packte, hatte sie das Gefühl, in einen bösen Traum zurückgesaugt zu werden, und sie war nicht sicher, ob das Beichten es besser oder schlimmer machte. Manchmal kam es ihr vor, als wühlte sie nur Sachen auf, die besser begraben blieben, aber das Bedürfnis nach Vergebung war einfach zu stark, sie kam nicht dagegen an.
Sobald sie auf der Trade Street war, kam sie an den dicht gedrängten Clubs, Bars und Tattooläden vorbei, die Caldwells Ausgehmeile darstellten. Das Iron Mask lag am hinteren Ende, und jede Nacht war dort die Hölle los. Endlose Schlangen von Möchtegern-Zombies schoben und drängelten sich vor der Tür. Marie-Terese bog in eine Seitenstraße ab, holperte über die Schlaglöcher an den Mülltonnen vorbei und erreichte den Parkplatz.
Der Camry passte genau in eine Lücke an der Backsteinmauer, auf der »Nur für Personal« stand.
Trez Latimer, der Betreiber des Clubs, bestand darauf, dass alle Frauen, die für ihn arbeiteten, die dem Hinterausgang am nächsten liegenden Stellplätze benutzten. Er kümmerte sich genauso gut um seine Angestellten, wie der Reverend es getan hatte, und sie alle wussten das zu schätzen. Caldwell hatte seine zwielichtigen Gegenden, und das Iron Mask lag genau mittendrin.
Marie-Terese stieg aus, ihre Tasche in der Hand, und sah nach oben. Die hellen Lichter der Stadt trübten die wenigen Sterne, die zwischen den Wolkenfetzen hervorblitzten, und der Himmel schien noch weiter entfernt, als er tatsächlich war.
Sie schloss die Augen, nahm einige lange, tiefe Atemzüge und zog den Kragen ihrer Jacke hoch. In dem Moment, in dem sie den Club betrat, würde sie in den Körper und den Geist einer anderen schlüpfen. Einer Frau, die sie nicht kannte und an die sie sich in Zukunft nicht gern erinnern würde. Die sie anwiderte. Die sie verachtete.
Ein letzter Atemzug.
Unmittelbar bevor sie die Lider hob, flackerte die Panik wieder auf. Trotz der Kälte brach ihr der Schweiß unter den Kleidern und auf der Stirn aus. Ihr Herz schlug so heftig, als würde sie vor einem Straßenräuber fliehen, sie fragte sich, wie viele solche Nächte sie noch überstehen könnte. Mit jeder Woche schien die Angst schlimmer zu werden, eine Lawine, die an Fahrt gewann, sich über sie hinwegwälzte und sie mit eisigem Gewicht zudeckte.
Doch sie konnte nicht aufhören. Sie zahlte immer noch Schulden ab … manche davon waren finanzieller Natur, andere ihrem Gefühl nach existenziell. Bis sie zurück an ihrem Ausgangspunkt war, musste sie bleiben, wo sie nicht sein wollte.
Außerdem sagte sie sich, dass sie die lähmende Angst gar nicht nicht erleben wollte; es bedeutete, dass sie sich den Umständen noch nicht vollständig ergeben hatte und dass wenigstens ein Teil ihres wahren Ichs noch am Leben war.
Nicht mehr lange, betonte eine leise Stimme.
Die Hintertür des Clubs schwang auf, und eine deutliche Stimme sagte auf ganz wundervolle Art und Weise: »Alles in Ordnung, Marie-Terese?«
Sie schlug die Augen auf, setzte ihre Maske auf und schlenderte mit ruhiger Entschlossenheit auf ihren Chef zu. Zweifellos hatte Trez sie auf der Überwachungskamera gesehen. Es gab ja auch weiß Gott genug davon hier.
»Mir geht’s gut, Trez, danke.«
Er hielt ihr die Tür auf, und als sie an ihm vorbeiging, musterten sie seine dunklen Augen. Mit seiner kaffeefarbenen Haut und einem Gesicht, das durch schlanke Züge und perfekt ausgewogene Lippen äthiopisch wirkte, war Trez Latimer ein echter Hingucker - wobei das Attraktivste an ihm seine Umgangsformern waren, soweit es Marie-Terese betraf. Der Kerl war galant bis in die Zehenspitzen.
Verärgern sollte man ihn allerdings nicht.
»Das machst du jeden Abend«, sagte er nun, während er die Tür hinter ihnen beiden schloss und den schweren Riegel vorlegte. »Du stehst neben deinem Auto und schaust in den Himmel. Jeden Abend.«
»Wirklich?«
»Belästigt dich jemand?«
»Nein, aber wenn es so wäre, würde ich dir Bescheid geben.«
»Hast du etwas auf dem Herzen?«
»Nein. Alles in Ordnung.«
Trez wirkte nicht gerade überzeugt, als er sie zum Umkleideraum begleitete und an der Tür stehen blieb. »Du weißt, ich bin immer für dich da, und du kannst jederzeit mit mir reden.«
»Das weiß ich. Und danke.«
Er legte sich die Hand aufs Herz und machte eine kleine Verbeugung. »Gern geschehen. Pass gut auf dich auf.«
Der Umkleideraum war gesäumt von hohen Metallspinden, hin und wieder unterbrochen von Bänken, die am Boden festgeschraubt waren. Gegenüber von der Tür hing ein gigantischer, beleuchteter Spiegel. Die zwei Meter lange Ablage darunter war übersät von Schminkutensilien, überall flogen Haarteile und knappe Kleidchen und hochhackige Schuhe herum. Es roch nach Mädchenschweiß und Shampoo.
Wie üblich hatte Marie-Terese alles ganz für sich allein. Sie kam immer als Erste und ging auch als Erste, und nun, da sie sich im Arbeitsmodus befand, gab es auch kein Zögern mehr, keinen Schluckauf im gewohnten Ablauf.
Jacke in den Spind hängen. Schuhe aus. Gummiband aus dem Haar ziehen. Reisetasche aufreißen.
Ihre Jeans, der weiße Rolli und die marineblaue Fleecejacke wurden gegen ein Outfit getauscht, in dem sie sich nicht einmal tot im Karneval erwischen lassen wollte: Mikroskopisch kleiner Stretchrock, Neckholder-Top, dessen Rückenausschnitt bis unter den Rippenbogen hing, lange Seidenstrümpfe mit Spitzenrand am Oberschenkel und nuttige Stilettos, die ihre Zehen einquetschten.
Alles in Schwarz. Schwarz war das Markenzeichen des Iron Mask, ebenso wie es auch in dem anderen Club gewesen war.
Außerhalb der Arbeit trug sie nie Schwarz. Ungefähr einen Monat, nachdem sie in diesen Alptraum geraten war, hatte sie jeden Fitzel Kleidung weggeworfen, der auch nur eine Spur von Schwarz enthalten hatte - mit dem Ergebnis, dass sie sich extra etwas Neues kaufen musste, als sie einmal zu einer Beerdigung musste.
Vor dem beleuchteten Spiegel sprühte sie sich ein bisschen Haarspray in ihre üppige brünette Mähne und wühlte sich dann durch die Palette von Lidschatten und Rouge, wobei sie nur dunkle, glitzernde Farben wählte, die ungefähr so brav wirkten wie ein Penthouse-Cover. Dann spielte sie Ozzy Osbourne mit dem Kajalstift und klebte sich falsche Wimpern an.
Zuletzt holte sie noch aus ihrer Handtasche einen Lippenstift. Lippenstift teilte sie sich nie mit den anderen Mädels. Alle wurden einmal im Monat gründlich untersucht, aber sie ging kein Risiko ein: Sie selbst konnte kontrollieren, was sie tat und wie gewissenhaft sie auf Sicherheit achtete. Die anderen Mädchen hatten vielleicht andere Standards.
Das rote Lipgloss schmeckte nach Plastikerdbeere, aber der Lippenstift war unverzichtbar. Kein Küssen. Niemals. Die meisten Männer wussten das sowieso, aber mit dieser Fettschicht erstickte sie jede Diskussion im Keim: Keiner von den Kerlen wollte, dass seine Frau oder Freundin erfuhr, was am »Männerabend« so getrieben wurde.
Sie weigerte sich, noch einen weiteren Blick auf ihr Spiegelbild zu werfen. Schnell stand sie auf und ging hinaus, um sich dem Lärm und den Menschen und der Arbeit zu stellen. Auf dem Weg durch den langen, halbdunklen Flur zum eigentlichen Club wurden die Bässe immer lauter, genau wie das Pochen ihres Herzens in ihren Ohren.
Vielleicht war das ein und dasselbe.
Am Ende des Ganges breitete sich der Club vor ihr aus, die dunkelvioletten Wände und der schwarze Fußboden und die blutrote Decke waren so dürftig beleuchtet, dass man das Gefühl bekam, eine Höhle zu betreten. Die Atmosphäre war aufgeladen mit Versprechungen von perversem Sex, Frauen tanzten in von der Decke hängenden schmiedeeisernen Käfigen, Körper bewegten sich paarweise oder in Dreiergrüppchen zur psychedelischen, erotischen Musik, die schwer in der stickigen Luft hing.
Nachdem sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, nahm sie die anwesenden Männer in Augenschein, wobei sie ein Datenraster anwendete, von dem sie wünschte, sie hätte es sich nie angeeignet.
Man konnte die potenziellen Kandidaten nicht an ihren Klamotten erkennen oder daran, mit wem sie hier waren oder ob sie einen Ehering trugen. Auch nicht an ihrer Blickrichtung, denn alle Männer machten den Von-den-Brüsten-zur-Hüfte-Schwenk. Der Unterschied hinsichtlich der Erfolgsaussichten bestand darin, dass in manchen Blicken mehr als nur Gier lag: Während diese Männer mit den Augen einen Körper abtasteten, war der Akt ihrem Empfinden nach bereits vollzogen.
Das allerdings störte Marie-Terese nicht weiter. Nichts, was ein Mann mit ihr machen konnte, war schlimmer als das, was schon passiert war.
Und zwei Dinge wusste sie ganz genau: Irgendwann würde es drei Uhr sein. Und wie jeder Abend, und somit ihre Arbeit, ein Ende nahm, so würde auch diese Phase ihres Lebens nicht ewig dauern.
In ihren vernünftigeren, weniger depressiven Momenten sagte sie sich, dass sie diese harten Zeiten überstehen würde, so als hätte ihr Leben eine Grippe: Obwohl es schwer war, Hoffnung in die Zukunft zu haben, musste sie daran glauben, dass sie eines Tages aufwachen, ihr Gesicht der Sonne zuwenden und sich genüsslich recken würde; sie würde in dem Bewusstsein schwelgen, dass die Krankheit vorüber und ihre Gesundheit zurückgekehrt war.
Was natürlich voraussetzte, dass es wirklich nur eine Grippe war. Wenn das, was sie sich zumutete, eher wie Krebs war … dann wäre vielleicht ein Teil von ihr für immer fort, auf ewig an die Krankheit verloren.
Marie-Terese brachte ihren Kopf zum Schweigen und marschierte voran in die Menge. Niemand hatte je behauptet, das Leben wäre lustig oder leicht oder auch nur fair, und manchmal tat man, um zu überleben, Dinge, die dem achtbaren Teil des eigenen Gehirns zutiefst und vollkommen unverständlich waren.
Aber im Leben gab es keine Abkürzungen, und man musste für seine Fehler bezahlen.
Immer.
Zwei
Das Geschäft Marcus Reinhardt Juweliere, gegr. 1893, residierte in dem eleganten Backsteinbau in der Innenstadt von Caldwell, seit der Mörtel in den tiefroten Mauern getrocknet war. Während der Weltwirtschaftskrise hatte der Betrieb den Besitzer gewechselt, doch das Firmenethos war gleich geblieben und in die Zeit des Internets hinübergerettet worden: hochwertiger, exklusiver Schmuck zu konkurrenzfähigen Preisen, gepaart mit einem Service, der seinesgleichen suchte.
»Der Eiswein kühlt im Séparée, Sir.«
»Ausgezeichnet. Wir sind gleich so weit.« James Richard Jameson, Urenkel des Mannes, der das Geschäft 1936 von Mr Reinhardt erworben hatte, rückte seine Krawatte vor einer der verspiegelten Auslagen gerade.
Zufrieden mit seinem Erscheinungsbild, drehte er sich um und inspizierte die drei Angestellten, die er ausgewählt hatte, um nach Ladenschluss noch zu bleiben. Sie alle trugen einen schwarzen Anzug beziehungsweise ein Kostüm, William und Terrence dazu die gold-schwarze Krawatte mit dem Geschäftslogo, Janice eine Goldkette mit Onyx aus den 1950ern. Perfekt. Seine Leute waren so elegant und diskret wie alles andere im Laden, und jeder von ihnen konnte sich auf Englisch wie auf Französisch unterhalten.
Für das, was Reinhardt im Angebot hatte, reisten die Kunden bereitwillig von Manhattan ebenso wie von Montreal an.
Und man wurde nie enttäuscht. Überall im Verkaufsraum blitzte und funkelte es einen an, als stünde man mitten in der Milchstraße. Der Effekt der direkten Beleuchtung und der Glasvitrinen war auf eine systematische Minimierung des Unterschieds zwischen Wollen und Brauchen ausgerichtet.
Unmittelbar bevor die Standuhr die zehnte Stunde schlug, flitzte James zu einer unauffälligen Schiebetür hinüber, schnappte sich einen Staubsauger und fuhr damit über die Fußabdrücke auf dem antiken Orientteppich. Hinterher trat er rückwärts in seinen eigenen Spuren zurück zum Besenschrank, um den Boden nicht wieder zu verunreinigen.
»Ich glaube, er ist da«, meldete William von einem der vergitterten Fenster.
»Oh … mein Gott«, murmelte Janice, als sie sich neben ihrem Kollegen vorbeugte. »Das kannst du laut sagen.«
James versteckte den Staubsauger und zog sein Jackett wieder gerade. Sein Herz raste in seiner Brust, aber äußerlich war er ruhig, als er bedächtig zur Tür schritt und auf die Straße sah.
Kunden waren von 10:00 bis 18:00 Uhr im Geschäft willkommen. Montag bis Samstag.
Besondere Kunden durften auch nach Ladenschluss kommen. An jedem Wochentag, der ihnen beliebte.
Der Gentleman, der gerade aus dem BMW M6 stieg, gehörte ganz klar in die Kategorie besonderer Kunde: Anzug in europäischem Stil, kein Mantel trotz des kühlen Wetters, ein Gang wie ein Sportler und ein Gesicht wie ein Auftragsmörder. Ein sehr kluger, sehr mächtiger Mann, der wahrscheinlich einen Hauch von Zwielicht mit sich brachte; aber bei Marcus Reinhardt wurde Mafia- oder Drogengeld keineswegs verschmäht. James war Verkäufer, kein Richter - soweit es ihn also betraf, war der Mann, der jetzt zu ihm kam, ein Muster an Tugend in teuren Lederschuhen von Bally.
James entriegelte das Schloss und öffnete, bevor noch die Klingel ertönte. »Guten Abend, Mr diPietro.«
Der Händedruck war fest und kurz, die Stimme tief und schneidend, die Augen kalt und grau. »Sind wir so weit?«
»Ja.« James zögerte. »Wird Ihre Zukünftige uns ebenfalls beehren?«
»Nein.«
James schloss die Tür und wies den Weg in den hinteren Teil des Ladens. Sorgsam ignorierte er Janice, die den Blick nicht von dem Mann lösen konnte. »Dürfen wir Ihnen eine Erfrischung anbieten?«
»Sie dürfen mir einfach Ihre Diamanten zeigen, wie wäre es damit.«
»Wie Sie wünschen.«
Das Séparée war mit Ölgemälden an den Wänden, einem großen antiken Schreibtisch und vier goldenen Stühlen eingerichtet. Darüber hinaus standen ein Mikroskop, ein schwarzes Samtkissen, der gekühlte Eiswein und zwei Kristallgläser bereit. James nickte seinen Angestellten zu, und Terrence trat vor und entfernte den silbernen Kühler, während Janice etwas fahrig die Gläser abräumte. William blieb im Türrahmen stehen, bereit, jeglicher Anfrage sofort Folge zu leisten.
Mr diPietro nahm Platz und legte seine Hände auf den Schreibtisch, eine Platinuhr von Chopard blitzte unter seinem Ärmelaufschlag hervor. Seine Augen, die von derselben Farbe waren wie die Uhr, waren nicht einfach nur auf James gerichtet, sie bohrten sich praktisch durch seine Schädelwand.
James räusperte sich, als er sich dem Mann gegenübersetzte. »Anknüpfend an unser Gespräch, habe ich eine Auswahl an Steinen aus unserer Sammlung zusammengestellt sowie einige Diamanten direkt aus Antwerpen einfliegen lassen.«
Damit zog James einen goldenen Schlüssel hervor und steckte ihn in das Schloss der obersten Schublade des Schreibtischs. Wenn er mit einem Kunden zu tun hatte, der noch nie etwas besichtigt oder gekauft hatte - wie es jetzt der Fall war -, dann musste er vorab eine Einschätzung treffen, ob sein Gegenüber der Typ war, der ohne Umwege das Spitzensortiment vorgeführt bekommen oder der sich eher nach und nach an die teureren Modelle herantasten wollte.
Welcher Sorte Mr diPietro angehörte war unschwer zu erkennen.
Zehn Ringe lagen auf dem Tablett, das James auf die Schreibtischplatte stellte, jeder davon für die Vorführung noch einmal unter Dampf gereinigt. Der, den er nun von dem schwarzen Samt nahm, war zwar nicht der größte - auch wenn der Unterschied nur den Bruchteil eines Karats ausmachte -, er war allerdings mit Abstand der beste.
»Dieses Exemplar hat sieben Komma sieben Karat, Baguetteschliff, Farbton D, lupenrein. Ich kann Ihnen sowohl das Zertifikat der GIA als auch das der EGL zur Prüfung vorlegen.«
Schweigend ließ James Mr diPietro den Ring in die Hand nehmen und eingehend untersuchen. Überflüssig zu erwähnen, dass Schliff und Symmetrie des Steins ganz hervorragend waren oder dass die Fassung aus Platin handgeschmiedet war oder dass so ein kostbarer Diamant nur sehr selten auf den Markt kam. Das sich in ihm spiegelnde Licht, das Feuer des Diamanten sprach für sich, er funkelte so prunkvoll, dass man fast das Gefühl bekam, der Stein könnte magische Kräfte besitzen.
»Wie viel«, wollte Mr diPietro wissen.
James legte die Zertifikate auf den Schreibtisch. »Zwei Millionen und dreihunderttausend.«
Je teurer, desto besser, war bei Männern wie Mr diPietro die Parole, doch in Wahrheit war das ein guter Deal. Um im Geschäft zu bleiben, musste Reinhardt Juweliere Gewinnspanne gegen Umsatz abwägen: Zu hohe Gewinnspanne, zu wenig Umsatz. Abgesehen davon war Mr diPietro - vorausgesetzt, er vermied Gefängnis und/oder Bankrott - genau die Sorte Mann, mit der James eine langfristige Geschäftsbeziehung aufbauen wollte.
Mr diPietro händigte dem Ladeninhaber den Ring wieder aus und studierte die Unterlagen. »Erzählen Sie mir etwas über die anderen.«
James schluckte sein Erstaunen herunter. »Aber natürlich. Selbstverständlich.«
Er ging von rechts nach links durch das Sortiment auf dem Tablett und beschrieb die Eigenschaften jedes Ringes, während er gleichzeitig heftig grübelte, ob er seinen Kunden falsch eingeschätzt hatte. Außerdem ließ er von Terrence noch sechs weitere Diamanten herbeibringen, alle über fünf Karat.
Eine Stunde später lehnte sich Mr diPietro im Stuhl zurück. Der Mann hatte die gesamte Zeit über nicht ein einziges Mal auf seinen BlackBerry geschielt oder sich auch nur im Geringsten ablenken lassen; kein einziger Witz war gemacht worden, um die Spannung zu durchbrechen. Er hatte nicht einmal einen flüchtigen Blick auf Janice geworfen, die sehr hübsch war.
Totale und absolute Versunkenheit.
James musste unwillkürlich überlegen, was für eine Frau wohl diesen Ring am Finger tragen würde. Schön war sie natürlich, aber sie musste auch sehr unabhängig und nicht sonderlich gefühlsbetont sein. Normalerweise bekam auch der sachlichste und erfolgreichste Mann noch ein Glitzern in den Augen, wenn er einen solchen Ring für seine Frau kaufte - ob es nun an dem Kick lag, sie mit so übertriebenem Luxus zu überraschen, oder der Stolz, sich etwas leisten zu können, was nur für 0,1 Prozent der Bevölkerung infrage kam -, aber die Männer zeigten in der Regel irgendeine Gefühlsregung.
Mr diPietro war so kalt und hart wie die Steine, die er betrachtete.
»Darf ich Ihnen noch etwas anderes zeigen?«, fragte James, der seine Felle davonschwimmen sah. »Rubine, oder vielleicht Saphire?«
Der Kunde griff in seine Anzugjacke und holte eine dünne schwarze Brieftasche hervor. »Ich nehme den ersten, den Sie mir gezeigt haben, für glatte zwei Millionen.« Als James blinzelte, legte Mr diPietro eine Kreditkarte auf den Tisch. »Wenn ich Ihnen schon mein Geld gebe, dann sollten Sie auch dafür arbeiten. Und Sie werden mir den Stein billiger geben, weil Ihr Unternehmen Kundschaft wie mich braucht.«
James brauchte einen Moment, um zu verdauen, dass tatsächlich ein Geschäftsabschluss stattfinden könnte. »Ich … äh, ich weiß Ihr fachkundiges Auge zu schätzen, aber der Preis lautet zwei Millionen und dreihunderttausend.«
Mr diPietro tippte auf das Plastik. »Das ist eine Geldkarte, der Betrag wird sofort abgebucht. Zwei Millionen. Hier und jetzt.«
James kalkulierte rasch im Kopf. Bei dem Preis würde er immer noch dreihundertfünfzigtausend an dem Stück verdienen.
»Ich denke, das geht in Ordnung«, sagte er.
Sein Gegenüber wirkte nicht überrascht. »Schlau von Ihnen.«
»Was ist mit der Anpassung? Wissen Sie, welche Ringgröße Ihre …«
»Die sieben Komma sieben Karat werden die einzige Größe sein, die sie interessiert. Um den Rest kümmern wir uns später.«
»Wie Sie wünschen.«
Üblicherweise hielt James seine Angestellten dazu an, sich um den Kunden zu kümmern, während er nach hinten ging, um den Schmuck in eine Schachtel zu setzen und die Schätzung des Wertes für die Versicherung auszudrucken. Heute allerdings schüttelte er demonstrativ den Kopf, als Mr diPietro ein Handy aus der Tasche zog und eine Nummer eintippte.
In seinem Büro hörte James den Mann im anderen Raum telefonieren. Doch es gab kein neckisches »Liebling, ich hab da was für dich« oder vieldeutiges »Schatz, ich komme gleich vorbei«. Nein, Mr diPietro rief gar nicht seine Verlobte an, sondern jemanden namens Tom, mit dem er eine Immobiliensache besprach.
James zog die Kreditkarte durch das Lesegerät. Während er auf die Autorisation wartete, reinigte er den Ring erneut und warf in regelmäßigen Abständen einen Blick auf die grüne Digitalanzeige des Kartenlesegeräts. Als er aufgefordert wurde, unverzüglich die Service-Hotline der Bank anzurufen, erstaunte ihn das in Anbetracht des Kaufbetrags nicht weiter. Kaum dass er jemanden erreicht hatte, wünschte der Angestellte, Mr diPietro persönlich zu sprechen.
Er stellte zu dem Telefon im Séparée durch und steckte den Kopf durch die Tür. »Mr diPietro …«
»Die möchten mit mir reden?« Er streckte die rechte Hand aus, ließ erneut die Uhr aufblitzen und nahm den Hörer ab. Noch ehe James die Annahmetaste für ihn drücken konnte, übernahm Mr diPietro das selbst und begann zu sprechen.
»Ja, stimmt. Ja, das bin ich. Ja. Ja. Der Mädchenname meiner Mutter lautet O’Brian. Genau. Danke.« Er sah zu James auf, während er wieder auf das andere Telefon durchstellte und den Hörer auflegte. »Sie werden Ihnen einen Autorisierungscode geben.«
James verneigte sich und ging zurück in sein Büro. Als er zurückkam, hatte er eine glänzende rote Tasche mit roten Seidenhenkeln und einen Umschlag mit der Quittung dabei.
»Ich hoffe, Sie beehren uns bald wieder.«
Mr diPietro nahm, was nun ihm gehörte, entgegen. »An sich habe ich vor, mich nur einmal zu verloben, aber es wird Hochzeitstage geben. Reichlich.«
Die Angestellten traten zurück, und James musste sich beeilen, die Tür zu öffnen, bevor Mr diPietro sie erreichte. Nachdem der Mann hinausgerauscht war, sperrte James wieder ab und spähte durchs Fenster.
Das Auto war einfach der Wahnsinn. Als es mit einem Knurren losfuhr, wurde die helle Straßenbeleuchtung von dem schwarzen Lack zurückgeworfen, der wie ein tiefes, stilles Gewässer schimmerte.
Als James sich abwandte, ertappte er Janice dabei, wie sie sich mit starrem Blick die Nase an einem anderen Fenster plattdrückte. Es war allerdings davon auszugehen, dass sie nicht den Wagen begutachtete, wie er es getan hatte, sondern sich stattdessen auf den Fahrer konzentrierte.
Es war doch merkwürdig. Dass das, was man nicht haben konnte, einem immer wertvoller erschien als das, was in Reichweite lag, und vielleicht war diPietro deshalb so reserviert: Er konnte sich all das leisten, was ihm gezeigt worden war, und deshalb war die Transaktion für ihn nicht anders gewesen, als der Kauf einer Zeitung oder einer Dose Cola es für einen normalen Menschen war.
Es gab nichts, was die wirklich Reichen nicht haben konnten. Was für Glückspilze.
»Nehmt’s mir nicht übel, aber ich hau ab.«
Jim stellte sein leeres Bier ab und schnappte sich seine Lederjacke. Er hatte seine zwei Budweiser getrunken; noch eins, und er dürfte nicht mehr fahren. Also wurde es Zeit für ihn.
»Ich kann nicht fassen, dass du allein nach Hause gehst«, bemerkte Adrian mit Blick auf das blaue Kleid.
Die Frau stand immer noch unter der Lampe. Und starrte immer noch. Und war immer noch der Hammer. »Jawohl, nur ich und mein Auto.«
»Die meisten Männer haben nicht so viel Selbstbeherrschung.« Adrian lächelte, der Ring in seiner Unterlippe glitzerte. »Irgendwie beeindruckend.«
»Ja, ich bin ein richtiger Heiliger.«
»Tja, dann fahr vorsichtig, damit du weiter deinen Heiligenschein polieren kannst. Wir sehen uns morgen auf der Baustelle.«
Hände wurden geschüttelt, dann bahnte sich Jim einen Weg durch die Menge. Im Vorbeigehen zog er die Blicke derer mit den schwarzen Ketten und Stachelhalsbändern auf sich, so wie die Grufties dies wahrscheinlich taten, wenn sie im Kaufhaus unterwegs waren. Die Blicke sagten: Was zum Teufel hast du hier verloren?
Vermutlich verletzten seine Jeans und das saubere Flanellhemd in diesem Etablissement das Zartgefühl aus Leder und Spitze.
Jim achtete darauf, einen weiten Bogen um das blaue Kleid zu machen, und als er draußen war, atmete er tief durch, als hätte er eine Art Prüfung bestanden. Die kalte Luft brachte ihm nicht ganz die Erleichterung, die er sich erhofft hatte, und auf dem Weg zum hinteren Parkplatz wanderte seine Hand zur Hemdtasche.
Vor einem Jahr hatte er aufgehört zu rauchen, und trotzdem tastete er immer noch nach den roten Marlboros. Seine bescheuerte Sucht war wie ein amputierter Körperteil mit Phantomschmerz.
Als er um die Ecke bog, lief er an einer Reihe Autos vorbei, die dicht vor dem Gebäude parkten. Alle waren schmutzig, die Seiten gesprenkelt vom Salz, mit dem die Straßen gestreut waren, und Monate altem Schneematsch. Sein Pick-up, der weit hinten in der dritten Reihe geparkt stand, sah genauso aus.
Im Weitergehen blickte Jim sich nach rechts und links um. Das hier war eine miese Gegend, und falls ihn jemand überfallen sollte, wollte er rechtzeitig sehen, was auf ihn zukam. Nicht, dass er etwas gegen einen guten Kampf einzuwenden hatte. In jüngeren Jahren hatte er sich einige geliefert, später war er dann in der Armee noch vernünftig ausgebildet worden. Außerdem war er dank seines Jobs auf dem Bau in Höchstform, mit Muskeln so hart wie Stahl. Aber Vorsicht war die Mutter der …
Er blieb stehen, weil auf dem Asphalt etwas aufblitzte.
Ein goldener Ring - nein, es war ein Ohrring, eine Creole. Er ging in die Hocke, hob das Schmuckstück auf, putzte den Dreck ab und warf einen Blick auf die geparkten Autos. Das hätte jeder verlieren können, und besonders wertvoll war das Ding sicherlich auch nicht.
»Warum bist du ohne mich gegangen?«
Jim erstarrte.
Shit, ihre Stimme war so sexy wie der Rest.
Er richtete sich wieder zu seiner vollen Größe auf und drehte sich auf dem Absatz seiner Arbeitsstiefel herum. Das blaue Kleid stand ungefähr zehn Meter entfernt unter einer Laterne, was ihn zu der Überlegung veranlasste, ob sie vielleicht immer Standorte wählte, an denen sie genau im Licht stand.
»Es ist kalt«, sagte er. »Sie sollten lieber wieder reingehen.«
»Mir ist nicht kalt.«
Irgendwie auch kein Wunder. Da sie so verflucht heiß war. »Also … ich geh dann mal.«
»Allein?« Jetzt kam sie auf ihn zu, ihre hohen Absätze schleiften über den löchrigen Asphalt.
Je näher sie kam, desto besser sah sie aus. Ihre Lippen waren praktisch für Sex geschaffen, tiefrot und leicht geöffnet, und diese Haare … Er malte sich aus, wie sie ihm über die nackte Brust und auf die Oberschenkel fielen.
Jim schob die Hände in die Jeanstaschen. Er war um einiges größer als sie, aber ihr Gang traf ihn wie ein Boxhieb in den Solarplexus, lähmte ihn durch heiße Gedanken und lebhafte Fantasien. Er fragte sich, ob ihre zarte, blasse Haut wohl so weich war, wie sie aussah. Fragte sich, was genau sich wohl unter dem Kleid verbarg. Fragte sich, wie sie sich unter seinem nackten Körper anfühlen würde.
Als sie vor ihm anhielt, musste er tief Luft holen.
»Wo steht dein Wagen?«, fragte sie.
»Pick-up.«
»Und wo?«
In diesem Moment wehte eine kalte Brise aus der Seitenstraße herüber, und sie erschauerte leicht, hob schlanke, hübsche Arme, um sie sich um den Körper zu schlingen. Ihre dunklen Augen, die im Club verführerisch ausgesehen hatten, blickten nun plötzlich flehentlich … und machten es ihm praktisch unmöglich, sich von ihr abzuwenden.
Sollte er sich auf sie einlassen? Sollte er in dieses warme Kissen einer Frau sinken, und wenn auch nur für kurze Zeit?
Noch ein Windstoß wälzte sich heran, und sie stampfte mit einem Stiletto auf, dann mit dem anderen.
Jim zog seine Lederjacke aus und ging zu ihr. Ohne den Blick von dem ihren zu lösen, legte er ihr um, was ihn zuvor selbst gewärmt hatte. »Hier drüben steht er.«
Sie nahm seine Hand. Er ging voraus.
Ein Ford F150 war nicht gerade die ideale Aufreißerkarre, aber er bot ausreichend Platz, wenn es einmal nötig war - vor allem aber war er das Einzige, was Jim zu bieten hatte. Er half der Frau auf den Beifahrersitz, ging dann um den Wagen herum und setzte sich ans Steuer. Der Motor sprang schnell an, und Jim schaltete das Gebläse ab, bis die Heizung warm wurde.
Sie rutschte zu ihm herüber, ihre Brüste schoben sich hoch über die engen Nähte des Kleides, als sie näher kam. »Du bist sehr nett.«
Als nett empfand er sich eigentlich nicht. Besonders im Moment, wenn man bedachte, was er vorhatte. »Ich kann ja nicht zulassen, dass eine Lady friert.«
Jim musterte sie von oben bis unten. Sie war in seine total abgewetzte alte Lederjacke gekuschelt, das Gesicht hatte sie nach unten gewandt, das lange Haar fiel ihr über die Schulter und in den Ausschnitt. Sie mochte vielleicht aussehen wie eine Verführerin, aber in Wahrheit war sie ein braves Mädchen, das nicht mehr weiterwusste.
»Möchtest du reden?«, fragte er, weil sie etwas Besseres verdiente als das, was er von ihr wollte.
»Nein.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich möchte … etwas tun.«
Okay, Jim war definitiv nicht nett. Er war ein Mann, der sich nur eine Handbreit von einer schönen Frau entfernt befand, und obwohl sie etwas Verletzliches ausstrahlte, wollte er sie in die Horizontale bringen - und zwar nicht, um den Psychiater zu spielen.
Ihr Blick war traurig wie der eines Waisenkindes, als sie ihn ansah. »Bitte … küss mich?«
Jim hielt inne, ihr Gesichtsausdruck bremste ihn aus. »Bist du dir da sicher?«
Sie warf das Haar zurück und klemmte es hinter die Ohren. Als sie nickte, blitzten die walnussgroßen Diamanten an ihren Ohrläppchen auf. »Ja … absolut. Küss mich.«
Da sie seinem Blick nicht auswich, beugte Jim sich nach vorn, er fühlte sich verführt und hatte nicht das Geringste dagegen einzuwenden. »Ich mach langsam.«
Oh … Herr … im … Himmel …
Ihre Lippen waren genauso weich, wie er sie sich vorgestellt hatte, und er liebkoste ihren Mund ganz behutsam, aus Angst, sie zu zerdrücken. Sie war süß, sie war warm, und sie vertraute darauf, dass er es vorsichtig anging. Ohne Widerstand nahm sie seine Zunge in sich auf, dann lehnte sie sich zurück, damit seine Hand nach unten wandern konnte, vom Gesicht übers Schlüsselbein … zu ihren vollen Brüsten.
Was das Tempo etwas anzog. Er blieb immer noch vorsichtig, aber die Sache kam in Schwung.
Unvermittelt setzte sie sich auf und streifte seine Jacke von ihren Schultern. »Der Reißverschluss ist hinten.«
Seine rauen Arbeiterhände fanden rasch, wonach er suchte. Er hatte Angst, das blaue Kleid kaputtzumachen, als er den Verschluss hastig herunterzog. Und dann stellte er das Denken komplett ein, als sie das Oberteil selbst von ihren Brüsten schob und ein BH aus Seide und Spitze zum Vorschein kam, der vermutlich so viel gekostet hatte wie sein Pick-up.
Durch den dünnen Stoff sah man die aufgerichteten Nippel, und in den Schatten, die das trübe Licht des Armaturenbretts warf, sahen ihre Brüste sensationell aus, wie ein Festmahl für einen Verhungernden.
»Die sind echt«, sagte sie leise. »Er wollte, dass ich mir Implantate machen lasse, aber ich … ich möchte das nicht.«
Jim runzelte die Stirn und dachte, dass der blöde Vollarsch, der so einen Mist von sich gegeben hatte, eine Augenoperation brauchte - mit einem Wagenheber. »Mach das nicht. Du bist wunderschön.«
»Findest du?« Ihre Stimme zitterte.
»Ja, ganz ehrlich.«
Ihr schüchternes Lächeln bedeutete ihm zu viel, versetzte ihm einen Stich in der Brust, traf ihn zu tief. Er kannte die hässliche Seite des Lebens in- und auswendig, hatte selbst die Art von Scheiße erlebt, die einen Tag so lang wie einen ganzen Monat machen konnte, und ihr wünschte er nichts von alledem. Es sah aber ganz so aus, als hätte sie selbst schon genug Schlimmes hinter sich.
Jim beugte sich vor und stellte die Heizung höher, um sie aufzuwärmen.
Als er sich wieder zurücklehnte, schob sie ein Körbchen ihres BHs beiseite und umfasste ihre Brust mit der Hand, ihm ihre Brustwarze darbietend.
»Du bist der Wahnsinn«, flüsterte er.
Dann senkte er den Kopf und nahm ihre Haut zwischen die Lippen, saugte sanft daran. Als sie keuchte und ihre Hände in sein Haar schob, spürte er seinen Mund weich in ihre Brust gebettet, und er erlebte einen Moment roher Lust, einer Lust, die Männer zu Tieren macht.
Doch da fiel ihm wieder ein, wie sie ihn angesehen hatte, und er wusste, er würde keinen Sex mit ihr haben. Er würde es ihr besorgen, hier im Führerhäuschen des Pick-ups, bei laufender Heizung und beschlagenen Scheiben. Er würde ihr zeigen, wie schön sie aussah und wie perfekt ihr Körper war und sich anfühlte und … schmeckte. Aber für sich selbst würde er nichts nehmen.
Vielleicht war er ja doch kein so mieser Kerl.
Bist du dir da sicher?, schaltete sich seine innere Stimme ein. Bist du dir da ganz sicher?
Nein, war er nicht. Aber Jim bettete die Frau rücklings auf den Sitz und knüllte seine Lederjacke zu einem Kissen für ihren Kopf zusammen und schwor sich, das Richtige zu tun.
Oh Mann … sie war einfach umwerfend, ein verirrter, exotischer Vogel, der in einem Hühnerstall Schutz gesucht hatte. Warum um alles in der Welt wollte sie ihn?
»Küss mich«, hauchte sie.
Als er sein Gewicht auf seine schweren Arme stützte und sich über sie beugte, fiel sein Blick auf die Digitaluhr am Armaturenbrett. 11:59. Auf die Minute genau der Augenblick, an dem er vor vierzig Jahren geboren worden war.
Was für ein schöner Geburtstag das noch geworden war.
Drei
Vin diPietro saß auf einem Seidensofa in einem Wohnzimmer, das ganz in Gold und Rot und Cremeweiß gehalten war. Der schwarze Marmorfußboden war mit antiken Teppichen ausgelegt, die Bücherregale voller Erstausgaben, und seine Sammlung von Kristall-, Bronze- und Ebenholzskulpturen funkelte.
Das ungeschlagene Highlight allerdings war der Blick über die Stadt.
Dank einer Glasfront, die sich über die gesamte Länge des Raums erstreckte, gehörten Caldwells Zwillingsbrücken und sämtliche Wolkenkratzer ebenso zur Dekoration wie die Vorhänge und Läufer und Kunstgegenstände. Die weitläufige Aussicht war städtische Pracht in Reinform, eine ausgedehnte, schimmernde Landschaft, die niemals genau gleich aussah, obwohl die Gebäude selbst sich nicht veränderten.
Vins Wohnung im Commodore erstreckte sich über die gesamte siebenundzwanzigste und achtundzwanzigste Etage des luxuriösen Hochhauses auf insgesamt fast tausend Quadratmetern. Sechs Schlafzimmer, eine Einliegerwohnung für Angestellte, Fitnessstudio, Kino. Acht Badezimmer. Vier Parkplätze in der Tiefgarage. Alles war exakt so, wie er es haben wollte, jede Marmorfliese, Granitplatte, Stoffbahn, Hartholzdiele, Teppichfläche - alles von ihm persönlich handverlesen aus dem Besten vom Besten.
Langsam wurde es Zeit auszuziehen.
So wie die Dinge liefen, könnte er dem Folgebesitzer die Schlüssel vermutlich in … vier Monaten aushändigen. Vielleicht schon in drei, je nachdem, wie schnell die Kolonne von Arbeitern auf der Baustelle war.
Obwohl diese Wohnung hier schon ganz hübsch war, wirkte sie gegen das, was Vin am Ufer des Hudson Rivers baute, wie sozialer Wohnungsbau. Er hatte ein halbes Dutzend alter Jagdhütten und Sommerhäuser aufkaufen müssen, um genug Fläche und Wasserzugang zusammenzubekommen, aber am Ende hatte alles bestens geklappt. Die Schuppen hatte er abgerissen, das Land gerodet und einen Keller ausschachten lassen, der so groß wie ein Fußballfeld war. Mittlerweile zogen die Arbeiter bereits den Rohbau hoch. Sobald das Dach fertig wäre, würde seine Elektrikerflotte anrücken und das zentrale Nervensystem des Hauses einbauen, und seine Klempner würden die Arterien und Venen installieren. Zum Schluss kämen dann Details wie Fliesen und Arbeitsflächen, Armaturen und Gerätschaften, und die Innenausstatter.
Alles fügte sich zusammen, wie von Zauberhand. Und nicht nur seinen künftigen Wohnort betreffend.
Vor ihm auf dem Glastisch lag eine Samtschachtel von Reinhardt Juweliere.
Die Standuhr in der Ecke verkündete Mitternacht, und Vin lehnte sich zurück in die Sofakissen und schlug die Beine übereinander. Er war kein Romantiker, noch nie gewesen, genau wie Devina - weshalb sie auch so perfekt zusammenpassten. Sie ließ ihm seinen Freiraum, beschäftigte sich selbst und war jederzeit bereit, in ein Flugzeug zu springen, wenn es sein musste. Und sie wollte keine Kinder, was ein riesengroßer Pluspunkt war.
Denn das kam für ihn überhaupt nicht infrage. Die Sünden der Väter und so weiter.
Titel der amerikanischen Originalausgabe
COVET-A NOVEL OF THE FALLEN ANGELS
2. Auflage 2010Deutsche Erstausgabe 3/2010Redaktion: Julia Abrahams
Copyright © 2009 by Jessica Bird
Copyright © 2010 der deutschsprachigen Ausgabeund der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Herstellung: Helga Schörnig
eISBN 978-3-641-04922-5
www.heyne-magische-bestseller.de
Leseprobe
www.randomhouse.de