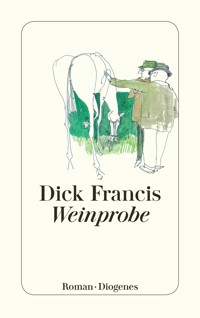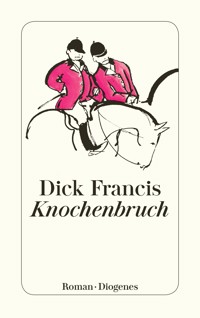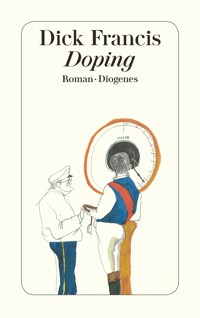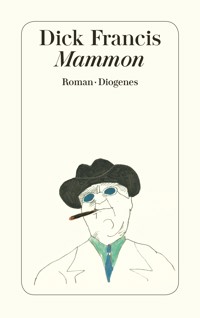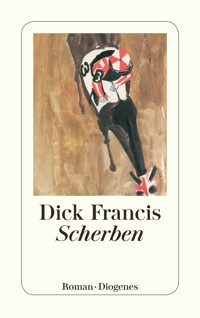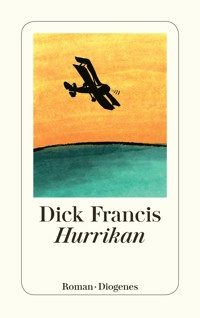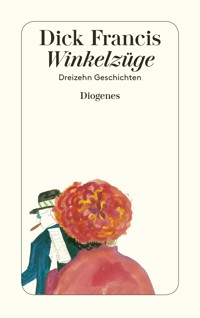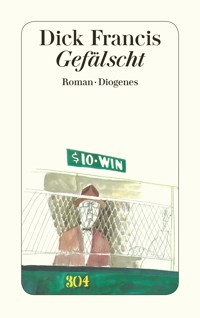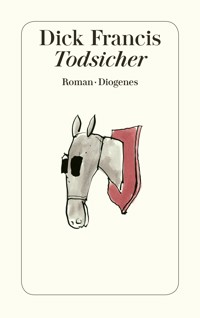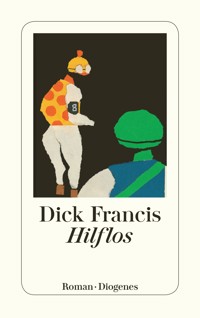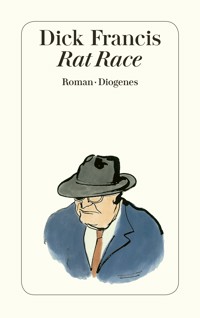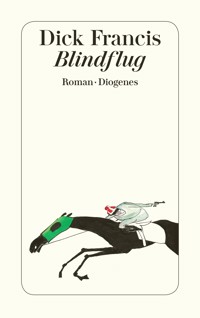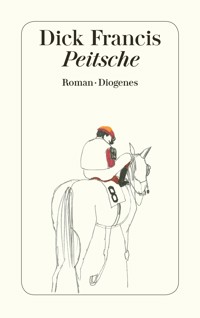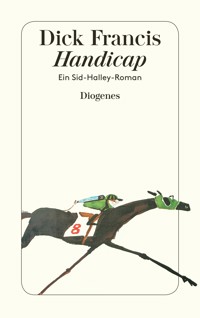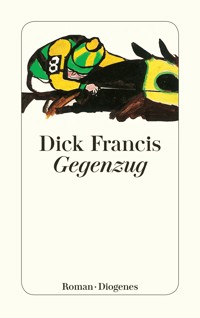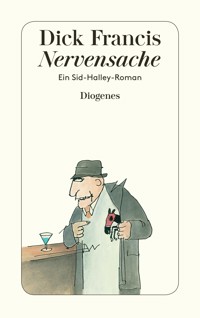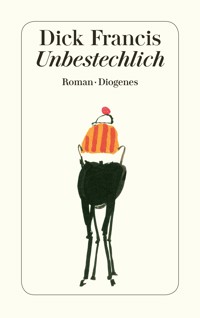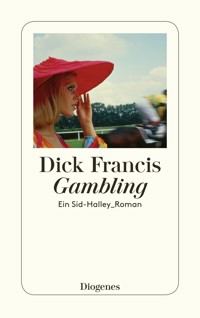
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sid Halley
- Sprache: Deutsch
Exjockey Sid Halley, der sich nach einem Sturz gezwungen sah umzusatteln und der seither als Privatdetektiv tätig ist, kommt auf der Rennbahn von Cheltenham einem Wettbetrug auf die Spur. Die Polizei hat keine Zeit, sich um den Fall zu kümmern. Deshalb nimmt Sid Halley die Sache selbst in die Hand – womit er jedoch sich und seine Liebsten der blinden Wut eines Unbekannten aussetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Dick Francis
Gambling
Ein Sid-Halley-Roman
Aus dem Englischen von Malte Krutzsch
Titel der 2006
bei Michael Joseph Ltd., London,
erschienenen Originalausgabe:
›Under Orders‹
Copyright © 2005 by Dick Francis
Umschlagfoto:
Copyright © Linda
zefa/Corbis/Dukas
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2014
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23936 2 (1.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60608 9
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
Für
meine verstorbene Frau Mary
und zum Gedenken an Dr.Jara Moserova,
meine tschechische Übersetzerin
und Freundin seit vierzig Jahren,
die an dem Tag starb, als dieses Buch fertig wurde.
Meinen Dank an
Literaturagent Andrew Hewson
Alan Stephenson vom Roehampton Rehabilitation Centre
Professor Alex Markham vom London Research Institute
DNA-Expertin Dr.Rosemarie Hutchinson
Rennsportjournalist Jonathan Powell
Edward Gillespie von der Rennbahn Cheltenham
Rodney Petinga von Raceform Interactive
Krankenschwester Catrina McDonald
und besonders
[7] 1
Tod auf der Rennbahn ist leider nichts Ungewöhnliches. Drei Todesfälle an einem einzigen Nachmittag erregen allerdings auch auf der Rennbahn Aufsehen. Daß nur eines der Opfer ein Pferd war, rief umgehend die Ortspolizei auf den Plan.
Der Tag des Cheltenham Gold Cup hatte klar und sonnig angefangen, Rauhreif lag weiß auf dem Vorfrühlingsgras. Angekündigt war scheußliches Wetter mit Westwind und heftigem Regen, doch als ich in der Küche meines Exschwiegervaters durchs Fenster auf den westlichen Himmel schaute, war von der vorhergesagten Warmfront noch nichts zu entdecken.
»Da hast du’s, Sid«, sagte Charles, als er, einen Morgenmantel über dem gestreiften Pyjama, blaue Samtpantoffeln an den Füßen, in die Küche kam. Konteradmiral a.D. Charles Rowland von der Royal Navy, mein Exschwiegervater, Vertrauter, Mentor und zweifellos mein bester Freund.
Unbekannten stellte ich ihn immer noch als meinen Schwiegervater vor, obwohl es inzwischen gut zehn Jahre her war, daß seine Tochter Jenny, meine Frau, es für nötig gehalten hatte, mich vor ein Ultimatum zu stellen: »Entweder ich oder dein Beruf.« Wenn man auf dem Gipfel seiner beruflichen Möglichkeiten steht, nimmt man so etwas nicht [8] ernst. Ich hatte weitergearbeitet wie immer, und Jenny hatte mich Gift und Galle speiend verlassen.
Daß nur wenige Monate später ein schwerer Unfall es mir unmöglich machte, den Beruf meiner Wahl weiter auszuüben, zählt zu den kleinen Ironien des Lebens, vor denen niemand sicher ist. Unsere Ehe war ein für allemal beschädigt, und es gab kein Zurück. Obwohl es noch viele Jahre dauerte und noch manches verletzende Wort fiel, bis wir uns voneinander lösen konnten. Schließlich hatten Jenny und ich uns scheiden lassen, und sie war durch eine zweite Ehe zu einem Adelstitel und beträchtlichem Vermögen gelangt. Heute sind wir höflich zueinander, und ich hoffe wirklich, daß eine vorsichtige Zuneigung in unserer stürmischen Beziehung noch möglich ist.
»Morgen, Charles«, sagte ich. »Schön draußen.«
»Diese Meteorologen«, erwiderte er, »haben doch nie den leisesten Schimmer.« Er beugte sich zum Fenster vor, um den Wetterhahn auf dem Garagendach besser sehen zu können. »Südwest«, bemerkte er. »Die Front ist noch im Anzug. Nehmen wir lieber einen Schirm mit.«
Ich bezweifelte nicht, daß er recht hatte. Auf See hatte er die unheimliche Fähigkeit erworben, mit Hilfe eines in die Luft gehaltenen, angefeuchteten Fingers die Zukunft vorherzusagen. Diesmal aber hatte er wohl einfach in seinem Zimmer Radio gehört. Von den Jahren auf See stammte auch seine Vorliebe für rein männliche Gesellschaft, denn Frauen fuhren damals nicht mit, und seine Eigenart, Probleme langsam, aber entschlossen anzugehen. Wie er mir oft erzählt hatte, braucht ein Flugzeugträger viele Kilometer, um zu wenden, so daß man sich beizeiten über die einzuschlagende [9] Richtung klarwerden sollte, damit man nicht wild durch die Gegend kurvt und allen zeigt, was für ein Vollidiot man ist.
Wir fuhren mit seinem Mercedes zur Rennbahn, Regenmäntel und Schirme auf dem Rücksitz verstaut. Während wir von Aynsford, seinem Wohnort in Oxfordshire, über die Cotswold Hills unterwegs nach Cheltenham waren, verkroch die Sonne sich hinter hohen Zirruswolken. Als wir von Cleeve Hill hinunter zur Rennbahn kamen, war sie vollends verschwunden, und auf dem Parkplatz klatschte Regen gegen die Windschutzscheibe, doch der Cheltenham Gold Cup zählt zu den größten Rennsportereignissen der Welt, und ein paar Regentropfen konnten uns die Laune nicht verderben.
Ich war diesen Kurs so oft geritten, daß ich das Gefühl hatte, jeden Grashalm wie einen alten Freund zu kennen. In meinen Träumen ritt ich noch immer dort, drängte bergab zur Einlaufgeraden und ging scharf den berüchtigten Abwärtssprung an, vor dem sich andere erst einmal sammelten. Hier gab es leicht eine Bruchlandung, wenn ein Gespann den Punkt nicht traf, aber es ging um den Sieg, und wenn man das Pferd antrieb, statt auf Sicherheit zu gehen, konnte man an diesem Hindernis Längen gutmachen, Längen, die die Konkurrenz am Berg vor der Ziellinie vielleicht nicht wieder aufzuholen vermochte.
Ein Sturz hatte meiner Rennsportkarriere ein Ende bereitet. Eigentlich war es ein Klacks. Mein junges Pferd stolperte beim Aufsprung am zweiten Hindernis in einem Sieglosen-Jagdrennen, bekam die Beine nicht unterm Hals weg und ging langsam nach rechts zu Boden. Ich hätte abspringen können, entschied mich jedoch, mit dem fallenden Tier [10] mitzugehen und seinen wild schlagenden Hufen auszuweichen. Es war ein unglücklicher Zufall, daß ein nachfolgendes Pferd nirgendwo anders hintreten konnte und mit seinem ganzen Gewicht auf der nach oben gedrehten Innenfläche meiner ausgestreckten linken Hand gelandet war. Eher kriminell als unglücklich war es jedoch, daß das Pferd ein durch langen Gebrauch scharf geschliffenes, ausgezacktes altes Rennhufeisen trug, das mir Muskeln, Sehnen und Knochen durchschnitt, meine Hand unbrauchbar machte und mein Leben ruinierte.
Aber ich will mich nicht beklagen. Ich war vier Jahre hintereinander Champion Jockey gewesen, mit mehr gewonnenen Hindernisrennen als jeder andere, und hätte wohl sowieso aussteigen müssen. Mit achtunddreißig war selbst für meine Begriffe das Alter überschritten, in dem man dem Körper die ständige Malträtierung zumuten konnte.
»Sid«, sagte Charles und holte mich damit in die Realität zurück, »du weißt ja, ich bin heute bei Lord Enstone zu Gast, und er hat mich gefragt, ob du nachher auf ein Glas in seine Loge kommst.«
»Mal sehen«, sagte ich, in Gedanken noch bei dem, was hätte sein können.
»Anscheinend liegt ihm viel daran.«
Da ich Charles kannte, sagte mir sein Nachhaken, daß er selbst Wert darauf legte.
»Ich werde dasein.«
Wenn es Charles wichtig war, würde ich wahrhaftig da sein. Ich verdankte ihm viel, und auf diese Art Dankesschuld abzutragen war leicht. Dachte ich wenigstens in dem Moment.
[11] Wir schlossen uns der Menschenmenge an, die von den Parkplätzen zur Rennbahn strömte.
»Tag, Mr.Halley«, sagte der Kontrolleur am Eingang. »Wer ist Ihr Tip für den Cup?«
»Tag, Tom«, erwiderte ich und las den Namen von seiner Karte ab. »Oven Cleaner müßte gute Chancen haben, zumal wenn es noch stärker regnet. Aber ich habe nichts gesagt.«
Er winkte mich lachend durch, ohne sich meine Plakette richtig anzusehen. Exjockeys sind den meisten Rennbahnen lästig. Haben sie freien Eintritt oder nicht? Und wie lange nach Beendigung ihrer Laufbahn? Kommt es darauf an, wie gut sie gewesen sind? Warum bleiben sie nicht einfach weg und geben Ruhe, statt immer nur davon zu reden, daß früher, als sie noch geritten sind, alles besser war und daß die Sprünge immer harmloser werden und kaum noch den Namen verdienen?
Hätte sich Tom meine Plakette genauer angesehen, hätte er festgestellt, daß sie, genau wie ich, schon ein wenig alt und mitgenommen war. Ich hatte einfach meine metallene Jokkeyplakette behalten, als ich abgetreten war, und benutzte sie immer noch. Niemand schien sich daran zu stören.
Charles winkte und machte sich auf den Weg zu den Logen oben auf der Tribüne, während ich ungehindert zu dem Platz vor dem Waageraum ging, gleich neben dem Führring.
»Sid Halley!« Ich drehte mich lächelnd um. »Wie läuft’s mit der Schnüffelei?«
Es war Bill Burton, Exjockey und jetzt mäßig erfolgreicher Trainer, dessen Taillenumfang schneller wuchs als sein Bankkonto.
[12] »Bestens, Bill.« Wir gaben uns herzlich die Hand. »Hält mich auf Trab.«
»Gut, solange du die Nase nicht in meine Angelegenheiten steckst.« Er sagte es mit einem Lächeln, das nicht ganz bis zu den Augen reichte.
Wir waren jahrelang regelmäßig gegeneinander geritten und wußten beide, daß er nicht unbedingt abgeneigt gewesen war, ein paar Pfund dazuzuverdienen, indem er dafür sorgte, daß sein Pferd nicht als erstes durchs Ziel ging. Er hatte immer steif und fest behauptet, er halte nur Pferde zurück, die ohnehin keine Chance hätten, das sei ja wohl kein Verbrechen. Ich meinte ihm anzusehen, daß er nach dem Umsatteln keineswegs umgedacht hatte.
Schade, dachte ich. Bill war kein krummer Hund, aber ganz ehrlich war er nach allem, was gemunkelt wurde, auch nicht. Einen solchen Ruf erwirbt man ja immer schneller, als man ihn los wird. Bill hoffte wohl umsonst, als Trainer einmal ganz nach oben zu kommen, und zwar nicht, weil es ihm an Kompetenz gefehlt hätte, sondern weil Besitzer, die sich auskannten, ihm nicht ihre besten Pferde anvertrauen würden.
»Hast du Starter heute?« fragte ich.
»Candlestick im ersten und Leaded Light im fünften. Aber ich würde auf beide nicht wetten.«
Ich fragte mich, ob das nun ein Hinweis war, daß sie nicht alles geben würden. Meine Zweifel stimmten mich traurig. Ich mochte Bill sehr. Wir waren viele Jahre lang Freunde und Rivalen auf der Bahn gewesen.
Er schien zu spüren, daß ich ihm tiefer in die Augen blickte, als ihm recht sein konnte, und wandte schnell den [13] Kopf ab. »Entschuldige, Sid«, sagte er leise, als er sich an mir vorbeischob, »muß meinen Jockey suchen.«
Ich sah zu, wie er durch die Tür des Waageraums verschwand, und schaute in der Zeitung nach, wer sein Jockey war. Huw Walker. Ein beliebter Routinier. Er hatte es nie zur Nummer 1 gebracht, hielt sich aber seit acht oder neun Jahren konstant unter den ersten zehn, bestritt zahlreiche Rennen und siegte oft. Ein Farmerssohn aus Wales, dem man ein Faible für flotte Frauen und schnelle Autos nachsagte, in dieser Reihenfolge. Soviel ich wußte, war er noch nie in Verdacht geraten, »hinterherzumachen« – Pferde zurückzuhalten. Als hätte das Übernatürliche die Hand im Spiel, blickte ich auf und sah Huw Walker auf mich zukommen.
»Tag, Huw«, sagte ich.
»Hallo, Sid. Hast du meine Nachricht bekommen?« Er sah ganz und gar nicht so fröhlich aus wie sonst.
»Nein«, erwiderte ich. »Was für eine Nachricht?«
»Auf deinem Anrufbeantworter. Gestern abend.«
»Wo hast du angerufen?«
»In London.« Er war sichtlich nervös.
»Tut mir leid. Ich bin über die Renntage bei meinem Schwiegervater in Oxfordshire.«
»Schon gut. Hier kann ich nicht reden. Ich ruf dich nachher noch mal an.«
»Auf meinem Handy, bitte«, sagte ich und gab ihm die Nummer.
Er eilte davon und verschwand im Waageraum.
Obwohl bis zum ersten Rennen noch über eine Stunde Zeit war, wurde es auf dem Platz vor der Waage schon ziemlich [14] voll, nicht zuletzt, weil alle Schutz vor dem jetzt stärker niedergehenden Regen suchten.
Es war die übliche gemischte Gesellschaft von Offiziellen, Presseleuten, Vollblutagenten, Fernsehleuten, Trainern und ihren einstigen und aktuellen Jockeys. Hier wurden die Klatschgeschichten der Woche erzählt und schmutzige Witze wie an der Börse gehandelt. Gerüchte verbreiteten sich wie die asiatische Grippe: wer mit wem schlief und wer dabei vom Partner in flagranti ertappt worden war. Im Rennsport gab es Scheidungen zuhauf.
Ich wanderte mit offenen Ohren in der Menge umher und erfuhr, was sich Neues in der Rennwelt tat.
»Jammerschade um Sandcastle«, meinte jemand in einer Gruppe links hinter mir. »Vorigen Oktober bei der Jährlingsauktion in Newcastle für eine halbe Million Pfund gekauft, und gestern morgen kommt er mit dem Fuß in ein Kaninchenloch und bricht sich das Sprunggelenk so bös, daß er eingeschläfert werden muß.«
Ich ging weiter.
»Die Pfeife hat mein Pferd halbtot geprügelt und ist gerade mal Dritter geworden.« Ein dicker Trainer im Dufflecoat, Andrew Woodward, ereiferte sich vor einer Handvoll Zuhörern. »Vier Tage aussetzen muß er, der Schwachkopf. Wenn er das noch mal macht, zieh ich ihm selber die Peitsche übern Arsch.«
Sein Fanclub lachte beifällig, aber ich glaubte ihm. Einmal hatte er seine heranwachsende Tochter in der Futterkammer beim Knutschen mit einem Jockeylehrling erwischt und den unglücklichen jungen Mann auf einen Heuballen geworfen, um ihm mit einer Reitpeitsche den nackten [15] Hintern zu versohlen. Es hieß sogar, seine Tochter habe er der gleichen Behandlung unterzogen. Woodward wurde schließlich wegen Körperverletzung verurteilt, aber die Sache trug ihm Respekt ein.
Er war ein ausgezeichneter Trainer, galt jedoch zu Recht als Jockeyhasser. Manche meinten, das sei einfach Neid; er selbst sei immer zu schwer gewesen, um Jockey zu werden. Ich war einige Male für ihn geritten und hatte mehr als einmal scharfe Kritik über mich ergehen lassen müssen, wenn das Resultat nicht seinen Erwartungen entsprach. Er bekam keine Weihnachtskarten von mir.
Ich ging auf die Treppe zum Führring zu, wo ich jemanden entdeckt hatte, mit dem ich reden wollte.
»Sid, alter Freund!« Paddy O’Fitch war ein ehemaliger Kollege, ein paar Zentimeter kleiner als ich und eine wandelnde Enzyklopädie des Rennsports mit Schwerpunkt Jagdrennen. Er sprach mit derbem Belfaster Einschlag und hielt alles Irische hoch, doch in Wahrheit war er gebürtiger Liverpooler und auf den Namen Harold getauft, nach dem damaligen Premierminister. Der Nachname in seinem Paß lautete schlicht Fitch. Das O’ hatte er hinzugefügt, als er noch Schüler war. Anscheinend hatte er seinen Eltern nie verziehen, daß sie ganze vierzehn Tage vor seiner Geburt über die Irische See nach England ausgewandert waren.
»Tag, Paddy«, sagte ich lächelnd.
Wir gaben uns die Hand, zwei Exjockeys, die jetzt viel lockerer miteinander umgingen als zu der Zeit, da sie tagtäglich gegeneinander angetreten waren.
Nach seinem Abschied vom Rennreiten vor sechs Jahren hatte Paddy sein Wissen zum Geschäft gemacht. Er schrieb [16] kurze, aber herrlich unterhaltsame Chroniken von Rennbahnen und Rennen, von Helden des Rennsports und großen Pferden und verkaufte sie in Form schmaler Broschüren auf Rennbahnparkplätzen im ganzen Land. Die Büchlein fügten sich zu einer umfassenden Geschichte des Rennsports zusammen und verkauften sich so gut, daß Paddy schon bald Leute anstellen mußte, die ihm den Verkauf abnahmen, während er sich aufs Schreiben konzentrierte.
Er hatte jahrelang sein eigenes privates Rennsportarchiv geführt, bevor ihn der Jockey-Club in Anerkennung seiner Verdienste offiziell mit der Einrichtung eines solchen Archivs betraute und ihn bat, die in diversen Rennsportmuseen des Landes verwahrten Materialien und Dokumente zu verwalten. Aber seine Chroniken hatten ihm Erfolg gebracht. Die schmalen, billig produzierten Heftchen gab es mittlerweile in farbigem Kunstdruck, jeden Monat ein neues. Die ledergebundenen Sammelmappen dafür waren alle Jahre wieder ein sicherer Geschenktip für jeden Rennsportbegeisterten.
Paddy war eine Fundgrube des nützlichen wie auch des nutzlosen Wissens, und seit ich als Privatdetektiv tätig war, hatte ich mich schon oft an ihn gewandt. In Rennsportfragen konnte Paddy Google übertrumpfen. Er war die beste Suchmaschine überhaupt.
»Welche Chance gibst du Candlestick im ersten?« fragte ich wie nebenher.
»Könnte siegen. Kommt drauf an…« Er brach ab.
»Worauf?« half ich nach.
»Ob er sich bemüht.« Er schwieg. »Warum fragst du?«
»Wollte vielleicht mal wetten.« Ich sagte es, als wäre es ganz normal.
[17] »Ach je! Hör sich das einer an!« Er wandte sich an niemand Bestimmten. »Sid Halley geht wetten. Es geschehen noch Zeichen und Wunder.« Er lachte. »Wenn du mir gesagt hättest, du hast ein drittes Auge am Hintern, hätte ich dir vielleicht eher geglaubt.«
»Ist ja gut, Paddy«, sagte ich.
»Schwindel den guten Onkel Paddy nicht an, Sid. Also, warum hast du nach Candlestick gefragt?«
»Wie kommst du darauf, daß er sich nicht bemühen könnte?« fragte ich, statt zu antworten.
»Das hab ich nicht gesagt«, gab er zurück. »Ich hab nur gesagt, daß er gewinnen könnte, wenn er sich bemüht.«
»Was doch heißt, daß du für möglich hältst, daß er’s nicht tut, oder?«
»Alles nur Gerüchte«, meinte er. »Man munkelt, daß Burtons Pferde nicht immer ihr Bestes geben.«
In diesem Moment kam es zum ersten Todesfall des Tages.
In Cheltenham dient ein Ende des Führrings zugleich als Absattelplatz für den Sieger, und das ansteigende Gelände bildet ein natürliches Amphitheater. Ein terrassenförmig angelegter Zuschauerbereich aus Beton und Stein umschließt im Halbkreis den Führring. Später am Tag würde hier der Gold-Cup-Sieger bejubelt werden, wenn er im Triumph zum Absatteln zurückkehrte. Jetzt, so früh am Nachmittag, standen nur einige Hartgesottene mit Schirmen herum, beobachteten das Kommen und Gehen an der Waage und warteten auf den Beginn der Veranstaltung.
»Hilfe! Hilfe! Bitte helfen Sie mir!«
Eine Frau mittleren Alters in einer offenen Wachsjacke [18] über einem grünen Tweedkostüm rief laut von der untersten Stufe der Terrasse her.
Alle blickten zu ihr hin.
Sie schrie weiter. »Helfen Sie doch, um Gottes willen!«
Paddy und ich liefen zu den Rails am Führring hinüber, und von dort sahen wir auf einen Blick, daß nicht die Frau, sondern der Mann, bei dem sie stand, in Schwierigkeiten war. Er war zusammengebrochen und lag zu ihren Füßen, direkt vor dem brusthohen Maschendrahtzaun, der das Publikum von den Pferden fernhielt. Einige Leute waren bereits zu Hilfe geeilt, und jemand rief nach einem Arzt.
Der Rennbahnarzt, sonst eher für die Versorgung verletzter Jockeys zuständig, kam aus dem Waageraum gelaufen und sprach eilig in sein Walkie-talkie.
Nichts bringt die britische Öffentlichkeit so sehr zum Gaffen wie ein medizinischer Notfall. Der Zuschauerbereich füllte sich im Nu, als zwei grüngekleidete Rettungssanitäter mit großen roten Rucksäcken auf dem Rücken in den Führring eilten. Da ihnen der Maschendrahtzaun im Weg war, hoben ein paar Beherzte gegen den Rat des Arztes den armen Patienten darüber hinweg. Er wurde genau da, wo später die Sieger des Tages stehen würden, auf das kurzgemähte Gras gelegt.
Der Arzt und die Rettungsleute machten sich ans Werk, doch schon bald wurde klar, daß sie auf verlorenem Posten kämpften. Der Arzt legte seine Lippen auf den Mund des Mannes und blies ihm Luft ein. Welch ein Vertrauen, dachte ich. Würde ich meinen Mund auf den eines wildfremden Menschen legen? Einer der Sanitäter löste den Arzt ab und führte einen mit einem blauen Ambubeutel verbundenen [19] Schlauch in den Rachen des Mannes ein, während der andere ihm Klebeelektroden auf der Brust befestigte. Der Körper des Mannes bäumte sich unter dem Stromstoß auf, lag danach jedoch wieder still.
Sie bemühten sich viel länger, als ich erwartet hätte. Abwechselnd preßten sie ihm Luft in die Lunge und drückten ihm den Brustkorb zusammen. Fast eine halbe Stunde verging, bis sie Anstalten machten, aufzugeben. Inzwischen war ein Krankenwagen vorgefahren, und eine Trage stand bereit. Der Mann wurde zwar auf die Trage gelegt, doch offensichtlich war es um ihn geschehen. Die Mediziner hatten es nicht mehr so eilig. Ein tödlicher Herzanfall, einer mehr für die Statistik.
Als der Tote in Begleitung seiner trauernden Witwe abtransportiert wurde, verzogen sich die Schaulustigen in die Bars, um ins Trockene zu kommen, beklagten den Vorfall und riefen sich in Erinnerung, wie wichtig es war, gesund zu leben. Dem Speckverkauf am Bratenstand tat es keinen Abbruch.
Ich sah mir das erste Rennen von der Besitzertribüne aus an. Das Triumph Hurdle ist das höchstdotierte Rennen für zu Beginn der Saison über die Hürden sieglose Vierjährige und geht über 3400Meter. Der Start war eindrucksvoll, mit fünfundzwanzig über die ganze Breite der Bahn verteilten Pferden, und ähnelte einem Kavallerieangriff auf die erste Hürde. Meine besondere Aufmerksamkeit galt Huw Walker auf Candlestick. Die Pferde bildeten noch einen Pulk, als sie zum ersten Mal in hohem Tempo an der Tribüne vorbeigaloppierten. Auf dem Weg zum höchsten Punkt der Bahn [20] lichtete sich das Feld, und nur ein gutes halbes Dutzend wahrten noch ihre Chance, als es nach links hinab in den Bogen ging. Candlestick ging als Dritter den vorletzten Sprung an, den das führende Pferd zu kurz nahm, so daß es an der Hürde hängenblieb und mit rudernden Beinen stürzte. Huw Walker zog nach links, um nicht dazwischenzugeraten, und stieß Candlestick hart in die Rippen.
Es war ein Finish, wie es das Publikum liebt. Vier Pferde nahmen den letzten Sprung gleichzeitig, und die Jockeys verschwanden förmlich in einem Wirbel von Armen und Peitschen, als sie versuchten, das Letzte aus ihren Tieren herauszuholen. Es stand außer Zweifel, daß Candlestick diesmal sein Bestes gab und Huw Walker ihn energisch dem Ziel entgegentrieb. Ihre Mühe wurde gebührend belohnt, denn sie siegten mit einer Kopflänge.
Zufrieden ging ich wieder zum Führring, um auf die Rückkehr des Pferdes zu warten, und sah, daß Bill Burton, der Trainer, ein wahnsinnig wütendes Gesicht machte. Einen Sieg hatte er offenbar nicht eingeplant. Wenn er nicht aufpaßt, dachte ich, zeigt er jedem, der ihn sieht, daß die Gerüchte stimmen.
Ich lehnte mich ans Rail und schaute zu, wie Bill Burton und Huw Walker das schwitzende Pferd absattelten. Dampf stieg von der Hinterhand des Pferdes auf wie Wolken, doch die Feindseligkeit zwischen den beiden Männern war trotzdem nicht zu übersehen. Als hätten sie die vielen tausend Menschen ringsum ganz vergessen, standen sie neben dem Pferd und schrien sich Beleidigungen ins Gesicht. Von da, wo ich stand, konnte ich nicht alles verstehen, bekam aber eindeutig ein paar »Sauhund«-Varianten und noch weniger [21] schmeichelhafte Adjektive mit. Es sah aus, als würden sie handgreiflich werden, doch ein Offizieller trat dazwischen und zog Bill Burton weg.
Huw blickte in meine Richtung, sah mich, zuckte mit den Achseln, zwinkerte mir zu und lächelte dann breit, als er an mir vorbei zur Waage ging.
Ich fragte mich noch, was ich von alldem halten sollte, als ich einen kräftigen Schlag auf den Rücken bekam. Chris Beecher, Mitte Vierzig, angehend kahl und um etliche Kilos zu schwer. Reporter und Nervensäge – und hinterhältig.
»Was macht Ihr schöner Greifhaken?«
Er schien sich nicht bewußt zu sein, daß man so etwas nicht fragte. Es ist ungefähr so, als wenn man sich erkundigt, ob das rote Muttermal auf dem Gesicht in der Sonne braun wird. Es gibt Dinge, über die man am besten schweigt. Aber Chris Beecher verdiente seinen Lebensunterhalt damit, daß er die Gefühle anderer Menschen verletzte. Klatschkolumnist nannte er sich offiziell. Gerüchtekoch hätte besser gepaßt. Er war für die Gesellschaftsseite in The Pump verantwortlich, einer Tages- und Sonntagszeitung, mit der ich vor einigen Jahren aneinandergeraten war. Was er schrieb, war zur Hälfte frei erfunden, enthielt aber doch so viel Wahrheit, daß viele ihm alles glaubten. Innerhalb des letzten Jahres waren zwei Scheidungen und ein Selbstmordversuch mit Sicherheit auf sein Konto gegangen.
Mein schöner Greifhaken, wie er es nannte, war eine kostspielige myoelektrische linke Hand. Ein sadistischer Schurke hatte das von dem gezackten Hufeisen begonnene Werk vervollständigt, und so war ich jetzt stolzer Besitzer eines Greifhakens im Stil des 21.Jahrhunderts. Tatsächlich [22] hatte ich gelernt, die meisten Dinge einhändig zu erledigen, doch ich trug die Unterarmprothese gern der Optik halber, um nicht angestarrt zu werden.
»Geladen und einsatzbereit«, sagte ich und bot ihm meine linke Hand.
»Nein, tausend Dank. Mit dem Ding quetschen Sie mir doch die Finger ab.«
»Damit kann ich sogar rohe Eier halten«, log ich. In Wahrheit hatte ich schon jede Menge Eier zerdrückt.
»Egal«, sagte er. »Mir ist zu Ohren gekommen, daß Sie Leute damit geschlagen haben und daß ein Schlag genügt.« Das stimmte. Ich hatte jemandem den Kiefer gebrochen. Wozu sauber kämpfen, wenn man eine veritable Keule am linken Ellenbogen sitzen hat?
»Was halten Sie von diesem kleinen Wortwechsel zwischen Trainer und Jockey?« fragte er ganz unschuldig.
»Ich weiß nicht, was Sie meinen.«
»Ach, hören Sie doch auf«, meinte er. »Den Streit hat ja wohl jeder mitbekommen.«
»Worum ging es denn?« fragte ich ebenso unschuldig.
»Klarer Fall. Walker hat gesiegt, wo er nicht sollte. Vom Stall hat keiner auf ihn gesetzt. Blöder Hund.«
»Wer?« fragte ich. »Walker oder Burton?«
»Gute Frage. Beide wahrscheinlich. Würde mich wundern, wenn die Rennleitung oder der Jockey-Club sie sich nicht vorknöpft. Lust auf ein Bier?«
»Ein andermal. Ich habe meinem Schwiegervater versprochen, daß ich ein Glas mit ihm trinke.«
»Exschwiegervater«, berichtigte er.
»Auf der Rennbahn bleibt vor Ihnen eben nichts geheim.«
[23] »Jetzt belieben Sie aber zu scherzen. Was Sie für sich behalten wollen, brächte ich selbst durch Prügel nicht aus Ihnen raus. Das habe ich auch munkeln gehört.«
Er hatte zuviel gehört, dachte ich.
»Was macht Ihr Liebesleben?« fragte er plötzlich.
»Das geht Sie nichts an.«
»Sehen Sie?« Er tippte mir an die Brust. »Mit wem pennt Sid Halley? Das bestgehütete Geheimnis der Rennwelt.«
Er machte sich auf die Suche nach leichterer Beute. Chris Beecher, Schwergewicht und Wichtigtuer. Ein Fiesling, der Menschen gern zum Weinen brachte. Ich schaute ihm hinterher und fragte mich, wie er nachts schlafen konnte.
[24] 2
Ich ging zu den Logen auf der Tribüne hinauf. Es war nicht so einfach wie früher, da der sogenannte Sicherheitsdienst, wie es schien, mit jedem Jahr strenger wurde. Freundliche Kontrolleure wie Tom unten am Parkplatzeingang, die jeden Trainer, jeden Jockey und auch viele Besitzer vom Sehen kannten, gab es kaum noch. Die neue Generation der jungen Leute, die mit Bussen aus den großen Städten angekarrt wurden, kannte sich im Rennsport nicht aus. Mein Gesicht, einst die Freikarte für jeden Teil jeder beliebigen Rennbahn, war jetzt nur ein Gesicht wie jedes andere in der Menge.
»Haben Sie eine Logenkarte?« fragte ein hochgewachsener junger Mann mit Stachelfrisur. Er trug einen dunklen Blazer mit dem aufgestickten Wort »Sicherheitsdienst« auf der Brusttasche.
»Nein, aber ich bin Sid Halley, und Lord Enstone hat mich auf einen Drink eingeladen.«
»Tut mir leid, Sir.« Er hörte sich nicht so an. »Sie brauchen eine Karte, um mit dem Lift nach oben zu fahren.«
Ich kam mir albern vor, als ich ihm meine nicht mehr aktuelle Jockeyplakette zeigte.
»Tut mir leid.« Es klang noch weniger bedauernd und um so entschlossener. »Damit kommen Sie hier nicht durch.«
[25] In diesem Augenblick rettete mich der geschäftsführende Direktor der Rennbahn, der wie üblich wohl von einer Kleinkrise zur nächsten eilte.
»Sid«, sagte er ganz herzlich, »wie geht es Ihnen?«
»Danke, Edward«, erwiderte ich und gab ihm die Hand. »Habe nur etwas Schwierigkeiten, in Lord Enstones Loge zu kommen.«
»Unsinn«, meinte er und zwinkerte dem jungen Mann zu. »Das wäre ja noch schöner, wenn Sid Halley auf unserer Rennbahn nicht überall hinkönnte.«
Er legte mir den Arm um die Schulter und bugsierte mich in den Lift.
»Wie läuft die Detektivarbeit?« fragte er, als wir in die fünfte Etage hinauffuhren.
»Immer viel zu tun«, sagte ich. »Und es scheint, sie führt mich immer öfter von der Rennbahn weg, aber natürlich nicht diese Woche.«
»Sie haben dem Rennsport viel Gutes getan. Wenn Sie Hilfe brauchen, sagen Sie Bescheid. Ich schicke Ihnen eine Karte, mit der Sie hier überall hinkommen, auch in mein Büro.«
»Auch in die Jockeystube?«
Er wußte ebensogut wie ich, daß zum Umkleideraum der Jockeys niemand Zutritt hatte außer den am betreffenden Tag reitenden Jockeys und ihren Dienern – den Männern, die sich um ihre Kleidung und Ausrüstung kümmerten. Selbst Edward durfte an Renntagen da strenggenommen nicht rein. »Fast überallhin«, sagte er und lachte.
»Danke.«
Die Tür ging auf, und er hastete davon.
[26] Lord Enstones Loge war brechend voll. Unmöglich alles Leute mit Logenkarte, dachte ich, als ich mich hineinzwängte. Offensichtlich hatten sie den stachelhaarigen jungen Mann besser beschwätzen können als ich.
Die wenigen Glücklichen, die am Gold-Cup-Tag in Cheltenham eine Loge haben, stellen unweigerlich fest, daß alle möglichen lieben Freunde sie auf einmal besuchen möchten. Daß diese »lieben Freunde« im ganzen Jahr nur einmal auftauchen, stört sie anscheinend nicht weiter.
Eine Kellnerin bot mir ein Glas Champagner an. Im allgemeinen hielt ich Getränke in der rechten Hand, aber das machte das Händeschütteln so kompliziert, und außerdem fand ich, daß ich mehr Gebrauch von meiner so teuer bezahlten Linken machen sollte. Behutsam sandte ich also die richtigen Impulse aus, und der Daumen meiner linken Hand schloß sich gerade so weit wie nötig um den Stiel des Glases. Wie oft hatte ich nicht schon feinstes Kristallglas zerbrochen, weil ich nicht wußte, wie fest ich mit den gefühllosen Fingern zugreifen mußte, damit das Glas nicht rausfiel. Das konnte demütigend sein.
Charles hatte mich in dem Gewühl entdeckt und kam auf mich zu.
»Gut, zu trinken hast du«, sagte er. »Komm mit mir zu Jonny.«
Wir drängelten uns zum Balkon durch, der vor den verglasten Logen über die ganze Länge der Tribüne verlief. Der Blick von hier über die Rennbahn und die dahintergelegenen Hügel war herrlich, selbst an einem trüben Tag.
Am anderen Ende des Balkons standen drei Männer und steckten die Köpfe zusammen. Einer von ihnen war Jonny. [27] Jonny war unser Gastgeber, Lord Enstone. Der zweite war Jonnys Sohn Peter. Den dritten kannte ich nur vom Hörensagen. Persönlich begegnet war ich George Lochs noch nicht. Er war um die Dreißig und bereits dick im Internet-Wettgeschäft. Seine Firma, www.gewagt-gewonnen.com, war zwar nicht marktführend, expandierte aber rasch, und im gleichen Maß wuchs sein Vermögen. Im Auftrag des Jockey-Clubs hatte ich einmal seine Herkunft überprüft, ein Routineverfahren, wenn jemand eine Buchmacherlizenz beantragt. Er war der zweite Sohn eines Buchmachergehilfen aus Nordlondon. Er hatte ein Stipendium für Harrow bekommen, wo sich die anderen Jungen anscheinend über seine Aussprache und die Art, wie er das Messer hielt, mokierten. Aber der junge George lernte schnell, paßte sich an und machte sich. Außer, daß er damals noch nicht George hieß. Von Hause aus hieß er Clarence Lochstein, so genannt von seiner Mutter nach dem Duke of Clarence. Nicht nach Albert, Duke of Clarence, dem ältesten Sohn von Edward VII., der 1892 an Lungenentzündung gestorben sein soll, obwohl sich das Gerücht hartnäckig hält, daß man ihn vergiftet hat, weil er verdächtigt wurde, Jack the Ripper zu sein, und man seiner Verhaftung zuvorkommen wollte. Auch nicht nach George, Duke of Clarence, dem Bruder Richards III., der wegen Hochverrats verurteilt und 1478 im Tower von London in einem Faß Malvasierwein ertränkt wurde. Clarence Lochstein war von seiner Mutter nach dem Duke-of-Clarence-Pub in ihrer Straße in Islington benannt worden. Es gab Gerüchte, daß George gebeten wurde, Harrow zu verlassen, weil er Pferdewetten von den anderen Jungs und angeblich auch von Lehrkräften angenommen hatte. Dennoch [28] bekam er einen Studienplatz an der London School of Economics. Clarence Lochstein/George Lochs war ein aufgeweckter Bursche.
»Darf ich Sie mit Sid Halley bekannt machen?« sagte Charles ohne Rücksicht auf die vertrauliche Unterhaltung der Männer.
George Lochs fuhr zusammen. Offensichtlich hatte nicht nur ich von ihm, sondern er auch schon von mir gehört.
An die Reaktion war ich durchaus gewöhnt. Wenn ein Streifenwagen hinter einem an der Ampel hält, reagiert man ähnlich. Unweigerlich bekommt man ein merkwürdig schlechtes Gewissen, auch wenn man gar nichts getan hat. Wissen die, daß ich vorhin zu schnell gefahren bin? Sind meine Reifen in Ordnung? Hätte ich das zweite Glas Wein besser stehen lassen sollen? Erst wenn der Streifenwagen abbiegt oder überholt, schlägt das Herz wieder normal und hören die Hände auf zu schwitzen.
»Sid. Gut. Schön, daß Sie kommen konnten.« Lord Enstone lächelte breit. »Darf ich Ihnen George Lochs vorstellen? George, Sid.«
Wir gaben uns die Hand und sahen uns in die Augen. Seine Hand war nicht sonderlich feucht, sein Gesicht verriet nichts.
»Und meinen Sohn Peter kennen Sie«, sagte Lord Enstone.
Ich hatte ihn verschiedentlich auf der Rennbahn gesehen. Wir nickten uns zu. Peter war ein durchschnittlich begabter Amateurjockey Anfang der Dreißig, der seit einigen Jahren mäßige Erfolge feierte, vor allem in reinen Amateurrennen.
»Starten Sie nachher im Foxhunters?« fragte ich ihn.
[29] »Schön wär’s«, sagte er. »Konnte keinen Besitzer überreden, mich aufzustellen.«
»Und die Pferde Ihres Vaters?« fragte ich, wobei ich dem Vater zuzwinkerte.
»Keine Chance«, meinte Peter mit einem halbherzigen Lächeln. »Der alte Widerling läßt mich nicht ran.«
»Wenn sich der Junge beim Pferderennen den Hals brechen will, ist das seine Sache, aber ich möchte ihm dabei nicht noch behilflich sein«, sagte Jonny und zauste seinem Sohn die blonden Haare. »Das würde ich mir nie verzeihen.«
Peter zog gereizt den Kopf von der Hand des Vaters weg und stapfte durch die Balkontür in die Loge. Über das Thema hatten sie sich offenbar schon öfter unterhalten.
»Charles, gehen Sie mit dem guten George doch hinein und besorgen Sie ihm ein Glas Schampus«, sagte Lord Enstone. »Ich möchte mit Sid unter vier Augen sprechen.«
Es war offensichtlich, daß der gute George sich nicht wegen eines Glases Schampus oder sonst etwas hinauskomplimentieren lassen wollte. »Ich höre auch bestimmt nicht zu«, meinte er lächelnd und rührte sich nicht vom Fleck.
»Genau.« Enstone verlor die Geduld und damit auch seinen gepflegten Zungenschlag. »Sie sollen mit Charlie reingehn, Freundchen, okay?«
Ein paar Jahre zuvor hatte ich auch ihn überprüft, im Auftrag eines Besitzersyndikats, dem er sich anschließen wollte. Jonny Enstone war Bauunternehmer. Mit sechzehn war er in Newcastle von der Schule abgegangen, um eine Maurerlehre bei J. W. Best anzufangen, einem kleinen Bauunternehmen, das dem Vater eines Schulfreundes gehörte. [30] Innerhalb von zwei Jahren arbeitete er sich zum Geschäftsführer hoch, und bald darauf zahlte er den Vater des Freundes aus. Das Unternehmen expandierte rasch, und mit dem Slogan »Das J. W. Best-gebaute Haus, das Sie kaufen können« wanderten Best-Häuser nach Norden, Süden und Westen und überzogen das Land von Glasgow bis Plymouth und darüber hinaus mit hübschen kleinen 3- oder 4-Zimmer-Schachteln.
Aus Jonny war erst Sir John, dann Lord Enstone geworden, doch er mischte immer noch in der Firma mit. Berüchtigt war er seit jenem frühmorgendlichen Auftritt auf einer Baustelle rund dreihundert Kilometer von seinem Wohnort entfernt, wo er persönlich jeden entlassen hatte, der auch nur eine Minute nach sieben erschienen war. Dann hatte er das Jackett seines Nadelstreifenanzugs ausgezogen, die Ärmel des gestärkten weißen Hemds hochgekrempelt und den ganzen Tag an der Stelle des gefeuerten Maurers gearbeitet. »Nun, Sid«, jetzt war das Englisch wieder fernsehreif, »ich möchte, daß Sie etwas für mich herausfinden.«
»Ich will’s versuchen«, sagte ich.
»Ich bezahle Sie zum Tarifsatz. Sie sollen herausfinden, warum meine Pferde nicht siegen, wenn sie es sollten.«
Immer wieder trat man mit dieser Bitte an mich heran. Ich seufzte innerlich. Die meisten Besitzer sind der Meinung, ihre Pferde sollten öfter gewinnen, als sie es tun. Sie denken: Ich hab ganz schön geblecht für das Vieh, warum wirft es nicht allmählich was ab?
»Ich glaube«, fuhr er fort, »mein Jockey und mein Trainer halten sie zurück.«
Das dachten sie alle.
[31] »Nehmen Sie sich einen anderen Trainer.« Ich war dabei, mich um einen Auftrag zu bringen.
»So einfach ist das nicht, junger Mann. Ich sage Ihnen, meine Pferde siegen nicht nur nicht, wenn sie siegen sollten, sie laufen unter fremder Order. Ich fühle mich manipuliert, und das gefällt mir nicht.« Mit einem Mal erkannte ich den wahren Jonny Enstone hinter der Savile-Row-Fassade: einflußreich, entschlossen, sogar gefährlich. »Ich bin im Rennsport, weil ich gern siege.« Er betonte das Wort. »Das Geld ist nicht wichtig, aber der Sieg.«
Wie kam es nur, dachte ich, daß immer diejenigen, die reichlich davon hatten, Geld nicht für wichtig hielten? Für den kleinen Zocker war eine Platzwette auf einen großen Außenseiter viel besser als eine Siegwette auf einen Favoriten.
Peter erschien mit einem Glas Champagner als Friedensangebot für seinen Vater; ihre kleine Kabbelei von vorhin war offensichtlich vergessen.
»Danke, Peter«, sagte Lord Enstone. Er trank einen Schluck von dem goldenen Saft.
»Wer trainiert Ihre Pferde?« fragte ich. »Und wer reitet sie?«
»Bill Burton und Huw Walker.«
Ich blieb und schaute mir den Gold Cup von Lord Enstones Loge aus an. Der Balkon ächzte unter den Leibern, die sich an das Geländer drückten, um diese größte Herausforderung für Steeplechaser mitzuerleben, 5200Meter über zweiundzwanzig Sprünge, alle Pferde mit dem gleichen Gewicht. Der Gewinner des Cheltenham Gold Cup war ein echter Champion.
[32] Ich war achtmal in diesem Rennen angetreten und wußte nur zu gut, unter welcher nervlichen Anspannung die Jockeys bei der Parade vor den ausverkauften Tribünen standen. Der Gold Cup ist eins von nur zwei oder drei Hindernisrennen im Jahr, die das Siegpferd und seinen Reiter in die Geschichtsbücher bringen. Ein Pferd, das dieses Rennen zweimal gewinnt, bringt die Menschen zum Träumen. Mit drei Gold-Cup-Siegen wird das Tier zur Legende.
Oven Cleaner trachtete ungeachtet seines rußigen Namens danach, sich unter die Legenden einzureihen.
Er war ein großer Schimmel, und ich sah zu, wie er im leichten Galopp mit den anderen zum Start ritt. Würde ich jemals aufhören, diejenigen zu beneiden, die das machten, wonach mir immer noch der Sinn stand? Ich war nicht im Sattel geboren worden und hatte nie auf einem Pferd gesessen, bis ich sechzehn war und meine unheilbar an Nierenkrebs erkrankte, verwitwete Mutter mich zu einem Trainer in Newmarket in die Lehre schickte, einfach weil ich klein war für mein Alter und bald ohne Eltern dastehen würde. Aber ich hatte mich beim Reiten sofort in meinem Element gefühlt. Ich fand die Beziehung zwischen Pferd und Reiter aufregend, erst recht, als ich merkte, daß ich die Gedanken der Pferde lesen konnte. Als mir aufging, daß sie auch meine lesen konnten, wußte ich, daß ich Teil einer unschlagbaren Verbindung war.
Und so blieb es auch, bis alles auseinanderfiel. Ein Jockey spürt ein Pferd weder durch die Füße in den Bügeln noch den Hintern auf dem Sattel, sondern durch die Hände an den Zügeln, die wie Stromkabel mit dem Maul des Pferdes verbunden sind und Befehle und Daten in beide Richtungen [33] übermitteln. Mit nur einer Hand war es wie eine Batterie mit nur einem Pol. Zwecklos – kein Kreislauf, keine Übertragung, keine Daten, nichts ging. Jedenfalls nicht schnell, und das wird von Rennpferden und Jockeys nun einmal erwartet.
Ich schaute den besten Steeplechasern der Welt zu, wie sie zum ersten Mal an der Tribüne vorbeigaloppierten, und sehnte mich regelrecht danach, bei ihnen zu sein. Es war Jahre her, doch es fühlte sich an, als wäre es gestern gewesen.
Oven Cleaner räumte auf. Wie man es von ihm kannte, sah es zunächst so aus, als warte er zu lange ab, doch dann steigerte er das Tempo, stürmte unter dem ohrenbetäubenden Gebrüll seiner zigtausend treuen Fans den Berg hinauf und gewann um Haaresbreite.
Die Zuschauer tobten, jubelten, schrien und warfen sogar die nassen Hüte in die Luft. Der große Schimmel nickte beifällig mit dem Kopf, als er auf dem Weg zum Absattelplatz für den Sieger den Applaus entgegennahm. Er war ein Held, und er wußte es. Erwachsene Männer weinten vor Freude und umarmten ihre Platznachbarn, ob sie sie kannten oder nicht. Die einzigen unglücklichen Gesichter waren die der Buchmacher, die ein Vermögen verlieren würden. Oven Cleaner war ein Nationalheiligtum, Hausfrauen hatten ihr Haushaltsgeld und Schulkinder ihr Taschengeld auf seinen Sieg gewettet. Der »Cleaner«, wie man ihn liebevoll nannte, war ein Gott unter den Rennpferden. Der Jubel stieg zu neuen Höhen an, als die Legende von ihrer begeisterten Besitzerin auf den Absattelplatz geführt wurde. Dann starb die Legende.
[34] Aus Freudentränen wurden Tränen der Verzweiflung, als der geliebte Champion plötzlich strauchelte und aufs Gras fiel, wobei er die Besitzerin umwarf und ihr Bein unter seinem Zehnzentnerleib begrub. Das Publikum verstummte bis auf eine Gruppe von feiernden Wettgewinnern im Hintergrund, die von der eingetretenen Tragödie noch nichts mitbekommen hatten. Die Schreie der Besitzerin mit ihrem eingeklemmten, zerdrückten Fußgelenk drangen schließlich auch zu ihnen durch, und sie wurden still.
Oven Cleaner hatte alles gegeben. Sein Herz, so stark noch, als es ihn in Cheltenham den Berg hinauftrug, hatte ihn im Augenblick seines Triumphs im Stich gelassen.
Helfern gelang es, die arme Besitzerin zu befreien, doch anstatt das gebrochene Fußgelenk medizinisch versorgen zu lassen, bettete sie den Kopf des Pferdes auf ihren Schoß und weinte die Tränen der Zurückbleibenden, für die es keinen Trost gibt.
Ich sah zu, wie der Tierarzt das Pferd untersuchte. Er setzte ein Stethoskop auf die weiß behaarte Brust und horchte einige Sekunden lang. Dann richtete er sich auf, schürzte die Lippen und schüttelte den Kopf. Keine Rettungsassistenten, keine Mund-zu-Mund-Beatmung, keine Klebeelektroden, keine Herzmassage, bloß ein Kopfschütteln.
Ein paar Arbeiter eilten mit Schutzschirmen aus grünem Segeltuch herbei, die sie rings um den noch dampfenden Leib herum aufstellten. Kein Schutzschirm für den armen Menschen, dachte ich, der keine drei Stunden zuvor an derselben Stelle gestorben war. Doch eigentlich brauchte es die Schutzwände nicht. Waren die Leute herbeigeströmt, um dem menschlichen Drama zuzuschauen, so wandten sie sich jetzt [35] ab, weil sie das traurige Ende eines derart geliebten Freundes nicht mit ansehen wollten.
Ein dunkler Schatten senkte sich auf die Rennbahn. Daß der Auswieger protestierte, weil Oven Cleaners Jockey sich nicht zurückgewogen hatte, machte es nicht besser.
»Wie sollte ich denn?« wehrte er sich. »Mein blöder Sattel ist doch noch auf dem Pferd, und das ist schon auf dem Weg zur Leimfabrik.«
Tatsächlich aber hatte der Trainer den erwähnten Sattel abgenommen, als das Pferd zusammengebrochen war, und ihn unter den mit einem Tuch bedeckten Tisch für die Preisverleihungen gelegt, wo er außer Sicht war. Dank einer ungewöhnlichen Portion gesunden Menschenverstandes kam die Rennleitung überein, daß der mit seinem Sattel wieder vereinte Jockey sich nachträglich zurückwiegen könne. Ich fragte mich, wie man entschieden hätte, wenn statt des Pferdes der Jockey gestorben wäre. Hätte man seinen leblosen Körper zur Waage geschleift? Totes Gewicht. Ich schmunzelte bei dem Gedanken und fing mir einige gestrenge Blicke dafür ein, daß ich zu einem Zeitpunkt allgemeiner Trauer ein so fröhliches Gesicht machen konnte.
Das vierte Rennen am Gold-Cup-Tag ist das Foxhunter Steeple Chase, das oft als Goldcup der Amateure bezeichnet wird. Der Favorit siegte, kehrte aber zu beinah stillen Tribünen zurück. Nach Jubeln war dem Publikum nicht mehr zumute, es klatschte nur noch höflich.
»Wo ist mein verdammter Jockey?« fragte Bill Burton alle und jeden vor dem Waageraum.
»Huw Walker?« fragte ich, als Bill im Eilschritt auf mich zukam.
[36] »Überhaupt kein Verlaß auf den Sauhund. Wie vom Erdboden verschluckt. Hast du ihn gesehen, Sid?« Ich schüttelte den Kopf. »Er soll Leaded Light im nächsten Rennen reiten, aber ich finde ihn nicht. Muß einen anderen Jockey angeben.« Er ging wieder hinein, um die Reiterangabe zu ändern.
Leaded Light wurde in einem knappen Einlauf, der die Zuschauer von den Sitzen hätte reißen müssen, auf den zweiten Platz verwiesen. Die Stimmung war jedoch derart gedrückt, daß noch nicht einmal der Jockey auf dem Sieger so aussah, als ob er sich freute. Viele Zuschauer waren bereits gegangen, und auch mir reichte es jetzt. Ich entschied mich, am Wagen auf Charles zu warten, in der Hoffnung, daß auch er nicht bis zum letzten Rennen würde bleiben wollen.
Ich ging gerade an den in Reihen aufgestellten Übertragungswagen vorbei, als eine junge Frau mit schreckgeweiteten Augen auf mich zustolperte. Ohne ein Wort herauszubringen, zeigte sie auf die Lücke zwischen zwei Wagen.
Sie hatte Huw Walker gefunden.
Er lehnte mit dem Rücken am Reifen eines Ü-Wagens und blickte mich mit einem Ausdruck der Überraschung an. Nur daß seine starren Augen nichts sahen und nie mehr etwas sehen würden.
Er trug noch seine Reitkleidung, Rennhose, leichte Reitstiefel und einen dünnen weißen Rolli unter einem blauen Anorak zum Schutz vor Regen und Märzkälte. Der Anorak stand offen, so daß ich deutlich die drei dicht beieinanderliegenden Einschußwunden mitten auf seiner Brust sehen konnte, die sich rot gegen die weiße Baumwolle [37] abzeichneten. Ich wußte, was eine Kugel dem Körper eines Menschen antun kann, denn ich hatte aus Unachtsamkeit selbst einmal eine eingefangen, doch diese drei waren näher am Herzen als damals bei mir, und die Todesursache stand ziemlich außer Zweifel.
[38] 3
Charles und ich kamen erst nach Mitternacht nach Aynsford zurück.
Wie so oft ging die Polizei rigoros vor, ohne Rücksicht auf irgend jemandes Gefühle zu nehmen und, wie es schien, ohne oder fast ohne Sinn und Verstand.
Das letzte Rennen des Tages wurde gestrichen, die Ausgänge wurden gesperrt. Niemand durfte gehen, nicht einmal die Zuschauer, die keinen Zugang zu der Stelle hatten, an der Huw Walker gefunden worden war. Für die Befragung von fast sechzigtausend Menschen denkbar schlecht gerüstet, gab die Polizei schließlich nach und ließ die durchnäßten und verärgerten Massen hinaus zu den Parkplätzen und nach Hause fahren, aber erst, als es stockdunkel und eiskalt war. In gewisser Weise taten mir die Beamten leid. Sie hatten keine Ahnung, wie sie mit tief bestürzten Rennbahnbesuchern umgehen sollten, die um ein Pferd trauerten. Der Mord an einem Jockey, meinten sie, ginge ihnen doch wohl näher als der Tod eines Tiers?
»Seien Sie nicht albern«, meinte ein Mann, der neben mir stand. »Die Jockeys sind doch sowieso alle Gauner. Wahrscheinlich hat er nur gekriegt, was er verdient hat.« Leider war das eine verbreitete Ansicht. Ein Sieg ist allein dem Pferd zu verdanken. Siegt es nicht, ist der Reiter schuld.
[39] Ich kam nicht so ohne weiteres davon, da ich Augenzeuge war, und erklärte mich widerwillig bereit, in dem provisorischen Einsatzraum, den sie in einem der jetzt verlassenen Restaurants eingerichtet hatten, eine Aussage zu machen. Ich wies darauf hin, daß ich nicht derjenige war, der Huw entdeckt hatte. Die junge Frau stand jedoch unter Schock und war von einem Arzt ruhiggestellt worden. Da sie schlief, konnte sie nicht mit der Polizei sprechen. Glück gehabt.
Huw war vor dem Gold Cup in der Jockeystube gesehen worden, aber danach nicht mehr. Bill Burton hatte knapp eine Stunde später nach ihm gesucht.
Als sie ihre Befragungsecke eingerichtet hatten und mit ihren Fragen zu mir kamen, war die Kunde von der lautstarken Auseinandersetzung zwischen Trainer und Jockey nach Candlesticks Sieg im ersten Rennen natürlich schon zu ihnen durchgedrungen. Wie es aussah, war Bill Burton bereits ihr Hauptverdächtiger.
Ich wies Chefinspektor Carlisle von der Kripo Gloucestershire darauf hin, daß Huw augenscheinlich von einem Profi getötet worden war, der eigens zu dem Zweck bewaffnet zur Rennbahn gekommen sein mußte, und daß Bill Burton schwerlich ein Schießeisen aus der Luft gezaubert haben konnte, nur weil er nach dem ersten Rennen Zoff mit seinem Jockey hatte.
»Ah«, meinte er, »vielleicht sollen wir aber genau das denken, und in Wirklichkeit hat Burton es von Anfang an geplant.«
Ja, ich hatte früher am Tag mit Huw Walker gesprochen.
Nein, er hatte nichts zu mir gesagt, was die Polizei weiterbringen könnte.
[40] Ja, ich hatte Huw Walker und Bill Burton nach dem ersten Rennen zusammen gesehen.
Nein, ich wußte nicht, warum ihm jemand nach dem Leben hätte trachten sollen.
Ja, ich würde mich mit ihnen in Verbindung setzen, wenn mir noch etwas einfiele, was für sie von Bedeutung sein könnte.
Mir fiel die Nachricht auf meinem Londoner Anrufbeantworter ein, und ich entschied mich, sie nicht zu erwähnen. Ich wollte sie mir erst anhören, und die Fernabfrage war kaputt.
Am nächsten Morgen brachten alle überregionalen Tageszeitungen Triumph und Tod von Oven Cleaner auf der Titelseite. The Times widmete der Story die ersten drei Seiten, mit eindrücklichen Fotos von seinem Sieg und der anschließenden Katastrophe.
Erst auf Seite 7 kam der Bericht über die Entdeckung des Leichnams von Jockey Huw Walker durch den ehemaligen Champion Jockey und jetzigen Privatdetektiv Sid Halley am späten Nachmittag. Auch dieser Artikel nahm Bezug auf das traurige Ableben des gefeierten Pferdes, und es wäre verzeihlich gewesen, wenn man unwillkürlich einen Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen gesehen hätte. Irgendwie wurde der Eindruck vermittelt, Walkers Tod sei eine kuriose Folge von Oven Cleaners Hinschied, als hätte sich der Jockey aus Kummer umgebracht, obwohl er das Pferd gar nicht selbst zum Sieg geführt hatte. Die drei Schußwunden in Huws Brust wurden nicht erwähnt. Da jeder einzelne Schuß tödlich gewesen war, ging zumindest die Polizei nicht von einem Selbstmord aus.
[41] Die Racing Post brachte gleich vier Doppelseiten über Oven Cleaners Karriere und widmete ihm einen Nachruf, der eines Premierministers würdig gewesen wäre.
»Dabei war’s doch bloß ein Pferd«, bemerkte Charles beim Frühstück. »Erinnert mich an das Londoner Denkmal für die Tiere im Krieg. Alberne Gefühlsduselei.«
»Na komm, Charles«, meinte ich. »Ich habe gesehen, wie es dich fast zum Weinen bringt, wenn deine Hunde sterben. Das ist das gleiche.«
»Quatsch!« Aber er wußte, daß es stimmte. »Wann fährst du?«
»Nach dem Frühstück. Ich muß ein paar Berichte schreiben.«
»Komm bald wieder. Komm, sooft du willst. Ich hab dich gern um mich, und du fehlst mir, wenn du nicht da bist.«
Ich war überrascht, aber erfreut. Anfangs war er strikt dagegen gewesen, daß seine Tochter einen Jockey heiratete. Keine passende Partie für die Tochter eines Admirals, hatte er gemeint. Über eine Schachpartie, die ich gewonnen hatte, waren wir zu einer bleibenden Freundschaft gelangt, die das Scheitern meiner Ehe ebenso überdauert hatte wie das jähe Ende meiner Rennlaufbahn und maßgeblich zum Gelingen meines neuen Lebens beigetragen hatte. Charles war keiner, der seine Gefühle offen zeigte; als Kommandeur zur See ist man allein und muß sich Untergebenen gegenüber ein dickes Fell zulegen.
»Danke«, sagte ich. »Ich bin gern hier und komme bald wieder.«
Wir wußten beide, daß ich meistens nur nach Aynsford kam, wenn ich in Schwierigkeiten steckte oder deprimiert [42] war oder beides. Aynsford war für mich zum Asyl und zur Therapie geworden. Es war der Fels in den stürmischen Gewässern, die ich zu meiner Heimat gemacht hatte.
Ich brach gleich nach dem Frühstück auf und fuhr über eine relativ leere M40 nach London. Unerbittlich prasselte der Regen auf das Dach meines Audi, als ich um Hyde Park Corner bog und nach Belgravia hineinfuhr. Ich hatte eine Wohnung im vierten Stock eines Hauses in der Ebury Street, nicht weit von Victoria Station, und nach fünf Jahren fühlte ich mich dort langsam zu Hause. Nicht zuletzt, weil ich dort nicht allein wohnte. Die Frau, mit der Sid Halley derzeit »pennte«, das Geheimnis, das ich vor Chris Beecher hütete, war Marina van der Meer, eine holländische Schönheit, eine natürliche Blondine mit Köpfchen und Mitglied eines Teams von Chemikern, die am Britischen Krebsforschungsinstitut in Lincoln’s Inn Fields nach dem Heiligen Gral suchten – einem einfachen Bluttest, mit dem man Krebs erkennen kann, lange bevor irgendwelche Symptome auftreten. Frühzeitiges Erkennen, sagte sie, verbessert die Heilungschancen.
Als ich gegen Mittag ankam, saß sie in einem flauschigen rosa Frotteemorgenmantel auf unserem breiten Bett und las die Samstagszeitungen.
»So, so, ganz der kleine Sherlock Holmes!« Sie zeigte auf ein Foto von mir im Telegraph. Es war eines, das oft verwendet wurde und auf dem ich breit lächelnd einen Pokal entgegennahm. Das Foto war schon über zehn Jahre alt und vor den grauen Stellen entstanden, die inzwischen meine Schläfen zierten. »Da steht, du hast die Leiche entdeckt. Ich wette, Colonel Mustard hat ihn im Wintergarten mit einem Bleirohr erledigt.« Ihr Englisch war perfekt, mit der leisen [43] Andeutung eines Akzents, mehr in der Art, wie sie die Sätze modulierte, als wie sie die Wörter aussprach. Musik für meine Ohren.
»Möglich wär’s, aber dann hat er aus dem Bleirohr erst Kugeln gegossen.«
»Daß er erschossen wurde, steht da nicht.« Sie schaute überrascht und tippte an die Zeitung. »Man bekommt eher den Eindruck, daß es ein natürlicher Tod oder Selbstmord war.«
»Schwierig, sich dreimal selbst ins Herz zu schießen. Dieses Juwel hat die Polizei für sich behalten, und ich hab’s der Presse auch nicht gesagt.«
»Wow.«
»Wieso bist du überhaupt noch im Bett?« fragte ich und legte mich neben sie auf die Steppdecke. »Es ist fast Mittag.«
»Ich hab keinen Hunger.«
»Sollen wir uns Appetit machen?« fragte ich grinsend.
»Na endlich.« Sie kicherte und streifte den Morgenmantel von den schlanken Schultern.
Chris Beecher, verzehr dich vor Gram.
Wir blieben bis weit in den Nachmittag im Bett und schauten uns die Pferderennen im Fernsehen an, die Klientenberichte konnten warten. Wegen des Dauerregens verzichteten wir auf einen Spaziergang im St.James’ Park, aber schließlich kuschelten wir uns doch unter einen Schirm und gingen zum Essen ins Santini, das italienische Restaurant an der Ecke. Marina aß Hähnchen, ich Seezungenfilet.
Zufrieden tranken wir eine Flasche Chablis und unterhielten uns über die vergangene Woche.
»Erzähl mir noch von dem ermordeten Jockey«, bat Marina.
[44] »Er war ganz in Ordnung«, sagte ich. »Ich habe kurz vorher sogar noch mit ihm gesprochen.« Huws Telefonnachricht, fiel mir ein, war noch unabgehört auf meinem AB.
»Er hat im ersten Rennen gesiegt«, sagte ich.
Aber ich fragte mich, ob das so vorgesehen war. Hatte er Order zu verlieren? Hatte er deshalb sterben müssen? Sicher nicht. Dieser Mord war fachmännisch ausgeführt. Es war eine Hinrichtung. Wie ich bereits der Polizei gesagt hatte, mußte jemand mit der Mordwaffe in der Tasche zur Rennbahn gekommen sein. Metalldetektoren waren an den Eingängen nicht üblich, nur in Aintree waren sie einmal eingesetzt worden, nachdem das Grand National wegen einer Bombendrohung verschoben worden war.
Der Regen hatte aufgehört, als wir Hand in Hand – ihre linke, meine rechte – nach Hause gingen, wobei wir den Pfützen auswichen und ausgelassen lachten. Deswegen nahm ich Marina nie mit zur Rennbahn. Das hier war eine andere Welt, eine, in der ich entspannen und mich wie ein Teenager aufführen konnte, in der ich zunehmend glücklich und zufrieden war, so sehr, daß ich mit dem Gedanken spielte, das Glück zu besiegeln. Wir blieben auf den fünfzig Metern mindestens viermal stehen, um uns zu küssen, und legten uns gleich wieder ins Bett.
In der Liebe mochte ich es am liebsten sanft und sinnlich, und Marina ging es genauso. Nach den Ereignissen vom Vortag fand ich Trost in ihrer zärtlichen Umarmung, und offenbar erfüllte der Liebesakt auch sie mit großer Zufriedenheit. Danach lagen wir im Dunkeln, schlaftrunken, und streichelten uns hin und wieder.
In der Regel nahm ich die Armprothese vorher ab, doch [45]