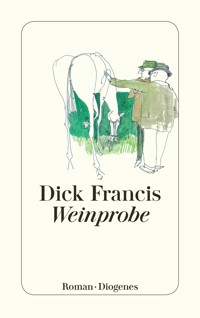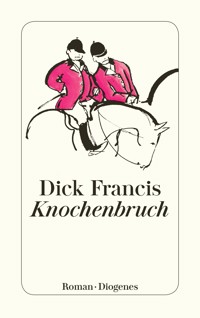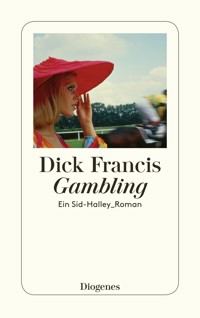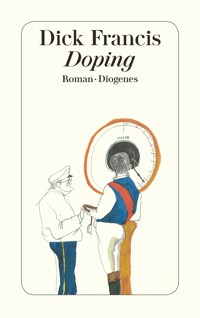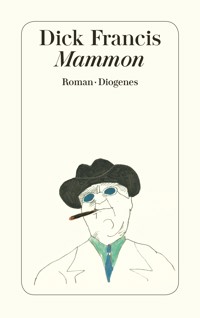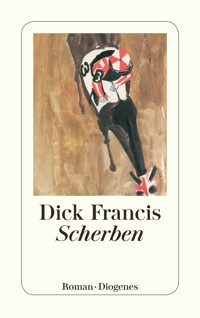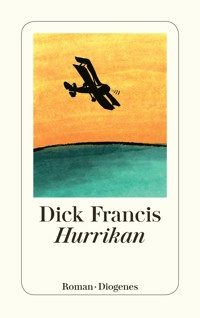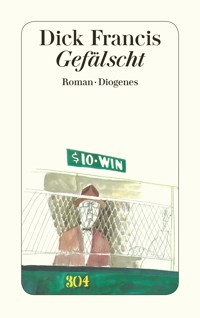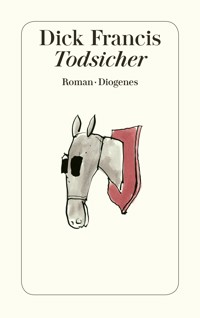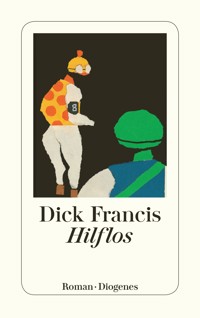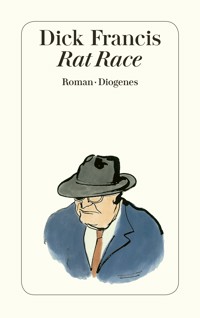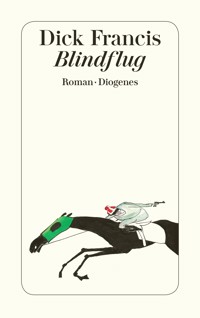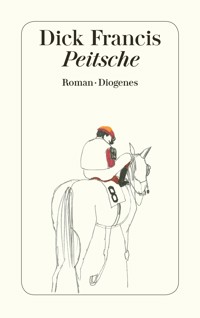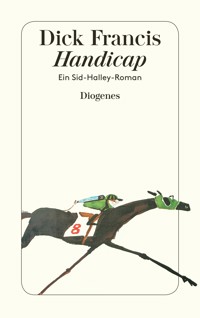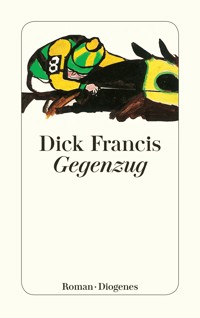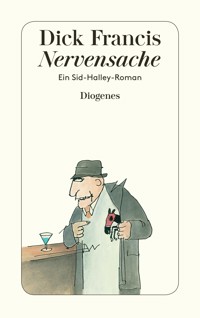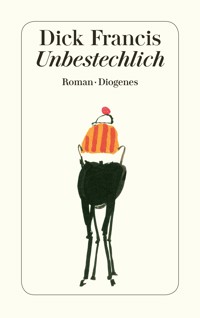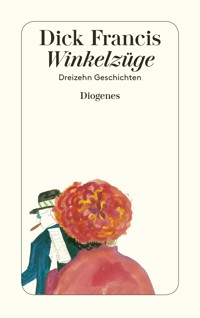
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nach 36 Romanen präsentiert uns der »Meister des Thrillers« (›Der Spiegel‹, Hamburg) zum ersten Mal eine Sammlung von Kurzgeschichten, wie sie schillernder nicht sein könnte. Entstanden zwischen 1970 und 1998, ist sie ein Querschnitt durch Francis' Schaffen. Figuren aus allen Schichten – darunter Sportreporter, Adelssprosse, Zigeuner und Totokassiererinnen – kämpfen hier um Erfolg, Geld und Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Dick Francis
Winkelzüge
DreizehnGeschichten
Aus dem Englischen vonMichaela Link
Titel der 1998 bei
Michael Joseph Ltd., London,
erschienenen Originalausgabe:
›Field of 13‹
Copyright ©1998 by Dick Francis
Die deutsche Erstausgabe erschien 2000
im Diogenes Verlag
Umschlagillustration von
Tomi Ungerer
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright ©2014
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23279 0 (1. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60621 8
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
Für die Recherchearbeit danke ichMary, Merrick, Felix,Jocelyn, Andrew, Jeffrey, Jenny
[7]Inhalt
Prolog [9]
Bombenalarm in Kingdom Hill [12]
Rot, rot, tot [29]
Ein Lied für Mona [67]
Ein strahlend weißer Stern [106]
Auf Kollisionskurs [122]
Alptraum [166]
Eine Möhre für den Fuchs [181]
Ein Geschenk des Himmels [213]
Frühlingsfieber [248]
Blindlings [271]
Winkelzüge [295]
Der Tag der Verlierer [338]
Der Tod von Christopher Haig
[9]Prolog
Erzähl mir eine Geschichte, eine mitreißende, flotte Geschichte. Erzähl mir eine Geschichte, nach der ich noch schlafen kann. Keine blutigen Leichen, kein Horror, keine erhängten, gestreckten und gevierteilten Helden.
Ich kann nicht versprechen, daß es keine Todesfälle geben wird. Aber auf Leichen kommt es mir nicht an.
Amüsiert euch, freut euch, widersprecht, laßt Angst und Schrecken von euch Besitz ergreifen. Stoßt ein Fenster auf, schaut euch an, was dahinter vorgeht. Zieht die Vorhänge wieder zu. Versucht es im nächsten Haus, werft dort einen Blick in den Kühlschrank, laßt euch die Eiswürfel daraus den müden Nacken hinuntergleiten.
Dreizehn unterschiedliche Gerichte. Rezepte je nach Aufwand. Laßt euch ein auf ihre Verschiedenartigkeit. Hier einmal dreitausend Worte und dort vielleicht achttausend. Zeitungen und Zeitschriften kürzen die Erzählungen, damit sie genau den vorhandenen Platz ausfüllen. (Versteht mich nicht falsch, ich spiele das Spiel gerne.) Also sind einige der Ausflüge länger und andere kürzer. Manche kommen schlank daher, andere etwas behäbiger.
Manche stammen aus ferner Vergangenheit, manche sind erst kürzlich entstanden. Trefft ein paar alte Freunde wieder. Schaut mal, ob ihr neue Freundschaften schließt.
[10]Acht dieser dreizehn Geschichten wurden ursprünglich von verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften in Auftrag gegeben, die freundlicherweise nur die Länge und nicht den Inhalt vorgaben. Die anderen fünf Geschichten sind neu und entsprechen nach Länge und Inhalt meiner Wahl.
Als die dreizehn Teilnehmer des Rennens beisammen waren, bereit für die Parade an den Start, da erhob sich wie überall im Leben die Frage: »Wer kommt als erster?« Sollte das Buch mit der zuerst geschriebenen Geschichte beginnen? Sollte das Erstgeburtsrecht bestimmend sein?
Überlassen wir es dem Zufall, sagten wir schließlich und veranstalteten eine improvisierte Ziehung.
»Wir«, das hieß in diesem Falle die vier, die sich friedlich zu einem vormittäglichen Drink zusammengefunden hatten. »Wir«, das sind meine Frau Mary, mein Sohn Felix, mein Literaturagent Andrew Hewson und ich selbst.
Wir schrieben die Titel der dreizehn Geschichten auf dreizehn Aufkleber und falteten diese sorgfältig zusammen, steckten sie in einen gläsernen Champagnerkühler, den meine Frau und ich von Phyllis und Victor Grann als Einweihungsgeschenk für unsere Wohnung in der Karibik geschenkt bekommen hatten. (Mrs.Phyllis Grann ist die Präsidentin von Penguin Putnam Inc., des Verlages von D. Francis in den USA.)
Abwechselnd schüttelten wir den Champagnerkühler und zogen jeweils einen der zusammengefalteten Aufkleber heraus.
Dieser wurde dann auseinandergefaltet, vorgelesen und auf ein Brett geklebt. Dreizehn Aufkleber… Dreimal durfte [11]jeder ziehen, den dreizehnten und letzten nahm ich selbst heraus.
Wir zogen völlig unbekümmert. Um ehrlich zu sein, dachten wir, wir würden uns an dem Resultat doch noch zu schaffen machen. Aber zu unserem Erstaunen ergab es sich in etwa so, wie wir es angeordnet hätten, so daß wir die Reihenfolge unverändert übernahmen.
[12]Bombenalarm in Kingdom Hill
Die Zeit macht sich auf unheimliche Weise über das Ersonnene und Erzählte lustig. Die Ereignisse im Zusammenhang mit einer Bombendrohung in Kingdom Hill – einer imaginären Rennbahn – wurden im Jahre 1975 zur sommerlichen Unterhaltung der Leser der Times erfunden. Jahre später sollte dann die Grundidee der Erzählung Wirklichkeit werden: Aufgrund eines falschen Bombenalarms wurde 1997 das Grand National Steeplechase in Aintree abgesagt.
Seit Tricksy Wilcox' Geistesblitz hat sich bei den Sicherheitsvorkehrungen vieles geändert, und auch der Wert des Geldes ist nicht mehr der alte. InKingdom Hillwie auch in den übrigen Erzählungen dieses Bandes habe ich Geldbeträge und mancherlei anderes den Verhältnissen der Jahrtausendwende angeglichen.
Am Donnerstagnachmittag kratzte Tricksy Wilcox sich geistesabwesend unter den Achseln und kam zu dem Schluß, daß es sich nicht lohnte, im Zwei-Uhr-dreißig-Rennen auf Claypits zu setzen. Tricksy Wilcox räkelte sich in einem ausgeleierten Sessel, eine halb ausgetrunkene Bierdose in bequemer Reichweite, und ein großer Farbfernseher lieferte ihm die genauen Einzelheiten des Eröffnungslaufs der drei Renntage von Kingdom Hill. Nur Schwachköpfe, [13]dachte er selbstzufrieden, legten bei einer solchen Julihitzewelle, die der Sahara alle Ehre gemacht hätte, eine volle Schicht von neun bis fünf hin. Vernünftige Burschen wie er saßen mit geöffneten Fenstern und bloßem Oberkörper zu Hause und ließen sich Bärte wachsen, während der schwüle Nachmittag dem Abend entgegendämmerte.
Im Winter, fand Tricksy, mühten sich nur Schwachköpfe durch Schnee und Graupel zur Arbeit, während vernünftige Burschen vorm Fernseher in der warmen Stube blieben und auf die Springer wetteten; im Frühling hatte man mit dem Regen zu tun und im Herbst mit dem Nebel. Mit vierunddreißig Jahren hatte Tricksy die Arbeitslosigkeit zu einer hohen Kunst entwickelt und hielt den Gedanken an ein volles, ehrliches Tagewerk für absurd. Es war Tricksys Frau, die bei jedem Wetter zu ihrer Arbeitsstelle im Supermarkt ging, Tricksys Frau, die die Miete für die Sozialwohnung aufbrachte und das abgezählte Geld für den Milchmann daließ. Nach elf Jahren Tricksy war sie immer noch fröhlich, unverdrossen und pragmatisch. Sie hatte während seiner beiden neunmonatigen Gefängnisstrafen ungerührt ausgeharrt und akzeptiert, daß er sich eines Tages wieder einfinden würde. Ihr Dad war ihre ganze Kindheit über mal drinnen und mal draußen gewesen. Die kleinkriminelle Gesinnung war ihr vertraut.
Tricksy sah zu, wie Claypits das Zwei-Uhr-dreißig-Rennen mit beleidigender Leichtigkeit gewann, und spülte sein angeschlagenes Selbstbewußtsein mit dem letzten Bier herunter. In letzter Zeit ging aber auch verdammt noch mal alles, was er anfaßte, in die verdammte Hose, dachte er düster. Er war entschieden knapp bei Kasse und hatte sich [14]sogar ein- oder zweimal beim Nötigsten wie Alkohol und Zigaretten einschränken müssen. Jetzt brauchte er einen netten kleinen Dreh, einen netten kleinen Kitzel, um ein paar arglose Trottel dazu zu bringen, ihre Brieftaschen zu öffnen. Zum Beispiel so was wie die Masche mit den knappen Eintrittskarten, auf die er jahrelang stolz gewesen war, bis die Bullen ihn in Wimbledon mit einem Stoß gefälschter Karten hoppgenommen hatten. Und die Touristen waren heutzutage so gerissen wie nur was; man konnte ihnen keine Abos mehr für nichtexistente Pornozeitschriften andrehen, ganz zu schweigen von der London Bridge.
Er konnte hinterher selbst nicht mehr sagen, was ihn auf die großartige Idee mit der Trittbrettfahrerei gebracht hatte. Eben sah er sich noch friedlich das Drei-Uhr-Rennen in Kingdom Hill an, und im nächsten Augenblick raubte ihm eine wilde, überschwengliche und unheilige Ausgelassenheit schier den Atem.
Er lachte laut. Er klatschte sich auf die Schenkel. Er stand auf und tanzte durchs Zimmer, denn die Kühnheit seiner Gedanken war im Sitzen kaum zu ertragen. »O Moses«, sagte er und schnappte nach Luft. »So einfach geht das. Kingdom Hill, ich komme.«
Tricksy Wilcox gehörte nicht zu den hellsten Köpfen.
Am Freitagmorgen begab sich Major Kevin Cawdor-Jones, der Geschäftsführer der Rennbahn von Kingdom Hill, mit seiner Aktentasche zu der turnusmäßigen Sitzung seines Vorstands, dessen Mitglieder einander größtenteils verabscheuten. Die Rennbahn, deren Eigner und Betreiber eine kleine, ständig in Vorstandskriege verstrickte [15]Privatgesellschaft war, litt unter den Konsequenzen von haßdiktierten, destruktiven Entscheidungen und warf daher nie den Profit ab, den sie hätte hergeben können.
Die Anstellung von Cawdor-Jones war ein typisches Beispiel der Mißwirtschaft. Als Nummer drei auf der Liste möglicher Kandidaten und mit weit geringeren Fähigkeiten als Nummer eins und zwei war er nur deswegen gewählt worden, weil irgendein Ausweg aus der Pattsituation gefunden werden mußte, in die sich die Parteien der Kandidaten eins und zwei gebracht hatten. So war Kingdom Hill zu einem nur mittelmäßigen Geschäftsführer gekommen, dessen vernünftigere Vorschläge zudem gewöhnlich von den zerstrittenen Vorständen vereitelt wurden.
Als Soldat war Cawdor-Jones impulsiv, unbeschwert und von überstürzter Tapferkeit gewesen, Eigenschaften, die sichergestellt hatten, daß ihm die wichtige Beförderung zum Oberst versagt blieb. Als Mensch war er faul und liebenswert, als Geschäftsführer ein Weichling.
Bei der Freitagssitzung dauerte es für gewöhnlich nicht lange, bis der Schlagabtausch in vollem Gange war.
»Massiver Ausbau der Sicherheitsvorkehrungen«, wiederholte Bellamy rechthaberisch. »Allerhöchste Priorität. Muß sofort in Angriff genommen werden. Heute.«
Der dünne Bellamy mit den scharfen Gesichtszügen sah sich aggressiv in der Runde um, und wie gewöhnlich schickte Roskin sich mit gedehnter Stimme an, ihm zu widersprechen.
»Sicherheit kostet Geld, mein lieber Bellamy.«
Roskin bediente sich eines herablassenden Tonfalls, denn er wußte, daß nichts Bellamy mehr erzürnte. Bellamys [16]Gesicht wurde dunkel vor Zorn, und die Sicherheit der Rennbahn wurde wie so vieles andere zum Spielball eines persönlichen Zwistes.
Bellamy ließ nicht locker: »Wir brauchen größere Absperrungen, zusätzliche Spezialschlösser an allen Innentüren und die doppelte Anzahl von Polizisten. Das muß sofort in Angriff genommen werden.«
»Die Besucher von Rennbahnen sind keine Hooligans, mein lieber Bellamy.«
Cawdor-Jones stöhnte innerlich auf. Ihm waren seine Inspektionsrundgänge an den rennfreien Tagen wahrlich schon lästig genug, und er neigte ohnehin dazu, sich nicht peinlich genau an die bereits bestehenden Sicherheitsvorkehrungen zu halten. Größere Absperrungen zwischen den einzelnen Bereichen würden bedeuten, daß er nicht mehr darüberklettern oder sich hindurchzwängen konnte, sondern einen langen Umweg in Kauf nehmen mußte. Mehr Schlösser bedeuteten mehr Schlüssel, mehr Zeitverschwendung, mehr lästigen Ballast. Und das alles wahrscheinlich nur, um den wenigen Schnorrern das Handwerk zu legen, die versuchten, auf bessere Plätze zu kommen, ohne dafür zu bezahlen. Er zog da den Status quo bei weitem vor.
Um ihn herum erhitzten sich die Gemüter, und die Stimmen wurden lauter. Resigniert wartete er darauf, einmal zu Wort zu kommen. »Ehm…«, sagte er und räusperte sich.
Sowohl die erhitzte Pro-Bellamy-Fraktion als auch die höhnische Pro-Roskin-Clique wandte sich ihm hoffnungsvoll zu. Cawdor-Jones war ihrer beider Ausweg – es sei denn, muß eingeschränkt werden, seine Lösungsvorschläge waren wirklich konstruktiv. In diesem Falle erhoben beide [17]Gruppen Einspruch, weil sie wünschten, sie wären selbst auf die Idee gekommen.
»Viele zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen würden mehr Arbeit für unser Personal bedeuten«, sagte er zaghaft. »Sie müßten vielleicht ein oder zwei zusätzliche Leute einstellen, um damit fertig zu werden… und nach den großen Anschaffungskosten wäre da immer noch die Wartung zu bedenken… und… ehm… also, welchen echten Schaden kann man schon einer Rennbahn zufügen?«
Dieses dünne Öl glättete die Wogen immerhin so weit, daß beide Seiten den Rückzug antraten, ohne dabei ihre Positionen oder Meinungen aufzugeben.
»Sie haben da mit dem Personal nicht ganz unrecht«, räumte Bellamy widerwillig ein, denn er wußte, daß zwei zusätzliche Leute erheblich mehr kosten würden als Schlösser und daß die Rennbahn sie sich nicht leisten konnte. »Aber ich bleibe dabei, daß strengere Sicherheitsmaßnahmen notwendig und mehr als überfällig sind.«
Cawdor-Jones war in seiner unbekümmerten Art insgeheim anderer Meinung. Bisher war nie etwas passiert. Warum sollte in Zukunft etwas passieren?
Die Diskussion grollte noch eine halbe Stunde aus, und es wurde nicht das Geringste unternommen.
Am Freitagnachmittag ging Tricksy Wilcox zum Rennen; er hatte die Ferienkasse seiner Frau – die sie in ihrer besten Teekanne aufbewahrte – halb leergeräumt. Es war eine Erkundungsfahrt mit dem Ziel, die Lage zu peilen, und Tricksy, der seine gierigen Augen weit aufgerissen hatte, kicherte unwillkürlich vor sich hin. Ein- oder zweimal ging [18]es ihm durch den Sinn, daß sein unbekümmerter Alleingang reine Verschwendung war: Professionelle Gauner hätten alles gewiß minutiös geplant und auf ihre humorlose Art und Weise alle Eventualitäten bedacht. Aber Tricksy war ein Einzelgänger, der sich nie einer Bande angeschlossen hatte, weil das zu sehr nach harter Arbeit aussah; man wurde die ganze Zeit herumgeschubst und hatte obendrein nicht mal Pensionsansprüche.
Er gönnte sich an verschiedenen Theken ein kleines Bier und setzte unbedeutende Beträge am Toto. Er sah sich die Pferde im Führring an, erkannte Jockeys, deren Gesichter ihm vom Fernsehen vertraut waren, und beobachtete aufmerksam die Rennen. Gegen Ende des Nachmittags machte er sich kichernd und dank einiger bescheidener Gewinne immer noch flüssig auf den Heimweg.
Am Freitagnachmittag verkaufte Mrs.Angelisa Ludville zwei Totoscheine an Tricksy Wilcox – und an hundert andere Leute, die sie genausowenig kannte. Sie war in Gedanken nicht bei ihrer Arbeit, sondern bei dem beängstigenden Stapel unbezahlter Rechnungen auf ihrem Bücherregal zu Hause. Das Leben hatte sie seit ihrem fünfzigsten Geburtstag unfreundlich behandelt; die Sorgen hatten sie unansehnlich gemacht, und eine Blondine hatte sich ihren Ehemann geschnappt. Sitzengelassen, geschieden und kinderlos hätte sie sich trotzdem zufrieden an ein Leben allein gewöhnen können, wenn damit nicht drastische Einschränkungen verbunden gewesen wären. Der unablässige, aufreibende Kampf, den es bedeutete, jeden Pfennig umdrehen zu müssen, fraß ihren natürlichen Optimismus und ihre gute Laune allmählich auf.
[19]Angelisa Ludville warf einen sehnsuchtsvollen Blick auf das Geld, das sie durch ihr Totofenster in Empfang nahm. Bündelweise ging das Zeug jeden Arbeitstag durch ihre Hände, und schon ein kleiner Bruchteil dessen, was das Publikum auf das Spiel verschwendete, würde all ihre Probleme wunderbar lösen, fand sie. Aber Ehrlichkeit war ihr zu einer eingefleischten Gewohnheit geworden, und außerdem war es unmöglich, den Toto zu bestehlen. Die Einnahmen für jedes Rennen wurden sofort eingesammelt und überprüft. Jeder Diebstahl wäre augenblicklich aufgeflogen. Angelisa seufzte und versuchte, sich mit der bevorstehenden Sperrung ihres Telefons abzufinden.
Am Samstagmorgen kleidete Tricksy Wilcox sich mit großer Sorgfalt für den vor ihm liegenden Job an. Seine Frau hätte ihm, wäre sie nicht im Supermarkt mit dem Aufstapeln gebackener Bohnen beschäftigt gewesen, von den fluoreszierenden, orangefarbenen Socken abgeraten. Tricksy, der sich im Schlafzimmerspiegel nur bis zu den Knien hinunter sehen konnte, war felsenfest davon überzeugt, daß der dunkle Anzug, die gedämpfte Krawatte und der braune Filzhut ihm das Aussehen eines ordentlichen, vornehmen Rennbesuchers gaben. Er hatte sich sogar ohne Widerstreben sein Haar um fünf Zentimeter gekürzt und seinen üppigen Schnurrbart entfernt. Mit einem übergroßen Fernglasfutteral über der Schulter betrachtete er mit beifälligem Grinsen seine Verwandlung und machte sich leichten Schritts auf den Weg zum Zug nach Kingdom Hill.
Auf dem Rennplatz drehte Major Kevin Cawdor-Jones wie an jedem Renntag und mit dem gewohnten Mangel an [20]Gründlichkeit seine Inspektionsrunde. Die Schluderigkeit seiner Geschäftsführung hatte außerdem zur Folge, daß das Polizeiaufgebot eine halbe Stunde zu spät und nicht in notwendiger Stärke auf dem Rennplatz erschien; außerdem waren beim Drucker nicht genug Rennkarten bestellt worden.
»Macht doch nichts«, wehrte Cawdor-Jones das Ganze mit einem Achselzucken ab.
Mrs.Angelisa Ludville fuhr mit fünfzig Kollegen in dem totoeigenen Bus zum Rennplatz. Sie sah sich durchs Fenster die vorbeifliegenden Vororte an und dachte trübsinnig über den Preis für Elektrizität nach.
Am Samstagnachmittag um halb drei war sie ganz in das Einerlei ihrer Arbeit versunken, gab Wettscheine aus, nahm Geld entgegen, konzentrierte sich auf ihre Tätigkeit und war einigermaßen glücklich. Sie ordnete ihre Kasse für das Drei-Uhr-Rennen, das größte Rennen des Tages. Schon bald würden sich die besonders langen Schlangen draußen bilden, und Geschwindigkeit und Geschicklichkeit beim Abfertigen der Wetten waren nicht nur ihre Aufgabe, sondern in der Tat ihr Stolz.
Um 14.55Uhr befand sich Cawdor-Jones in seinem Büro neben der Waage und versuchte, das Durcheinander der Löhne für die Aushilfsarbeiter zu entwirren. Um 14.57Uhr klingelte sein Telefon ungefähr zum zwanzigsten Mal seit zwei Stunden. Als er den Hörer aufnahm, waren seine Gedanken immer noch bei den fraglichen Stundenlöhnen für die Leute, die die herausgerissenen Grasplacken wieder in die Bahn steckten.
»Cawdor-Jones«, sagte er automatisch.
[21]Ein Mann mit irischem Akzent begann mit leiser Stimme zu sprechen.
»Was?« sagte Cawdor-Jones. »Sprechen Sie doch bitte lauter. Es ist hier drin so laut… ich verstehe Sie nicht.«
Der Mann mit dem irischen Akzent wiederholte seine Botschaft in demselben leisen, fast flüsternden Tonfall.
»Was?« sagte Cawdor-Jones. Aber sein Anrufer hatte bereits aufgelegt.
»O mein Gott«, sagte Cawdor-Jones und streckte die Hand nach dem Schalter aus, der ihn mit der rennbahneigenen Lautsprecheranlage verband. Er blickte gehetzt auf die Uhr. Ihre Zeiger tickten auf 14.59Uhr zu, und in diesem Augenblick wurden die vierzehn Starter für das Drei-Uhr-Rennen in die Startboxen geführt.
»Ladies und Gentlemen«, sagte Cawdor-Jones, dessen Stimme aus jedem Lautsprecher auf der Rennbahn schallte. »Wir haben eine Warnung bekommen, daß irgendwo auf der Tribüne eine Bombe versteckt worden sei. Würden Sie sich bitte alle sofort von Ihren Plätzen erheben und in die Mitte der Bahn begeben, die Polizei wird eine Durchsuchung in die Wege leiten.«
Der Augenblick ungläubigen Schreckens dauerte weniger als eine Sekunde: Dann strömte die gewaltige Menge der Zuschauer wie ein Fluß die Treppen hinunter, aus den Unterführungen herauf, durch die Türen hinaus, rannte, stürmte und kämpfte sich mit Ellbogen der Sicherheit des freien Raumes auf der tribünenfernen Seite der Rennbahn zu.
Die Bars leerten sich dramatisch, halbvolle Gläser wurden in der Panik umgeworfen und zerbarsten. Die [22]Menschenschlangen am Toto schmolzen augenblicklich dahin, und die Wettscheinverkäufer liefen ihnen Hals über Kopf hinterher. Die Rennaufsicht verließ ihr abgelegenes Büro in würdevollem Laufschritt hügelabwärts, und die Journalisten eilten holterdiepolter den Ausgängen zu, ohne sich die Zeit zu nehmen, ihre Zeitungen zu verständigen. Die Redaktionsbüros zu Hause konnten eine halbe Stunde warten. Bomben warteten nicht.
Binnen zwei Minuten hatten die wogenden Menschenmengen sämtliche Gebäude der Rennbahn verlassen. Nur sehr wenige blieben zurück, zuvorderst Kevin Cawdor-Jones, dem es noch nie an persönlichem Mut gemangelt hatte und der es nun als seine soldatische Pflicht ansah, auf seinem Posten zu bleiben.
Die unterbesetzte Polizeitruppe sammelte sich nach und nach vor der Waage – keiner unter ihnen, der nicht seine natürliche Angst hinter einer zuversichtlichen Miene verborgen hätte. Vielleicht wieder so ein dämlicher Scherz, meinte man untereinander. Es war immer ein Scherz. Oder fast immer. Ihr Vorgesetzter übernahm die Organisation der Durchsuchung und wies den Zivilisten Cawdor-Jones an, sich in Sicherheit zu bringen.
»Nein, nein«, sagte Cawdor-Jones. »Während Sie nach der Bombe suchen, werde ich feststellen, ob auch wirklich alle gegangen sind.« Er lächelte ein wenig nervös und verschwand mit energischem Schritt in der Waage.
Alles in Ordnung hier, dachte er und warf noch einen hastigen Blick in den Waschraum der Jockeys. Alles in Ordnung im Richterturm, der Dunkelkammer für die Entwicklung der Zielfotos, den Küchen, dem Boilerraum, dem Toto, [23]den Büros, den Lagerräumen… Er hetzte von Gebäude zu Gebäude, denn er kannte alle Hinterzimmer, kannte jeden Winkel, in dem ein tauber Mitarbeiter der Rennbahn oder ein betrunkener Besucher ahnungslos herumsitzen konnte.
Er sah keinen Menschen. Er sah keine Bombe. Er kam etwas außer Atem wieder vor der Waage an und wartete auf einen Bericht der langsameren Polizei.
Währenddessen setzte Tricksy Wilcox seine erstklassige Idee nachlässig in die Tat um. Er grinste bei der Erinnerung an den irischen Akzent, der gut genug für einen Eintritt in die Schauspielergewerkschaft gewesen war, und eilte mit schnellem Schritt von Bar zu Bar, von Tür zu Tür, und füllte sein großes, leeres Fernglasfutteral mit Futter. Es war doch erstaunlich, dachte er kichernd, wie sorglos die Leute sich in Panik verhielten.
Zweimal fand er sich Auge in Auge mit einem Polizisten wieder.
»Alles in Ordnung da drin, Officer«, sagte er bestimmt und zeigte jedesmal auf den Raum, aus dem er gekommen war. Jedesmal glitt der Polizeiblick arglos über die Melone, den dunklen Anzug, die gedämpfte Krawatte und hielt ihn für einen Mitarbeiter der Rennbahn.
Nur die orangefarbenen Socken verhinderten, daß er ungeschoren davonkam. Ein Polizist, der seinem entschwindenden Rücken nachsah, runzelte unsicher die Stirn, als ihm die leuchtenden Abschnitte zwischen Hosenbein und Schuh auffielen, und ging langsam hinter ihm her.
»He…«, sagte er.
Tricksy drehte sich um, sah das Gesetz in Gestalt des [24]Polizisten auf sich zukommen, verlor die Nerven und stürmte los. Tricksy gehörte eben nicht zu den hellsten Köpfen.
Am Samstagnachmittag um vier Uhr machte Cawdor-Jones eine weitere Durchsage.
»Es sieht so aus, als sei die Bombendrohung nur ein Scherz gewesen. Sie können sich jetzt gefahrlos wieder zurück zur Tribüne begeben.«
Die Menge strömte wieder zurück und strebte in die Bars. Die Barmädchen kehrten auf ihre Posten zurück und erhoben augenblicklich Hände und Stimmen zu einem kreischend schrillen Refrain beleidigten Entsetzens.
»Jemand hat sämtliche Einnahmen geklaut!«
»Was für eine Unverschämtheit! Alles weg, auch unsere Trinkgelder!«
In den verschiedenen Totogebäuden standen die Wettscheinverkäufer entgeistert da. Der größte Teil der gewaltigen Einnahmen für das wichtigste Rennen des Tages war einfach verschwunden.
Angelisa Ludville betrachtete ihre geplünderte Bargeldkasse mit fassungslosem Staunen. Weiß und zitternd stimmte sie in das Getöse der Stimmen ein. »Das Geld ist weg.«
Cawdor-Jones nahm mit dem Ausdruck ängstlicher Verzweiflung Bericht um Bericht entgegen. Er wußte, daß nach der Massenflucht Richtung Rasen keine einzige Tür abgesperrt worden war. Er wußte, daß keinerlei Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden waren. Der Rennplatz war für eine solche Situation nicht gerüstet. Das Komitee würde [25]zweifellos ihm die Schuld geben. Würde ihm vielleicht sogar kündigen.
Um sechzehn Uhr dreißig hörte er sich mit erstaunter Erleichterung an, was die Polizei Neues zu berichten hatte – ein Mann war festgenommen worden und versuchte zu erklären, wieso sein Fernglasfutteral überquoll von benutzten Banknoten, die vielfach noch das frische, von der Benutzung eines feuchten Bierglases als Briefbeschwerer herrührende Wasserzeichen trugen.
Am Montagmorgen erschien Tricksy Wilcox mit düsterer Miene vor einem Richter und wurde für sieben Tage in Untersuchungshaft geschickt. Die große Idee war doch nicht so toll gewesen, und diesmal würden sie ihn zweifellos für mehr als neun Monate in den Bau schicken.
Nur ein einziger Gedanke hellte seine Zukunft auf. Die Polizei hatte das ganze Wochenende versucht, eine Information aus ihm herauszubekommen, und er hatte den Mund fest geschlossen gehalten. Wo, wollten sie wissen, hatte er den größten Teil seiner Beute versteckt?
Tricksy sagte nichts.
In dem Fernglasfutteral war nur für ein Zehntel des gestohlenen Geldes Platz gewesen. Wo hatte er den Hauptteil versteckt?
Tricksy sagte es ihnen nicht.
Er würde besser wegkommen, hieß es, wenn er den Rest dem Gericht aushändigte.
Tricksy glaubte es nicht. Er grinste hämisch und schüttelte den Kopf. Tricksy wußte aus Erfahrung, daß es ihm als dem Besitzer eines großen, versteckten Schatzes in nächster [26]Zeit weit besser gehen würde. Man würde ihn respektieren. Mit geziemender Ehrfurcht behandeln. Er würde einen gewissen Status haben. Nichts auf Erden hätte ihn dazu bewegen können, alles auszuplaudern.
Am Montagmorgen ging Major Cawdor-Jones mit hochrotem Kopf zu einer Krisensitzung seines Vorstandes und stimmte hilflos Bellamys in scharfem Tonfall wiederholter Meinung zu, daß die Sicherheitsvorkehrungen der Rennbahn eine Schande waren.
»Ich habe Sie gewarnt«, bemerkte Bellamy zum zehnten selbstgerechten Mal. »Ich habe Sie alle gewarnt. Wir brauchen mehr Schlösser. Es gibt hervorragende Schnappschlösser für die Bargeldkassen im Toto zu kaufen. Ich habe mir sagen lassen, daß man das ganze Geld binnen fünf Sekunden sicher verschließen kann. Ich schlage vor, daß diese Vorrichtungen umgehend überall auf der Rennbahn angebracht werden.«
Er blickte streitlustig vom einen zum anderen. Roskin hielt den Blick gesenkt und schürzte lediglich die Lippen, und Kingdom Hill traf jetzt, da das Kind in den Brunnen gefallen war, den Entschluß, alles sicher zu verriegeln.
Am Montagabend schenkte Angelisa Ludville sich einen doppelten Gin ein, schaltete den Fernseher ein und legte die Füße hoch. Neben ihr lag ein Stapel abgestempelter und adressierter Umschläge, deren jeder einen Scheck für eine der gefürchteten Rechnungen enthielt. Sie seufzte zufrieden. Nie, dachte sie, würde sie den Schock beim Anblick ihrer leeren Kasse vergessen. Nie würde sie den Schrecken verwinden, den sie ausgestanden hatte. Nie würde sie die [27]Woge der Erleichterung vergessen, als ihr klar wurde, daß alle ausgeraubt worden waren, nicht nur sie allein. Weil sie nämlich ganz genau wußte, daß es eine der anderen Kassen gewesen war, deren Einnahmen sie hatte mitgehen lassen, als alle zum Ausgang gerannt waren. Es wäre schlicht und einfach dumm gewesen, das Geld aus ihrer eigenen Kasse zu stehlen. Sie konnte ja nicht wissen, daß es noch einen anderen, ehrgeizigeren Dieb gegeben hatte. Es wäre schlicht und einfach töricht gewesen, ihre eigene Kasse zu bestehlen. Außerdem war an dem anderen Schalter viel mehr Bargeld zu holen gewesen.
Am Montagabend saß Kevin Cawdor-Jones in seiner Junggesellenwohnung und dachte über die zweite Durchsuchung von Kingdom Hill nach. Den ganzen Sonntag lang hatte die Polizei noch einmal jede Ecke und jeden Winkel untersucht, aber langsam diesmal und ohne Furcht, weil sie nicht Zunder, sondern Zaster suchten. Cawdor-Jones hatte ihnen willig seine Unterstützung angeboten, aber man hatte nicht das Geringste gefunden. Das Geld war spurlos verschwunden.
»Tricksy muß einen Partner gehabt haben«, sagte der mit dem Fall betraute Polizeibeamte verdrossen. »Aber wir kriegen kein Sterbenswort aus ihm raus.«
Cawdor-Jones, ungekündigt in seinem Verwaltungsposten, lächelte sanft bei der Erinnerung an diese letzten Tage. Er war ein impulsiver Mensch, mutig und von schnellem Entschluß, und er hatte das Beste aus der Gelegenheit gemacht, mit der Tricksy Wilcox ihn versorgt hatte.
[28]Cawdor-Jones, an dessen Nervenkraft nie gezweifelt werden konnte, war am Samstagabend ungehindert mit dem Jackpot vom Toto im Wagen heimgefahren.
[29]Rot, rot, tot
Obwohl die Erzählung an dieser Stelle das erste Mal veröffentlicht wird, spielt ›Rot, rot, tot‹ in der Vergangenheit (in den Jahren 1986 und 1987, um genau zu sein), zum Teil deshalb, weil die Vorschriften zur Mitnahme von Handfeuerwaffen vom europäischen Festland nach England durch das Feuerwaffengesetz von 1988 verschärft wurden.
Émile Jacques Guirlande, ein Franzose, fürchtete sich auf eine Weise vorm Fliegen, die an Phobie grenzte. Selbst Werbeplakate, auf denen Flugzeuge zu sehen waren, und insbesondere laufende Flugzeugmotoren, führten bei ihm zu unangenehm beschleunigtem Herzschlag und trieben ihm winzige Tröpfchen kalten Schweißes auf die Stirn. Infolgedessen reiste er zu Land und zu See, wenn seine weltweiten unternehmerischen Aufgaben ihn aus seinem Pariser Haus fortriefen. Überdies paßte diese geruhsamere Art des Reisens auch besser zu seinem vorsichtigen Wesen. Er ging seine Arbeit gern mit Bedacht an und plante für jede Eventualität voraus. Panikreaktionen auf unvorhergesehene Schwierigkeiten waren für einen Mann von seinem methodischen Denken die Torheit von Amateuren.
Émile Jacques Guirlande war Mörder von Beruf, ein [30]Killer, der weder verdächtigt noch gefangen wurde, ein ruhiger, gesitteter Mann, der jede Aufmerksamkeit mied, der aber im Alter von siebenunddreißig Jahren erfolgreich sechzehn Zielpersonen aus dem Weg geräumt hatte, genauer: sieben Geschäftsmänner, acht Ehefrauen und ein Kind.
Er war natürlich teuer. Und auch verläßlich, einfallsreich und herzlos.
Mit sieben verwaist und nie adoptiert, aufgewachsen in Institutionen, war er selbst nie von Herzen geliebt worden, noch hatte er jemals für ein lebendes Wesen (mit Ausnahme eines Hundes) freundschaftliche Zuneigung empfunden. Beim Militärdienst in der Armee hatte er schießen gelernt, und eine angeborene Sachkundigkeit im Umgang mit Feuerwaffen, vereint mit einem wachsenden Hunger nach Macht, hatten ihn anschließend veranlaßt, eine Stelle als Teilzeitlehrer in einem Schießsportverein anzunehmen, wo Gespräche über den Tod wie Kordit in der Luft schwelten.
›Gelegenheiten‹ wurden Émile Jacques per Post über einen nicht identifizierten Mittelsmann angetragen, den er nie kennengelernt hatte. Bevor er einen Auftrag annahm, unterzog er ihn einer gründlichen Untersuchung. Émile hielt sich für erste Klasse. Der amerikanische Ausdruck »Totschläger« war für einen Mann von seiner Gesinnung unbedingt vulgär. Émile nahm einen Auftrag erst dann an, wenn er sich sicher war, daß sein Kunde zahlen konnte, zahlen würde und nicht nachher von weinerlicher Reue überwältigt zusammenbrach. Überdies bestand Émile auf der Konstruktion wasserdichter Alibis für jeden Kunden, auf den ein überwältigender Verdacht fallen mußte. Und obwohl das durchaus einfach klang, war dies bisweilen der [31]Faktor gewesen, der allein über Tun oder Lassen entschieden hatte.
So war es auch an einem bestimmten Dienstag im Dezember 1986. Das unentbehrliche Alibi schien perfekt zu sein, so daß Émile den Auftrag annahm und sorgfältig seine Taschen für eine kurze Reise nach England packte.
Émiles Englisch, das eher zweckmäßig als kunstvoll war, hatte ihn bisher drei englische Morde in vier Jahren unbeschadet überstehen lassen. Die Paradestücke der Touristenwörterbücher – (»Mon auto ne marche pas«; »Mein Wagen ist stehengeblieben«) – hatte ihn nicht nur vor der gefährlichen Neugier anderer bewahrt, sondern es ihm auch ermöglicht, seine Mission vorausschauend zu verwerfen, wenn ihn vor der Tat ein Gefühl der Unsicherheit plagte. Tatsächlich hatte er schon zweimal in einem späten Stadium den bereits begonnenen Job abgebrochen: einmal wegen schlechten Wetters, ein anderes Mal aus Unzufriedenheit über die Erbärmlichkeit des vorgeschlagenen Alibis.
»Pas bon«, sagte er sich. »Nicht gut.«
Sein Klient, der ein halbes Vermögen im voraus gezahlt hatte, wurde angesichts der Verzögerungen immer ungeduldiger.
An jenem Dienstag im Dezember 1986 jedoch war Émile Jacques, das Alibi betreffend, so zufrieden, wie er es nur sein konnte. Er hatte seine Koffer gepackt und sich beim Schießsportverein für die nächsten Tage abgemeldet und machte sich nun in seinem unauffälligen weißen Wagen auf den Weg nach Calais, um von dort aus die winterliche See des Ärmelkanals zu überqueren.
Wie gewöhnlich führte er die Werkzeuge seines [32]Gewerbes offen mit sich: Handfeuerwaffen, Ohrenschützer sowie mannigfache Zertifikate, die seine Anerkennung als zugelassener Lehrer in einem hochklassigen Pariser Club bewiesen. Das Ganze hatte er in einem verschlossenen, mit Schaumgummi ausgepolsterten Koffer aus Metall, wie Fotografen ihn besaßen. Es sollte noch zwei Jahre dauern, bis Handfeuerwaffen in England verboten wurden, so daß seine Geschichte von einer beabsichtigten Teilnahme an einem Wettbewerb nicht in Frage gestellt wurde. Hätte man ihm bei der Einreise Schwierigkeiten gemacht, hätte er nur resigniert gelächelt und wäre nach Hause gefahren.
Émile Jacques Guirlande, von Beruf Mörder, bekam an jenem Dienstag im Dezember 1986 keine Schwierigkeiten. Nachdem er die Hürde Dover mühelos genommen hatte, fuhr er zufrieden durch die im Winterschlaf liegenden Felder Südenglands und ging im Geiste friedlich noch einmal seinen bösen Plan durch.
In diesem Jahr knisterte es in der Jagdrennszene der britischen Rennplätze. Grund für dieses Knistern war die unmögliche Trainer-Jockey-Allianz zwischen einem langhaarigen Abkömmling echter Zigeuner und dem aristokratischen Neffen aus einem historischen Haus.
Gypsy Joe (genauer gesagt, John Smith) verspürte und zeigte jene beinahe magische Verbundenheit mit Tieren, wie sie bei seinem Volk schon seit Urzeiten existiert. Gypsy Joe zuliebe gruben Vollblüter in ihrem eigenen archaischen Stammesgedächtnis und begriffen, daß die Führung der Herde das Ziel des Lebens war. Der Anführer der Herde gewann das Rennen.
[33]Gypsy Joe gab seinen Pferden mit großer Umsicht das Futter und das Training, das ihren Herzen die größtmögliche Kraft verlieh, und flüsterte ihnen, während er sie für ein Rennen sattelte, rätselhafte Worte der Ermutigung zu. An üblichen Maßstäben gemessen war er durchaus erfolgreich und erfreute sich der widerwilligen Bewunderung der meisten seiner Kollegen, aber für Joe war das nie genug. Er war stets – und vielleicht unrealistischerweise – auf der Suche nach einem Reiter, dessen psychische Schwingungen genau zu dem paßten, was er von seinen Pferden wußte. Er suchte nach Jugend, Mut, Talent und einer unverdorbenen Seele.
Jedes Jahr, während er sich mit den Pferden aus seinem Stall beschäftigte, beobachtete und analysierte er die Rennreiter, die neu auf der Bahn waren. Nach fünf Jahren fand er endlich, wonach er suchte, und verschwendete keine Zeit, es sich öffentlich zu sichern.
Und so erschütterte Gypsy Joe im Spätfrühling des Jahres 1986 die Bruderschaft der Jagdrennjockeys, indem er einem unbeschwerten Amateur – der genau eine Saison lang Rennen geritten und keine bemerkenswerten Siege errungen hatte – einen Jockeyvertrag anbot. Der Amateur brauchte sich, um diesen ungewöhnlichen Vorschlag annehmen zu können, lediglich unverzüglich eine Lizenz als Berufsjockey zu verschaffen.
Red Millbrook (Red für rot; er hatte rotes Haar) hatte dem telefonischen Angebot von Gypsy Joe mit derselben allgemeinen Verwirrung gelauscht, die schon bald etliche andere befallen sollte, angefangen von den Mandarinen des Jockeyclubs bis hin zu kritischen Scharen von Stalljungen in den heimischen Pubs.
[34]Erstens wurden für Jagdrennen nur wenige Reiter fest verpflichtet. Zweitens ritten bereits (wenn auch ohne Verträge) zwei Profis, beides alte Hasen, regelmäßig für Gypsy Joe; beider Resultate wurden weithin als zufriedenstellend betrachtet, da Gypsy Joe auf der Siegertafel der Trainer an fünfter Stelle stand. Drittens konnte man Red Millbrook, der die Schule noch nicht lange hinter sich hatte, als unbedarften Neuling einstufen.
Mit der Selbstsicherheit der Jugend bewarb sich der ›unbedarfte Neuling‹ unverzüglich um eine Lizenz.
Red Millbrook, soeben zum professionellen Jockey aufgestiegen, sah Gypsy Joe zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht, als er vor dem April Gold Cup in Sandown Park voller Neugier in den Führring trat. Gypsy Joe, vierzig und ebenso dickköpfig wie selbstbewußt, wußte, daß er den Spott der Rennszene herausforderte, wenn er diesen beinahe unerprobten Adelssproß in einem großen Rennen zum ersten Mal testete, noch dazu auf einem Pferd, auf dem er nie zuvor gesessen hatte. Kritische Kommentare in verschiedenen Rennzeitungen hatten Joe bereits öffentlich Schelte dafür erteilt, daß er seine beiden nützlichen, getreuen – und wutschnaubenden – Stalljockeys übergangen hatte und »die Hoffnung auf den Gold Cup um eines Publicitygags willen hatte fahren lassen«. Gypsy Joe vertraute seinem Instinkt und ließ sich nicht beirren.
Der junge Red Millbrook sah in Gypsy Joe, als er ihn im Führring traf, einen großen, ungepflegten, langmähnigen Kerl von einem Mann und bedauerte schon die spontan eingegangene Verpflichtung zu reiten, wann immer und wo immer der Trainer es ihm auftrug.
[35]Die beiden so schlecht zusammenpassenden zukünftigen Verbündeten schüttelten einander zaghaft und unter den Augen von Tausenden von Fernsehzuschauern die Hände, und Red Millbrook dachte, der Schauder, der ihn durchlief, sei nur auf die Erregung des Augenblicks zurückzuführen. Gypsy Joe lächelte jedoch zufrieden vor sich hin und war vielleicht der einzige Zuschauer, den es nicht überraschte, als sein Starter sich mit einer halben Länge Vorsprung das Gold sicherte.
Nicht daß Red Millbrook in seinem kurzen Leben je schlecht geritten wäre: In der Tat hatte er alle freien Stunden seiner Jugend auf dem Pferderücken zugebracht, obwohl diese freien Stunden zielgerichtet von elterlicherseits aufgenötigter Schulbildung begrenzt worden waren. Seine mit Adelstiteln geschmückten Eltern konnten durchaus Stolz für ihren Sohn als Amateur aufbringen, schraken aber entsetzt vor dem Wort ›professionell‹ zurück. Wie eine Nutte, stöhnte seine Mutter.
Red Millbrook sah in seinem neuen Profistatus einen Schritt nach oben, nicht nach unten. Ängstlich bestrebt, in Sandown eine gute Figur zu machen, ging er mit grimmiger Entschlossenheit zur Startmaschine und entdeckte über dem ersten Hindernis eine unerwartete geistige Verbundenheit mit dem Pferd in sich. Noch nie in seinem Leben hatte er etwas Ähnliches empfunden. Sein ganzer Körper reagierte. Er und das Pferd erhoben sich wie ein einziges Wesen über sämtliche Hindernisse, die dazu ersonnen und aufgestellt waren, den Schnellsten unter ihnen zu bestimmen. Red Millbrook, eins mit dem Pferd, flog um die letzte Kurve und reckte sich nach vorn über den letzten Hügel. Er [36]teilte den Willen und die Entschlossenheit seines tierischen Partners. Als er siegte, war es nicht Staunen, das ihn erfüllte, sondern das Gefühl, sein gottgegebenes Königreich betreten zu haben.
Im Absattelring des Siegers lächelten Gypsy Joe und Red Millbrook einander leise zu, als seien sie einer privaten Bruderschaft beigetreten. Gypsy Joe wußte, daß er seinen Reiter gefunden hatte. Red Millbrook sah voller Freude seiner Zukunft entgegen.
Oben auf der Tribüne beobachteten die beiden übergangenen Stalljockeys mit wachsendem Zorn das Rennen und den Sieg. Normalerweise hätte einer von ihnen auf dem Pferd gesessen.
Davey Rockman fühlte sich in seiner Wut durch und durch gerechtfertigt. Mit Gypsy Joe war nicht gut Kirschen essen für jene, die für ihn arbeiteten (fand Davey Rockman), aber seine Pferde starteten häufig, waren gut trainiert und hatten ihn – Davey – während der letzten fünf Jahre mit Luxus und Mädchen versorgt. Davey Rockmans Appetit auf Frauen, einst der Skandal der Rennbahnen, war inzwischen lange als normal akzeptiert worden; man wußte eben, daß ›Rock‹, ein dunkler Typ, mit seinem guten Aussehen alles, was Röcke trug, in seinen Bann schlug. Davey Rockmans Ärger über das Geld, das der Sieg in diesem großen, angesehenen Rennen ihm eingetragen hätte, war eine Nichtigkeit im Vergleich zu der Kränkung seines sexuellen Egos.
Nicht ein einziges Mal kam ihm der Gedanke, daß das Pferd, wenn er es geritten hätte und nicht der Thronräuber Red Millbrook, vielleicht gar nicht gewonnen hätte.
[37]Nigel Tape, der zweite Stalljockey, verzehrte sich in treuem Groll um Rocks willen. Nigel Tape, vom Schicksal nicht dazu auserkoren, selbst als Star zu glänzen, sonnte sich gewohnheitsmäßig in seiner Stellung als Kumpan von Rock. Er pflegte dieselben Enttäuschungen zu beklagen, dieselben Triumphe zu feiern, erging sich in denselben unrealistischen Nörgeleien. Als hätte es ihn selbst getroffen, war er wie Davey Rockman empört darüber, durch einen anderen ersetzt worden zu sein, und blähte das Ärgernis zu Dimensionen auf, die nach Rache verlangten. Davey the Rock fühlte sich geschmeichelt von Nigel Tapes geradezu fanatischer Hingabe und erkannte ihre Gefahren nicht.
Am Montag nach dem April Gold Cup betrachtete Gypsy Joe die finsteren Mienen seiner beiden langjährigen Jockeys, als diese zum Morgentraining in seinen Stallhof kamen.
Ungerührt und mit geschäftsmäßigem Tonfall erklärte er ihnen: »Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, wird von jetzt an Red Millbrook mein erster Jockey sein. Sie, Davey, haben die Möglichkeit, als ausbildender Jockey hierzubleiben, ein Job, in dem Sie sehr gut sind, und gelegentlich ein Rennen zu reiten. Wenn es Ihnen lieber ist, können Sie natürlich versuchen, bei einem anderen Trainer wieder erster Jockey zu werden.«
Davey Rockman lauschte in erbittertem Schweigen. Sein Status als Gypsy Joes erster Jockey hatte ihm in der Jagdrennwelt zu angenehm hohem Ansehen verholfen. Die Degradierung, die ihm soeben durch den Trainer zuteil geworden war, bedeutete nicht nur einen ernsten Verlust, was Gesicht und Einkommen betraf, sondern auch das [38]buchstäbliche Ende seiner Anziehungskraft auf die Damenwelt. Er war es gewohnt, die Macht seiner Stellung auszunutzen, um Frauen zu beherrschen. Es gefiel ihm, sie ein wenig herumzustoßen, bis sie um Gnade bettelten. Er fühlte sich überlegen. Er stolzierte häufig in seinen Jockeystiefeln herum, die er als Symbol der Manneskraft betrachtete.
Sich einen Job mit vergleichbarem Ansehen zu suchen war kaum eine ernsthafte Möglichkeit: Es gab einfach nicht genug gute Anstellungen für Stalljockeys auf dem Markt. Davey Rockman sah Gypsy Joes unbekümmerter Entschlossenheit, ihn zu degradieren, direkt in die Augen und spürte das erste Aufwallen von mörderischem Haß.
Nigel Tape fragte mit aggressivem Unterton: »Und was ist mit mir?«
»Sie können weitermachen wie bisher«, antwortete der Trainer ihm.
»Und die Brosamen aufsammeln? Das ist nicht fair.«
»Das Leben ist niemals fair«, entgegnete Gypsy Joe. »Ist Ihnen das noch nicht aufgefallen?«
Gypsy Joes archaische Instinkte erwiesen sich auf spektakuläre Weise als richtig. Red Millbrook und Gypsy Joes Pferde verschmolzen miteinander, elektrisierten einander auf einer Rennbahn nach der anderen, während sonst das Jagdrennprogramm gegen Sommer immer unspektakulärer wurde. Der Applaus für den einen Sieg war kaum verklungen, wenn schon der nächste anschwoll. Die Besitzer waren außer sich vor Begeisterung: Jeden Tag boten neue Besitzer ihre Pferde an. Als die nächste zehnmonatige Saison im August langsam anfing, hatte der Trainer etliche weitere Ställe [39]angemietet, und der Jockey pfiff in glücklicher Selbsterfüllung vor sich hin, während er seinen Wagen von einem Erfolg zum anderen fuhr. Im September, im Oktober und im November sah es so aus, als könne er nichts falsch machen. Er war die Nummer eins auf der Jockeyliste.
Seine Eltern söhnten sich langsam mit seiner »Nuttenhaftigkeit« aus und prahlten statt dessen mit ihm, aber seine beiden älteren, unverheirateten Schwestern neideten ihm seinen Ruhm. Er wohnte noch immer in seinem Elternhaus in London, das seine anspruchsvolle Mutter so sehr dem Dasein in einem feuchten alten Landhaus vorzog. Red begnügte sich mit ihrem Londoner Luxus, während er gleichzeitig plante, sich von seinen Sieggeldern ein eigenes Haus zu kaufen, das im übrigen nicht unbedingt auf Gypsy Joes Schwelle stehen mußte. Das Leben von Jockey und Trainer verlief in verschiedenen Bahnen, genauso wie es gewesen war, bevor ihre Partnerschaft in Sandown besiegelt worden war, aber die Schwingungen zwischen den beiden Männern blieben unverändert. Sie lächelten stets dasselbe verstehende Lächeln, setzten sich aber niemals auf ein Glas Wein zusammen.
Red Millbrook – freundlich, unkompliziert, von großzügigem Naturell – verkehrte kaum mit den anderen Jockeys, die sein atemberaubendes Talent in der Regel mit Ehrfurcht erfüllte. Die Mißgunst, die er in Davey Rockmans Augen brennen sah und die ihr Spiegelbild in der grollenden Miene Nigel Tapes fand, ignorierte er frohen Mutes. Da jetzt viel mehr Pferde im Stall waren als zuvor, ritt Davey Rockman, so überlegte Red Millbrook unbekümmert, immer noch ziemlich viele Rennen, auch wenn es sich dabei nicht um die [40]siegverheißende Spitzenklasse handelte und auch wenn ihm nicht dieselbe staunende und kniefällige Aufmerksamkeit der Presse zuteil wurde. Es war nicht seine Schuld, beruhigte er sich, daß Gypsy Joe ihn auserkoren und ihm eine solch großartige und befriedigende Chance gegeben hatte.
Er hatte keine Ahnung, daß es der katastrophale Zusammenbruch seines ausgiebigen Sexuallebens war, der Rock am meisten erzürnte; und Rock seinerseits war blind gegen die Erkenntnis, daß es sein ständiges, verbittertes Murren war, das die Frauen abstieß. Zum ersten Mal in seinem Leben scharten sich die Mädchen um Red Millbrook, der ihre Annäherungsversuche eher komisch fand: Und seine Belustigung erzürnte seinen brodelnden, entthronten Rivalen nur um so mehr.
Als Davey Rockman im Dezember bei einem Rennen stürzte und sich einige kleine Knochen in seinem Fuß brach, schickte Red Millbrook ihm ein paar freundliche Zeilen, in denen er sein Mitleid bekundete. Rock betrachtete das als Beleidigung und antwortete ihm nicht.
Red Millbrook hatte seinen Wagen in der Londoner Straße draußen vor seinem Elternhaus stehen und fuhr von dort aus jeden Tag dorthin, wo er gerade zum Rennen eingeteilt war. Normalerweise brach er Richtung Norden auf, über eine Straße, die ihn durch hohe schwarze Geländer in die rasenbedeckte Weite des Hyde Parks führte. Dort gab es Fußwege und immergrüne Büsche und Bänke für die Rast ermüdeter Spaziergänger. Daneben fanden sich dort mehrere Verkehrsampeln, die einerseits den Fußgängern die Überquerung der Straße erleichtern und es andererseits dem [41]Verkehr ermöglichen sollten, einem komplizierten Muster folgend nach rechts abzubiegen. Eine der Ampeln sprang fast immer auf Rot, sobald Red Millbrook sich näherte. Geduldig wartete er dann auf Grün, während sein Radio den Wagen mit Musik erfüllte.
An einem Freitagmorgen im Dezember trat, während Red vor sich hinsummend an der Ampel wartete, ein Mann an seinen stehenden Wagen heran und klopfte an der Beifahrerseite ans Fenster. Er war gekleidet wie ein Tourist und hatte einen großen Stadtplan bei sich, auf den er mit hoffnungsvoller Gebärde aufmerksam machte.
Red Millbrook drückte auf einen Knopf und öffnete zuvorkommend das elektrisch bediente Fenster. Der Tourist beugte sich mit dem Plan in Händen höflich in den Wagen.
»Entschuldigen Sie bitte«, sagte der Tourist, »wie komme ich am besten zum Buckingham Palace, bitte?«
Er hatte einen ausländischen Akzent, ging es Red Millbrook flüchtig durch den Kopf. Ein Franzose vielleicht. Der Jockey drehte sich zum Fenster um und beugte den Kopf über den Stadtplan.
»Sie gehen…«, sagte er.
Émile Jacques Guirlande erschoß ihn.
Um die Wahrheit zu sagen, Émile Jacques genoß das Töten.
Es erfüllte ihn mit Stolz, in der Lage zu sein, den Tod so sauber und schnell herbeizuführen, daß sein Opfer nicht einmal den Verdacht schöpfte, es könne angebracht sein, sich zu fürchten. Émile Jacques fand, daß er seinen eigenen hohen Ansprüchen untreu würde, falls er jemals Augen sich in verzweifelter Angst weiten sehen oder auch nur die [42]ersten Silben eines jämmerlichen Flehens hören würde. So mancher bezahlte Mörder mochte Gefallen finden am Entsetzen seiner Opfer: Émile Jacques war, für einen Mörder, ein gütiger Mensch.
Red Millbrook hatte ausschließlich auf den Stadtplan gesehen, den Émile Jacques ihm mit der linken Hand halb geöffnet hingehalten hatte. Er hatte keine Zeit gehabt, die neun Millimeter Browning zu sehen, wie sie mit ihrem wirksamen, langen Schalldämpfer anmutig unter dem Stadtplan hervorglitt. Émiles rechte Hand war, wenn er eine Waffe hielt, von einer Schnelligkeit und Eleganz, wie kein Magier sie hätte übertreffen können.
Die glutheiße Kugel zerstörte Red Millbrooks Gehirn binnen eines Augenblicks. Er fühlte nichts, wußte nichts, gab keinen Laut von sich. Das schwache »Plop« der Browning verlor sich im Rhythmus der Radiomusik.
Ohne zu zögern nahm Émile Jacques seinen Stadtplan wieder an sich, und die Pistole verschwand darin. Er machte eine Gebärde des Dankes, für den Fall, daß sie Zuschauer hatten, und ging beiläufig davon.
Er schritt ohne Hast einen Fußweg entlang und umrundete ein Gebüsch, und er war schon ein ganzes Stück entfernt, als er hinter sich lautstarkes Hupen hörte. Die Ampel war, wie er wußte, auf Grün gesprungen, aber ein Auto bewegte sich nicht von der Stelle und behinderte den Verkehr. Als schließlich erzürnte Autofahrer das Blut und die Schädelknochensplitter entdeckten und hysterisch aufschrien, wandte Émile Jacques dem Park bereits den Rücken zu, um wieder in seinen Wagen zu steigen; und als die Metropolitan Police in aller Eile ein Sonderkommando [43]einrichtete, um ihre Ermittlungen anzustellen, war Émile Jacques mit bedächtiger Fahrweise bereits auf dem Rückweg nach Frankreich und auf halber Strecke nach Dover.
Nicht schlecht, dachte er. Am Ende war es nicht schlecht gelaufen, obwohl es schwierig gewesen war, die Sache einzufädeln.
Als man ihm den Job Ende Oktober angeboten hatte, hatte er wie gewohnt unbewaffnet das Terrain sondiert, hatte die Lebensgewohnheiten seines Opfers studiert und die günstige Gelegenheit bemerkt, die die zahlreichen Ampeln an einem bestimmten Eingang des Hyde Parks darstellten. Mit einer Stoppuhr war er die normale tägliche Route seines Opfers wieder und wieder abgefahren, bis er auf die Sekunde genau die maximale und die minimale Zeitspanne kannte, die ein Wagen warten mußte, bis die Ampel von Rot auf Grün sprang. Red Millbrook verließ sein Haus zu unterschiedlichen Zeiten, nahm aber so gut wie immer den Weg über den Park, um allzu dichten Verkehr zu meiden. Alle vier Tage oder häufiger mußte er an der Ampel stehenbleiben. Jedes Mal, wenn die Ampel ihn aufhielt, saß er schutzlos in seinem Auto. Dort konnte er ihn durchaus töten, befand Émile Jacques, wenn er es nur schnell machte.
Zu Hause übte er dann mit einem Stadtplan und einer Pistole an seinem eigenen Autofenster, bis er wußte, daß er den Überfall binnen Sekunden würde ausführen können. Dann nahm er das Angebot, das man ihm gemacht hatte, an, und als er im November die vereinbarte Vorauszahlung erhalten hatte, setzte er von Dieppe nach Newhaven über (zur Abwechslung) und fuhr mit seinem deklarierten Waffenkoffer durch den Zoll.
[44]Von da an ging fast sofort alles mögliche schief. Red Millbrook verließ London und fuhr zu einer zweitägigen Rennveranstaltung in Ayr nach Schottland; von dort aus fuhr er in aller Seelenruhe Richtung Süden, machte bei Freunden und Besitzern Station, um ihnen im ganzen Norden des Landes einen Sieg nach dem anderen einzuheimsen, Émile Jacques saß nervös und hilflos in London und fühlte sich angreifbar, und als Red Millbrook endlich in das Haus seiner Eltern zurückkehrte, kam es zu einem Wettereinbruch mit stürmischem Wind, Hagelschlag und ausgiebigen Regengüssen; die Art von Wetter, bei der kein Tourist herumspazieren und sich mit einem Stadtplan nach dem Weg erkundigen würde.
Zu guter Letzt studierte Émile Jacques mit großer Sorgfalt eine Rennzeitung und fand mit Hilfe seines englisch-französischen Wörterbuchs heraus, daß das ihm versprochene, auf mangelnder Gesundheit fußende Alibi seines Kunden keine Gültigkeit mehr hatte. Da ihm überdies unangenehm bewußt war, daß die Empfangsdame seines kleinen Hotels langsam den Wunsch entwickelte, mit dem ruhigen Gast mit dem französischen Akzent zu flirten, wandte Émile Jacques sich gänzlich von seiner Mission ab und fuhr vorsichtigerweise nach Hause.
Es war drei Wochen später, als das Wetter an einem Freitagmorgen im Dezember kalt, aber sonnig war, daß Red Millbrook an der Ampel stehenblieb und starb.
Die Empörung, die die Rennwelt erschütterte, überraschte Émile Jacques in Frankreich. Ihm war nicht bewußt gewesen, mit welcher Inbrunst die Briten ihren Sporthelden [45]huldigten, und er war ungemein bestürzt zu hören, daß er (der Attentäter) gelyncht werden würde (mindestens), falls man ihn fand. Es wurde ein Fonds eingerichtet, dem in einer Flut von Gefühlen von jeder Rennbahn Gelder zuflossen und aus dessen Quelle ein verlockender Preis auf den Kopf des Mörders ausgesetzt wurde.
Émile Jacques Guirlande saß an seinem gewohnten, unauffälligen Ecktisch in dem Café in der Nähe seiner Wohnung und übersetzte sorgfältig, Wort für Wort, die Nachrufe, die die englische Rennpresse zum Ruhm des toten Wunderkindes veröffentlichte. Émile Jacques schürzte die Lippen und unterdrückte ein Gefühl des Bedauerns.
Der Wirt, ein vierschrötiger Mann mit einer gewaltigen Schürze und einem schweren Schnurrbart, blieb neben Émile Jacques stehen und gab seine Meinung zum besten. »Nur ein Teufel«, sagte er und zeigte auf Red Millbrooks attraktives Foto, »kann einen solchen Prachtburschen töten.« Er seufzte über die Bosheit der Welt und fügte hinzu: »Da ist ein Brief für Sie, Monsieur.« Er bedachte Émile Jacques mit einem verschwörerischen, lüsternen Grinsen und einem Rippenstoß und hielt ihm einen Umschlag hin, der neben der Kasse gelegen hatte. Der Wirt glaubte, die Briefe, die er seinem beständigsten Kunden gelegentlich überreichte, kämen von sexhungrigen Damen, die sich auf diesem Wege heimlich mit ihm verabredeten.
Émile Jacques nahm die Briefe stets mit einem Augenzwinkern entgegen, und niemals raubte er seinem Gastgeber seine Illusionen: Auf diese Weise bekam er am Ende einer Zwischenträgerkette seine Nachrichten, und auf diese Weise verschickte er seine Antworten. An jenem Abend [46]enthielt der Umschlag den pflichtschuldigst gezahlten Rest des vereinbarten Preises für den Millbrook-Job: Kein kluger Mann und keine kluge Frau hätten es je riskiert, einem Killer vorzuenthalten, was ihm zustand.
Man hätte erwarten können, daß der scharfsinnige Superintendent von der Metropolitan Police, der mit der Aufklärung von Red Millbrooks Mord beauftragt war, es nie zu einer Seelenfreundschaft mit Gypsy Joe Smith bringen würde. Gypsy Joe war ein Mann mit Instinkt und einem großartigen Buchhalter. Mit seinem Instinkt gewann er die Rennen, sein Buchhalter machte ihn reich. Gypsy Joe tat, was er tat, aus tiefer Intuition heraus. Der Polizist und der Buchhalter stützten sich bei ihrer Arbeit auf Fakten und logische Schlußfolgerungen.
Der Superintendent glaubte, in der Welt des Rennsports seien alle Leute halbe Betrüger, und Gypsy Joe hatte dieselbe Meinung von der Polizei. Der Superintendent betrachtete Gypsy Joes inbrünstige und echte Trauer mit Argwohn. Gypsy Joe fragte sich, wie ein derart begriffsstutziger Kerl es bis zum Superintendent hatte bringen können.
Sie gingen in Gypsy Joes Stallbüro wie die Bullen aufeinander los, ingrimmig unterstützt von einem hochrangigen einheimischen Polizeibeamten, dessen Hauptsorge die Frage der »Zuständigkeit« zu sein schien.
»Wen schert es, in wessen Bezirk er gestorben ist«, brüllte Gypsy Joe. »Steckt eure dämlichen Köpfe zusammen und findet den Schuldigen.«
Das taten die beiden hohen Polizeitiere denn auch, aber es ging ihnen auch dann kein Licht auf. Sie verhörten [47]ausgiebig die beiden Frauen, die hinter Red Millbrooks Wagen an der Ampel gestanden und, als es Grün wurde, gehupt hatten, anschließend ausgestiegen waren, um ihn anzuschreien, die seinen in sich zusammengesunkenen, blutigen Leichnam gefunden hatten und nie wieder traumlos würden schlafen können.
Sie hatten niemanden gesehen, erklärten sie. Sie hätten sich miteinander unterhalten. Es seien nicht viele Leute im Hyde Park gewesen. Es sei schließlich Winter.
Émile Jacques hatte in Red Millbrooks Wagen keine Anhaltspunkte hinterlassen: keine Fingerabdrücke, keine Fasern, keine Haare. Die hoffnungsvoll aus dem Chassis ausgegrabene Kugel paßte zu niemandes Vorstrafenregister und würde es auch niemals tun. Der vorsichtige Émile Jacques tötete niemals mit einer Waffe, die er für sein vorheriges Opfer benutzt hatte. So sehr sie sich alle auch bemühten, der Fall blieb ungelöst.
Der Superintendent von der Metropolitan Police änderte seine Meinung über Gypsy Joe und begegnete ihm nunmehr mit widerwilligem Respekt. Der Mann, der neben ihm in seinem windigen Stallhof stand, so ging es dem Superintendent durch den Kopf, war der letzte Mensch auf der Welt, der dem toten Jockey auch nur ein Haar gekrümmt hätte, und da dem so war, konnte er ihn um Hilfe bitten. Er glaubte nicht an das zweite Gesicht oder an Wahrsagerei, aber man konnte ja nie wissen… Und Gypsy Joe hatte Red Millbrook praktisch aus der Luft herausgepflückt, hatte sein unentwickeltes Talent erkannt und diesem Talent blühendes Leben eingehaucht. Angenommen… nun, nur mal [48]angenommen, die Intuition des Zigeuners könnte Erfolg haben, wo Polizeimethoden keinen hatten.
Der Superintendent schüttelte den Kopf, um sich von solchen Hirngespinsten zu befreien, und sagte nüchtern: »Ich habe mich umgehört. Es sieht so aus, als wären die meisten Jockeys grün vor Neid auf Red Millbrook gewesen, und die Buchmacher scheinen gehofft zu haben, daß er sich den Hals brechen würde, aber von da ist es ja noch weit bis zu einem Mord.« Er hielt inne. »Man erzählt mir, der Mensch, der ihn am meisten gehaßt hätte, sei die zweite Geige gewesen, Davey Rockman, ihre ehemalige Nummer eins.«
»Er kann es nicht gewesen sein«, erwiderte Gypsy Joe düster. »Er hat ein perfektes Alibi.«
»Er kann es nicht getan haben«, meinte der Superintendent nickend, »weil er zu dem fraglichen Zeitpunkt durch das hiesige Krankenhaus humpelte und Physiotherapie für seinen gebrochenen Fuß bekam.«
»Und sein siamesischer Zwilling, Nigel Tape, kann es auch nicht gewesen sein, weil er hier vor meiner Nase war und meine Pferde beim Trainingsgalopp geritten hat, als Red…« Gypsy Joe brach ab, weil seine Kehle plötzlich wie zugeschnürt war. Die Vergeudung und Zerstörung des himmelstürmenden Talents, das er auf seinen Pferden zur Entfaltung gebracht hatte, brachte Gypsy Joe tagtäglich den Tränen näher, als er es je für möglich gehalten hätte. Er wußte, daß er niemals einen zweiten Red Millbrook finden würde; ein Jockey, der sich auf solche Weise mit seinen Pferden ergänzte, begegnete einem Trainer nur einmal im Leben.
[49]Als der Superintendent gegangen war, brannte Gypsy Joes Haß auf Red Millbrooks Mörder immer weiter in seinem Innern, wie ein beharrliches, unbarmherziges Feuer. Er würde es herausfinden, dachte er. Eines Tages würde er auf jenem unerklärlichen Wege, auf dem sich die Dinge ihm zeigten, herausfinden, wer Red Millbrook getötet hatte, und er würde wissen, was zu tun war.