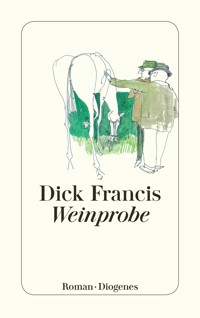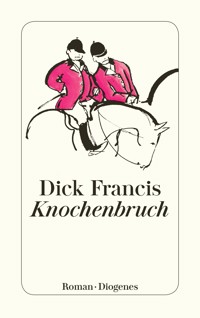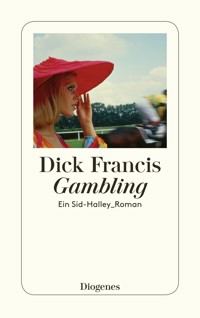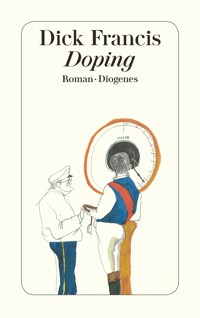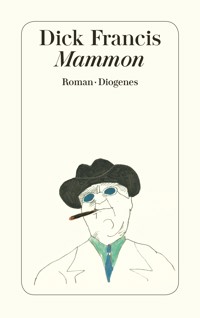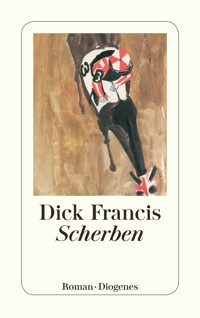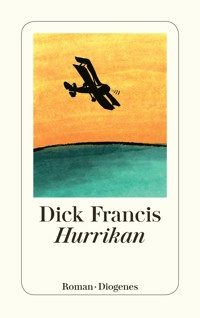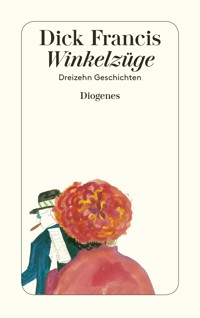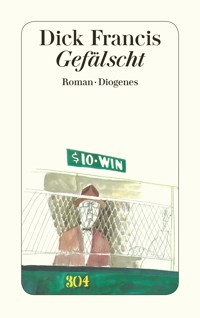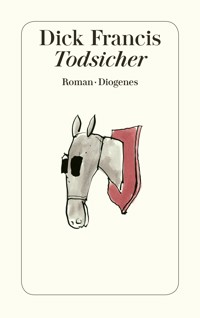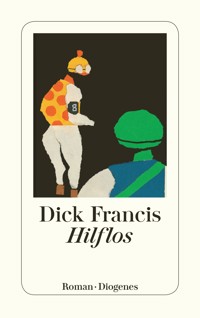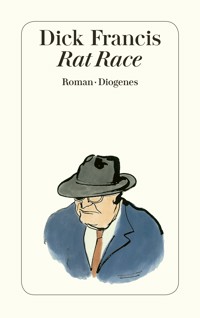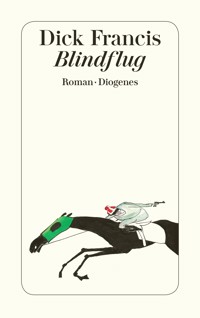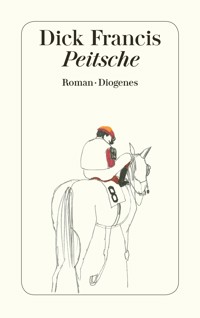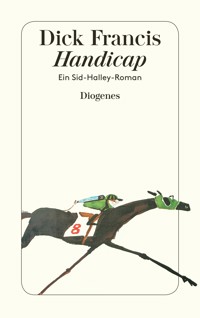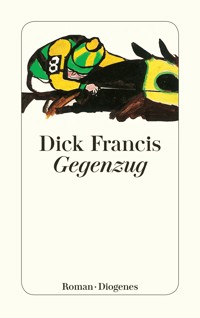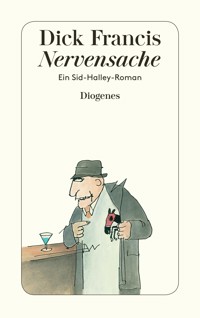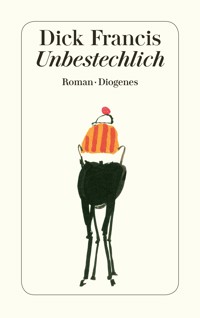
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Derek Franklin, Steeplechase-Jockey, hat genug eigene Probleme. Mit vierunddreißig nähert er sich allmählich dem Ende seiner Karriere, und einem Zusammenstoß mit dem letzten Hindernis in Cheltenham hat er es zu ›verdanken‹, daß er jetzt mit einem gebrochenen Knöchel an Krücken herumhumpelt. Der Tod seines geliebten Bruders Greville stürzt ihn jedoch in noch größere Schwierigkeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Dick Francis
Unbestechlich
Roman
Aus dem Englischen von Jobst-Christian Rojahn
Diogenes
{5}Mein Dank gilt vor allem
Joseph und Danielle Zerger
von Zarlene Imports
Edelsteinhändler
und auch
Mary Bromiley – Knöchelspezialistin
Barry Park – Tierarzt
Jeremy Thompson – Arzt und Pharmakologe
Andrew Hewson – Literarischer Agent
und wie immer
Merrick und Felix, unseren Söhnen.
Alle in dieser Geschichte
vorkommenden Personen sind frei erfunden.
Alle geschilderten technischen Geräte
gibt es wirklich.
{7}1
Ich habe das Leben meines Bruders geerbt. Habe seinen Schreibtisch, seine Firma, sein technisches Spielzeug, seine Feinde, seine Pferde und seine Geliebte geerbt. Ich habe das Leben meines Bruders geerbt und dabei fast das meine verloren.
Ich war damals 34 Jahre alt, und eine Meinungsverschiedenheit mit dem letzten Hindernis des Rennens in Cheltenham hatte zur Folge, daß ich an Krücken herumhumpelte. Sollten Sie noch nicht erlebt haben, wie es ist, wenn Ihr Fußgelenk zerschmettert wird, dann haben Sie nichts versäumt. Wie immer war es nicht der Sturz bei voller Geschwindigkeit gewesen, der den Schaden verursacht hatte, sondern die halbe Tonne von Rennpferd, das hinter mir über das Hindernis setzte. Es sprang mit einem seiner Vorderhufe direkt auf meinen Stiefel, und der Arzt, der mir diesen dann vom Bein schnitt, überreichte ihn mir als Andenken. Mediziner haben nun mal einen makabren Sinn für Humor.
Zwei Tage nach diesem Vorfall, als ich mich allmählich mit der Tatsache abzufinden begann, daß ich zumindest sechs Wochen der Rennsaison und damit wahrscheinlich auch meine letzte Chance verpassen würde, noch einmal zu Meisterehren zu kommen (mit Mitte dreißig erreichen Steeplechase-Jockeys den Anfang vom Ende ihrer sportlichen Laufbahn), nahm ich so ungefähr zum zehnten Mal an diesem Morgen den Telefonhörer ab – diesmal jedoch, um festzustellen, daß nicht noch ein weiterer Freund mich seines Mitgefühls versichern wollte.
»Könnte ich bitte mit Derek Franklin sprechen?« fragte eine weibliche Stimme.
»Ich bin Derek Franklin«, sagte ich.
{8}»Gut.« Die Stimme klang sowohl energisch als auch zögernd, und das war durchaus verständlich. »Wir haben Sie als den nächsten Angehörigen Ihres Bruders aufgeführt gefunden.«
Der Ausdruck »nächster Angehöriger« mußte zu den unheilvollsten gehören, die es gab, dachte ich mit schneller schlagendem Herzen.
Ich fragte langsam, ohne eigentlich die Antwort hören zu wollen: »Was ist geschehen?«
»Ich rufe vom St. Catherine’s Hospital in Ipswich an. Ihr Bruder liegt hier auf der Intensivstation …«
Wenigstens lebt er, dachte ich benommen.
»… und die Ärzte sind der Ansicht, daß Sie davon in Kenntnis gesetzt werden sollten.«
»Wie geht es ihm?«
»Es tut mir leid, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin hier am Krankenhaus als Sozialarbeiterin tätig. Soweit ich aber weiß, ist sein Zustand sehr ernst.«
»Was ist mit ihm?«
»Er hatte einen Unfall«, sagte sie. »Er ist schwer verletzt und hängt am Tropf.«
»Ich komme«, sagte ich.
»Ja, das wäre wohl das beste.«
Ich dankte ihr, ohne eigentlich so recht zu wissen wofür, und legte auf, wobei erst jetzt der Schock physisch spürbar wurde – ich fühlte mich benommen, und meine Kehle war wie zugeschnürt.
Er würde schon wieder auf die Beine kommen, sagte ich mir. Intensivstation – das bedeutete doch nur, daß man sich wirklich intensiv um ihn bemühte. Er würde sich bald wieder erholen, gar keine Frage.
Ich verdrängte alle Befürchtungen und wandte mich statt dessen dem praktischen Problem zu, wie ich mit einem kaputten Fußgelenk etwa 150 Meilen über Land von Hungerford in Berkshire, wo ich wohnte, nach Ipswich in Suffolk gelangen sollte. Zum {9}Glück handelte es sich um den linken Fuß, was bedeutete, daß ich sehr bald wieder in der Lage sein würde, mein Auto zu benutzen, das ein automatisches Getriebe hatte – im Augenblick jedoch verursachte mir mein Fuß noch heftige Beschwerden. Trotz aller Tabletten und Eisbeutel war er heiß und geschwollen und schmerzte stark. Ich konnte das Gelenk nicht bewegen, ohne daß mir der Atem stockte, und das war teilweise meine eigene Schuld.
Da mir die schädigende Unbeweglichkeit von Gipsverbänden schon immer verhaßt gewesen war, ich diesbezüglich fast so etwas wie eine Phobie hatte, war ich ein gut Teil des vorangegangenen Tages damit beschäftigt gewesen, einen leidgeprüften Orthopäden dazu zu überreden, meinem Knöchel die Stütze einer schlichten elastischen Binde angedeihen zu lassen, statt ihn in Gips einzusperren. Mein Orthopäde gehörte zu jenen Chirurgen, die Platten und Schrauben bevorzugen, weshalb er wie gewohnt mit Murren auf mein Ansinnen reagierte. Eine Bandage, wie ich sie haben wolle, möge zwar im Endeffekt besser für die Muskulatur sein, biete aber keinerlei Schutz vor Stößen, wie er mir schon bei anderen Gelegenheiten klarzumachen versucht habe, und würde mir lediglich mehr Schmerzen eintragen.
»Mit so einem Verband kann ich aber sehr viel schneller wieder Rennen reiten.«
»Es wäre an der Zeit, daß Sie damit aufhören, sich die Knochen zu brechen«, sagte er, gab aber achselzuckend und seufzend nach und legte mir eine sehr eng gewickelte Bandage an. »Eines Tages werden Sie sich noch mal was Ernsthaftes antun.«
»Eigentlich breche ich sie mir gar nicht so gerne.«
»Immerhin brauchte ich diesmal nichts zu klammern«, sagte er. »Aber Sie sind verrückt.«
»Ja, herzlichen Dank.«
»Gehen Sie nach Hause und halten Sie Ruhe. Geben Sie Ihren Bändern eine Chance.«
{10}Die Bänder erhielten diese Chance auf dem Rücksitz meines Wagens, während Brad, ein arbeitsloser Schweißer, diesen nach Ipswich lenkte. Brad, schweigsam und störrisch, war gewohnheitsmäßig und aus freien Stücken ohne Job. Er verdiente sich seinen kargen Lebensunterhalt mit Gelegenheitsarbeiten, die er in unserer Wohngegend für jeden übernahm, der seine Launen zu ertragen bereit war. Da ich sein langes Schweigen seinen seltenen Gesprächen entschieden vorzog, kamen wir gut miteinander zurecht. Er sah aus wie vierzig, war noch keine dreißig und lebte bei seiner Mutter.
Brad fand das St. Catherine’s Hospital ohne größere Schwierigkeiten, half mir am Eingang aus dem Wagen und reichte mir die Krücken. Er sagte, er werde das Auto auf den Parkplatz bringen und dann in der Eingangshalle auf mich warten – ich solle mir nur Zeit lassen. Auch am Vortag hatte er schon stundenlang auf mich gewartet und dabei weder Ungeduld noch Mitgefühl erkennen lassen. Er war lediglich auf eine ruhige und neutrale Weise verdrießlich gewesen.
Die Intensivstation erwies sich als streng bewacht von energischen Krankenschwestern, die einen Blick auf meine Krücken warfen und mir dann erklärten, daß ich in der falschen Abteilung gelandet sei. Als ich ihnen jedoch endlich beigebracht hatte, wer ich war, statteten sie mich teilnahmsvoll mit Mundschutz und Kittel aus und ließen mich dann zu Greville hinein.
Irgendwie hatte ich erwartet, daß Intensivstation gleichbedeutend sei mit hellen Lampen und geräuschvoller Geschäftigkeit, sah aber nun, daß dem nicht so war, jedenfalls nicht auf dieser Station in diesem Krankenhaus. Das Licht war gedämpft, die Atmosphäre friedlich, der Geräuschpegel – sobald sich mein Gehör darauf eingestellt hatte – ein wenig über der absoluten Stille, aber noch nicht so weit darüber, daß ich einzelne Laute hätte identifizieren können.
Greville lag auf einem hohen Bett ganz allein in einem Raum, {11}der voller Drähte und Schläuche war. Abgesehen von einem schmalen Leinentuch, das lose über seinen Lenden lag, war er völlig nackt und sein Schädel zur Hälfte kahlgeschoren. Weitere Spuren chirurgischer Eingriffe zogen sich wie die eines Tausendfüßlers quer über seinen Unterleib und eine Hüfte hinab, und er hatte am ganzen Körper Blutergüsse.
Hinter seinem Bett zeigten eine Reihe von Bildschirmen ihre leeren, viereckigen Gesichter – die Apparate waren nicht eingeschaltet, da die Informationen der Elektroden zu anderen, in einem Nebenraum stehenden Geräten weitergeleitet wurden. Der Patient brauche, so sagte man mir, nicht ständig einen Pfleger in seiner Nähe zu haben, da man seine Reaktionen permanent von diesem Nebenraum aus überwache.
Greville war ohne Bewußtsein, sein Gesicht blaß und still, sein Kopf ein wenig zur Tür hin geneigt, als erwarte er den Eintritt von Besuchern. Ein der Druckverminderung dienender Eingriff hatte auf seinem Schädel eine Wunde hinterlassen, die mit einem dick gepolsterten Schutzverband abgedeckt worden war, der eher wie ein seinen Kopf stützendes Kissen aussah.
Greville Saxony Franklin, mein Bruder. Neunzehn Jahre älter als ich – keine Überlebenschance. Dem hatte man sich zu stellen. Das galt es zu akzeptieren.
»Hi, Guy«, sagte ich.
Es war dies eine amerikanische Begrüßungsformel, die er selbst häufig benutzte, aber sie fand keine Erwiderung. Ich berührte seine Hand, die sich warm und entspannt anfühlte und deren Fingernägel wie immer sauber und gepflegt waren. Herz und Kreislauf funktionierten noch, angeregt von elektrischen Impulsen. Durch einen Schlauch an seinem Hals wurde Luft in seine Lungen gepumpt und wieder abgesaugt. Im Inneren seines Kopfes stellten die Nervenknoten ihre Tätigkeit ein. Wo war wohl seine Seele, fragte ich mich – wo der vernunftbegabte, ausdauernde, starke Geist? Wußte er, daß er im Sterben lag?
{12}Ich mochte ihn nicht einfach sich selbst überlassen. Niemand sollte einsam sterben müssen. Ich ging hinaus und sagte das.
Ein Arzt in einem grünen Kittel erklärte mir, daß sie, wenn die gesamte noch feststellbare Gehirntätigkeit aufgehört habe, meine Zustimmung einholen würden, bevor sie die Geräte abschalteten. Wenn ich es wünsche, dürfe ich selbstverständlich in diesem kritischen Augenblick, aber auch schon vorher, bei meinem Bruder sein. »Aber der Tod«, sagte er dann streng, »wird in seinem Falle ein sich unendlich lang hinziehender Prozeß und kein eindeutig bestimmbarer Augenblick sein.« Er machte eine Pause. »Auf dem Flur hier befindet sich ein Warteraum, wo es unter anderem auch Kaffee gibt.«
Banales und Dramatisches, dachte ich – sein Alltag. Ich hinkte den langen Weg zum Empfang zurück, fand dort Brad, informierte ihn über den Stand der Dinge und sagte ihm, daß ich wohl noch ziemlich lange hierbleiben würde, vielleicht sogar die ganze Nacht.
Er machte eine zustimmende Handbewegung. Er werde da sein, sagte er, oder an der Pforte eine Nachricht hinterlassen. In jedem Falle bliebe er erreichbar für mich. Ich nickte und ging wieder nach oben, wo ich den Warteraum bereits von einem sehr jungen, gramverzehrten Paar besetzt fand, dessen Baby nur noch mit Fäden am Leben hing, die kaum stärker waren als die von Greville.
Der Raum war hell, komfortabel eingerichtet und unpersönlich. Ich lauschte dem langsamen Schluchzen der Mutter und dachte an all das Elend, das Tag für Tag in diese Wände hineinsickerte. Das Leben hatte schon so seine ganz eigene Art, einen wie einen Fußball vor sich herzustoßen. Jedenfalls hatte ich diesen Eindruck. Das Schicksal hatte es mir nie leichtgemacht, aber das war in Ordnung so, das war ganz normal. Die Mehrzahl der Menschen, so schien mir, waren irgendwann einmal dran und wurden zum Fußball. Die meisten überlebten das. Einige nicht.
Greville war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. {13}Den spärlichen Informationen, über die man im Krankenhaus verfügte, hatte ich entnommen, daß er die High Street von Ipswich entlanggegangen war, als Teile eines Baugerüstes, das gerade abmontiert wurde, aus großer Höhe auf ihn herabgestürzt waren. Einer der Bauarbeiter war getötet, ein anderer mit gebrochener Hüfte ins Krankenhaus eingeliefert worden.
Was meinen Bruder anbetraf, so hatte man mich mit den klinischen Details vertraut gemacht. Eine Metallstange hatte seinen Bauch durchbohrt, eine andere war in sein Bein eingedrungen. Etwas Schweres war ihm auf den Kopf gefallen, was zu erheblichen Verletzungen des Gehirns mit entsprechenden inneren Blutungen geführt hatte. Das Unglück war am späten Nachmittag des gestrigen Tages passiert, er lag seitdem in tiefer Ohnmacht und hatte erst identifiziert werden können, als Arbeiter, die am heutigen Morgen die Trümmer beiseite räumten, seinen Taschenkalender gefunden und der Polizei übergeben hatten.
»Brieftasche?« fragte ich.
Nein, keine Brieftasche. Nur der Taschenkalender, dessen erste Seite ordentlich ausgefüllt worden war – nächster Angehöriger: Derek Franklin, Bruder; dazu die Telefonnummer. Zuvor hatten sie über keinerlei Hinweise verfügt, sah man einmal von den Initialen G.S.F. ab, die oben auf der Brusttasche seines zerrissenen und blutbefleckten Hemdes eingestickt waren.
»Ein Seidenhemd«, hatte die Schwester mißbilligend hinzugefügt, als ob mit Monogramm bestickte Seidenhemden irgendwie etwas Unmoralisches seien.
»Nichts in seinen Taschen?« fragte ich.
»Ein Schlüsselbund und ein Taschentuch. Das war alles. Man wird Ihnen diese Sachen natürlich zusammen mit dem Kalender, seiner Uhr und seinem Siegelring aushändigen.«
Ich nickte. Es war nicht nötig zu fragen, wann.
Der Nachmittag zog sich hin, fremd und unwirklich, ein unendlich gedehntes Übergangsstadium. Ich ging wieder zu {14}Greville hinein, um eine Weile bei ihm zu sein, aber er lag bewegungs- und wahrnehmungslos in seinem dahinschwindenden Dämmerlicht, in kaum merklicher Weise schon nicht mehr er selbst. Wenn Wordsworth recht hatte mit dem, was er über die Unsterblichkeit gesagt hat, so war das Leben Schlaf und Vergessen, der Tod aber ein Wiedererwachen – vielleicht sollte ich um Greville da nicht trauern, sondern mich eher für ihn freuen.
Ich dachte an ihn, wie er einmal gewesen war, und an unser Leben als Brüder.
Wir hatten nie zusammen in einem Familienverband gelebt, denn als ich geboren wurde, studierte er schon und baute sich eine eigene Existenz auf. Als ich sechs war, heiratete er, als ich zehn wurde, ließ er sich scheiden. Jahrelang war er für mich nicht viel mehr als ein Halbfremder, den ich zumeist nur kurz bei Familienzusammenkünften traf – bei Festen, die immer seltener stattfanden, weil unsere Eltern älter wurden und starben, und die ganz aufhörten, als die beiden Schwestern, die die Lücke zwischen Greville und mir füllten, auswanderten, die eine nach Australien, die andere nach Japan.
Ich war schon 28 Jahre alt, als wir uns nach langwährendem Austausch höflicher Weihnachts- und Geburtstagskarten völlig unverhofft auf einem Bahnsteig trafen und während der dann folgenden Fahrt zu Freunden wurden. Auch dann nicht zu engen, viel Zeit miteinander verbringenden Freunden, aber einander doch zugetan genug, um gelegentlich anzurufen oder zusammen essen zu gehen und uns wohl dabei zu fühlen.
Wir waren in ganz verschiedenen Welten aufgewachsen – Greville in dem stattlichen Londoner Haus, das zu der Tätigkeit unseres Vaters als Manager bei einem der großen Grundbesitzer gehörte, und ich in dem behaglichen Landhaus seines Ruhestandes. Greville war von unserer Mutter in Museen, Galerien und ins Theater mitgenommen worden, ich hatte Ponys geschenkt bekommen.
{15}Wir sahen uns nicht einmal besonders ähnlich. Greville war – wie unser Vater – um die einsachtzig groß, ich etwa zehn Zentimeter kleiner. Grevilles Haar, das nun grau wurde, war hellbraun und glatt gewesen, meines von dunklerem Braun und gelockt. Von der Mutter hatten wir beide die goldbraunen Augen und die guten Zähne, vom Vater den Hang zur Hagerkeit geerbt, aber unsere Gesichter waren, obwohl beide durchaus gut geschnitten, doch sehr verschieden.
Greville konnte sich am besten an die aktiven Jahre unserer Eltern erinnern, ich war in der Zeit ihrer Krankheit und ihres Sterbens bei ihnen gewesen. Unser Vater war zwanzig Jahre älter als unsere Mutter gewesen, aber sie war vor ihm gestorben, was mir ungeheuer unfair vorgekommen war. Der alte Herr und ich hatten danach noch eine kurze Zeit in tolerantem gegenseitigem Nichtverstehen zusammengelebt, obwohl ich nie daran gezweifelt habe, daß er mich auf seine Art sehr wohl mochte. Er war bei meiner Geburt 62 gewesen und an meinem 18. Geburtstag gestorben, mir ausreichende Mittel für die Fortsetzung meiner Ausbildung und einen Brief voller Ermahnungen und Anweisungen hinterlassend, von denen ich einige befolgt habe.
Grevilles Ruhe war vollkommen. Ich dagegen war unruhig, fühlte mich an meinen Krücken höchst unbehaglich und dachte daran, um einen Stuhl zu bitten. Ich würde ihn nicht noch einmal lächeln sehen, dachte ich – nicht dieses Aufblitzen in den Augen und das Leuchten der Zähne, nicht das schnelle Erfassen des schwarzen Humors dieses Daseins, nicht das Bewußtsein der eigenen Stärke.
Er war Richter, Friedensrichter, und er importierte und verkaufte Schmucksteine. Von diesen nackten Tatsachen einmal abgesehen, wußte ich nur recht wenig von seiner Alltagsexistenz, denn wenn wir zusammengekommen waren, schien er sich stets mehr für mein Tun und Treiben zu interessieren als für das seine. Er besaß auch Pferde – dies von dem Tage an, als er mich angerufen {16}und um meine Meinung gebeten hatte: Einer seiner Schuldner hatte ihm bei Fälligkeit der Schuld statt Geld sein Rennpferd angeboten. Was ich davon hielte. Ich sagte, ich würde zurückrufen, holte Auskünfte über das Pferd ein, kam zu dem Schluß, daß das ein guter Handel sei, und sagte Greville, er solle auf das Angebot eingehen, wenn er das noch wolle.
»Wüßte nicht, was dagegen spräche«, hatte er erwidert. »Erledigst du den Papierkram?«
Ja, natürlich, hatte ich gesagt, ich würde mich darum kümmern. Es fiel niemandem schwer, den Wünschen meines Bruders zu entsprechen – viel schwerer war es, auch mal nein zu sagen.
Das Pferd hatte ihm hübschen Gewinn gebracht und ihn dadurch zu weiteren Käufen ermutigt, obwohl er nur selten zu den Rennen ging, bei denen seine Pferde liefen. Das war für einen Besitzer durchaus nichts Ungewöhnliches, für mich aber blieb es ein Rätsel. Er weigerte sich strikt, auch Springpferde zu erwerben, und begründete das damit, daß er dann in die Gefahr käme, etwas zu kaufen, was mich umbringen könnte. Für Flachrennen war ich zu groß, und deshalb fühlte er sich da sicher. Ich konnte ihm nie begreiflich machen, daß ich gern für ihn reiten würde, und gab am Ende meine entsprechenden Versuche auf. Wenn sich Greville einmal zu etwas entschlossen hatte, dann war er nicht mehr davon abzubringen.
Etwa alle zehn Minuten kam leise eine Krankenschwester herein, stand für kurze Zeit neben dem Bett und kontrollierte, ob alle Elektroden und Schläuche noch in Ordnung waren. Sie lächelte mir kurz zu und meinte einmal, daß mein Bruder meine Anwesenheit doch gar nicht wahrnähme und sie ihm deshalb auch kein Trost sein könne.
»Ich bin genausosehr um meinet- wie um seinetwillen hier«, sagte ich.
Sie nickte und ging wieder hinaus, und ich blieb noch ein paar Stunden, lehnte an der Wand und dachte über die Ironie des {17}Schicksals nach, daß er nun durch einen zufälligen Unfall ums Leben kam, wo doch ich derjenige war, der die Hälfte des Jahres das seine in höchst rühriger Weise aufs Spiel setzte.
Wenn ich heute auf diesen sich in die Länge ziehenden Abend zurückblicke, erscheint es mir auch seltsam, daß ich mir damals überhaupt keine Gedanken über die Folgen seines Todes machte. Die Gegenwart war selbst noch in diesen stillen, dahinschwindenden Stunden von starker Lebendigkeit, und alles, was ich in der Zukunft zu sehen vermochte, war ein ziemlich langweiliges, aus Formularausfüllerei und Beerdigungsvorbereitungen bestehendes Programm, über das im einzelnen nachzudenken ich keinerlei Lust verspürte. Ich würde, wie ich vage vermutete, die Schwestern anrufen müssen, und vielleicht kam es ja auch zu ein bißchen Trauer aus der Ferne, aber ich wußte auch schon, daß sie schließlich sagen würden: »Du kannst dich doch darum kümmern, nicht wahr? Alles, was du veranlassen wirst, soll uns recht sein.« Sie würden nicht um die halbe Welt gereist kommen, um da in trauervollem Nieselregen am Grabe eines Bruders zu stehen, den sie in zehn Jahren vielleicht zweimal gesehen hatten.
Mehr als das ging mir nicht durch den Kopf. Das Band gemeinsamen Blutes war alles, was Greville und mich wirklich verband, und sobald es gelöst war, würde nichts bleiben als die Erinnerung an ihn. Von Traurigkeit erfüllt, beobachtete ich den an seinem Hals unregelmäßig zuckenden Puls. Wenn er nicht mehr zu sehen sein würde, würde ich in mein eigenes Leben zurückkehren und gelegentlich mit Wärme an ihn denken, mich mit einem Gefühl allgemeinen Kummers dieser Nacht erinnern, aber mehr nicht.
Ich kehrte in das Wartezimmer zurück, um meinen Beinen ein wenig Ruhe zu gönnen. Die verzweifelten jungen Eltern waren noch da, hohläugig und eng umschlungen, aber bald darauf erschien eine düster dreinblickende Schwester, um sie zu holen, und wenig später hörte ich dann das ansteigende Wehklagen der Mutter, die den erlittenen Verlust beweinte. Ich fühlte das Prickeln {18}von Tränen, die ihr, einer Fremden, galten. Ein totes Kind, ein sterbender Bruder, ein alle verbindendes Elend. Der Tod des Kindes ließ mich in diesem Augenblick wirklich intensiv um meinen Bruder Greville trauern, und es wurde mir bewußt, daß ich mich, was das Ausmaß meines Schmerzes anbetraf, geirrt hatte. Ich würde ihn sehr vermissen.
Ich legte mein Fußgelenk hoch, bettete es auf einen Stuhl und döste immer wieder ein. Irgendwann vor Anbruch des Tages erschien die gleiche Schwester mit dem gleichen Gesichtsausdruck, um nun mich abzuholen.
Ich folgte ihr über den Flur und in Grevilles Zimmer. Diesmal brannten sehr viel mehr Lampen darin, waren sehr viel mehr Menschen anwesend, und die mit Monitoren ausgestatteten Geräte hinter dem Bett waren eingeschaltet worden. Blasse grüne Linien bewegten sich über die Bildschirme, einige in regelmäßigen Zuckungen, andere kompromißlos gerade.
Man brauchte mir nichts zu sagen, aber sie erklärten es mir trotzdem. Die geraden Linien zeigten die Summe aller Hirnaktivitäten an, das heißt, es waren nicht die geringsten mehr vorhanden.
Es gab keinen persönlichen Abschied. Der hatte ja auch keinen Sinn. Ich war dort, und das war genug. Sie erbaten und erhielten meine Zustimmung zur Abschaltung der Apparate, und bald wurden auch die noch pulsierenden Linien gerade – und was immer in dem stillen Körper gewesen sein mochte, war nun nicht mehr da.
Es dauerte lange, bis sich an diesem Morgen irgend etwas erledigen ließ, denn es stellte sich heraus, daß Sonntag war.
Ich versuchte mich zu erinnern, da ich jede zeitliche Orientierung verloren hatte. Am Donnerstag hatte ich mir den Knöchel gebrochen, am Freitag war das Baugerüst auf Greville herabgestürzt, am Samstag hatte mich Brad nach Ipswich gefahren. Das alles schien unendlich weit weg zu sein – gelebte Relativität.
Es bestand, wie es schien, die Möglichkeit, daß die {19}Gerüstbaufirma schadensersatzpflichtig war, weshalb man mir riet, einen Anwalt zu konsultieren.
Während ich mich durch den Papierberg arbeitete und versuchte, Entscheidungen zu treffen, wurde mir klar, daß ich gar nicht wußte, was eigentlich Grevilles Wille war. Wenn er irgendwo ein Testament hinterlegt hatte, so waren da vielleicht Dinge verfügt, die ich ausführen sollte. Der Gedanke durchzuckte mich, daß wohl außer mir niemand sonst von seinem Ableben wußte. Es gab sicher Leute, die ich benachrichtigen mußte – aber ich hatte keine Ahnung, wer sie waren.
Ich fragte, ob ich den Taschenkalender bekommen könne, der am Unfallort gefunden worden war, und sofort übergab man mir nicht nur das Büchlein, sondern auch all die anderen Dinge, die mein Bruder bei sich gehabt hatte: Schlüsselbund, Uhr, Taschentuch, Siegelring, ein bißchen Kleingeld, Schuhe, Socken, Jacke. Die übrigen Kleidungsstücke, zerfetzt und blutgetränkt, waren, wie es schien, verbrannt worden. Man forderte mich auf, den Empfang der Gegenstände mit meiner Unterschrift zu bestätigen, wobei vorher jeder einzelne bei der Übergabe abgehakt worden war.
Es war alles aus dem großen braunen Plastikbeutel ausgeschüttet worden, in dem man die Sachen aufbewahrt hatte. Auf beiden Seiten des Beutels stand in weißer Schrift »St. Catherine’s Hospital«. Ich tat Schuhe, Socken, Taschentuch und Jacke wieder in den Beutel zurück und zog die Schnur zu. Dann steckte ich den großen Schlüsselbund in meine Hosentasche, ebenso den Ring, die Uhr und das Geld, und besah mir sodann den Kalender.
Auf der ersten Seite hatte er seinen Namen eingetragen, dazu die Telefonnummern seiner Wohnung und seiner Firma, aber keine Adressen. Unten auf der Seite, wo »Bei Unfall bitte benachrichtigen« stand, hatte er »Derek Franklin, Bruder, nächster Angehöriger« hingeschrieben.
Der Taschenkalender war der, den ich ihm zu Weihnachten {20}geschenkt hatte – es war der Rennkalender, den der Verband der Jockeys zusammen mit dem Fonds für verletzte Jockeys herausgab. Daß er ausgerechnet diesen Kalender benutzt hatte, wo er doch sicherlich noch eine ganze Reihe anderer überreicht bekommen hatte, überraschte und rührte mich. Daß er meinen Namen darin vermerkt hatte, war erstaunlich, und ich fragte mich, was er wohl von mir gehalten haben mochte – was wir einander hätten bedeuten können, und was wir versäumt hatten.
Ich steckte den Kalender traurig in meine andere Hosentasche. Morgen früh würde ich wohl in der Firma anrufen und die schreckliche Nachricht übermitteln müssen. Vorher konnte ich niemanden informieren, da ich weder die Namen noch die Telefonnummern der Leute kannte, die für ihn arbeiteten. Ich wußte nur, daß er keine Partner hatte, weil er des öfteren betont hatte, daß er sein Unternehmen nur allein führen könne. Partner spielten einem zu oft Streiche, hatte er gemeint, und davon wolle er nichts wissen.
Als ich alle Unterschriften geleistet hatte, wickelte ich die Schnur des Plastikbeutels ein paarmal um mein Handgelenk und schleppte ihn und mich an den Krücken hinunter in die Eingangshalle, die an diesem Sonntagmorgen mehr oder minder verlassen war. Auch Brad war nicht da, hatte auch keine Nachricht beim Pförtner hinterlassen, weshalb ich mich einfach hinsetzte und wartete. Ich zweifelte nicht, daß er, finster dreinblickend wie eh und je, irgendwann nach eigenem Gutdünken zurückkehren würde. Genau dies tat er schließlich auch und schlurfte ohne das geringste Anzeichen von Hast zur Tür herein.
Er erspähte mich, näherte sich mir bis auf drei Meter, fragte »Soll ich mal das Auto holen?«, und als ich nickte, drehte er ab und verschwand wieder. Ein Mann von wenigen Worten, dieser Brad. Ich folgte ihm langsam, wobei der Plastikbeutel unaufhörlich gegen die Krücke schlug. Wenn ich schneller gedacht {21}hätte, hätte ich ihn Brad mitgegeben, aber es hatte ganz den Anschein, als sei ich in gar keiner Weise zu schnellem Denken in der Lage.
Draußen schien die Oktobersonne hell und warm. Ich atmete die milde Luft tief ein, machte noch ein paar Schritte von der Tür weg, wartete geduldig weiter – und war nicht im geringsten darauf gefaßt, brutal überfallen zu werden.
Ich erkannte kaum, wer es war. Eben noch aufrecht dastehend, unkonzentriert auf meine Krücken gestützt, erhielt ich im nächsten Augenblick einen rammbockartigen Stoß ins Kreuz und stürzte nach vorn auf den harten schwarzen Asphalt der Einfahrt. In dem Versuch, mich zu retten, stellte ich ganz instinktiv den linken Fuß auf den Boden, der sich verdrehte, was schmerzhaft war und nichts brachte. Halb von Sinnen, flog ich flach auf den Bauch, und es war mir schon fast gleichgültig, als jemand gegen die eine der zu Boden gefallenen Krücken trat, so daß sie weit davonrutschte, und dann an dem noch an meinem Handgelenk hängenden Beutel zerrte.
Er … es mußte ein Er sein, dachte ich, bei dieser Schnelligkeit und Stärke … er setzte mir einen Fuß in den Nacken und legte sein ganzes Gewicht darauf. Dann zog er meinen einen Arm hart nach oben und vorn und durchtrennte die Plastikschnur mit schnellem Schnitt, wobei auch ein Stück der Haut meines Handgelenks daran glauben mußte. Ich spürte es kaum. Die Botschaften, die mein linkes Fußgelenk aussandte, verdrängten alles andere.
Eine Stimme näherte sich, rief mit Nachdruck »He! He!«, und der Angreifer ließ von mir ab und verschwand so schnell, wie er gekommen war.
Es war Brad, der zu meiner Rettung erschienen war. An jedem anderen Tag der Woche wären wahrscheinlich andauernd irgendwelche Menschen vorbeigekommen, nicht aber an einem Sonntagmorgen. Niemand sonst schien da zu sein und etwas bemerkt zu haben. Nur Brad war herbeigerannt.
{22}»Schöne Scheiße«, sagte er über mir. »Alles in Ordnung?«
Weit gefehlt, dachte ich.
Er ging und holte die weggetretene Krücke zurück. »Ihre Hand blutet ja«, sagte er ungläubig. »Wolln Sie nicht aufstehn?«
Ich war mir da nicht so sicher, aber es schien mir gar nichts anderes übrig zu bleiben. Als ich eine einigermaßen aufrechte Stellung eingenommen hatte, betrachtete er ungerührt mein Gesicht und äußerte dann die Ansicht, daß wir lieber ins Krankenhaus zurückkehren sollten. Da mir nicht nach einer Auseinandersetzung zumute war, taten wir das.
Ich setzte mich ans Ende einer der langen Bänke und wartete darauf, daß die Flut der Schmerzen abebben würde. Als ich dann die Dinge wieder ein bißchen besser unter Kontrolle hatte, ging ich hinüber zur Aufnahme und schilderte dort, was sich ereignet hatte.
Die Frau hinter der Glasscheibe war entsetzt.
»Jemand hat Ihnen Ihren Plastikbeutel gestohlen?« sagte sie mit weit aufgerissenen Augen. »Ich meine, jeder hier weiß, was diese Beutel zu bedeuten haben, sie werden immer für die Sachen der Leute genommen, die gestorben sind oder die nach Unfällen hier eingeliefert werden. Ich meine, jeder weiß, daß Brieftaschen und Schmuck und so weiter da drin sein können, aber ich habe noch nie gehört, daß jemandem eine weggeschnappt worden ist. Wie fürchterlich! Was haben Sie alles verloren? Sie melden das besser der Polizei!«
Die Vergeblichkeit solchen Tuns erfüllte mich mit Müdigkeit. Irgend so ein Punker hatte es darauf ankommen lassen und gehofft, daß die Hinterlassenschaft des Toten das Risiko wert sein würde – und die Polizei würde den Tathergang aufnehmen und dann zu der Mehrzahl der ungesühnten Raubüberfälle legen. Ich war wohl, wie ich annahm, der Kategorie der Verwundbarsten zugeordnet worden, zu der vor allem kleine alte Damen gehörten, und so schmerzhaft diese Vorstellung für mich auch sein mochte, {23}Tatsache blieb doch, daß ich da auf meinen Krücken nicht nur wie ein Kinderspiel ausgesehen hatte, sondern auch eins gewesen war, und das ganz buchstäblich.
Ich schlurfte unter Schmerzen in den Waschraum und ließ kaltes Wasser über meine blutende Hand laufen, wobei ich entdeckte, daß der Schnitt breiter als tief und wohl eher als Hautabschürfung zu klassifizieren war. Seufzend betupfte ich mit einem Papierhandtuch die scharlachrot hervorsickernden Flecken, wickelte die noch an meinem Handgelenk hängenden Stückchen von weißem und braunem Plastik ab und warf sie in den Papierkorb. Was für ein hirnrissiges, fast enttäuschend wirkendes Postscriptum zu dem Unfall, der meinen Bruder das Leben gekostet hatte!
Als ich wieder nach draußen kam, fragte mich Brad mit einer gewissen Ängstlichkeit: »Wolln Sie also zur Polente gehn?« und entspannte sich sichtbar, als ich den Kopf schüttelte und sagte: »Nein. Nur wenn Sie eine genaue Beschreibung der Person liefern können, die mich attackiert hat.«
Ich vermochte seinem Gesichtsausdruck nicht zu entnehmen, ob er dazu in der Lage gewesen wäre oder nicht. Ich gedachte ihn später auf der Heimfahrt danach zu fragen, aber als ich dies dann tat, sagte er nur: »Er hatte Jeans an und so eine von diesen Wollmützen auf dem Kopp. Und er hatte ein Messer. Ich konnte sein Gesicht nicht sehn, irgendwie hatte er den Rücken in meine Richtung, aber die Sonne blitzte in seinem Messer, verstehn Sie? Ging alles so schnell. Ich dachte schon, Sie wär’n hin. Dann rannte er mit dem Beutel weg. Sie haben verdammt Glück gehabt, würde ich mal sagen.«
Ich fühlte mich gar nicht glücklich, aber es war ja alles relativ.
Nachdem Brad diese für seine Verhältnisse lange Rede gehalten hatte, verfiel er wieder in das für ihn normale Schweigen, und ich dachte, was der Bandit wohl von seiner aus Schuhen, Socken, Taschentuch und Jacke bestehenden Beute halten würde, deren Verlust bei nüchterner Betrachtung keine Anzeige wert war. Was {24}immer Greville an Wertvollem bei sich gehabt haben mochte, hatte mit Sicherheit in seiner Brieftasche gesteckt – und die war wohl einem früheren Räuber in die Hände gefallen.
Ich hatte Hemd, Schlips und Pullover angehabt, beziehungsweise hatte diese Sachen noch immer an, jedenfalls aber kein Jackett. Ein Pullover war bei den Krücken praktischer als eine Jacke. Es war sinnlos, sich die Frage zu stellen, ob der Dieb auch meine Hosentaschen noch geleert hätte, wenn Brad nicht dazwischengekommen wäre. Sinnlos ebenfalls die Frage, ob er mir sein Messer auch zwischen die Rippen gestoßen hätte. Das ließ sich einfach nicht sagen. Sagen ließ sich nur, daß ich ihn nicht hätte abwehren können und daß seine Beute in jedem Falle mager gewesen wäre. Außer Grevilles Sachen hatte ich – da ich alter Gewohnheit gemäß mit leichtem Gepäck zu reisen pflegte – nur eine Kreditkarte und ein paar Geldscheine in einer kleinen Börse bei mir.
Ich hörte auf, weiter über die Sache nachzudenken, und fragte mich statt dessen und um mich von meinem Knöchel abzulenken, was Greville wohl in Ipswich gemacht haben mochte. Fragte mich, ob dort vielleicht jemand seit Freitag auf seine Ankunft wartete. Fragte mich, ob er sein Auto irgendwo dort geparkt hatte, und wenn ja, wie ich es je finden würde – eingedenk der Tatsache, daß ich dessen Zulassungsnummer nicht kannte und auch nicht wußte, ob er noch seinen Porsche fuhr. Aber irgend jemand würde das schon wissen, dachte ich unbekümmert. Seine Mitarbeiter in der Firma, seine Autowerkstatt um die Ecke, ein Freund. Das war alles nicht mein eigentliches Problem.
Als wir drei Stunden später Hungerford wieder erreichten, hatte Brad inzwischen nur noch angemerkt, daß uns der Sprit ausgehe (wogegen wir etwas unternommen hatten) und – eine halbe Stunde von zu Hause entfernt – daß er, falls ich ihn auch in der kommenden Woche noch als Fahrer gebrauchen könne, gern zur Verfügung stehe.
»Halb acht morgen früh?« schlug ich nach kurzem {25}Nachdenken vor, und er gab ein grollendes Geräusch von sich, das ich als Zustimmung deutete.
Er fuhr mich bis vor die Haustür, half mir wieder aus dem Wagen, reichte mir meine Krücken, schloß das Auto ab und drückte mir die Schlüssel in die Hand – alles ohne ein einziges Wort zu sagen.
»Danke«, sagte ich.
Er neigte den Kopf, ohne mich anzusehen, wandte sich um und trottete zu Fuß dem Hause seiner Mutter zu. Ich sah ihm nach – diesem schüchternen, schwierigen Menschen ohne alle gesellschaftlichen Umgangsformen, der mir wahrscheinlich an diesem Morgen das Leben gerettet hatte.
{26}2
Ich hatte auf drei Jahre das Erdgeschoß eines alten Hauses gemietet, das an einer Ecke der Hauptstraße lag, welche durch das altehrwürdige Landstädtchen führte. Es gab ein Schlaf- und ein Badezimmer, die zur Straße und nach Osten, also zum Sonnenaufgang hin lagen, und einen großen Allzweckraum nach hinten hinaus, den der Sonnenuntergang erhellte. Von ihm aus sah man auf ein schmales, an den Fluß grenzendes Gärtchen, das ich mir mit den Hausbesitzern, einem älteren, über mir wohnenden Ehepaar teilte.
Brads Mutter kochte und putzte schon seit vielen Jahren für sie, während Brad Reparaturen ausführte und Holz hackte, wann immer ihm danach zumute war. Kurz nach meinem Einzug hatten Mutter und Sohn auch mir wie beiläufig ihre Dienste angetragen, was mir sehr gelegen gekommen war. Alles in allem war es ein unbeschwertes, geordnetes Leben, aber wenn es stimmt, daß man nur dort wirklich zu Hause ist, wo das Herz ist, dann war das für mich draußen in den windigen Downs und in den Ställen und auf den von heiserem Lärm erfüllten Rennplätzen, wo ich arbeitete.
Ich betrat die stillen Räume, saß mit Eisbeuteln und hochgelegten Beinen auf dem Sofa, beobachtete die Sonne, die auf der anderen Seite des Flusses unterging, und dachte bei mir, daß ich wohl besser daran getan hätte, in Ipswich im Krankenhaus zu bleiben. Vom Knie an abwärts schmerzte mein linkes Bein ganz fürchterlich, und von Minute zu Minute wurde mir klarer, daß mein Sturz den Schaden vom Donnerstag verheerend verschlimmert hatte. Mein Orthopäde war übers Wochenende nach Wales gefahren, aber ich hatte auch so meine Zweifel, ob er sehr viel mehr getan {27}hätte als »Das habe ich Ihnen ja gleich gesagt!« zu mir zu sagen, weshalb ich schließlich schlicht und einfach ein weiteres Distalgesic, eine Schmerztablette, nahm, die Eisbeutel erneuerte und die Tageszeit von Tokio und Sydney ermittelte.
Um Mitternacht rief ich in diesen beiden Städten an, wo schon Morgen war, und erreichte glücklicherweise beide Schwestern. »Armer Greville«, sagten sie betrübt, und »Mach, was du für richtig hältst.« – »Schick ein paar Blumen in unserem Namen.« – »Halt uns auf dem laufenden.«
Das würde ich machen, sagte ich. Armer Greville, wiederholten sie und meinten das auch, und sie sagten, daß ich sie doch mal in Sydney und in Tokio besuchen solle, jederzeit. Ihren Kindern, sagten sie, ginge es gut. Ihren Männern ginge es auch gut. Ob’s mir auch gut ginge? Armer, armer Greville.
Ich legte traurig den Hörer auf die Gabel zurück. Familien zerstreuten sich – und einige zerstreuten sich mehr als die meisten anderen. Ich kannte inzwischen meine Schwestern nur noch von den Fotos, die sie manchmal zu Weihnachten schickten. Sie hatten meine Stimme nicht erkannt.
Am nächsten Morgen ließ ich die Dinge langsam angehen. Da sich nicht viel gebessert hatte, wählte ich, wie gehabt, Hemd, Schlips und Pullover für den Tag, zog rechts einen Schuh an, links nur die Socke, und war fertig, als Brad fünf Minuten vor der Zeit bei mir eintraf.
»Wir fahren nach London«, sagte ich. »Hier ist ein Stadtplan, auf dem ich unser Ziel angekreuzt habe. Glauben Sie, daß Sie es finden werden?«
»Hab doch ’nen Mund zum Fragen«, sagte er und starrte auf das Straßengewirr hinab. »Denke schon.«
»Na, dann mal los.«
Er nickte, half mir auf den Rücksitz und fuhr siebzig Meilen schweigend durch den dichten Morgenverkehr. Dann schlängelte {28}er sich auf Zickzack-Kurs durch Holborn, wobei er immer wieder schreiend bei Straßenhändlern Auskunft einholte, bog ein paarmal falsch ab, korrigierte sich und blieb ganz plötzlich in einer geschäftigen Straße in der Nähe von Hatton Garden stehen.
»Da wär’n wir«, sagte er, mit dem Finger hinauszeigend. »Nummer 56. Das Bürogebäude da.«
»Hervorragend.«
Er half mir aus dem Wagen, reichte mir die Krücken und begleitete mich, um mir die schwere gläserne Eingangstür aufzuhalten. Drinnen saß hinter einem Tresen ein Mann mit helmartiger Mütze, die Sicherheit in Person, und fragte mich drohend, in welche Etage ich wolle.
»Saxony Franklin«, sagte ich.
»Name?« fragte er und zog eine Liste zu Rate.
»Franklin.«
»Ihr Name, meine ich.«
Ich erklärte ihm, wer ich war. Er hob die Augenbrauen, nahm den Telefonhörer auf, drückte einen Knopf und sagte: »Ein Mr. Franklin ist auf dem Weg nach oben.«
Brad erkundigte sich bei dem Pförtner, wo er parken könne, und bekam die Auskunft, daß sich hinter dem Gebäude ein Hof befinde. Er würde dort auf mich warten, sagte er. Keine Eile. Kein Problem.
Das Bürogebäude war modern und machte bis zum 6. Stock gemeinsame Sache mit seinen schnörkeligen viktorianischen Nachbarn. Erst dann erhob es sich frei und mit einer Menge Glas bis in die Höhen einer 10. Etage.
Die Firma Saxony Franklin Ltd. befand sich allem Anschein nach im 8. Stockwerk. Ich fuhr in einem sanft gleitenden Lift hinauf und gelangte, Ellbogen voran, durch eine schwere Schwingtür in einen Empfangsraum, der mit einem Tisch, einigen Sesseln für Wartende und zwei Polizisten ausgestattet war.
{29}Hinter den Polizeibeamten saß eine Dame mittleren Alters, die ganz entschieden verwirrt aussah.
Mir schoß durch den Kopf, daß wohl die Nachricht von Grevilles Tod bereits eingetroffen war und daß ich wahrscheinlich gar nicht hätte herkommen müssen, aber dann ergab sich, daß die Ordnungshüter aus ganz anderen Gründen erschienen waren.
Die verwirrte Dame erhob sich, schenkte mir einen verständnislosen Blick und sagte: »Das ist aber nicht Mr. Franklin. Der Pförtner hat gesagt, Mr. Franklin sei auf dem Weg nach oben.«
Ich beruhigte die argwöhnischen Polizisten ein wenig, indem ich auch ihnen mitteilte, daß ich Grevilles Bruder sei.
»Oh«, sagte die Dame. »Ja, er hat einen Bruder.«
Sie ließen nun alle ihre Blicke über meine vergleichsweise große Unbeweglichkeit gleiten.
»Mr. Franklin ist nicht anwesend«, erklärte mir die Frau.
»Hm, äh …«, sagte ich, »was ist denn hier los?«
Keiner sah willens aus, mir eine Antwort zu geben. Ich sagte zu der Frau: »Ich bedaure, aber ich weiß Ihren Namen leider nicht.«
»Adams«, sagte sie zerstreut. »Annette Adams. Ich bin die persönliche Assistentin Ihres Bruders.«
»Es tut mir leid«, sagte ich langsam, »aber mein Bruder wird heute nicht kommen. Er hatte einen Unfall.«
Annette Adams hörte die schlechte Nachricht aus meiner Stimme heraus. Sie legte in einer klassischen Geste die Hand auf ihr Herz, als wolle sie es in ihrer Brust festhalten, und sagte ahnungsvoll: »Was für ein Unfall? Ist er verletzt?«
Sie konnte die Antwort deutlich von meinem Gesichtsausdruck ablesen und tastete mit der freien Hand nach ihrem Stuhl, in den sie sich, vom Schock getroffen, zurückfallen ließ.
»Er ist gestern morgen im Krankenhaus gestorben«, sagte ich zu ihr und den Polizisten, »nachdem am vergangenen Freitag Teile eines Baugerüstes auf ihn gefallen waren. Ich war bei ihm dort in der Klinik.«
{30}Einer der beiden Polizisten zeigte auf meinen baumelnden Fuß. »Sind Sie bei der gleichen Gelegenheit verletzt worden, Sir?«
»Nein, das ist etwas anderes. Ich war nicht Zeuge des Unfalls. Ich wollte damit sagen, daß ich bei ihm gewesen bin, als er starb. Das Krankenhaus hatte mich benachrichtigt.«
Die beiden Polizisten schauten sich an und beschlossen schließlich, mir mitzuteilen, warum sie da waren.
»Am Wochenende ist hier in diese Büroräume eingebrochen worden, Sir. Mrs. Adams hat es entdeckt, als sie heute morgen sehr früh zur Arbeit kam, und hat uns verständigt.«
»Was spielt das noch für eine Rolle? Es ist jetzt auch egal«, sagte die Frau und wurde immer blasser.
»Es herrscht eine ganz schöne Unordnung«, fuhr der Polizist fort, »und Mrs. Adams weiß nicht, was gestohlen worden ist. Wir warteten gerade auf Ihren Bruder, der uns das sagen sollte.«
»O Gott, o Gott«, sagte Annette, nach Luft ringend.
»Ist sonst noch jemand da?« fragte ich sie. »Jemand, der Ihnen mal einen Becher Tee bringen könnte?« Bevor Sie ohnmächtig werden, dachte ich, sprach es aber nicht aus.
Sie deutete ein Kopfnicken an und blickte auf die Tür auf der anderen Seite des Schreibtisches, und ich humpelte hinüber und versuchte sie zu öffnen. Sie wollte aber nicht aufgehen, der Türknauf ließ sich nicht drehen.
»Das geht nur elektronisch«, sagte Annette schwach. »Sie müssen die richtigen Zahlen eingeben …« Sie legte den Kopf zurück gegen die Stuhllehne und sagte, sie könne sich nicht an die für den heutigen Tag geltende Zahlenkombination erinnern. Sie würde sehr häufig geändert. Sie und die Polizisten waren, wie es schien, durch die Tür gegangen und hatten sie dann hinter sich zufallen lassen.
Einer der Beamten trat zu mir, hämmerte mit der Faust gegen die Tür und rief sehr entschieden »Polizei!«, was – fast reflexhaft – die gewünschte Wirkung hatte. Ohne Umschweife erklärte er der {31}sehr viel jüngeren Frau, die die Tür geöffnet hatte, daß ihr Chef tot und Mrs. Adams dabei sei, in Ohnmacht zu fallen und einen starken, süßen Tee brauche, meine Liebe, aber ganz schnell.
Mit weit aufgerissenen, flackernden Augen zog sich die junge Frau zurück, um hinter den Kulissen noch mehr Bestürzung zu verbreiten, und der Polizist machte den Schutz der Firma dadurch zunichte, daß er die elektronisch gesicherte Tür am Zufallen hinderte, wozu er sich eines Stuhles bediente.
Ich nahm ein paar weitere, über das Grau meiner ersten Eindrücke hinausgehende Einzelheiten der Umgebung in mich auf. Die tiefschwarzen Polsterstühle und der mattschwarze Tisch aus gebeiztem und unpoliertem Holz standen auf einem hellen, grünlich-grauen Teppich. An den Wänden, in blassestem Grau gehalten, hing eine Reihe geologischer Karten, die Rahmen alle schwarz, schmal und von gleicher Größe. Die aufgehaltene Tür und eine andere, ähnliche an der Seite des Raumes, die noch geschlossen war, waren in der gleichen Farbe wie die Wände gestrichen. Von in die Decke eingelassenen Strahlern erhellt, wirkte das Ganze sowohl klar und gradlinig als auch in höchstem Maße raffiniert, womit es ganz und gar dem Wesen meines Bruders entsprach.
Mrs. Annette Adams, noch immer geschwächt von den zu vielen unangenehmen Überraschungen, mit denen sie an diesem Montagmorgen konfrontiert worden war, trug eine cremefarbene Bluse, einen schwarz-grauen Rock und eine Kette aus unregelmäßigen Perlen. Sie hatte dunkle Haare, war vielleicht Ende vierzig und fing, wie ich aus der Starrheit ihres Blickes schloß, wohl gerade erst an zu begreifen, daß der gegenwärtige Aufruhr ein dauerhafter sein würde.
Die jüngere Frau kehrte schon bald mit einem roten Becher mit dampfendem Tee zurück, und Annette Adams trank ein paar Schlucke davon, während sie zuhörte, wie mir der Polizist erklärte, daß der Einbrecher nicht mit dem Besuchern {32}vorbehaltenen Hauptlift heraufgekommen war, sondern mit einem anderen im rückwärtigen Teil des Gebäudes, der von den Angestellten aller im Hause residierenden Firmen und für den Transport von Lasten benutzt wurde. Dieser Lift brachte einen in eine hintere Halle hinab, von der aus man direkt in den Hof gelangte, wo Autos und Lieferwagen parken konnten – und wo wahrscheinlich in diesem Augenblick Brad auf mich wartete.
Der Eindringling war offenbar bis in die 10. Etage hinaufgefahren, über eine Nottreppe aufs Dach gelangt und hatte sich dann mit irgendwelchen Hilfsmitteln außen am Gebäude bis in den 8. Stock hinunterbewegt, wo er ein Fenster eingeschlagen hatte und in die Büroräume eingestiegen war.
»Was für Hilfsmittel?« fragte ich.
»Das wissen wir nicht, Sir. Was immer es war, er hat’s wieder mitgenommen. Vielleicht ein Seil.« Er zuckte die Achseln. »Wir haben uns bisher nur flüchtig hier umgesehen. Wir wollten wissen, was gestohlen worden ist, bevor wir … äh … Also, wir möchten unsere Zeit ja auch nicht wegen nichts und wieder nichts vertun.«
Ich nickte. Wie Grevilles gestohlene Schuhe, dachte ich.
»Das Viertel hier um Hatton Garden herum ist weitgehend in der Hand der Edelsteinhändler. Wir haben andauernd mit Einbrüchen oder versuchten Einbrüchen zu tun.«
Der andere Polizist sagte: »Der Laden hier ist natürlich vollgestopft mit Steinen, aber der Tresorraum ist noch zu, und Mrs. Adams meint, daß es so aussehe, als ob in den Ausstellungsräumen nichts fehle. Mr. Franklin hat einen Schlüssel zum Tresorraum, wo die wertvolleren, geschliffenen Steine aufbewahrt werden.«
Mr. Franklin hatte keine Schlüssel mehr. Die Schlüssel von Mr. Franklin steckten in meiner Tasche. Ich nahm an, daß es nichts schaden würde, wenn ich sie hervorholte.
Der Anblick des ihr wahrscheinlich nur allzu vertrauten Schlüsselbundes ließ Tränen in Annette Adams’ Augen steigen. {33}Sie setzte den Becher ab, kramte nach einem Taschentuch und rief »Dann ist er also wirklich tot!«, als ob sie nicht schon vorher ernsthaft davon überzeugt gewesen wäre.
Als sie sich ein bißchen erholt hatte, bat ich sie, uns den Schlüssel zum Tresorraum zu zeigen. Es war der längste und schmalste am Schlüsselbund, und kurz darauf schritten wir alle durch die aufgehaltene Tür und einen Mittelgang entlang, zu dessen beiden Seiten sich geräumige Büros befanden. Vom Schock gezeichnete Gesichter blickten uns an, als wir vorbeigingen. Vor einer ganz gewöhnlich aussehenden Tür, die man fälschlicherweise auch für eine Schranktür hätte halten können und die ganz gewiß nicht wie die zu einem Tresorraum aussah, blieben wir stehen.
»Das ist sie«, sagte Annette Adams und nickte mit dem Kopf. Ich steckte also den schmalen Schlüssel in das kleine, ganz normale Schlüsselloch und fand zu meiner Überraschung, daß ich ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen mußte. Die dicke, schwere Tür gab meinem Druck nach und schwang nach innen zur rechten Seite hin auf, wobei automatisch ein Licht anging und beleuchtete, was tatsächlich eher wie ein riesiger, begehbarer Schrank aussah, in dem viele Reihen von weißen Pappkartons auf einfachen, weiß gestrichenen Regalen standen, die die gesamte linke Seite des Raumes einnahmen.
Alle sahen sich schweigend um. Nichts schien durcheinandergebracht worden zu sein.
»Wer weiß denn, was in diesen Schachteln drin sein muß?« fragte ich und erhielt die erwartete Antwort – nur mein Bruder.
Ich machte einen Schritt in den Raum hinein und nahm den Deckel von einer der am nächsten stehenden Schachteln, auf dem ein Etikett mit der Aufschrift »MgAl2O4, Burma« klebte. Darin befand sich etwa ein Dutzend glänzende weiße Umschläge, alle im Format der Schachtel. Ich holte einen heraus, um ihn zu öffnen.
»Seien Sie vorsichtig!« rief Annette Adams aus, als sie sah, wie {34}ich, an meinen Krücken balancierend, ungeschickt damit herumhantierte. »Man muß diese Päckchen auffalten.«
Ich übergab ihr den Umschlag, den ich gerade in der Hand hielt, und sie faltete ihn ganz vorsichtig auf ihrer offenen Hand auseinander. Darin lagen nun, auf weißes Tuch gebettet, zwei große, rote, durchsichtige Steine, geschliffen und von länglicher Form, deren intensiv im Licht strahlende Farbe fast zu pulsieren schien.
»Sind das Rubine?« fragte ich, zutiefst beeindruckt.
Annette Adams lächelte nachsichtig. »Nein, das ist Spinell. Sehr schöne Stücke. Mit Rubinen haben wir selten zu tun.«
»Sind hier auch Diamanten drin?« fragte einer der Polizisten.
»Nein, wir handeln nicht mit Diamanten. Fast nie.«
Ich bat sie, in ein paar weitere Schachteln zu schauen, was sie auch tat, nachdem sie zuvor die beiden roten Steine sorgfältig wieder eingewickelt, in die Schachtel gepackt und diese an ihren alten Platz zurückgestellt hatte. Wir sahen ihr zu, wie sie sich reckte und bückte, um wahllos Kästchen aus den verschiedenen Regalbrettern zu öffnen und gelegentlich auch ein Päckchen zu genauerer Prüfung herauszunehmen. Schließlich schüttelte sie den Kopf und sagte, daß überhaupt nichts fehle, jedenfalls nicht, soweit sie sehen könne.
»Der eigentliche Wert dieser Steine liegt in ihrer Quantität«, sagte sie. »Die einzelnen Steine kosten keineswegs ein Vermögen. Aber wir verkaufen sie im Dutzend, zu Hunderten …« Ihre Stimme verlor sich in einer Art Verlassenheit. »Ich weiß nicht, was ich machen soll«, sagte sie. »Mit den Aufträgen, meine ich.«
Die Polizisten berührte dieses Problem nicht. Wenn hier nichts fehle, dann gebe es andere Einbrüche, um die sie sich kümmern müßten, und sie würden einen Bericht anfertigen, aber vorerst auf Wiedersehen, oder etwas in dem Sinne.
Als sie fort waren, standen Annette Adams und ich im Flur und sahen uns an.
{35}»Was soll ich machen?« sagte sie. »Läuft das Geschäft weiter?«
Ich mochte ihr nicht sagen, daß ich nicht den blassesten Schimmer hatte. Ich fragte: »Hatte Greville ein eigenes Büro?«
»Da herrscht ja gerade die allergrößte Unordnung«, sagte sie, drehte sich um und ging den Flur zurück bis zu einem großen Eckzimmer in der Nähe des Empfangs. »Hier.«
Ich war ihr gefolgt und sah nun, was sie mit »Unordnung« gemeint hatte. Der Inhalt aller weit herausgerissener Schubfächer schien auf dem Fußboden gelandet zu sein, im wesentlichen Papier. Die Bilder waren von den Wänden genommen und auf die Erde geworfen worden. Ein Aktenschrank lag umgekippt auf der Seite wie ein gefallener Soldat. Der Schreibtisch war ein einziges Schlachtfeld.
»Die Polizei meint, der Einbrecher habe wohl hinter den Bildern nach einem Safe gesucht. Aber es gibt keinen … nur den Tresorraum.« Sie seufzte unglücklich. »Es ist alles so sinnlos.«
Ich drehte mich um. »Wie viele Mitarbeiter gibt es hier insgesamt?« fragte ich.
»Sechs. Und Mr. Franklin natürlich.« Sie schluckte. »Mein Himmel!«
»Mm«, stimmte ich ihr zu. »Gibt es einen Ort, wo ich mal mit allen sprechen kann?«
Sie nickte stumm und führte mich in einen anderen großen Büroraum, wo bereits drei der Mitarbeiter versammelt waren, großäugig und führungslos. Die anderen beiden kamen herbei, als sie gerufen wurden. Vier Frauen und zwei Männer, alle besorgt und verunsichert und Entscheidungen von mir erwartend.
Greville hatte, das sah ich sofort, keine potentiellen Führungskräfte um sich geschart. Auch Annette Adams war keine aggressive, hinter der Bühne auf ihren Auftritt wartende Managerin, sondern wohl eher eine echte Stellvertreterin, befähigt, Aufträge auszuführen, aber nicht in der Lage, solche zu initiieren. Alles in allem nicht so gut für mich.
{36}Ich stellte mich vor und berichtete, was Greville widerfahren war.
Wie ich zu meiner Freude feststellen konnte, hatten sie ihn gemocht. Es flossen Tränen um seinetwillen. Ich sagte, daß ich ihre Hilfe brauche, denn es gebe da sicherlich Menschen, denen ich seinen Tod mitteilen müsse, etwa seinen Anwälten und seinem Steuerberater und seinen engsten Freunden – ich wisse aber überhaupt nicht, wer sie seien. Ich würde gern, sagte ich, eine Liste anfertigen, und ich setzte mich, mit Papier und Bleistift ausgerüstet, neben einen der Schreibtische.
Annette sagte, sie wolle mal Grevilles Adreßbüchlein aus seinem Büro holen, kehrte aber nach einer Weile frustriert wieder zurück – sie hatte es in all dem Chaos nicht finden können.
»Es muß doch noch andere Unterlagen geben«, sagte ich. »Was ist mit diesem Computer da?« Ich zeigte auf ihn. »Haben Sie nicht Adressen gespeichert?«
Das Gesicht des Mädchens, das Annette den Tee gebracht hatte, hellte sich beträchtlich auf, und sie klärte mich darüber auf, daß dies das Büro der Lagerverwaltung sei. In dem besagten Computer würden die Bestände festgehalten, Wareneingang, Warenausgang, Bestand, Rechnungen, Kundenkonten. Aber, so meinte sie ermutigend, in ihrem anderen Reich jenseits des Flures gäbe es noch einen Computer, den sie für die Korrespondenz verwende. Als sie das Ende ihres Satzes erreicht hatte, sauste sie aus dem Zimmer, und Annette bemerkte, daß June immer ein rechter Wirbelwind sei.
June, blond, langbeinig und flachbrüstig, kam mit einem Schnellausdruck von Grevilles häufigsten Korrespondenzpartnern wieder (sie hatte die Kunden weggelassen), zu denen nicht nur die Anwälte und der Steuerberater gehörten, sondern ferner auch seine Bank, ein Börsenmakler und eine Versicherungsgesellschaft.
»Großartig«, sagte ich. »Und könnte sich einer von Ihnen {37}vielleicht mal mit allen großen Kreditkarten-Gesellschaften in Verbindung setzen und herauszufinden versuchen, ob Greville ihr Kunde gewesen ist, und falls ja, mitteilen, daß er tödlich verunglückt und seine Karte gestohlen worden ist?« Annette erklärte sich traurig bereit, das sofort zu erledigen.
Dann fragte ich, ob einem von ihnen Marke und Zulassungsnummer von Grevilles Auto bekannt sei. Das wußten alle, denn sie hatten den Wagen ja schließlich jeden Tag unten im Hof stehen sehen. Er kam in einem Rover 3500 ohne Radio und Kassettenrecorder in die Firma, weil der Porsche, den er vorher gehabt hatte, zweimal aufgebrochen und am Ende ganz gestohlen worden war.
»In der alten Karre steckt immer noch ein Haufen von technischem Krimskrams«, sagte der jüngere der beiden Männer, »aber diese Spielsachen hatte er alle in den Kofferraum gesperrt.«
Greville war schon immer ganz versessen auf technische Spielereien gewesen, hatte sich stets für die neuesten, kurzlebigsten Methoden, ganz normale Aufgaben auszuführen, begeistert. Er hatte mir bei unseren Treffen mehr über sein Spielzeug erzählt als über seine zwischenmenschlichen Beziehungen.
»Warum fragen Sie nach dem Auto?« wollte der junge Mann wissen. Er trug eine Fülle von Abzeichen auf seiner schwarzen Lederjacke, und sein orangefarbenes, stachelartiges Haar wurde von Gel in Form gehalten. Ich vermutete, daß dies dem Bedürfnis entsprach, irgendwie zu beweisen, daß er existierte.
»Es könnte vor seiner Haustür stehen«, sagte ich. »Oder es ist vielleicht irgendwo in Ipswich geparkt.«
»Ah ja«, sagte der junge Mann nachdenklich, »verstehe, was Sie meinen.«
Das Telefon neben mir auf dem Schreibtisch fing an zu klingeln, und Annette kam nach kurzem Zögern herbei und nahm den Hörer ab. Sie lauschte mit besorgtem Gesichtsausdruck, hielt dann mit der Hand die Sprechmuschel zu und fragte mich: »Was soll ich machen? Es ist ein Kunde, der eine Bestellung aufgeben möchte.«
{38}»Haben Sie da, was er gern hätte?«
»Ja, gewiß doch.«
»Dann sagen Sie ihm, daß es in Ordnung geht.«
»Aber soll ich ihm auch das mit Mr. Franklin sagen?«
»Nein«, sagte ich ganz spontan, »nehmen Sie nur den Auftrag entgegen.«
Sie schien froh über diese Anweisung zu sein und schrieb die Bestellung mit. Als sie wieder aufgelegt hatte, schlug ich den Anwesenden vor, daß sie zumindest am heutigen Tag die eingehenden Aufträge in der gewohnten Form abwickeln und nur im Falle, daß sie gefragt würden, mitteilen sollten, daß Mr. Franklin auf Reisen und im Augenblick leider nicht erreichbar sei. Wir würden die Kunden erst dann von seinem Tod unterrichten, wenn ich mit Anwalt, Steuerberater, Bank und allen anderen gesprochen und mich über die Rechtslage informiert hätte. Sie waren erleichtert und hatten keine Einwände, und der ältere Mann erkundigte sich, ob ich bald die Reparatur des zerbrochenen Fensters veranlassen könne, da es sich im Pack- und Versandraum befinde, wo er arbeite.
Ich sagte, ich würde es versuchen, und hatte dabei das Gefühl, mit den Füßen voran in Treibsand zu versinken. Mir wurde klar, daß ich weder dorthin noch zu dem Leben all dieser Menschen gehörte, und daß alles, was ich vom Edelsteingeschäft wußte, lediglich war, wo ich zwei rote Steine in einer Schachtel mit der Aufschrift »MgAl2O4, Burma« finden konnte.
Beim vierten, von den Gelben Seiten inspirierten Versuch wurde mir zugesagt, daß man sich augenblicklich um das Fenster kümmern wolle, und danach rief ich, als die Büroroutine um mich herum wieder in Gang zu kommen begann, die Anwaltskanzlei an.
Die Anwälte waren ernst, sie waren voll des Mitgefühls, sie waren mir zu Diensten. Ich erkundigte mich, ob Greville vielleicht ein Testament hinterlassen habe, da ich vor allem gern {39}erfahren hätte, ob er irgendwelche Anweisungen hinsichtlich einer Beerdigung oder Einäscherung gegeben habe, und ob sie, wenn nicht, wüßten, ob ich mich mit irgend jemandem in Verbindung setzen oder aber so verfahren solle, wie es mir richtig erschiene.
Ich hörte das eine oder andere Räuspern und erhielt dann das Versprechen, daß man in den Unterlagen nachschauen und zurückrufen wolle. Sie hielten Wort und riefen mich zu meiner Überraschung schon nach sehr kurzer Zeit wieder an.
Mein Bruder habe tatsächlich ein Testament hinterlassen – sie hätten es vor drei Jahren für ihn ausgefertigt. Sie könnten zwar nicht beschwören, ob dieses sein letzter Wille sei, aber es sei das einzige, was ihnen vorläge. Sie hätten darin nachgelesen. Greville habe, so erklärten sie pedantisch, keine besonderen Wünsche bezüglich des Verbleibs seiner sterblichen Überreste geäußert.
»Soll ich dann also einfach … Entsprechendes veranlassen?«
»Gewiß doch«, sagten sie. »Sie sind im übrigen von ihm als sein alleiniger Testamentsvollstrecker benannt worden. Es ist also geradezu Ihre Pflicht, diese Entscheidungen zu treffen.«
Teufel auch, dachte ich, und bat sie um eine Liste aller Begünstigten, damit ich sie von seinem Ableben unterrichten und zur Bestattung einladen könne.
Nach einer Pause meinten sie, daß sie Informationen dieser Art gemeinhin nicht telefonisch weitergäben, ob ich nicht in ihre Kanzlei kommen könne. Sie befände sich genau auf der anderen Seite der City, gleich beim Temple.
»Ich habe ein gebrochenes Fußgelenk«, sagte ich entschuldigend. »Ich brauche schon eine Ewigkeit, um nur durch das Zimmer zu kommen.«
O jemine, sagten sie. Sie berieten sich flüsternd und erklärten schließlich, daß es wohl keinen Schaden anrichten würde, wenn sie mich ins Bild setzten. Grevilles Testament sei äußerst einfach. Er habe seine gesamte Habe Derek Saxony Franklin, seinem einzigen Bruder, hinterlassen. Das hieße also: mir.
{40}»Was?« sagte ich töricht. »Das kann doch nicht sein.«
Er habe sein Testament in großer Eile gemacht, sagten sie, da er in ein gefährliches Land habe fliegen wollen, um dort Steine zu kaufen. Sie als seine Anwälte hätten ihn davon überzeugen können, daß es nicht gut sei, wenn er ohne Hinterlassung einer letztwilligen Verfügung reise, und er sei ihrem Rat gefolgt – dies sei, soweit sie wüßten, das einzige Testament, das er je gemacht habe.
»Er kann das einfach nicht als sein letztes angesehen haben«, sagte ich verständnislos.
Vielleicht nicht, räumten sie ein – es gäbe wohl nur wenige Männer, die, sofern sie sich bei guter Gesundheit befänden, erwarteten, daß sie mit 53 Jahren sterben würden. Dann schnitten sie diskret die Frage der offiziellen Testamentseröffnung an und erbaten meine Instruktionen, und ich fühlte, wie mir der Treibsand jetzt schon bis über die Knie reichte.
»Ist es legal«, fragte ich, »wenn das Geschäft zunächst unverändert weiterläuft?«
Sie sahen da keine rechtlichen Hindernisse. Die gerichtliche Bestätigung des Testaments ebenso vorausgesetzt wie das Nichtvorhandensein eines zu einem späteren Zeitpunkt verfaßten letzten Willens, würde die Firma auf mich übergehen, und wenn ich sie einmal zu verkaufen beabsichtige, läge es sogar in meinem ureigensten Interesse, das Geschäft weiterlaufen zu lassen. Als Testamentsvollstrecker meines Bruders sei ich sogar verpflichtet, mein Bestes zum Wohle des hinterlassenen Besitztums zu tun. Eine interessante Situation, meinten sie nicht ohne Humor.
Ich vermochte diese subtile Sicht der Dinge nicht sogleich nachzuvollziehen, und fragte, wie lange die gerichtliche Anerkennung des Testaments denn dauern würde.
Das sei immer schwer vorherzusehen, lautete die Antwort. Alles zwischen sechs Monaten und zwei Jahren, je nachdem, wie kompliziert Grevilles Angelegenheiten seien.
»Zwei Jahre!«
{41}Sechs Monate seien wahrscheinlicher, murmelten sie beschwichtigend. Das Tempo werde ganz von den Steuerberatern und Finanzbehörden abhängen, die man aber nur selten zur Eile antreiben könne. Das alles ruhe im Schoße der Götter.
Ich erwähnte, daß hinsichtlich der mit dem Unfall zusammenhängenden Schadensersatzansprüche einiges an Arbeit anfallen könne. Sie würden sich glücklich schätzen, sich darum kümmern zu dürfen, sagten sie und versprachen, sich mit der Polizei in Ipswich in Verbindung zu setzen. Inzwischen: alles Gute!
Ich legte den Hörer mit steigendem Entsetzen auf die Gabel. Das Geschäft würde wohl – wie jedes andere auch – dank seiner Eigendynamik erst einmal zwei Wochen weitergehen wie bisher, vielleicht auch vier Wochen, aber danach … Danach würde ich wieder auf einem Pferd sitzen und versuchen, mich für die anstehenden Rennen fit zu machen!
Ich würde mir einen Manager holen müssen, dachte ich vage, und hatte keine Ahnung, wo ich mit der Suche nach einem beginnen sollte. Annette Adams erschien mit Sorgenfalten auf der Stirn und fragte, ob es in Ordnung sei, wenn sie sich daran machten, Mr. Franklins Büro aufzuräumen, und ich sagte ja und dachte, daß ihr Mangel an Schwung zum Untergang des ganzen Schiffes führen könnte.
Würde bitte mal jemand so gut sein, bat ich die Welt im allgemeinen, hinunter in den Hof zu gehen und dem Mann in meinem Auto zu sagen, daß ich wohl nicht vor Ablauf von zwei oder drei weiteren Stunden hier fortkäme – und schon raste June mit ihrem strahlenden Gesicht aus der Tür, kehrte wenig später zurück und berichtete, daß mein Mann das Auto abschließen, zu Fuß zum Mittagessen gehen und rechtzeitig wieder da sein würde, um sodann weiter auf mich zu warten.
»Hat er das alles gesagt?« fragte ich neugierig.
June lachte. »Also, eigentlich hat er nur gesagt ›Gut, geh ’n Happen essen‹, und ist fortgestapft.«
{42}Sie fragte, ob sie mir ein Sandwich bringen solle, wenn sie selbst zum Mittagessen ginge, und ich nahm dieses Angebot überrascht und dankbar an.
»Ihr Fuß schmerzt stark, nicht wahr?« fragte sie voller Umsicht.
»Mm.«
»Sie sollten ihn hochlegen, auf einen Stuhl.«