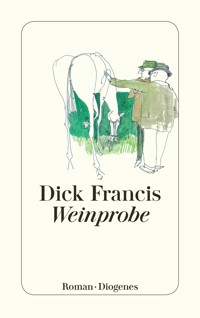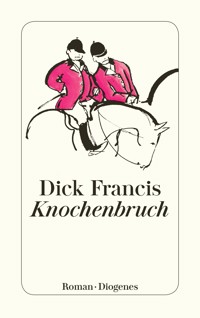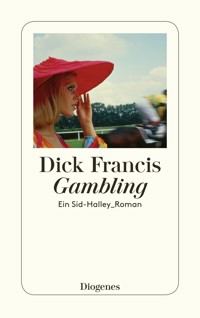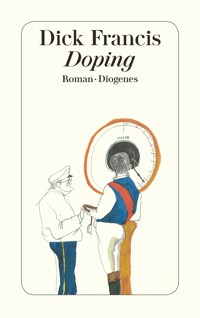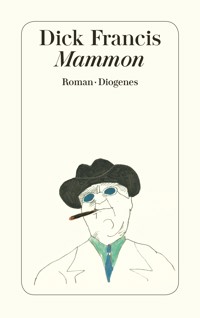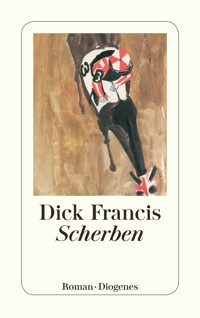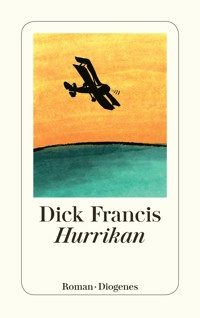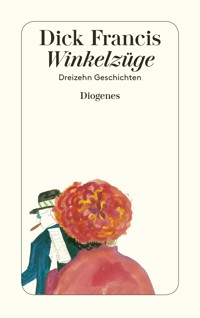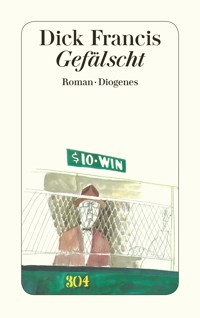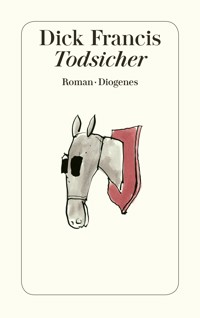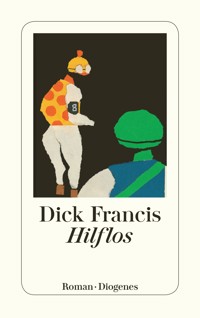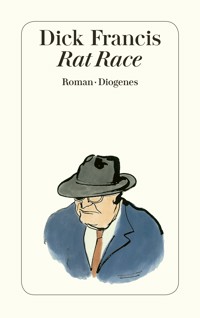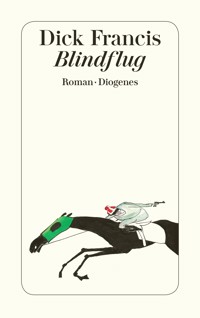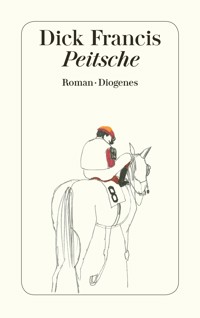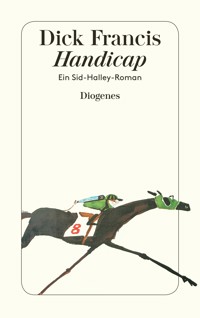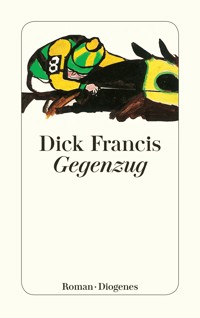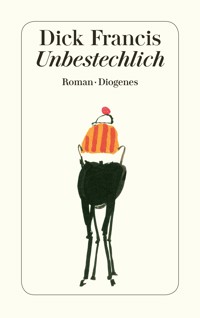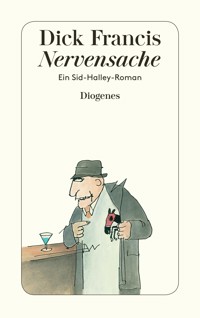
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sid Halley
- Sprache: Deutsch
Skrupellose Geschäftemacher bedrohen die Existenz des Rennplatzes Seabury. Immobilienschwindel? Sid soll dies aufklären. Dabei trifft er auf einen Gegner, der keine Skrupel kennt: Howard Kraye – ein Mann ohne Vergangenheit. Und dann ist da noch die ebenso schöne wie eiskalte Doria. Ihre Gelüste bringen Held und Gegenspieler gleichermaßen auf Trab…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Dick Francis
Nervensache
Ein Sid-Halley-Roman
Roman
Aus dem Englischen von Tony Westermayr
Diogenes
{5}1
Ich war von meinem Job nie besonders begeistert gewesen, bis zu dem Tag, als ich angeschossen wurde und ihn beinahe verlor, zusammen mit meinem Leben. Aber die Kugel, die mir die Gedärme zerfetzte, war in gewisser Weise der erste Schritt auf dem Weg zur Freiheit, obwohl ich es damals nicht ahnte. Die Kugel traf mich, weil ich unvorsichtig war. Die Unvorsichtigkeit entsprang der Langeweile.
Ich kam im Krankenhaus langsam zu mir, in einem Zimmer erster Klasse, wofür ich später gehörig blechen mußte. Noch bevor ich die Augen öffnete, begann ich zu bedauern, daß ich nicht für ganz Abschied von der Welt genommen hatte. Unter meinem Nabel schien ein Feuer zu lodern.
Mit keineswegs gedämpften Stimmen stritt man sich über meinen Kopf hinweg. Ohne sonderliche Begeisterung versuchte ich auszumachen, worum es ging.
»Können Sie ihm nicht etwas geben, daß er schneller wach wird?«
»Nein.«
»Wir können kaum etwas unternehmen, bis er seine Aussage gemacht hat, das sehen Sie doch ein. Seit der Operation sind jetzt sieben Stunden vergangen. Immerhin –«
»Aber dafür lag er vier Stunden auf dem Operationstisch. Wollen Sie ihm den Rest geben?«
»Doktor …«
»Tut mir leid, Sie müssen warten.«
Der hält wenigstens zu dir. Sie müssen warten. Wer hat es schon eilig, in die triste Welt zurückzukehren? Warum nicht einen {6}Monat lang schlafen und erst wieder anfangen, wenn das Feuer erloschen ist?
Ich öffnete widerstrebend die Augen.
Es war Nacht. An der Decke glomm eine Lampe. Stimmt, dachte ich. Jones hatte mich am Morgen auf dem Linoleumbelag im Büro verblutend aufgefunden und war zum Telefon gerannt. Seit der ersten barmherzigen Spritze waren also etwa zwölf Stunden vergangen. Reichte ein Vorsprung von vierundzwanzig Stunden für einen von Panik ergriffenen, ungeschickten kleinen Verbrecher, um das Land zu verlassen und alle Spuren zu verwischen?
Links von mir standen zwei Polizeibeamte, der eine in Uniform, der andere in Zivil. Sie schwitzten, denn im Zimmer war es heiß. Der Arzt stand auf der rechten Seite und machte sich an einem Schlauch zu schaffen, der von einer Flasche zu meiner Armvene führte. Ein paar andere Schläuche sprossen in widerwärtiger Weise aus meinem Bauch, zum Teil durch ein dünnes Laken verdeckt. Tropfinfusion und Drainage, dachte ich ironisch, einfach großartig!
Radnor beobachtete mich vom Bettende aus, ohne an dem Streitgespräch zwischen Heilkunst und Arm des Gesetzes teilzunehmen. Ich hatte nicht gedacht, daß sich der Chef selbst an mein Bett begeben würde, aber es kam wohl auch nicht jeden Tag vor, daß einer seiner Leute in ein derartiges Schlamassel geriet.
»Er ist wieder bei Bewußtsein, und seine Augen sind nicht mehr so glasig. Vielleicht bekommen wir diesmal mehr aus ihm heraus.«
Er schaute auf die Uhr.
Der Arzt beugte sich über mich, prüfte meinen Puls und nickte.
»Also gut, fünf Minuten. Keine Sekunde länger!«
Der Polizeibeamte in Zivil kam Radnor um den Bruchteil einer Sekunde zuvor: »Können Sie uns sagen, wer Sie niedergeschossen hat?«
Das Sprechen fiel mir immer noch erstaunlich schwer, aber es war mir nicht mehr unmöglich wie am Morgen, als sie mich {7}dasselbe gefragt hatten. Offenbar schien es mir doch besser zu gehen. Trotzdem blieb dem Polizeibeamten Zeit genug, seine Frage zu wiederholen und eine Weile zu warten, bis ich eine Antwort zustande brachte.
»Andrews.«
Der Name bedeutete dem Polizeibeamten nichts, aber Radnor machte ein erstauntes und zugleich enttäuschtes Gesicht.
»Thomas Andrews?« fragte er.
»Ja.«
Radnor erteilte dem Polizeibeamten Aufklärung. »Ich habe Ihnen gesagt, daß Halley und sein Kollege eine Falle gestellt hatten, um eine Sache aufzuklären, mit der wir befaßt waren. Sie erhofften sich einen großen Fang, aber es sieht jetzt doch so aus, als sei ihnen nur ein ganz kleiner Fisch ins Netz gegangen. Andrews ist unbedeutend, ein schwächlicher junger Mann, der Botendienste leistet. Ich hätte nie gedacht, daß er eine Schußwaffe besitzt, geschweige denn sie gebraucht.«
Ich auch nicht. Er hatte den Revolver ungeschickt aus der Jackettasche gezogen, ihn unsicher auf mich gerichtet und mit beiden Händen abgedrückt. Wenn ich nicht gesehen hätte, daß vom Köder nur Andrews angelockt worden war, wäre ich nicht unachtsam aus der Dunkelheit der Toilette getreten, um ihn eines Einbruchs in die Büroräume des Ermittlungsdienstes Hunt Radnor um ein Uhr nachts in der Cromwell Road zu überführen. Ich war gar nicht auf den Gedanken gekommen, daß er mich angreifen könnte.
Bis ich begriff, daß er die Waffe im Ernst gebrauchen wollte und nicht nur drohend damit herumfuchtelte, war es viel zu spät. Ich hatte den Lichtschalter noch nicht ganz herumdrehen können, als mich die Kugel traf, meinen Körper schräg durchschlug und wieder austrat. Ich sank auf die Knie und stürzte vornüber zu Boden.
Er lief mit steifen Beinen zur Tür, stieß einen Schrei aus, und {8}seine Augen waren weit aufgerissen. Er schien über das, was er angerichtet hatte, genauso entsetzt zu sein wie ich selbst.
»Um welche Zeit fiel der Schuß?« fragte der Polizeibeamte förmlich.
»Gegen ein Uhr.«
Der Arzt zog abrupt den Atem ein. Er brauchte es nicht auszusprechen; ich wußte, daß ich nur durch Glück noch am Leben war. Immer schwächer werdend, hatte ich in der kühlen Septembernacht auf dem Boden gelegen und ein Telefon angestarrt, mit dem ich keine Hilfe herbeiholen konnte. Alle Apparate im Büro waren an eine Vermittlung angeschlossen. Das Ganze hätte sich ebensogut auf dem Mond abspielen können, statt auf dem kurzen Weg vom Flur, die Treppe hinunter, bis zur Tür des Empfangsschalters – wobei das Mädchen, das den Klappenschrank bediente, im Bett lag und schlief.
Der Polizeibeamte machte sich Notizen. »Ich kann eine Beschreibung von Thomas Andrews auch von jemand anderem bekommen, damit ich Sie nicht allzusehr strapazieren muß«, sagte er, »aber vielleicht könnten Sie mir sagen, was er anhatte?«
»Schwarze Leinenhose, sehr eng. Olivgrüner Pullover, weites schwarzes Jackett.« Ich machte eine Pause. »Schwarzer Pelzkragen, schwarzweiß-kariertes Innenfutter – abgetragen, schmutzig.« Ich zwang mich, weiterzusprechen. »Er hatte den Revolver in der rechten Jackettasche … Keine Handschuhe … Kann nicht vorbestraft sein.«
»Schuhe?«
»Nicht gesehen … Aber offenbar Gummisohlen.«
»Und sonst?«
Ich überlegte. »Er hatte ein paar Verzierungen am linken Jackettärmel … Ortsnamen, Totenschädel mit gekreuzten Knochen und so …«
»Aha. Na schön, das genügt vorerst.« Er klappte sein Notizbuch zu, lächelte kurz, drehte sich um und ging zur Tür, gefolgt {9}von seinem uniformierten Begleiter und Radnor, der offenbar Andrews zu beschreiben hatte.
Der Arzt tastete nach meinem Puls und überprüfte der Reihe nach die Schläuche. Sein Gesicht zeigte Zufriedenheit.
»Sie müssen eine Pferdenatur haben«, meinte er lebhaft.
»Nein«, sagte Radnor, der gerade wieder zur Tür hereinkam und die Bemerkung hörte. »Pferde sind eigentlich sehr zarte Geschöpfe. Halley hat die Konstitution eines Jockeys. Er hat früher Hindernisrennen geritten. Sein Körper ist wie ein Stoßdämpfer, das muß er auch sein, wenn man all die Verletzungen und Brüche verdauen will, die er schon erlitten hat.«
»Und die Hand hat er sich auch bei einem Sturz verletzt?«
Radnors Blick streifte mich kurz. Von meiner Hand wurde im Büro nie gesprochen. Keiner erwähnte sie, mit Ausnahme meines Fallensteller-Kollegen Chico Barnes, der bei keinem Menschen ein Blatt vor den Mund nahm.
»Ja«, sagte Radnor knapp. »Das stimmt.« Er wechselte das Thema. »Na, Sid, besuchen Sie mich, wenn es Ihnen besser geht. Lassen Sie sich Zeit.«
Er nickte mir verlegen zu, und er und der Arzt komplimentierten sich nach einem Blick über die Schulter gegenseitig zur Tür hinaus.
Radnor hatte es also nicht eilig, mich wieder aufzunehmen. Ich hätte gelächelt, wenn die Energie dazu vorhanden gewesen wäre.
Als er mir eine Stellung angeboten hatte, vermutete ich, daß mein Schwiegervater irgendwo im Hintergrund seine Beziehungen spielen ließ. Ich war damals in einer gleichgültigen Stimmung gewesen. Nichts spielte mehr eine Rolle für mich.
»Warum nicht?« sagte ich zu Radnor, und er stellte mich als Ermittler in der Abteilung Rennsport an, ohne meinen gänzlichen Mangel an Erfahrung zu berücksichtigen. Den anderen erzählte {10}er, daß ich als Berater dienen würde, weil ich die Branche in- und auswendig kennte. Insgesamt hatten sie es recht vernünftig aufgenommen. Vielleicht begriffen sie wie ich selbst, daß meine Anstellung vom Mitleid diktiert war. Vielleicht dachten sie auch, ich sollte eigentlich zu stolz sein, diese Art von Mitleid zu akzeptieren. Ich war es nicht. Es war mir so oder so egal.
Radnors Ermittlungsdienst bestand noch aus den Abteilungen Vermißte, Bewachung und Scheidung, dazu kam ein Arbeitsgebiet mit dem Titel Bona Fides, das beinahe so groß war wie alle anderen zusammengenommen. Der Großteil der Arbeit bestand aus Routineermittlungen, die manchmal zu Zivilverfahren oder Scheidungsprozessen führten. Meistens aber wurde lediglich ein vertraulicher Bericht an den Kunden geschickt. Strafsachen wurden zwar angenommen, kamen aber selten vor. Die Geschichte mit Andrews war die erste seit drei Monaten.
Die Abteilung Rennsport war Radnors Lieblingskind. Sie hatte noch nicht existiert, als er nach dem Krieg die Agentur gekauft und aus einem kleinen Büro zu einem im ganzen Land bekannten Unternehmen gemacht hatte. Auf den Briefköpfen stand ›Schnelligkeit, Resultate, absolute Vertraulichkeit‹. Radnor hielt seine Versprechen. Eine aus frühester Jugend datierende Begeisterung für den Pferderennsport, dazu sechsmaliger Start bei Jagdrennen hatten ihn nicht so sehr dazu gebracht, sich dem Jockeyclub und dem Nationalen Rennsportkomitee aufzudrängen, als vielmehr die Möglichkeit, durchblicken lassen zu können, daß ihnen sein Unternehmen zur Verfügung stand. Der Jockeyklub und das Rennsportkomitee steckten die Zehen ins Wasser, fanden es vorteilhaft und stürzten sich hinein. Die Abteilung Rennsport blühte auf. Nach einiger Zeit überwogen private Aufträge – vor allem, als Radnor Bewacher für wertvolle Pferde zu stellen begann.
Als ich in die Firma eintrat, hatte die Abteilung Rennsport schon solchen Erfolg, daß sie sich von dem großen Büro in den nächsten Raum ausgebreitet hatte. Gegen eine erträgliche Gebühr {11}konnte ein Trainer Wesen und Vergangenheit eines künftigen Pferdebesitzers, ein Buchmacher seinen Kunden, ein Kunde seinen Buchmacher, jeder jeden überprüfen. Der Ausdruck ›Anerkannt von Radnor‹ war in den Jargon übergegangen: Echt, hieß das – vertrauenswürdig. Ich hatte sogar einmal gehört, daß man das Prädikat auf ein Pferd anwandte. Einen Auftrag bekam ich jedoch nie. Diese Arbeit wurde von einer Gruppe unauffälliger, älterer, pensionierter Polizeibeamter geleistet, die mit dem geringsten Aufwand an Zeit die besten Resultate erzielten. Man hatte mich nie ausgeschickt, eine ganze Nacht vor der Stallbox eines Favoriten zu sitzen, obwohl ich das bereitwillig getan hätte. Ich war nie einer Rennbahn-Patrouille zugeteilt worden. Wenn die Rennleitung um die Entsendung von Leuten bat, die unerwünschte Elemente bei Rennveranstaltungen bewachen sollten, kam ich nicht in Frage. Wenn jemand auf Taschendiebe im Tattersall angesetzt wurde, war ich es nicht. Radnors Ausreden für das Ausbleiben von Aufträgen waren erstens, daß man mich in der Rennsportwelt zu gut kannte, als daß ich unauffällig hätte arbeiten können; und zweitens, daß er nicht der Mann wäre, einem ehemaligen Championjockey Aufgaben zu übertragen, die ihn sein Gesicht verlieren ließen, selbst wenn mir das nichts auszumachen schien.
Das Ergebnis war, daß ich fast die ganze Zeit damit zubrachte, im Büro die Berichte anderer Leute zu lesen. Wenn mich jemand um Rat anging, erteilte ich ihn. Wenn mich jemand fragte, was ich unter gewissen Umständen tun würde, sagte ich meine Meinung. Ich lernte alle Außendienstangestellten kennen – eigentlich mußte man sie ja alle als Privatdetektive einstufen – und unterhielt mich mit ihnen, wenn sie das Büro aufsuchten. Zeit dazu hatte ich immer. Wenn ich mir einen Tag frei nahm und ein Rennen besuchte, beschwerte sich niemand. Manchmal fragte ich mich, ob es überhaupt auffiel.
Von Zeit zu Zeit erklärte ich Radnor, er bräuchte mich nicht zu {12}behalten, da ich ja offensichtlich mein Gehalt nicht verdiente. Er erwiderte jedesmal, er wäre mit der Abmachung zufrieden, wenn ich nichts einzuwenden hätte. Ich gewann den Eindruck, daß er auf etwas wartete, wußte aber nicht, worauf. An dem Tag, als mich Andrews Kugel erwischte, war ich auf diese Art genau zwei Jahre bei Radnor ›tätig‹ gewesen.
Eine Schwester kam ins Zimmer, um die Schläuche nachzusehen und meinen Blutdruck zu messen. Sie lächelte, sagte aber nichts. Ich wartete darauf, daß sie sagen würde, meine Frau wäre draußen und fragte besorgt nach mir.
Sie sagte es nicht. Meine Frau war nicht gekommen und würde nicht kommen. Wenn ich sie nicht hatte halten können, solange ich richtig am Leben gewesen war, warum sollte mein Beinahe-Tod sie herbeischaffen … Jenny … Meine Frau … Immer noch meine Frau, trotz dreijähriger Trennung … Bedauern war es wohl, was uns beide vor dem endgültigen Schritt einer Scheidung zurückhielt … Wir hatten Leidenschaft, Freude, Meinungsverschiedenheiten, Zorn und schließlich die Explosion erlebt. Nur das Bedauern blieb. Es war nicht stark genug, sie ins Krankenhaus zu bringen. Sie hatte mich schon so oft im Krankenhaus gesehen. Es war nicht mehr dramatisch, nicht mehr wirkungsvoll, wenn ich auf einem Krankenbett lag – selbst mit Schläuchen nicht. Sie würde nicht kommen, nicht telefonieren, nicht schreiben. Es war dumm von mir, es zu wünschen.
Die Zeit verging langsam, und ich hatte keinen Spaß dabei. Endlich wurden eines Tages die Schläuche bis auf den im Arm entfernt, und mein Körper begann zu heilen. Die Polizei fand Andrews nicht, Jenny blieb aus, Radnors Schreibdamen schickten mir eine Genesungskarte und das Krankenhaus eine Rechnung.
Eines Abends schlenderte Chico ins Zimmer, die Hände in {13}den Hosentaschen, das übliche höhnische Grinsen im Gesicht. Er betrachtete mich gemächlich von oben bis unten, das Grinsen schien sich zu verstärken.
»Mit Ihnen möchte ich nicht tauschen«, sagte er.
»Sie können mich mal!«
Er lachte. Was Wunder, ich war für ihn eingesprungen, weil er mit einem Mädchen verabredet gewesen war, und Andrews Kugel hätte ihm Schmerzen verursachen sollen, nicht mir.
»Andrews«, sagte er nachdenklich. »Wer hätte das gedacht? Der kleine Knilch! Trotzdem, wenn Sie getan hätten, was ich gesagt habe – in der Toilette geblieben wären und sein Foto mit der Infrarotkamera aufgenommen hätten –, wäre er später ganz schlicht hopp gegangen, und Sie könnten im Büro herumhocken, statt hier langsam zu zerlaufen.«
»Sie brauchen mir das nicht noch unter die Nase zu reiben«, erwiderte ich. »Was hätten Sie gemacht?«
Er grinste. »Wahrscheinlich dasselbe wie Sie. Ich hätte gedacht, daß ein paar Ohrfeigen genügten, um aus dem Kerl herauszubringen, wer ihn geschickt hat.«
»Und das wissen wir jetzt nicht.«
»Nein.« Er seufzte. »Der Alte ist natürlich nicht maßlos begeistert. Er wußte zwar, daß ich das Büro als Falle benutzte, aber er glaubte nicht, daß es klappen würde. Jetzt ist er natürlich sauer. Er versucht, das Ganze zu vertuschen. Sie hätten auch eine Bombe schicken können, meint er. Und Andrews hat natürlich ein Fenster eingeschlagen, das ich wahrscheinlich bezahlen muß. Natürlich kommt der Trottel mit einem Schloß nicht zurecht.«
»Das Fenster bezahle ich«, sagte ich.
»Ja«, meinte er grinsend. »Ich habe mir schon gedacht, daß Sie’s tun, wenn ich’s Ihnen sage.«
Er wanderte im Zimmer herum und sah sich alles an. Es gab nicht viel zu sehen.
»Was ist in der Flasche, aus der es in die Vene tropft?«
{14}»Irgendeine Nahrung, soviel ich weiß. Zu essen bekomme ich jedenfalls nie etwas.«
»Wahrscheinlich haben sie Angst, daß Sie platzen.«
»Mag sein.«
»Nicht mal einen Fernseher! Wäre doch ein Vergnügen, zur Abwechslung mal zuzuschauen, wenn andere abgeknallt werden.«
Er studierte die Fieberkurve.
»Neununddreißig vier hatten Sie heute früh, wissen Sie das? Glauben Sie, daß Sie abkratzen?«
»Nein.«
»Muß aber knapp gewesen sein, was man so hört. Jones sagte, Sie hätten geblutet wie ein abgestochenes Kalb.«
Mit Jones’ Art von Humor konnte ich nicht viel anfangen.
»Kommen Sie zurück?« fragte Chico.
»Vielleicht.«
Er knüpfte Knoten in die Zugschnur der Jalousie. Ich beobachtete ihn. Ein hagerer Bursche mit so viel Energie ausgestattet, daß es ihm schwerfiel, sich ruhig zu halten. Er hatte zwei Nächte lang erfolglos in der Toilette gewartet, bevor ich an seine Stelle getreten war, und ich wußte, daß er diese Untätigkeit nicht hätte ertragen können, wenn er nicht so an seinem Beruf gehangen hätte. Er war der Jüngste in Radnors Team, ungefähr vierundzwanzig, wie ich glaubte. Als Kind war er auf den Stufen eines Polizeireviers ausgesetzt worden, so daß niemand genau Bescheid wußte.
Wenn die Polizei nicht so gut zu ihm gewesen wäre, sagte Chico manchmal, hätte er wahrscheinlich die späteren Gelegenheiten benutzt und die Verbrecherlaufbahn eingeschlagen. Die Mindestgröße für den Polizeidienst erreichte er nie. Seine Arbeit bei Radnor war Ersatz dafür. Er war tüchtig. Er vermochte zwei und zwei behende zu addieren, und niemand reagierte schneller als er. Judo und Ringen waren seine Steckenpferde, und neben den üblichen Griffen und Überwürfen hatte er ein paar erstaunlich schmutzige {15}Tricks gelernt. Seine kleine Statur war in keiner Weise ein Nachteil bei seiner Arbeit.
»Wie kommen Sie mit dem Fall voran?« fragte ich.
»Mit was für einem Fall? Ach, der … Seit Sie angeschossen worden sind, ist es ruhig geworden. Brinton hat seither weder Drohbriefe noch Telefonate bekommen. Die Leute, die hinter der Sache stecken, scheinen etwas gerochen zu haben. Jedenfalls fühlt er sich plötzlich sicherer und meckert bei dem Alten über die Kosten. Noch ein, zwei Tage, dann wird ihm nachts keiner mehr das Händchen halten. Außerdem bin ich abgelöst worden. Ich fliege morgen nach Irland, zusammen mit einem sündteuren Hengst.«
Als Begleitperson war ich nie eingesetzt worden. Chico hatte eine Vorliebe für diese Aufträge und war oft unterwegs. Seit er einmal einen Neunzig-Kilo-Mann über eine zwei Meter hohe Mauer geworfen hatte, war er sehr begehrt.
»Sie sollten zurückkommen«, sagte er plötzlich.
»Warum?« Ich war überrascht.
»Ich weiß nicht«, sagte er grinsend. »Eigentlich komisch, wenn einer bloß herumhockt, aber man scheint sich an Sie gewöhnt zu haben. Sie werden vermißt, Kleiner, da staunen Sie.«
»Sie machen Witze.«
»Ja …« Er löste die Knoten in der Zugschnur auf, zuckte die Achseln und steckte die Hände in die Hosentaschen. »Meine Güte, da wird einem ja schlecht. Es riecht nach warmem Karbol, scheußlich. Wie lange wollen Sie hier eigentlich noch rumliegen?«
»Tage«, sagte ich gelassen. »Guten Flug!«
»Bis dann!« Er nickte und ging erleichtert zur Tür. »Wollen Sie irgend etwas, ich meine Bücher?«
»Nichts, danke.«
»Nichts … Typisch Sid. Sie wollen nichts.«
Er grinste und verschwand. Ich wollte nichts. Typisch. Mein Problem. Ich hatte besessen, was mir am liebsten gewesen war und es unwiederbringlich verloren. Ich hatte keinen Ersatz dafür {16}gefunden. Ich starrte an die Decke und wartete darauf, daß die Zeit verging. Ich wollte nichts, als wieder auf die Beine kommen und das Gefühl loswerden, einen Zentner grüne Äpfel verschluckt zu haben.
Drei Wochen nach der Schießerei besuchte mich mein Schwiegervater. Er kam am späten Nachmittag und brachte ein kleines Päckchen mit, das er kommentarlos auf den Nachttisch legte.
»Na, Sid, wie geht’s?«
Er ließ sich in einem Sessel nieder, schlug die Beine übereinander und zündete sich eine Zigarre an.
»Kuriert, mehr oder weniger. Ich kann bald raus, gut, gut.«
»Und deine Pläne?«
»Ich habe keine.«
»Du kannst nicht ohne Rekonvaleszenz ins Büro zurück«, meinte er.
»Wahrscheinlich.«
»Irgendwo in der Sonne zu liegen, wäre dir wohl am angenehmsten«, sagte er, die Zigarre betrachtend, »es wäre mir lieb, wenn du ein paar Tage zu mir nach Aynsford kommen würdest.«
Ich schwieg eine Weile. »Ist …?« begann ich und verstummte wieder.
»Nein«, sagte er. »Sie wird nicht da sein, sie ist nach Athen gefahren, zu Jill und Tony. Ich habe sie gestern weggebracht, beste Grüße.«
»Danke«, sagte ich trocken.
Wie gewöhnlich wußte ich nicht, ob ich traurig oder fröhlich sein sollte, daß ich meine Frau nicht treffen würde.
»Du kommst also? Mrs. Cross wird sich um dich kümmern.«
»Ja, Charles, danke. Ein paar Tage auf jeden Fall.«
Er klemmte die Zigarre zwischen die Zähne, kniff die Augen zusammen und zog sein Notizbuch heraus.
{17}»Also, sagen wir, du wirst in – na, vielleicht in einer Woche, entlassen … Hat keinen Sinn, sich zu beeilen. Das wäre der Sechs- undzwanzigste … Hmm … Sagen wir – nächste Woche, Sonntag? Ich bin den ganzen Tag zu Hause. Paßt dir das?«
»Ja, wenn die Ärzte nichts dagegen haben.«
»Also abgemacht.«
Er kritzelte etwas in sein Notizbuch, steckte es weg, nahm die Zigarre aus dem Mund und lächelte, während seine Augen mich undurchdringlich und ausdruckslos anblickten. Er saß leger in seinem dunklen Geschäftsanzug da, Konteradmiral a.D. Charles Roland. Ein Mann, dem seine sechsundsechzig Jahre nicht anzusehen waren. Fotos aus dem Krieg zeigten ihn groß, aufrecht, beinahe knochig, mit hoher Stirn und dichtem dunklen Haar. Die Zeit hatte es ergrauen lassen, und durch ihr Zurückweichen wirkte die Stirn höher als je. Außerdem hatte er zugenommen. Er war meistens außergewöhnlich charmant und gelegentlich auf herablassende Weise beleidigend. Ich hatte beides bei ihm erlebt. Jetzt lehnte er sich bequem zurück und sprach vom Hindernisrennsport.
»Was hältst du von dem neuen Rennen in Sandown? Ich finde, daß es da noch an verschiedenem hapert.«
Sein Interesse für den Sport war erst ein paar Jahre alt, aber zu seinem Vergnügen hatte man ihn in letzter Zeit sogar gebeten, hier und dort in der Rennleitung mitzuwirken. Während ich ihm zuhörte, konnte ich ein Schmunzeln kaum verbergen. Es war schwer, seine damalige Reaktion auf Jennys Verlobung mit einem Jockey zu vergessen, seine Ablehnung meiner Person als künftigem Schwiegersohn, sein Fehlen bei unserer Hochzeit, die folgenden Monate eisiger Mißbilligung, das kühle Schweigen mir gegenüber.
Ich hielt das damals für reinen Snobismus, aber ganz so simpel war es nicht. Zweifellos hielt er mich nicht für gut genug, aber nicht nur oder nicht einmal in der Hauptsache vom {18}Klassenstandpunkt aus; wahrscheinlich hätten wir einander nie verstanden, geschweige denn uns gar leiden können, wenn nicht ein regnerischer Nachmittag und das Schachspiel gewesen wären.
Jenny und ich fuhren zu einem unserer seltenen, quälenden Sonntagsbesuche nach Aynsford. Das Roastbeef verzehrten wir beinahe schweigend, Jennys Vater starrte unhöflich zum Fenster hinaus und trommelte mit den Fingern auf die Tischplatte. Ich beschloß innerlich, nie mehr herzukommen. Ich hatte genug. Jenny konnte ihn alleine besuchen.
Nach dem Mittagessen sagte sie, sie wollte ein paar Bücher aussuchen, da wir einen neuen Bücherschrank gekauft hatten. Sie ging nach oben. Charles Roland und ich sahen einander unfreundlich an, bedrückt von der Aussicht auf den langweiligen Nachmittag. Ein Wolkenbruch verhinderte einen Rückzug in den Garten oder den Park dahinter.
»Spielst du Schach?« fragte er gelangweilt.
»Ich weiß, wie man zieht«, sagte ich.
Er hob die Schultern, schien sich aber zu überlegen, daß es weniger Mühe machen würde als ein Gespräch, holte ein Schachspiel und winkte mich an den Tisch.
Er war normalerweise ein guter Spieler, an diesem Nachmittag aber gelangweilt, gereizt und unaufmerksam, und ich besiegte ihn verhältnismäßig leicht. Er konnte es nicht glauben. Er starrte das Brett an und spielte mit dem Läufer, der ihn das Spiel gekostet hatte.
»Wo hast du das gelernt?« fragte er schließlich.
»Nach einem Buch.«
»Spielst du viel?«
»Nein, hier und da einmal.« Aber ich hatte meistens sehr gute Gegner gehabt.
»Hm.« Er machte eine Pause. »Noch ein Spiel?«
»Ja, wenn du magst.«
Wir spielten. Es dauerte lange und endete patt, mit nur noch {19}wenigen Figuren auf dem Brett. Vierzehn Tage später rief er uns an und bat uns, beim nächsten Besuch, wenn möglich, über Nacht zu bleiben. Es war der erste Friedensfühler.
Von dieser Zeit an fuhren wir öfter und bereitwilliger nach Aynsford. Charles und ich spielten gelegentlich Schach, Siege und Niederlagen verteilten sich gleichmäßig, und er fing an, Rennplätze zu besuchen. Ironischerweise wurde die gegenseitige Achtung so stark, daß sie sogar den Zusammenbruch meiner Ehe überlebte. Charles’ Interesse für den Rennsport erweiterte und vertiefte sich mit jedem Jahr.
»Gestern war ich in Ascot«, sagte er. »Ganz ordentlich. Wally Gibbons ritt im Handicap-Rennen einen großartigen Sieg heraus, dafür versagte er im Neulingsrennen völlig.«
»Das kann er nicht«, gab ich zu.
»Eine großartige Rennbahn.«
»Weitaus die beste.«
Schwäche überflutete mich wie eine Welle, vom Magen aus. Meine Beine begannen unter der Decke zu zittern. Das kam oft vor – ärgerlich.
»Gottseidank, daß der Platz der Königin gehört und vor Bodenspekulation sicher ist.« Er lächelte.
»Ja, sicher …«
»Du bist müde«, sagte er plötzlich. »Ich bin zu lange geblieben.«
»Nein«, protestierte ich. »Es geht mir wirklich gut.«
Er drückte jedoch die Zigarre aus und stand auf.
»Ich kenne dich zu gut, Sid. Was du unter gut verstehst, ist nicht dasselbe wie bei anderen Leuten. Wenn du Sonntag in einer Woche noch nicht soweit bist, daß du nach Aynsford kommen kannst, sag mir bitte Bescheid. Ansonsten sehen wir uns.«
»Ja, okay.«
Er verabschiedete sich, und ich dachte hinterher, daß ich mich zu schnell erschöpfte. Muß wohl das hohe Alter sein, sagte ich mir, {20}schon einunddreißig! Der alte, müde, demolierte Sid Halley, armer Kerl. Ich schnitt eine Grimasse. Eine Krankenschwester kam herein, um mich für die Nacht herzurichten.
»Sie haben ein Päckchen«, sagte sie, als spräche sie mit einem zurückgebliebenen Kind. »Wollen Sie es nicht aufmachen?«
Ich hatte Charles’ Mitbringsel vergessen.
»Soll ich es für Sie auspacken? Ich meine, wenn man so eine Hand hat, fällt das doch sicher schwer.«
»Ja«, sagte ich, »danke.«
Sie durchschnitt die dünne Schnur, schälte das Geschenk aus seiner Verpackung und starrte das schmale schwarze Buch zweifelnd an.
»Es gehört doch Ihnen? Ich meine, eigentlich ist es kein Geschenk für Patienten.«
Sie gab mir das Buch in die rechte Hand, und ich las den Titel ›Grundzüge des Gesellschaftsrechts‹.
»Mein Schwiegervater hat es absichtlich hiergelassen. Er hat es mir zugedacht.«
»Na ja, es fällt einem ja auch nicht leicht, einen Kranken zu beschenken, der kein Obst essen darf.«
Sie machte sich an die Arbeit und ließ mich dann allein.
›Grundzüge des Gesellschaftsrechts‹ …?
Ich blätterte in dem Band. Es war zweifellos ein Buch über Gesellschaftsrecht. Pure Juristerei. Keine leichte Unterhaltung für einen Invaliden. Ich legte es auf den Nachttisch. Ich setzte voraus, daß er nicht ohne Absicht gerade dieses Buch ausgewählt hatte. Er verband irgendeinen Hintergedanken damit. Das Thema sollte mir oder ihm später einmal nützlich sein. Er glaubte vielleicht, mich in eine andere Laufbahn drängen zu können, nachdem ich mich bei Radnor nicht ausgezeichnet hatte. Ein Anstoß, das sollte das Buch sein. Ein Anstoß in eine bestimmte Richtung.
Ich überlegte mir, was er gesagt hatte, auf der Suche nach einem Hinweis. Er hatte darauf gedrängt, ich möchte ihn in Aynsford {21}besuchen, er hatte Jenny nach Athen geschickt. Er hatte vom Rennsport gesprochen, von dem neuen Rennen in Sandown, von Ascot, von Wally Gibbons … Nirgends ein Zusammenhang mit Gesellschaftsrecht.
Ich seufzte und schloß die Augen. Ich fühlte mich nicht besonders. Ich brauchte das Buch nicht zu lesen, brauchte die von Charles gewiesene Richtung nicht einzuschlagen. Und doch – warum nicht? Es gab nichts, was ich statt dessen dringend tun müßte. Ich beschloß, mich der Mühe zu unterziehen – morgen …
Vielleicht.
{22}2
Vier Tage nach meiner Ankunft in Aynsford kam ich nach dem Nachmittagsschlaf ins Parterre, wo Charles in der großen Halle vor einer riesigen Kiste stand und darin wühlte. Auf dem ganzen Parkett war Holzwolle verstreut, auf einem niedrigen Tisch neben ihm lagen Trophäen seiner Wühlarbeit, für mein ungeübtes Auge nichts als Gesteinsbrocken.
Ich nahm einen davon in die Hand. Auf einer Seite war der Stein glattgeschliffen. Dort klebte ein Etikett.
›Porphyr‹ stand darauf und darunter ›Mineralogiestiftung Carver‹.
»Ich wußte nicht, daß du dich so für Quarz interessierst.«
Er warf mir einen seiner ausdruckslosen Blicke zu, die nicht bedeuteten, daß er mich nicht gehört oder verstanden hätte, sondern daß er sich nur nicht zu erklären gedachte.
»Ich angele«, sagte er und griff wieder in die Kiste. Der Quarz war also ein Köder. Ich legte den Porphyr weg und nahm ein anderes Stück. Es war klein, ungefähr eigroß und wunderschön, klar und durchsichtig wie Glas. Auf dem Etikett stand nur ›Bergkristall‹.
»Wenn du dich nützlich machen willst«, sagte Charles, »kannst du auf die leeren Etiketten, die auf meinem Schreibtisch liegen, die Namen schreiben, die Klebezettel der Stiftung ablösen und die neuen aufkleben. Aber die alten nicht wegwerfen! Wir müssen sie auswechseln, wenn das Zeug zurückgeschickt wird.«
»In Ordnung.«
Der nächste Brocken, den ich aufhob, war schwer und von Gold durchzogen.
{23}»Sind die Dinger wertvoll?« erkundigte ich mich.
»Manche schon. Irgendwo muß eine Broschüre sein. Ich habe der Stiftung erklärt, daß sie hier in Sicherheit sind. Ich sagte, ein Privatdetektiv wäre im Haus und bewachte sie ständig.«
Ich lachte und begann, nach der Inventurliste neue Etiketten zu schreiben. Die Brocken hatten keinen Platz mehr auf dem Tisch und mußten auf den Boden gelegt werden, bevor die Kiste leer war.
»Draußen ist noch eine Kiste«, meinte Charles.
»Um Gottes willen!«
»Ich sammle Quarz«, sagte Charles würdevoll, »das bitte ich nicht zu vergessen. Ich sammle schon seit Jahren, nicht wahr?«
»Seit Jahren«, stimmte ich zu. »Du bist eine Autorität.«
»Ich habe genau einen Tag Zeit, um alle Namen auswendig zu lernen«, sagte Charles lächelnd. »Sie sind später gekommen, als ich dachte. Bis morgen abend darf mir kein Fehler mehr unterlaufen.«
Er holte die zweite Ladung, die wesentlich kleiner war und wichtigtuerische Siegel trug. In der Kiste befanden sich ungeschliffene Halbedelsteine, jeder auf eigenem Sockel. Der Gesamtwert machte mich schwindlig. Die Stiftung Carver mußte das Märchen mit dem Privatdetektiv ernst genommen haben. Man hätte die Schätze nicht herausgegeben, wenn mein Gesundheitszustand dort bekannt gewesen wäre.
Wir arbeiteten geraume Zeit an der Auswechslung der Etiketten, während Charles die Namen wie Beschwörungsformeln vor sich hinmurmelte.
»Chrysopras, Aventurin, Achat, Onyx, Chalzedon, Tigerauge, Karneol, Citrin, Rosentopas, Plasma, Basanit, Heliotrop, Hornstein … Warum, zum Teufel, habe ich damit angefangen?«
»Na, und warum?«
Wieder der ausdruckslose Blick. Er wollte nicht damit herausrücken.
{24}»Du kannst mich abhören«, sagte er.
Wir trugen sie Stück für Stück ins Eßzimmer, wo neben dem Kamin die großen Bücherschränke mit den Glastüren geleert worden waren.
»Da kommen sie später hinein«, sagte Charles, während er den großen Eßtisch mit einer dicken Filzplatte bedeckte. »Leg sie zunächst auf den Tisch.«
Als sie in Reih und Glied dalagen, ging er langsam im Kreis herum und lernte die Namen auswendig. Es waren ungefähr fünfzig Stück. Ich hörte ihn nach einer Weile ab, und er vergaß ungefähr die Hälfte. Kein Wunder, die meisten sahen einander ähnlich. Er seufzte.
»Jetzt trinken wir einen Schluck, und du gehst wieder ins Bett.«
Er ging voraus in das kleine Wohnzimmer und füllte zwei Gläser mit Kognak. Er prostete mir zu und trank genießerisch den ersten Schluck. Man spürte eine unterdrückte Erregung an ihm. In den unergründlichen Augen glitzerte es. Ich schlürfte den Kognak und fragte mich mit größerem Interesse, was er vorhatte.
»Übers Wochenende kommt Besuch«, sagte er gleichgültig. »Mr. Rex van Dysart mit Frau und Mr. Howard Kraye mit Frau und meine Kusine Viola, die als Gastgeberin fungiert.«
»Alte Bekannte?« murmelte ich, da ich bisher nur von Viola gehört hatte.
»Nicht sehr«, sagte er beiläufig. »Sie werden morgen bis zum Abendessen hier sein. Da kannst du sie kennenlernen.«
»Aber ich bin doch überflüssig. Ich gehe hinauf, bevor sie kommen, und lasse mich übers Wochenende nicht blicken.«
»Nein«, sagte er scharf, viel zu nachdrücklich.
Ich war überrascht. Dann kam mir plötzlich die Idee, daß die ganze Spielerei mit den Gesteinsproben und seinem Angebot, mich bei ihm zu erholen, wohl nur dazu gedient hatte, eine Begegnung zwischen mir und den Wochenendgästen zu ermöglichen. Er bot mir Ruhe. Mr . van Dysart und Mr. Kraye bot er {25}Quarzbrocken. Wir hatten seinen Köder geschluckt. Ich beschloß, ein bißchen an der Schnur zu zerren, um herauszufinden, wie entschlossen der Angler war.
»Ich bin aber lieber oben. Du weißt, daß ich Diät halten muß.«
Meine Ernährung bestand zu dieser Zeit aus Kognak, Bouillon und im Vakuum abgepackter Pasten, die man für die Versorgung von Astronauten erfunden hatte. Offenbar fügten diese Dinge meinen zerschossenen Gedärmen keinen weiteren Schaden zu.
»Beim Essen werden die meisten Leute aufgeschlossener, sie reden viel, und man lernt sie besser kennen.«
Er gab sich Mühe, nicht zu drängen.
»Sie reden mit dir genauso, wenn ich nicht dabei bin, sogar ungezwungener. Und ich kann euch nicht zusehen, wenn ihr alle Steaks verdrückt.«
»Du kannst alles, Sid«, sagte er nachdrücklich, »und ich glaube, daß du interessiert sein wirst, nicht gelangweilt – das verspreche ich dir! Noch einen Kognak?«
Ich schüttelte den Kopf und gab nach.
»Na schön, ich komme zum Essen, wenn du willst.«
Er entspannte sich nur wenig, ein beherrschter und kluger Mann. Ich lächelte ihn an, und er erriet, daß ich nur getestet hatte.
»Du bist ein Halunke«, sagte er.
Bei ihm war das ein Kompliment.
Das Transistorgerät neben meinem Bett brachte die Morgennachrichten, während ich langsam mein Astronautenfrühstück hinunterwürgte.
»Die für heute und morgen in Seabury vorgesehenen Rennveranstaltungen mußten abgesagt werden«, erklärte der Sprecher. »Ein Tankzug mit flüssigen Chemikalien stürzte gestern nachmittag auf einer die Rennbahn überquerenden Straße um. Der Rasen wurde sehr stark beschädigt, und die Rennleitung entschied heute morgen nach einer Besichtigung, daß die Rennen nicht stattfinden {26}können. Man hofft, die Bahn bis zur nächsten Veranstaltung in vierzehn Tagen wieder in rennfähigen Zustand bringen zu können. Hierzu erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt noch eine Bekanntmachung. Abschließend der Wetterbericht …«
Das arme Seabury, dachte ich, immer dasselbe. Erst vor einem Jahr waren vor einer Veranstaltung die Stallungen abgebrannt. Auch damals hatte man absagen müssen, weil über Nacht nicht einmal Behelfsstallungen errichtet werden konnten, und das Nationale Rennsportkomitee nach Rücksprache mit Radnor entschieden hatte, daß die beliebige Unterbringung von Pferden in der Umgebung zu riskant wäre.
Die Bahn in Seabury war ausgesprochen gut, eine große Rundbahn ohne scharfe Kurven. Es hatte auch im Frühling schon einmal Schwierigkeiten gegeben: Während eines Hindernisrennens war ein Entwässerungsgraben eingebrochen. Das Vorderbein eines bedauernswerten Pferdes war bis zu einer Tiefe von ungefähr vierzig Zentimetern abgerutscht, was zu einem Beinbruch geführt hatte. Bei dem sich entwickelnden Massensturz waren zwei weitere Pferde und ein Jockey schwer verletzt worden. Aus den Landkarten ließ sich das Vorhandensein des Abwasserkanals nicht ersehen, und ich hatte manchen Trainer Bedenken äußern hören, daß es vielleicht noch mehr solch alte Wassergräben gäbe, die ebenso unerwartet einbrechen könnten. Die Geschäftsführung behauptete natürlich das Gegenteil.
Eine Weile träumte ich vor mich hin, bestritt in Seabury ein Rennen und wünschte mir nutzlos, hoffnungslos, qualvoll, es in Wirklichkeit tun zu können.
Mrs. Cross klopfte an die Tür und kam herein. Sie war eine kleine, unauffällige Frau mit braunem Haar und ein wenig schielenden graugrünen Augen. Obwohl sie völlig temperamentlos zu sein schien und kaum je sprach, hielt sie das Haus hervorragend in Schuß, unterstützt von einer meist unsichtbaren Armee von ›Hilfen‹. Für mich besaß sie die große Tugend, erst seit {27}verhältnismäßig kurzer Zeit hier zu arbeiten und Jenny und mir neutral gegenüberzustehen. Ihrer Vorgängerin, die Jenny wie ihr eigenes Kind betrachtet hatte, hätte ich nicht getraut.
»Der Admiral möchte wissen, ob Sie sich wohl fühlen, Mr. Halley?« fragte Mrs. Cross geziert und hob mein Tablett auf.
»Ja, danke, mehr oder weniger.«
»Er sagte, Sie möchten doch zu ihm ins Eßzimmer hinunterkommen.«
»Zu seinen Felsbrocken?«
Sie lächelte schwach.
»Er ist heute schon vor mir aufgestanden und hat dort gefrühstückt. Soll ich ihm sagen, daß Sie kommen?«
»Bitte.«
Als sie gegangen war und ich mich langsam anzog, läutete das Telefon. Kurz danach kam Charles selbst herauf.
»Das war die Polizei«, sagte er stirnrunzelnd, »offenbar hat man eine Leiche gefunden, die du identifizieren sollst.«
»Wessen Leiche?«
»Davon war nicht die Rede. Man schickt aber sofort einen Wagen her. Offenbar rief man hier an, weil man nicht genau wußte, wo du dich aufhältst.«
»Ich habe keine Angehörigen. Das muß ein Irrtum sein.«
Er zuckte die Achseln. »Wir werden ja bald Bescheid wissen. Komm jetzt mit hinunter und hör mich mit den Steinen ab. Ich glaube, jetzt habe ich’s.«
Wir gingen ins Eßzimmer, wo ich feststellen konnte, daß er nicht übertrieben hatte. Er ging die ganze Sammlung ohne einen einzigen Fehler durch. Ich veränderte die Reihenfolge, aber das brachte ihn nicht aus dem Konzept. Er lächelte zufrieden.
»Es klappt«, sagte er. »Jetzt legen wir sie in die Fächer, das heißt, die nicht so wertvollen da hinauf und die Halbedelsteine in den Bücherschrank im Wohnzimmer, den mit den Vorhängen an den Glastüren.«
{28}»Sie gehören in einen Tresor.« Das hatte ich schon gestern abend erklärt.
»Trotz deiner Ängste ist nichts passiert, obwohl sie die ganze Nacht auf dem Tisch lagen.«
»Als beratender Privatdetektiv empfehle ich trotzdem einen Tresor.«
Er lachte.
»Du weißt sehr gut, daß ich keinen Tresor habe. Aber als beratender Privatdetektiv kannst du die Steine heute abend bewachen. Leg sie dir unters Kissen! Was hältst du davon?«
»Einverstanden.«
»Das ist doch nicht dein Ernst?«
»Eigentlich nicht, da schläft sich’s so hart.«
»Mensch …«
»Aber oben, entweder bei mir oder bei dir. Ein paar von diesen Steinen sind sehr wertvoll. Die Versicherungsprämie muß dich einen schönen Batzen Geld gekostet haben.«
»Äh … Nein«, gestand Charles. »Ich habe zugesichert, daß ich alles ersetze, was beschädigt wird oder verlorengeht.«
Ich riß die Augen auf. »Ich weiß, daß du reich bist, aber du bist vollkommen verrückt! Laß sie sofort versichern! Hast du eine Ahnung, was jedes einzelne Stück wert ist?«
»Nein, eigentlich nicht. Ich habe nicht gefragt.«
»Na, wenn dich ein Sammler besucht, wird er wohl davon ausgehen, daß du weißt, was du für die Stücke bezahlt hast.«
»Daran habe ich schon gedacht«, unterbrach er mich. »Ich habe sie von einem entfernten Vetter geerbt. Damit läßt sich viel Unwissenheit vertuschen, nicht nur Kosten und Wert, sondern auch Näheres über Kristallographie, Vorkommen, Seltenheit und so weiter. Ich habe festgestellt, daß sich an einem Tag einfach nicht genug lernen läßt, aber es müßte genügen, wenn ich mich mit der Sammlung ein bißchen vertraut zeige.«
»Gewiß. Du rufst jetzt sofort die Stiftung an und erkundigst {29}dich, was die Steine wert sind, dann setzt du dich mit deinem Versicherungsmann in Verbindung. Du bist einfach zu ehrlich, Charles. Andere Leute sind es nicht. Du lebst jetzt in der großen bösen Welt, nicht mehr in der Marine.«
»Na schön«, sagte er jovial, »wird gemacht. Gib mir die Liste!«
Er ging ans Telefon, und ich legte die Steine in die leeren Fächer, aber bevor ich einigermaßen vorangekommen war, läutete es an der Eingangstür. Mrs. Cross öffnete und kam herein, um mir zu sagen, daß mich ein Polizeibeamter zu sprechen wünschte.
Ich steckte meine nutzlose, verkrüppelte linke Hand in die Tasche, wie ich es immer vor Fremden machte, und ging in die Halle. Ein großer, breitschultriger junger Mann in Uniform stand da und versuchte den Eindruck zu erwecken, als überwältigte ihn die großartige Umgebung überhaupt nicht.
»Ist es wegen der Leiche?« fragte ich.
»Ja, Sir, ich glaube, sie erwarten uns schon.«
»Wessen Leiche ist es denn?«
»Das weiß ich nicht, Sir. Ich soll Sie nur abholen.«
»Tja … Wohin?«
»Nach Epping Forest, Sir.«
»Aber das ist ja weit weg«, wandte ich ein.
»Jawohl, Sir«, gab er mit einer Spur von Bedrückung zu.
»Sind Sie sicher, daß ich gebraucht werde?«
»Absolut, Sir.«
»Na schön. Setzen Sie sich einen Augenblick, ich hole meinen Mantel und sage Bescheid.«