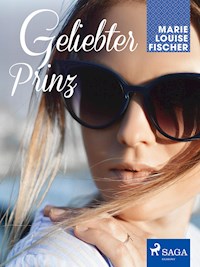
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dorothee Schubert legt nach dem Tod ihres Mannes ihre ganze Energie in ihre Mutterrolle. Insbesondere ihren Sohn Daniel überhäuft sie mit übertriebener Zuneigung. Daraus entwickelt sich fast zwangsläufig ein Gespinst gegenseitiger Eifersucht. Jede Freundin, die Daniel später mit nach Hause bringt, ist für Dorothee eine mögliche Konkurrentin. Als Dorothee sich nach einigen Jahren in einen Mann verliebt, der es auch ernst mit ihr meint, wird dieser von ihren Kindern abgelehnt. Es ist schwer, sich aus diesem selbstgeschaffenen Gefängnis zu lösen und ein neues, eigenständiges und glückliches Leben zu leben.Marie Louise Fischer wurde 1922 in Düsseldorf geboren. Nach ihrem Studium arbeitete sie als Lektorin bei der Prag-Film. Da sie die Goldene Stadt nicht rechtzeitig verlassen konnte, wurde sie 1945 interniert und musste über eineinhalb Jahre Zwangsarbeit leisten. Mit dem Kriminalroman "Zerfetzte Segel" hatte sie 1951 ihren ersten großen Erfolg. Von da an entwickelte sich Marie Louise Fischer zu einer überaus erfolgreichen Unterhaltungs- und Jugendschriftstellerin. Ihre über 100 Romane und Krimis und ihre mehr als 50 Kinder- und Jugendbücher wurden in 23 Sprachen übersetzt und erreichten allein in Deutschland eine Gesamtauflage von über 70 Millionen Exemplaren. 82-jährig verstarb die beliebte Schriftstellerin am 2. April 2005 in Prien am Chiemsee.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Marie Louise Fischer
Geliebter Prinz
Roman
SAGA Egmont
Geliebter Prinz
Genehmigte eBook Ausgabe für Lindhardt og Ringhof A/S
Copyright © 2017 by Erbengemeinschaft Fischer-Kernmayr, (www.marielouisefischer.de)
represented by AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Originally published 1967 by F. Schneider, Germany
All rights reserved
ISBN: 9788711718841
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt og Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
SIE saßen um den runden, hübsch gedeckten Tisch im Wintergarten, während draußen ein leichter Frühlingsregen niederfiel und, wenn der Wind sich drehte, gegen die Scheiben klopfte.
Dorothee Schubert war glücklich im Kreis der Menschen, die sie lieb hatte.
An diesem Nachmittag hatte sie den Freund, Professor Dr. Wolfgang Ortlieb, zum ersten Mal in ihr schönes Haus im Münchener Herzogpark geladen, das sie von ihrem verstorbenen Mann geerbt hatte. Sie hatte Wolfgangs Begegnung mit ihren Kindern mit Vorfreude, wenn auch mit einer gewissen Nervosität entgegengefiebert. Aber es schien alles gut zu gehen. Während sie alle der Kirschtorte mit Schlagsahne zusprachen – die Erwachsenen tranken Kaffee dazu –, stellte er bedeutsame Fragen, die Daniel und Delia artig beantworteten. »Laßt den ›Professor‹ weg«, hatte er gleich bei der Begrüßung gesagt, »für euch bin ich ›Onkel Wolfgang‹ oder› besser noch, ganz einfach ›Wolfgang‹.«
Die Kinder hatten zustimmend gelächelt und genickt, aber bis jetzt vermieden sie immer noch jede Anrede. Doch sie antworteten ungezwungen. Dorothee war stolz auf sie.
Die siebenjährige Delia sah reizend aus in dem geblümten Kleidchen mit Spitzenkragen, das sie der Mutter zuliebe angezogen hatte. Der zwei Jahre ältere Daniel trug sich, wie immer, männlich elegant in Jeans, Baumwollhemd und Weste – man hätte seinen Aufzug für einfach halten können, wenn man nicht wußte, wie teuer seine Designerklamotten tatsächlich waren.
Wolfgang ahnte es nicht, wie Dorothee hoffte. Er selber legte keinen Wert auf gute Kleidung. Heute hatte er sieh – womöglich um dem Anlaß auch nicht den Hauch von Festlichkeit zuzugestehen – besonders lässig angezogen. Die Beine seiner schlecht sitzenden Hose waren ausgebeult, der Kragen seines karierten Hemdes wirkte ungebügelt, und die Ellbogen seines edlen erdbeerroten Kaschmirpullovers waren durchgescheuert.
Dorothee störte sich nicht daran. ›Typisch Junggeselle‹, dachte sie liebevoll. In ihren Augen war er ein ausgesprochen gutaussehender Mann. Er hatte scharf blickende Augen, eine kräftige Nase und einen festen Mund. Die Winkel seiner Lippen waren leicht verzogen, was seiner Miene einen ständigen Ausdruck von Ironie und Skepsis verlieh, auch wenn er im Moment gar nicht so empfand. Sein volles, lockiges Haar wich aus der Stirn zurück, wie es für einen Mann Mitte vierzig durchaus normal war.
Jetzt hatte er sein Stück Torte aufgegessen. Er förderte ein zerknautschtes Zigarettenpäckchen und ein Feuerzeug aus der rechten Hosentasche. »Du erlaubst doch?« fragte er Dorothee, bevor er sich Feuer gab.
»Aber ja!« – Dorothee selber hatte sich das Rauchen schon vor vielen Jahren um der Kinder willen abgewöhnt.
Er sah sich suchend um; seine Augen begegneten denen Delias. »Würdest du mir, bitte, einen Aschenbecher bringen?« fragte er höflich.
Ihre runden blauen Augen hielten seinem Blick stand. »Nein, du Arschloch!« – Sie sagte es sehr laut und sehr deutlich, ohne auch nur mit einer ihrer blonden Wimpern zu zucken.
Dorothee reagierte fassungslos. Sie war nicht weltfremd, wußte, daß die Jugend solche Ausdrücke benutzte, hatte sie aber noch nie aus dem Mund ihrer Tochter gehört und auch nie in einer so beleidigenden Form für möglich gehalten. Sie brachte keinen Ton heraus.
Daniel hob die Augenbrauen und beobachtete Wolfgangerwartungsvoll.
Der, an Kinder nicht gewöhnt, war diesem Angriff nicht gewachsen. »Na, dann nicht, du kleines Miststück!« konterte er. »Sieh mich nicht so an, als hätte ich dich beleidigt! Wer Unflat in den Mund nimmt, ist eine Dreckschleuder!« Ostentativ stäubte er Asche auf den zuvor benutzten Kuchenteller.
Daniel preßte die Lippen zusammen, um nicht aufzulachen; seine klaren grünen Augen funkelten vor Vergnügen.
Delias Gesichtchen hatte sich knallrot verfärbt. Sie stieß ihren Stuhl fast um, als sie aufsprang, dann stürmte sie aus dem Wintergarten.
Dorothee hatte ihre Sprache endlich wiedergefunden. »Wolfgang, wie kannst du!« rief sie empört.
»Na, erlaube mal! Wer hat denn angefangen?«
»Sie ist noch ein Kind!«
»Ein verzogener Fratz!«
»Du kannst dich doch nicht mit ihr auf eine Stufe stellen!«
»Ich denke nicht im Traum daran.«
»Doch. Das hast du getan! Sie hat sich unglaublich benommen, zugegeben. Aber das darf doch für dich kein Grund sein, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Du solltest den Umgang mit jungen Leuten gewohnt sein.«
»Unter meinen Studenten gibt’s schrille Typen, das leugne ich gar nicht. Aber aus dem Gröbsten sind sie doch alle raus.«
Daniel erhob sich und erklärte betont formell: »Wenn ihr mich jetzt, bitte, entschuldigen würdet – ich will mal nach der Kleinen sehen.«
Beide, Dorothee und Wolfgang, empfanden, daß er genauso gut hätte sagen können: »Ich will euch nicht beim Streiten stören.«
Daniel ging hinaus.
Wolfgang wußte, daß es klüger gewesen wäre, den Mund zu halten. Trotzdem entfuhr es ihm: »Ein arroganter Knabe.«
»Er hat dir nun wirklich nichts getan!« gab Dorothee hitzig zurück.
Daniel fand seine Schwester, wie er erwartet hatte, in ihrem Zimmer. Er hatte an die geschlossene Tür geklopft, war dann aber eingetreten, ohne daß sie ihn gerufen hatte.
Der Boden des hellen, freundlichen Raumes war übersät mit achtlos ausgezogenen Kleidungsstücken, aufgeschlagenen Comic-Heften und zerknüllten Papieren, durch die er sich einen Weg bahnen mußte.
Delia lag auf ihrem Bett, bäuchlings, die Arme über dem Kopf, das Gesicht in ein Kissen vergraben.
»Na, na, na!« Er klopfte ihr beruhigend auf den Rükken. »Nimm’s nicht zu tragisch!«
Sie rollte sich zur Seite und richtete sich auf; dicke Tränen liefen ihr aus den Augen, Tränen der Wut. »Dieser gemeine Kerl – wie ich ihn hasse!«
»Das ist er doch gar nicht wert.«
»Am liebsten hätte ich ihm die Kaffeetasse auf den Schädel geschlagen!«
Daniel wußte natürlich, daß sie übertrieb und dazu gar nicht fähig gewesen wäre. Trotzdem sagte er, um ihre Eitelkeit nicht zu verletzen: »Gut, daß du es nicht getan hast. Das wäre nämlich des Guten zu viel gewesen.«
Schon halb getröstet, wischte sie sich mit dem Handrücken die Tränen von den Wangen. »Findest du?«
»Unbedingt. Du hast es genau richtig gemacht. Du kannst stolz auf dich sein. Du warst unschlagbar.«
»Ach, Daniel«, sagte sie und schniefte.
»Jetzt aber Schluß mit dem Geheule. Überlegen wir lieber, was wir jetzt anfangen.«
»Spielst du was mit mir?« fragte sie hoffnungsvoll.
»Erst einmal räumen wir dein Zimmer auf!«
»Warum?« –
»Weil es bei dir wieder mal wie in einer Räuberhöhle aussieht.«
»Stört dich das?«
»Ja. Aber mehr noch Mama. Sie wird Zustände kriegen, wenn sie hier hereinkommt.«
»Ach, sie kennt das doch. Tu nicht so, als würde sie aus der Haut fahren.«
»Sie versucht sich zu beherrschen, stimmt. Aber das heißt nicht, daß es ihr nicht durch und durch geht.«
»Woher willst du das wissen?«
»Weil’s schon mich jedesmal umwirft, und ich bin doch lange nicht so empfindlich wie sie.«
Delia zog das Näschen hoch. »Stell dich nicht so an!«
»Also willst du nun, oder …« Er sprach den Satz nicht zu Ende, aber die Drohung war unüberhörbar.
Delia wollte es genau wissen. »Oder was?«
»Ich lasse dich allein.«
»Wenn dich das bißchen Durcheinander so stört, können wir ja auch zu dir gehen.«
»Jetzt sag mal: Bist du nun so blöd oder stellst du dich nur so? Was denkst du, was die beiden jetzt unten tun?«
»Wieso?«
»Frag nicht, beantworte einfach meine Frage: Was tun sie jetzt?«
»Sich küssen?«
»Nein. Erst einmal streiten sie. Sie haben sich noch gezankt, als ich gegangen bin. Aber dann werden sie sich wieder versöhnen, und bestimmt wird der Fatzke versuchen, sie gegen uns aufzuhetzen.«
»Na und?«
»Und wenn sie nachher raufkommt und das Tohuwabohu hier sieht, wird sie denken, daß er vielleicht doch recht hat und daß du tatsächlich ein Miststück bist.«
Delia ballte ihre Händchen zu Fäusten. »Bin ich nicht!«
»Habe ich ja auch gar nicht behauptet. Nur daß man es denken könnte, wenn man sich hier so umsieht. Also los! Wir vertrödeln sonst nur unsere Zeit.«
Mißmutig machte Delia sich daran, ihre Sachen vom Boden aufzuklauben. Jedes Kleidungsstück hielt sie ihrem Bruder unter die Nase, der dann entschied: »Muß in die Wäsche!« Oder: »Zusammenlegen! Das kannst du noch mal anziehen!«
Ohne Widerspruch unterwarf sich Delia dem Urteil ihres Bruders, obwohl sie selber am liebsten alles einfach zusammengerafft und in den Wäschekorb im Badezimmer gestopft hätte. Aus leidvoller Erfahrung wußte sie aber, daß er ihr das nicht durchgehen lassen würde. Danach sammelte sie die Schuhe ein. Einer war weit unter das Bett gerutscht, wie immer das geschehen sein mochte, und sie mußte sich auf den Bauch legen, um ihn hervorzuangeln.
Sie knallte ihn in den Schrank.
»Stell ihn ordentlich hin!« verlangte der Bruder.
»Eine tolle Hilfe bist du«, meuterte sie, gehorchte aber doch.
»Fang bloß nicht an zu quengeln! Ohne meine geistige Unterstützung sähe es hier immer noch wie in einem Saustall aus.«
Aber immerhin ließ er sich herab, ihr beim Aufheben der Papierchen – meist Umhüllungen von Bonbons und Süßigkeitsriegeln – zu helfen. Die Comics schlug er zu, glättete sie und legte sie sehr akkurat zu den anderen in Delias Bücherregal.
»So, das war’s!« sagte er abschließend und sah sich zufrieden um. Das große Zimmer mit den hellen Holzmöbeln, dem roten Teppichboden und den bunten Vorhängenwirkte jetzt ausgesprochen freundlich und einladend. »Bedank dich bei deinem großen Bruder!«
»Das könnte dir so passen!« parierte sie und boxte auf ihn ein, aber nur spielerisch und nicht allzu fest, denn sie wußte, daß sie es auf eine ernsthafte Rauferei nicht ankommen lassen durfte.
Aber das wollte sie auch gar nicht, denn sie liebte und bewunderte ihn.
Dorothee und Wolfgang waren inzwischen in einen anderen Raum gegangen, der für die Kinder immer noch »Vaters Zimmer« war. Hier gab es Wände voller Bücher, einen massiven Schreibtisch, bequeme Ledersessel, einen Schrank mit hochprozentigen Getränken, Aschenbecher und Zigarrenkisten.
Hierhin hatte sich Verleger Johannes Schubert zurückgezogen, wenn er allein sein, arbeiten, nachdenken oder mit Freunden Männergespräche führen wollte. Nach seinem Tod hatte seine Witwe den Raum so, wie er war, übernommen. Sie hatte kaum etwas geändert, nicht, weil sie eine Art kleines Museum daraus machen wollte, sondern weil sie ihren Mann um dieses Refugium immer schon unwissentlich beneidet hatte. Nur die Blumenstöcke in den weißen Keramikübertöpfen und die kleine Kupfergießkanne verrieten, daß »Vaters Zimmer« inzwischen zum Reich einer Frau geworden war. Daniel und Delia respektierten, daß sie nicht gestört sein wollte, wenn sie sich hierher zurückzog.
Jetzt stellte sie fest, daß auch Wolfgang in diesen Raum zu passen schien. Die Beine weit von sich gestreckt, hatte er es sich in einem der schweren Sessel bequem gemacht und schmauchte, einen großen runden Schwenker mit Cognac halb gefüllt in der anderen Hand, eine duftende Zigarre. »Sie haben es also doch nicht geschafft, die lieben Kleinen!« sagte er, nicht ohne Selbstgefälligkeit.
»Was meinst du damit?« Sie saß ihm aufrecht gegenüber, auf der breiten Armlehne eines anderen Sessels, und wirkte sehr dekorativ in dieser Haltung, die ihre schönen schlanken Beine voll zur Geltung brachte, dekorativ, aber auch wie auf dem Sprung.
»Uns gegeneinander aufzuhetzen«, erklärte er trocken.
»Das war bestimmt keine Absicht!« behauptete sie.
»Doch, Dorothee, da bin ich mir sicher. Die Aktion war klug vorausgeplant, und sie hat ja auch Erfolg gebracht.«
»Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst, Wolfgang! Delia ist aus der Rolle gefallen, das gebe ich ja zu. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Aber darum gleich von einer Aktion zu reden ….« Die Stimme versagte ihr.
Um seine Mundwinkel zuckte es. »Du hältst dieses ›du Arschloch‹ allen Ernstes für eine spontane Äußerung?«
»Was sonst?«
»Und du bildest dir ein, daß dein bezauberndes Söhnchen nichts damit zu tun hat?«
Jetzt sprang sie tatsächlich auf. »Du kannst Daniel nichts vorwerfen – nichts, aber auch gar nichts! Er hat sich von Anfang bis Ende tadellos benommen, wie immer.«
In ihrer Erregung wirkte sie jünger, als sie tatsächlich war. Ihre Wangen hatten sich gerötet, ihre runden Augen, blau wie Bergseen, funkelten, und ihr nußbraunes Haar schien sich zu sträuben. Sein Lächeln wurde geradezu liebevoll. Er spürte, wieviel ihm an ihr lag und wie ungern er sie verlieren würde.
Trotzdem sagte er: »Du hast also nicht gemerkt, wie sehr er sich über die Attacke seiner Schwester gefreut hat? Und über meine hilflose Reaktion?«
»Das bildest du dir doch nur ein!« Nervös begann sie, zwischen Sitzgruppe und Schreibtisch auf und ab zu gehen. »Er hat keinen Ton von sich gegeben.«
»Am liebsten«, sagte er, »würdest du jetzt nach deinen Kindern sehen.«
»Überhaupt nicht.« Doch wie ertappt blieb sie stehen.
»Du hast also nicht den Wunsch, mich rauszuwerfen?«
»Natürlich nicht. Wie kommst du darauf?«
»Dann setz dich endlich richtig hin!«
Sie tat es, mit einem tiefen Seufzer, der ihr selbst nicht bewußt wurde; eigentlich empfand sie den Sessel als zu groß für ihre kleine Person und zupfte am Saum ihres schlicht eleganten Kleides aus blau eingefärbter Schurwolle.
»Entspann dich!«
»Als wenn das so einfach wäre!«
»Versuch’s halt.«
»Wolfgang«, stieß sie hervor, »was soll jetzt aus uns werden?«
»Willst du dir nicht auch einen Cognac gönnen?« lenkte er ab. »Das würde helfen.«
»Du weißt, ich trinke nicht. So gut wie nicht.«
»Um den Kindern kein schlechtes Beispiel zu geben.«
»Es besteht kein Grund, das zu belächeln. Wenn man selber Drogen nimmt – und Nikotin und Alkohol sind Drogen –, mit welchem Recht könnte man das den Kindern später verbieten? Mit welchen Argumenten sie warnen?«
»Wärst du konsequent, dürftest du dir dann auch weder Tee noch Kaffee gönnen.«
»Ich bin keine Heilige und will auch meine Kinder nicht zu Heiligen machen.«
»Dann könntest du in dieser Ausnahmesituation doch ruhig auch mal einen Schluck Cognac nehmen.«
»Nein, gerade nicht. Damit würde ich zugeben, daß ich in nüchternem Zustand unseren Problemen nicht gewachsen wäre.«
»Na bravo.« Er trank, ließ den Cognac auf der Zunge zergehen, bevor er ihn schluckte, und stellte den Schwenker aus der Hand. »Also dann, ganz wie du willst, zu unseren Problemen. Wenn du mich fragst: Wir haben keine.«
Sie wußte, daß er von seinem Standpunkt aus recht hatte. Seit einigen Monaten waren sie ein Liebespaar und trafen sich, so oft es ihnen möglich war, in seiner Wohnung oder zu öffentlichen Anlässen. Ihm hatte dieses Arrangement, das ihnen viel Freiheit gab und wenig Verpflichtungen auferlegte, ganz gut gepaßt. Wenn er vielleicht auch bedauerte, daß sie nie über Nacht bei ihm bleiben konnte. Aber das hatte er klaglos in Kauf genommen.
Sie war es gewesen, die ihn in ihre Familie einbeziehen wollte. Ohne sich ganz darüber klar zu sein, hatte sie ihn wegen seines Junggesellendaseins bedauert. Sie hatte ihn aus seiner Höhle, wie er selber seine Altbauwohnung nannte, herausholen wollen. Der Wunsch, ihn zu pflegen, für ihn zu kochen, ihn zu umsorgen war immer stärker geworden, obwohl sie wußte, daß es aus einem sehr weiblichen Gefühl und nicht aus der Vernunft heraus kam.
Doch sie war auch sicher gewesen, daß er für ihre Kinder eine männliche Bezugsperson sein könnte, die sie, nach allem, was sie über Erziehungsfragen gelesen hatte, dringend brauchten. Sie hatte sich eingebildet, daß die Menschen, die sie liebte, kleinere Spannungen eingerechnet, miteinander harmonisieren würden.
»Wenn du nur ein wenig Geld aufbringen könntest«, sagte sie jetzt.
»Um deine Kinder zu zähmen? Oder sie für mich einzunehmen?« Er nahm wieder einen Schluck Cognac, ließ ihn auf der Zunge zergehen und stellte den Schwenker dann ab. »Nein, das denn doch nicht.«
»Um meinetwillen, Wolfgang.«
»Ich will unsere Liebe nicht aufs Spiel setzen, Dorothee. Wir beide sind uns doch genug. Ein Gezerre zwischen mir und den kleinen Ungeheuern wäre mehr, als ich ertragen könnte.«
Sie nahm einen Anlauf, ihre Kinder heftig zu verteidigen, begriff aber, daß dies nach dem, was geschehen war, zwecklos sein würde. »Delia tut es bestimmt schon leid«, sagte sie statt dessen und spürte selber, daß es matt klang. »Sie wird sich bei dir entschuldigen.«
»›Ich nehme das Arschloch mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück‹? So etwa?« Sein Lachen klang trocken.
»Und damit, glaubst du, wäre die Sache aus der Welt geschafft? Aber das war mehr als eine bloße Ungezogenheit. Es war sozusagen der Gipfel eines Eisberges. Deine Kinder lehnen mich rundweg ab.« Er hatte während dieser verhältnismäßig langen Rede seine Zigarre vergessen und nahm jetzt ein paar kräftige Züge, um sie am Verglühen zu hindern. »Und, wie die Dinge stehen, kann ich es ihnen nicht einmal verdenken.«
»Du willst also nicht um mich kämpfen?«
»Nicht gegen deine Kinder.«
»Aber was können wir denn sonst tun?«
»Alles beim alten lassen, wie ich dir schon vorgeschlagen habe.«
»Und wenn mir das nicht mehr genügt?« Sie sah ihn erwartungsvoll an, und als er nicht gleich eine Antwort gab, fügte sie beschwörend hinzu: »Ich will mit dir zusammenleben. In diesem Haus ist Platz genug. Wir würden uns bestimmt nicht auf die Nerven gehen. Ich verspreche dir, du würdest es gut bei mir haben. Lockt dich das denn überhaupt nicht?«
»Doch, Dorothee. Du weißt, daß ich Vorbehalte gegen die Ehe hatte. Du bist die erste Frau in meinem Leben, bei der die Vorstellung einer festen Bindung mich nicht abschreckt. Ich bin mir sicher, daß unsere Beziehung von Dauer sein wird.«
»Oh, Wolfgang!« rief sie gerührt.
Sofort dämpfte er ihre Gefühle. »Vielleicht liegt es ja auch daran, daß ich ein gewisses Alter erreicht habe.«
»Warum mußt du nur immer so zynisch sein?«
»Ich bin nur bemüht, mir nichts vorzumachen – und dir übrigens auch nicht.«
»Ich bin sicher, daß die Kinder sich auf Dauer an dich gewöhnen würden.«
»Ja. Vielleicht. Das ist nicht auszuschließen. Es könnte sein, daß sie mich als ein unvermeidliches Übel in Kauf nehmen.« Sie machte einen Ansatz, ihm zu widersprechen, aber er ließ sie nicht zu Wort kommen. »Aber das will ich nicht. Geduldet zu werden liegt mir nicht. Da ziehe ich denn doch, bei aller Liebe, meine Freiheit entschieden vor.«
Sie war nahe daran, in Tränen auszubrechen. Aber sie tat es nicht. Es hätte ihr Erleichterung verschafft, aber sie fand, daß es ihrer unwürdig gewesen wäre.
Er schien zu spüren, was in ihr vorging. »Nun nimm es nicht so tragisch, Geliebte. Es ist ja alles halb so schlimm. Du hast zwar nicht bekommen, was du wolltest, aber du hast auch nichts verloren.«
»Aber ich bin traurig«, gestand sie.
»Das ist nur natürlich. Jeder Mensch ist traurig, wenn sich eine Hoffnung zerschlägt.«
»Aber es müßte doch einen Weg geben«, sagte sie verzweifelt, »irgendeinen.«
»Ja, den gibt es.«
»Wirklich? Ah, ich wußte es doch. Du bist ja so klug. Sag mir, was wir machen könnten.«
Er lächelte. »Denk mal darüber nach. Du wirst schon selber draufkommen.«
»Nein, nein. Ich weiß es nicht. Ich habe mir schon den Kopf darüber zerbrochen, aber mir fällt nichts ein.«
»Na dann.« Er hatte genug von der ungewohnten Zigarre, legte sie auf den Rand des kupfernen Aschenbechers und ließ sie verglühen. »Das war’s dann also.«
»Was?«
»Mir scheint, wir haben das Ende der Fahnenstange erreicht. Es würde keinen Sinn machen, alles noch einmal und noch einmal durchzukauen.«
»Wolfgang, du behältst etwas für dich!« protestierte sie. »Gib zu: Du hast mir noch nicht alles gesagt.«
»Was erwartest du denn noch von mir?« Er leerte sein Glas und erhob sich.
Sie war mit einem Satz auf den Beinen. »Deinen Vorschlag!«
Sie standen sich gegenüber; Dorothee, mehr als einen Kopf kleiner als er, wirkte kampfbereit.
»Nein«, entschied er, nahm sie in die Arme und küßte sie sanft.
Sie entspannte sich nicht, sondern stemmte ihre Fäuste gegen seine Brust und stieß ihn zurück. »Ich will es wissen!«
»Du würdest mich hassen.«
»Nein.«
»Geliebte, ich kenne dich zu gut. Du würdest es mir bis ans Ende unserer Tage vorhalten.« Er gab sie frei.
Sie sackte in sich zusammen. »Das klingt, als sollte ich sie umbringen.«
Er lächelte auf sie herab und schüttelte den Kopf.
»Was sonst?« Als er immer noch schwieg, fragte sie weiter: »Ich soll sie in ein Internat schicken?«
»Jetzt bist du es, die es gesagt hat.«
»Aber du hast mich dazu manipuliert! Du hast es dir ausgedacht, nicht ich! Wie kannst du verlangen, daß ich meine Kinder aus dem Haus gebe?«
»Das tue ich ja gar nicht. Ich will mich absolut nicht in deine Probleme einmischen. Sie gehen mich ja auch nichts an. Ich gönne dir von Herzen, daß du deine Kinder bei dir behältst – von mir aus bis zum Sankt Nimmerleinstag.«
»Warum sagst du das so? Ich sehe nicht ein, was falsch daran sein soll.«
Er wandte sich zur Tür. »Na gut. Dann werde ich jetzt gehen.«
Sie klammerte sich an seinen Arm. »Wolfgang, ich …«
Er fiel ihr ins Wort. »Es gibt wirklich nichts mehr zu sagen.«
»Begreifst du denn nicht, daß sie viel zu jung für ein Internat sind?«
»Du mußt dich ja nicht von heute auf morgen entscheiden. Im nächsten Jahr wird Daniel zehn, Delia acht. Das wäre ein sehr guter Zeitpunkt.«
»Ich kann das nicht, Wolfgang. Ich kann ihnen das nicht antun. Sie haben den Vater verloren …«
»Gerade deshalb wäre es gut für sie, in einer Gemeinschaft aufzuwachsen, unter der Aufsicht von objektiv urteilenden Erwachsenen – und nicht unter den Augen einer Mutter, die sie vergöttert, abgeschirmt gegen alle Widrigkeiten dieser Welt. Ich sag’s nicht meinetwegen und nicht unseretwegen, Geliebte, und ich werde es auch nie mehr wiederholen: Es wäre gut für sie, wenn du sie aus dem Nästchen entließest.«
»Ich tue alles für sie, was in meiner Kraft steht.«
»Daran habe ich keinen Augenblick gezweifelt. Du bist die beste aller Mütter und« – er breitete die Arme aus, – »die wunderbarste aller Geliebten. Es besteht absolut kein Grund, daß wir uns streiten.«
Sie warf sich an seine Brust. »Warum tun wir es dann?«
»Muß auch mal sein – von Zeit zu Zeit. Ohne Auseinandersetzungen wäre auch die heißeste Liebe so fade wie eine Suppe ohne Salz. Also nimmt es nicht tragisch. Wir werden es nicht zulassen, daß deine Kinder uns entzweien, ja?«
»Nein, niemals. Ich liebe dich so sehr.«
Wenig später war Wolfgang gegangen.
Dorothee hatte ihn noch zur Haustür gebracht und gesehen, wie er, barhäuptig und in seinem alten, eng gegürteten Trench, den Garten durchquert hatte. Der Regen hatte ihn nicht daran gehindert, beim Tor stehenzubleiben und ihr zuzuwinken. Auch sie hatte die Hand erhoben und sich zu einem Lächeln gezwungen.
Aber ihr Herz war schwer. Alles war so anders gekommen, als sie es sich erträumt hatte. Er hätte zum Abendessen bleiben sollen und vielleicht noch länger. Nicht, daß sie vorgehabt hätte, mit ihm ins Bett zu gehen, nicht bei seinem ersten Besuch. Selbst wenn die Kinder tief und fest geschlafen hätten, wäre sie die Vorstellung nicht losgeworden, daß sie etwas spüren könnten. Ihre Angst, sie zu beunruhigen, wäre zu groß gewesen.
Daß ihre Mutter Sex haben könnte – Sex mit einem Mann, der ihnen fast fremd war –, das würden sie nicht verstehen, glaubte sie. Nur behutsam, sehr behutsam, würde man ihnen diesen Gedanken nahebringen und sie daran gewöhnen können. Sie waren so unschuldig und verletzlich.
Gedankenvoll ging Dorothee ins Haus zurück. In »Vaters Zimmer« öffnete sie das Fenster, um zu lüften, stellte die Cognacflasche zu den anderen in den Schrank und trug das Glas und den Aschenbecher in die Küche. Sie nahm sich ein Tablett und räumte das Geschirr vom Kaffeetisch im Wintergarten zusammen, versorgte die Sahne und den Rest der Torte. Da sie ihr bestes Porzellan benutzt hatte – sehr alt und mit einem Dekor von Rosenblüten – wagte sie nicht, es in die Spülmaschine zu stecken, sondern ließ heißes Wasser ins Becken.
Daniel steckte seinen Kopf in die Küche. »Alles okay, Ma?« fragte er. Er war nicht so unbefangen, wie er tat.
»Wolfgang ist fort«, sagte sie.
»Ich weiß.« Daniel trat näher, nahm sich ein Küchentuch und begann abzutrocknen. »War er sehr böse?«
»Was denkst du?«
»Daß er keinen Spaß versteht.«
»Jetzt mach aber mal einen Punkt! Wenn das ein Spaß sein sollte …«
»Delia hat es gar nicht so gemeint, Ma.«
»Wie denn sonst? Wollte sie ihn etwa nicht beleidigen?«
»Bestimmt nicht«, behauptete er und polierte eifrig Tassen und Teller. »Es ist ihr einfach so rausgerutscht.«
»Ein so häßliches Wort? Ganz aus Versehen?«
»Ja, klar. Wir reden dauernd so, wenn wir untereinander sind. Die meisten Kinder, meine ich.«
Dorothee ließ die Hände sinken und sah ihn an. Er hielt ihrem Blick stand. Die gewöhnlich grünschimmernde Iris seiner leicht schrägstehenden Augen wirkte jetzt eher blau, jedoch war es ein Farbton, der weder ihrem noch dem von Delia glich. ›Wie wundervoll er doch ist!‹ schoß es ihr durch den Kopf, als sie in sein eifriges kleines Gesicht sah. Sie unterdrückte ein Lächeln, weil sie wußte, daß es pädagogisch falsch gewesen wäre, ihm das zu sagen.
Daniel spürte den Umschwung nicht sofort; er hielt es für nötig, seine Erklärung noch zu untermauern. »Wir sagen: ›Komm her, du Arschloch! ‹ Oder: ›Du baust wieder mal Scheiße!‹ oder auch: ›Fick dich ins Knie!‹ und denken uns gar nichts dabei.«
Dorothee war entsetzt. »Gebraucht ihr wirklich solche Ausdrücke?«
»Aber ja doch, Ma.« Einschränkend fügte er hinzu: »Natürlich nicht, wenn du dabei bist.
Dorothee war nahe daran ihn zu fragen, was dieses ominöse »Fick dich ins Knie« denn seiner Meinung nach zu bedeuten hätte. Seine Antwort hätte ihr wahrscheinlich Auskunft über den Stand seiner Aufklärung gegeben. Aber da das Thema ihr unangenehm war, sah sie zur Seite und wendete sich wieder ihrer Spülerei zu. »Also wißt ihr jedenfalls, daß solche Ausdrücke in meinen Ohren sehr häßlich klingen. Um so unverständlicher, daß Delia ein so schlimmes Wort ausgerechnet einem Gast an den Kopf geworfen hat.«
Daniel zuckte die Schultern. »Wahrscheinlich bloß, weil er sich so aufgeplustert hat.«
»Aufgeplustert? Er hat sich völlig normal benommen. Ihr könnt euch an seinen Umgangsformen ein Beispiel nehmen.«
»Ja, genauso hat er sich benommen! Genauso gut hätte er krähen können: ›Seht her, ich bin der Größte! Und ihr Kleinen da unten seid gar nichts. Es ist eine Gnade von mir, daß ich überhaupt das Wort an euch richte.‹«
»Jetzt spinnst du aber.«
»Nein, gar nicht. Genau so ist es mir vorgekommen, und Delia sicher auch.«
»Wolfgang ist wirklich ein besonderer Mann. Er ist ein Doktor und ein Professor. Wahrscheinlich hat euch das gestört. Aber eingebildet ist er wirklich ganz und gar nicht.«
»Uns ist es anders vorgekommen.«
»Du bist sehr geschickt, Daniel. Delia hat einen Freund von mir schwer beleidigt, und jetzt bringst du mich dazu, ihn zu verteidigen. So etwas nennt man den Spieß umdrehen.«
»Du hast mich gefragt, warum Delia so frech war, und ich versuche es dir zu erklären. Was soll jetzt daran falsch sein?«
»Jedenfalls, wenn er das nächste Mal kommt …«
Ihr Sohn ließ sie nicht aussprechen. »Kommt er denn noch mal?«
»Warum denn nicht?«
»Ich dachte, er hätte die Schnauze voll.« Als Dorothee ihm einen strafenden Blick zuwarf, verbesserte er sich sofort. »’tschuldigung, das war wieder so ein Ausdruck, ja, ich weiß. Ich dachte, daß er genug von uns hätte.«
»Im Moment, ja. Aber ich denke doch, er wird nicht nachtragend sein. Er ist sehr klug und sehr tolerant. Ihr könntet viel von ihm lernen.«
»Wir lernen schon genug in der Schule. Und von dir natürlich auch, Ma. Du kannst uns immer alles erklären. Wir brauchen keinen Doktor und Professor dazu.«
»Aber vielleicht brauche ich ihn.«
»Wozu?«
›Weil ich ihn liebe‹, hätte sie antworten sollen, sie wußte es, aber sie brachte es nicht über sich. Immer hatte sie, wenn auch heimlich, dem Sohn versichert, daß sie ihn mehr liebte als jeden anderen Menschen – mehr als den Vater, mehr auch als die Schwester.
Ihr verstorbener Mann hatte es geahnt, und er war eifersüchtig auf seinen kleinen Sohn gewesen, wenn er es auch nicht zugegeben hatte. Er wäre sich lächerlich dabei vorgekommen. Delia nahm es einfach hin, als eine gegebene Tatsache. Auch in ihren Augen war der Bruder ja der Größte. Also war es für sie nur natürlich, daß er der Mutter mehr bedeutete als sie.
Wie hätte Dorothee den Jungen jetzt einfach abservieren können mit der Erklärung, daß sie Wolfgang liebte?
»Es ist wichtig für eine alleinstehende Frau, einen guten Freund zu haben«, sagte sie statt dessen vorsichtig, »der sie ins Theater begleitet, in Konzerte und Ausstellungen.«
»Das kann er ja auch ruhig tun, wenn du Wert darauf legst.«
»Wie großzügig von dir.«
Er überhörte ihren liebevollen Spott. »Aber bei uns zuhause hat er nichts zu suchen.«
Dorothee wischte das Spülbecken aus; sie unterdrückte einen Seufzer. »Wie du willst.«
»Ja, ich will es so!« erklärte Daniel mit einer Entschiedenheit, die im Gegensatz zu seinem bisherigen diplomatischen Vorgehen stand.
Dazu wußte Dorothee nichts zu sagen. Schweigend begann sie, Teller und Tassen in den Schrank zu räumen. Sie erkannte, daß sie eine entscheidende Gelegenheit verpaßt hatte.
Für Daniel war das Thema noch nicht erledigt; er wollte seinen Sieg auskosten. »Wie er überhaupt aussieht! Ein alter Mann mit Locken.«
»Die sind Natur! Soll er sie etwa anklatschen?«
»Und was für Klamotten! Sahen aus, als hätte er sie aus der Mülltonne geholt.«
»Er kann sich sehr gut anziehen, wenn er will.«
Daniel lümmelte sich, das Küchentuch immer noch in der Hand, gegen die Anrichte. »Und warum wollte er heute nicht?«
»Weil es ein ganz inoffizieller Besuch war. Weil er es bequem haben wollte. Weil er keinen Wert auf Äußerlichkeiten legt. Weil er unsere Konsumgesellschaft verabscheut.«
Daniel grinste, »’ne Menge Entschuldigungen für ’ne schlecht sitzende Hose, wie?«
Eine Sekunde lang war sie wütend auf ihn, so wütend, daß sie ihm am liebsten eine Ohrfeige verpaßt hätte. Doch diese Regung schwand so schnell, wie sie gekommen war. Sie mußte selber lächeln. »Was für ein schlauer kleiner Teufel du doch bist!«
Dorothee war als die Mittlere von drei Geschwistern aufgewachsen. Carola, Dorothee und Evelyn hatten ihre Rivalitäten mit Wortgefechten, aber manchmal auch mit Handgreiflichkeiten ausgetragen. Die Eltern hatten sich sehr bemüht, objektiv zu sein. Doch Dorothee hatte oft das Gefühl gehabt, am wenigsten geliebt zu werden. Der Vater schien Carola, seine Älteste, vorzuziehen, die Mutter die Jüngste, Evelyn. Bis heute war sie sich nicht ganz im klaren, ob diese Zurücksetzung Wirklichkeit gewesen war, oder ob sie sie sich nur eingebildet hatte.
Als Erwachsene jedenfalls war sie es, die sich mit der Mutter am besten verstand. Carola war Ärztin geworden und fühlte sich der Familie, aus der sie kam, entschieden überlegen. Evelyn hatte eine gute Position als Einkäuferin einer Warenhauskette. Aber sie irritierte ihrer Mutter durch den ständigen Wechsel ihrer Liebschaften, die sie nicht vor ihr verbergen konnte – oder das auch gar nicht wollte.
Elisabeth Kettner war eine sehr bürgerliche Frau und hatte mit ihrem Mann, einem Postbeamten im gehobenen Dienst, eine ruhige bürgerliche Ehe geführt. Ein solches Leben erwartete sie auch von ihren Töchtern. Ihr Mann war kurz vor der Silbernen Hochzeit gestorben und hatte sie mit einer schönen Pension zurückgelassen. Die Töchter hatten gefürchtet, daß sie nun, von einem Tag auf den anderen auf sich selbst gestellt, zusammenbrechen könnte. Aber das genaue Gegenteil war eingetreten. Elisabeth hatte sich erstaunlich rasch an die neue Freiheit gewöhnt und sie zu Auslandsreisen und zu einem verstärkten Engagement in verschiedenen Vereinen und Frauengruppen genutzt.
Dorothees Heirat mit dem Verleger Johannes Schubert hatte sie immer als einen Glücksfall angesehen und, weit davon entfernt, eine böse Schwiegermutter zu sein, hatte sie sich mit dem Mann ihrer Tochter ausgezeichnet verstanden. Johannes Schubert hatte sie sehr geschätzt.
Nach seinem Tod waren sich die beiden Frauen noch näher gekommen. Dorothee dachte bisweilen, daß einige ihrer Probleme gelöst wären, wenn die Mutter zu ihr in das Haus am Herzogpark ziehen würde. Aber Elisabeth liebte ihre Selbständigkeit zu sehr, um sich zur Betreuung der Enkel einspannen zu lassen. Andererseits hätte sie, sobald sie im Haus wohnte, die Zügel sehr rasch an sich gerissen. Wie es die Art vieler älterer Frauen war wollte sie, daß alles nach ihrem Kopf gehen sollte. Aber das mochte Dorothee sich und den Kindern nicht antun. So blieb ihr nichts anderes übrig, als sich um ihre Familie wie ihren Beruf gleichermaßen zu kümmern.
Dorothee hatte als junges Mädchen Philologie, Psychologie und Kunstgeschichte studiert, ohne noch ein festes Berufsziel vor Augen zu haben. In den Semesterferien hatte sie beim »Johannes Schubert Verlag« gejobbt, bis ihr diese Arbeit endlich wichtiger geworden war als die Universität. Ihre Bewunderung für den Chef, der damals schon geschieden gewesen war, hatte sich mit der Zeit erst in Zuneigung, dann in Liebe gewandelt. Johannes Schubert, von seiner Frau betrogen und verlassen, zwanzig Jahre älter als Dorothee, hatte sie erst zu seiner rechten Hand und dann zu seiner Frau gemacht.
Sie hatte sich sehr um ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern bemüht, Marion und Thomas, die der gleichen Generation angehörten wie sie selber. Eine Weile schien ihr das auch zu gelingen. Als Freundin, Geliebte und Mitarbeiterin des Vaters wurde sie durchaus akzeptiert, wenn auch nicht ganz vollkommen. Doch gegen eine Heirat hatten die erwachsenen Kinder sich mit aller Kraft gestemmt, und als ihr Vater sich nicht beirren ließ, hatten sie absolut feindlich reagiert.
Der Grund dieser Ablehnung war wohl weniger persönlicher Natur gewesen, sondern hatte in der Befürchtung gelegen, daß diese Heirat ihr Erbe schmälern würde. Das traf dann auch zu. Nach dem Tod von Johannes Schubert war Dorothee Haupterbin geworden, die Kinder hatten sich mit jeweils einem Viertel des halben Vermögens begnügen müssen, wobei Dorothee das Erbe ihrer Kinder bis zur Volljährigkeit verwaltete.
Thomas und Marion hatten sich mit dem Testament ihres Vaters nicht abfinden wollen, und fast wäre es zu einem Erbstreit vor Gericht gekommen. Das hatte Dorothee nur verhindern können, indem sie den Geschwistern ihr Erbe bar auszahlte.
Damit war die Kapitaldecke des Verlages fast unerträglich strapaziert worden. Johannes Schubert hatte noch kurz vor seinem Tod einige Manuskripte erworben, von denen er sich viel versprach. Jetzt hätte Dorothee einen erheblichen Kredit aufnehmen müssen, um die Bücher mit der nötigen Werbung so herauszubringen, daß sie Erfolge wurden.
Doch das hätte, auch bei der sorgfältigen Planung, genauso gut schiefgehen können. Dorothee war keine Spielerin; sie hatte nicht den Mut, ein solches Wagnis einzugehen.
Mit Einverständnis der Autoren gab sie die Rechte an den Manuskripten an einen bedeutenden, finanzstarken Verleger weiter. Die Bücher wurden, bis auf eines, zu Bestsellern. Dorothee bemühte sich indessen, den »Johannes Schubert Verlag« in den schwarzen Zahlen zu halten. Das gelang ihr.
Zweifellos hätte sie noch jahrelang so weiterkrebsen können, aber es war ein hartes Brot. Als der Konzern »International Books & Pictures« Interesse an ihrem Unternehmen zeigte, entschloß sie sich, den Verlag zu verkaufen. Sie machte einen beachtlichen Gewinn dabei, der »Johannes Schubert Verlag« bleib nominell erhalten, und für sie selbst schaute dabei ein langjähriger Vertrag als Verlagsleiterin heraus.
Die Bitterkeit blieb, daß die den Verlag nicht hatte halten können und in ihren Entscheidungen nicht mehr frei war. Trotzdem war es in ihrer Situation als alleinerziehende Mutter junger Kinder das Beste, was sie hatte erreichen können; sie war in ihrem Beruf nicht mehr völlig eingespannt, konnte sich die Arbeit einteilen, wie sie wollte, und eine gewaltige Verantwortung war von ihren Schultern genommen.
Der »Johannes Schubert Verlag« hatte seine Büros am Frankfurter Ring und war in einer guten halben Stunde vom Herzogpark aus zu Fuß zu erreichen. Aber nur selten nahm sich Dorothee dazu die Zeit. Hin und wieder benutzte sie die U-Bahn von der Station »Dietlindenstraße« aus, dann hatte sie zuvor einen Gang quer durch den Englischen Garten gemacht, aber meistens nahm sie ihr Auto. Sie bemühte sich, mittags zuhause zu sein, wenn die Kinder aus der Schule kamen, aber wichtig nahm sie das nicht. Das gemeinsame Mittagessen hatte sie seit langem gestrichen, weil sie festgestellt hatte, daß weder Daniel noch Delia Wert darauf legten. Sie nahmen sich lieber rasch, auf was sie gerade Lust hatten, ein Butterbrot oder ein Müsli, Früchtejoghurt oder Obst. Nachdem Daniel auf das »Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium« gekommen war, traf er ohnehin immer sehr viel später ein als die Schwester, die noch die Grundschule an der Gebelestraße besuchte. Erst am frühen Abend gab es dann eine warme Mahlzeit, zu der sich die Familie im kleinen Speisezimmer vereinte. Darauf legte Dorothee großen Wert, nicht einmal so sehr aus Gründen der Ernährung, sondern wegen der Gelegenheit, sich miteinander auszusprechen.
Dorothee unternahm viel mit ihren Kindern. Um es erst gar nicht zu einer Fernsehsucht kommen zu lassen, besuchte sie mit ihnen fast jeden jugendfreien Film. Aber sie führte sie auch in Museen, in den Zoo, in Kunstausstellungen und, wenn das Programm nicht allzu anstrengend war, auch in Konzerte. So versuchte sie ihnen früh, klassische Konzerte nahezubringen. Aber sie begleitete sie auch in die Pop- und Rockkonzerte, obwohl das Gedränge und Geschrei ihr zuweilen Angst und Bange machte.
»Warum tust du dir das an?« pflegte ihre Mutter kopfschüttelnd zu fragen. »Es würde doch genügen, wenn du sie hinbringst und wieder abholst.«
Elisabeth verstand nicht, daß es Dorothee wichtig war, das Erlebnis mit ihren Kindern zu teilen.
»Du machst dir etwas vor«, mahnte Elisabeth, »die jungen Leute erleben das doch ganz anders als du.«
Das mußte Dorothee zugeben. Aber es hielt sie nicht davon ab, Daniel und Delia zu solchen Veranstaltungen zu begleiten. Die Kinder störten sich nicht daran, denn sie war durchaus nicht die einzige Erwachsene, die sich mit ihrem Nachwuchs in den Trubel stürzte. Oft nahm Dorothee noch Freundinnen und Freunde ihrer Kinder aus der Nachbarschaft mit.
Wolfgang äußerte sich nicht dazu. Wenn sie ihn um Rat fragen wollte, auch das kam vor, oder vor hatte, ihm eine von Daniels Heldentaten zu erzählen, schnitt er ihr sofort das Wort ab. »Deine Kinder sind für mich kein Thema.«
»Du bist ein Egoist«, gab sie verärgert zurück.
»Immer gewesen.«
Sie verstand, was er damit sagen wollte. Sie hatte sich in ihn verliebt, so wie er war, ein Junggeselle, der sich das Leben ganz nach dem eigenen Kopf eingerichtet hatte. Er war durchaus zur Liebe fähig, nicht aber zur Aufopferung, und würde sich wohl kaum ändern. Mit ihm Schluß zu machen, hatte sie nicht die Kraft. Dazu bestand ja auch keine Notwendigkeit. Aber daß sie zu ihm nicht einmal über ihre Kinder reden konnte, blieb ein Dorn in ihrem Herzen, der sich immer tiefer und tiefer bohrte.
Natürlich forderte das Leben, das sie führte, auch seinen Tribut. Für die Kinder bedeutete es, daß sie früh im Haushalt mithelfen mußten, um Dorothee die nötige Freiheit zu verschaffen. Noch taten sie es ohne Widerrede, weil sie von klein auf daran gewöhnt waren.
Da Dorothee die Arbeit im Verlag auf keinen Fall vernachlässigen wollte und die wenigen Morgenstunden nicht genügten, war sie regelmäßig gezwungen, Manuskripte und Korrekturbögen mit nach Hause zu nehmen und sich, sobald die Kinder zu Bett gegangen waren, noch einmal ans Werk zu machen. So kam sie an ganz gewöhnlichen Tagen selten vor Mitternacht ins Bett und mußte doch spätestens morgens um sieben wieder aufstehen.
Aber das war nun einmal ihr Leben, und es kam ihr ganz selbstverständlich vor; jedenfalls war es ausgefüllt bis zum Rand.
An einem der folgenden Abende besuchte Dorothee in Begleitung von Professor Dr. Wolfgang Ortlieb eine jener halboffiziellen Parties, bei denen sie ihr Erscheinen als Pflicht ansah. Natürlich nutzte sie auch die Gelegenheit, sich zu amüsieren, wichtiger war es ihr jedoch, gesehen zu werden. Es kam darauf an, daß ihr Name in der nächsten Nummer der »Abendzeitung« genannt wurde, mögliehst





























