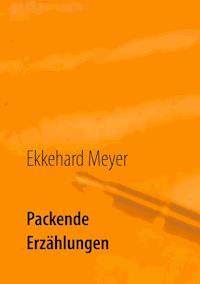Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ekkehard Meyer kann als reifer Mann aus einem Fundus von Erlebnissen und Beobachtungen schöpfen. Beim Lesen kann der sinnliche Rausch einer Nacht und die Tragik des verschmähten Freiers erlebt werden. Es entstehen Sympathien für das kauzige Verhalten des liebenswerten Chaoten, wie für die fordernde Tochter und den unbeugsamen Aussteiger. Er beschreibt Entspannung vor dem Kamin und macht neugierig auf die Metamorphosen seiner Protagonisten bis hin zum Ende des Weges. Seine Geschichten geben Leser und Leserin die Gelegenheit zu einen Blick hinter die Fassaden und sparen nicht mit Überraschungen. Die Lektüre führt zum Schmunzeln und Nachdenken, in jedem Fall berührt sie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Ekkehard Meyer wuchs mit Bruder und Schwester im Nachkriegsberlin auf. Als Schüler begeisterte er sich für den Zusammenschluss Europas und hatte die Gelegenheit in Gastfamilien in Frankreich und England zu leben. Er gründete zusammen mit Freunden die EAG, eine Arbeitsgemeinschaft, die eine Vereinigung Europas unterstützte, und für die er Manifeste und Liedertexte verfasste. Der Autor studierte Wirtschaftswissenschaften und Maschinenbau und erlebte intensiv die 1968-er Protestbewegung der Studenten.
Die berufliche Tätigkeit führte ihn in mehrere Städte des süddeutschen Raums. Er gestaltete für Industriebetriebe die ausländischen Vertriebswege und hatte dabei die Gelegenheit die Lebensweise und Mentalität anderer Kulturen schätzen zu lernen.
Als der Broterwerb nicht mehr im Mittelpunkt stand, widmete er sich der Literatur und wurde Mitglied der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe. Einige seiner Kommentare und seine Bücher: Der Europäische Schatten, Der geliehene Partner, Wirtschaft ohne Moral, Die Frau, das Mann, Packende Erzählungen, wurden veröffentlicht. Ekkehard Meyer ist Vater von zwei erwachsenen Söhnen. Ihm wurden vier muntere Enkelkinder beschert.
Kurzfassung
Ekkehard Meyer kann als reifer Mann aus einem Fundus von Erlebnissen und Beobachtungen schöpfen. Er lässt beim Lesen den sinnlichen Rausch einer Nacht und die Tragik des verschmähten Freiers erleben. Es entstehen Sympathien für das kauzige Verhalten des liebenswerten Chaoten, für die fordernde Tochter und den unbeugsamen Aussteiger. Er beschreibt Entspannung vor dem Kamin und macht neugierig auf die Metamorphosen seiner Protagonisten bis hin zum Ende des Weges.
Seine Geschichten geben Leser und Leserin die Gelegenheit zu einem Blick hinter die Fassaden und sparen nicht mit Überraschungen. Die Lektüre führt zum Schmunzeln und Nachdenken, in jedem Fall berührt sie.
Inhaltsverzeichnis
Der Autor
Kurzfassung
Ein liebenswerter Chaot
Der verführte Student
Die Panne in Salerno
Der Rausch einer Nacht
Die Freundin meines Sohnes
Der offene Kamin
Die Geburtstagsfeier
Meine ältere Partnerin
Der unbeugsame Aussteiger
Der verschmähte Freier
Das verzögerte Eheversprechen
Der rasende Weihnachtsmann
Meine Skatrunde
Die fordernde Tochter
Die ältere Schwester
Am Ende des Weges
01.Ein liebenswerter Chaot
Für die Dachgeschosswohnung meines Hauses suchte ich einen Mieter und hatte einige der Interessenten zu einer Wohnungsbesichtigung eingeladen. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum war groß, daher gab es zahlreiche Bewerber. Ich beobachtete einen etwa dreißig Jahre alten Mann, der auf unser Haus zukam, mit dem Gang aus der Hüfte heraus, wie der Cowboy John Wayne, bei der Jagd auf Indianer. Er klingelte und als ich öffnete, hatte er ein Strahlen im Gesicht: »Hallo, ich bin der Sebastian«, als müsste jeder diesen Sebastian kennen. Er war zehn Zentimeter zu klein, um eine stattliche Erscheinung zu sein, war braun gebrannt, sah gut aus und verfügte über eine ansteckende Fröhlichkeit: »Hier soll heute die Schlacht um eine Wohnung stattfinden. Ich bin einer von den Kämpfern und zwar der unwürdigste Bewerber, der gerne lange schläft, nur arbeitet wenn er muss, seinen Hobbys nachgeht und nicht gerne putzt.«
Mich überraschte sein freimütiges Geständnis, und ich empfand sofort Sympathie für diesen Schöngeist. Ich führte Sebastian ins Haus, stellte die Standardfragen und zeigte ihm das Mietobjekt. Er lief interessiert durch die Wohnung, schaute in alle Ecken, wie ein Kammerjäger bei der Suche nach Ungeziefer, befühlte das Bett und öffnete das Dachflächenfenster: »Der Rahmen ist hier in der Ecke verrottet, das sollten Sie so nicht lassen, ich werde das ausbessern, habe einmal in einer Schreinerei gearbeitet.«
Er zeigte gleich Fürsorge für das Objekt, und so entstand der Eindruck, ich hätte ihm die Wohnung schon zugesagt. Es kam ihn nicht in den Sinn, dass nicht er, sondern ein Anderer, die Zusage erhalten könnte. Sebastian legte ein Bandmaß auf den Boden und murmelte: »Das müsste ausreichen.« Schließlich wurde die Wand beklopft und gefragt: »Hält die Gipswand den Haken für meine Hängematte aus?« Ich wusste die Antwort nicht, und sie schien ihn auch nicht zu interessieren, er führte mehr ein Selbstgespräch. An der Stelle, wo vorher das Bett stand, war der Teppich deutlich heller, und ich erklärte mich bereit den Teppich zu erneuern. Sebastian schmunzelte: »Das soll so bleiben, wenn ich in meiner Hängematte liege, erinnert es mich an den Zusammenfluss des lehmigen Amazonas mit dem schwarzen Rio Negro, die Wassermassen fließen über Kilometer getrennt, ohne sich zu vermischen.«
Ich war neugierig auf diesen liebenswerten Weltenbummler und fasste den Entschluss diesem Bewerber die Wohnung zu geben. »Können sie mir beim Tragen meiner Werkbank behilflich sein? Sie ist noch im Auto«, kam er ohne Umschweife zur Sache. Die Werkbank fand ihren Platz im Wohnzimmer, dazu gesellte sich noch eine Platte, auf der Ringschlüssel Zangen und Schraubendreher aufgereiht waren. Eine ausgefallene, romantische Zierde für den Wohnbereich, dachte ich.
Im Laufe der nächsten Wochen pflegten wir einen regen Meinungsaustausch und Sebastian stellte meiner Frau und mir seine Freundin Angie vor. Sie studierte Medizin, war bildhübsch, etwa zwanzig Jahre jung, hatte zwei gutaussehende Schwestern und vergötterte unseren Mieter. Gelegentlich versammelte er den gesamten Harem um sich. An einem Abend, wir saßen am Tisch beim Abendessen, gesellte sich Sebastian zu uns: »Hier riecht es gut«, bemerkte er, ging in die Küche, schaute in den Topf, »das reicht für mehrere«, setze sich an den Tisch und blickte mich erwartungsvoll an. Ich füllte dem unerwarteten Gast einen Teller.
»Ich werde für euch meine berühmten Kiftas zubereiten. Es wäre schön, wenn eure Söhne auch dazu kämen.«
Wir vereinbarten für Samstag um achtzehn Uhr ein Festessen in unserem Garten, Sebastian wollte für unsere Familie kochen. Meine beiden Söhne, meine Frau Sophia und ich saßen mit Hunger und großen Erwartungen am Tisch und warteten. Als der Koch kurz vor dem vereinbarten Termin immer noch nicht im Hause war, machte ich mir Gedanken darüber, welche Alternative ich meiner Familie bieten könnte. Kurz nach achtzehn Uhr hörten wir wie die Haustür geöffnet wurde, der Gastgeber kam eilig mit zwei Tüten unter dem Arm und dem Griff des Einkaufsnetzes zwischen den Zähnen auf uns zu: »Es dauert noch einen kleinen Moment, probiert inzwischen diesen trocknen Sherry«, erklärte er, nachdem das Netz abgestellt war. Mit einladender Geste wurde die Flasche auf den Tisch gestellt und der Koch zog sich in seine Küche zurück. Es dauerte nicht lange, da rief er nach mir: »Du, Erich kannst du mir helfen, es ist wieder spät geworden«, er knete den Teig für seine Fleischbällchen und benutzte exotisch riechende Gewürze, »reiche mir bitte vier Eier.«
»Wo finde ich die Eier?«, rief ich.
»Im Wäscheschrank, oberste Schublade, der Kühlschrank ist voll mit Getränken.«
Ich ging ins Schlafzimmer, suchte mir mit Mühe einen Weg über Schuhe, Hosen, Kartons und den Plattenspieler am Boden, zu der obersten Schublade. Dort befand sich tatsächlich ein Eierkarton: »Da sind nur zwei Eier drin!«
»Verflixt, kannst du mir zwei Eier leihen?«
»Ist kein Problem«, antwortete ich und lief in unsere Küche.
»Kannst du dich um die Kartoffeln kümmern? Du findest den Kartoffelschäler an der Werkzeugwand im Wohnzimmer.«
Ich schälte die Kartoffeln, gab etwas Salz in das Wasser und setzte sie auf.
»Du musst Kartoffeln und Fenchel gleichzeitig aufsetzen, beide brauchen knapp zwanzig Minuten«, belehrte mich Sebastian, »danach suche bitte zwei Flaschen Rotwein aus, wähle den ältesten Barolo, den du finden kannst, serviere ihn unten und nimm den Calvados als Verdauungsschnaps gleich mit.«
Als ich mich wieder an den Tisch setzte, hatte ich das Gefühl, die Vorbereitungen sind nun auf einem guten Weg, auch wenn der vereinbarte Termin nie haltbar war. Der Wein war zwanzig Jahre alt und war von hervorragendem Geschmack, genau wie das Essen. Wir plauderten in fröhlicher Runde und als Nachtisch wurde Eis serviert, das mit Eierlikör und Schokoladensplittern garniert war. Als wir beim Calvados-Trinken waren, fragte Sebastian: »Sophia, wann warst du besonders glücklich?«
Mir erschien diese Frage etwas indiskret. Meine Frau überlegte einen Augenblick und verriet in Erinnerungen schwelgend: »Die erste Auslandsreise mit Erich führte mich nach Italien. Wir fuhren in einem VW-Käfer und schliefen im Zelt. An die Landschaft und die lauen Nächte erinnere ich mich besonders gerne.«
»Ich werde deine glückliche Zeit an den Himmel zaubern, du musst nächste Woche um die gleiche Zeit zum Himmel schauen«, versprach unser Gastgeber mit einem geheimnisumwitterten Lächeln.
Sebastian arbeitete in einem großen, nahe gelegenen Institut, das sich mit der Erforschung von Plastikverbindungen und Sprengstoffen beschäftigte. Seine Firma zeigte zwei Mal im Jahr ein beeindruckendes Feuerwerk. Die erste Detonation war oft so heftig, dass die Alarmanlagen von den umliegenden Wohnhäusern ausgelöst wurden. In diesem Jahr gab es eine Überraschung: Eine Rakete schoss einen Sprengsatz in die Luft, der bei seiner Explosion eine Palme und ein Hauszelt am Himmel zeigte, ein zweiter Sprengsatz zauberte, bei einiger Phantasie, die Umrisse eines VW-Käfers auf die Wolken. Sebastian hatte sein nebulöses Versprechen eingelöst.
Der Wonnemonat Mai bescherte uns warmes Wetter und ich richtete mein Motorboot für die beginnende Bootsaison her. Dabei entdeckte ich, dass die Kühlwasserpumpe defekt war. Das Boot war über dreißig Jahre alt, und es war schwierig dafür noch Ersatzteile zu bekommen. Über das Internet fand ich einen Lieferanten, der diese Pumpe für achthundert Euro anbot. Das Ersatzteil war nicht größer als ein Aschbecher, und ich fand den verlangten Preis unverschämt hoch und fluchte vor mich hin: »Diese gierigen Raubritter sollte man bei Wasser und Brot einsperren! Mit mir nicht, dann schnitze ich mir lieber eine Pumpe…«, in diesem Moment gesellte sich Sebastian dazu:
»Ja, ja, man hält die Bootbesitzer für reiche Leute, die man melken kann. Gib mir deine defekte Pumpe, vielleicht kann ich eine Lösung finden.«
Am nächsten Tag brachte er die alte Pumpe und einen Nachbau zurück: »Ich habe dir eine Pumpe geschnitzt.« Dies tüchtige Kerlchen hatte das Gehäuse aus dem Vollen gefräst und die alten Anschlüsse angeschweißt, die Pumpe arbeitete einwandfrei.
»Was bin ich schuldig?«, fragte ich begeistert.
»Ach, lass mal, du hast mir auch geholfen. Ich hab das in der Mittagspause erledigt und das Material stammt aus dem Abfall. Es sind keine Kosten entstanden.«
Zu meiner Überraschung stand einige Wochen später ein Trailer mit einem zweiten Motorboot vor unserem Haus. Sebastian gestand, dass er bei dem angebotenen Preis nicht widerstehen konnte und das Boot gekauft hatte, ohne es zu testen, wie die Katze im Sack. Das Objekt war in gutem Zustand, nur der Motor war defekt, und ein Tausch-Motor war sehr teuer. Bei unserer Untersuchung stellten wir fest, dass der Zylinderkopf einen Riss hatte. Wir konnten einen gebrauchten Zylinderkopf beschaffen, bauten ihn gemeinsam ein, und der Motor lief wieder.
Nun sollte ein Praxistest auf dem Rhein erfolgen, der die Funktionsfähigkeit bewies und die Frage beantworten sollte, welches Boot das Schnellere war. Sebastian hatte zu dieser Fahrt seinen Harem eingeladen, die drei schlanken, jungen Geschwister im Alter von sechzehn, achtzehn und zwanzig Jahren. Mein Boot war mit mir und meinen beiden Söhnen besetzt, wir waren nur schlank, wenn wir den Bauch einzogen. Leider minderte diese Aktion nicht unser Gewicht. Auf das Händeklatschen der Jüngsten hin starteten beide Boote rheinaufwärts mit Vollgas. Sebastian nahm die Bugwelle eines entgegen kommenden Lastenkahns ungeschickt und fiel zurück. Obwohl wir alles Gewicht nach vorne legten und uns hinter die Windschutzscheibe duckten, holte das andere Boot auf und hätte überholen können. Der Kapitän drosselte seinen frisch reparierten Motor und überließ es dem älteren Herrn als Erster in den Hafen einzufahren, als Sieger ohne Sieg.
In den Sommerferien unternahm Sebastian mit Angie eine Reise nach Südafrika und Namibia. Er schickte uns eine Ansichtskarte in der er begeistert über die Landschaft, die Tierwelt und die Freizügigkeit berichtete. Nach einiger Zeit wurde für unseren Mieter ein besonders langes Paket zugestellt. Er öffnete es und präsentierte uns den Inhalt voller Stolz. Es war ein verwittertes Holzbrett, mit dem in deutscher Sprache von Hand aufgetragenen, eingebrannten Hinweis: Achtung Flugverkehr. Es stand einst in Namibia an einer Straße, über der gelegentlich Flugzeuge einschwebten und wurde von Sebastian weggefunden.
»Was willst du mit diesem Riesenteil anfangen?«, forschte ich nach. Seine Sammlung in der kleinen Wohnung hatte schon ein bedrohliches Ausmaß angenommen.
»Ich weiß es noch nicht, ich fand es originell und es hat mir gefallen«, kam die typische Antwort von unserem liebenswerten Chaoten.
An einem Sonntag wurde ich morgens durch heftiges Klingeln geweckt. Vor der Tür standen zwei grimmig dreinblickende Polizisten, die dringend Sebastian sprechen wollten. Als ich seinen Schuh und Socken im Vorgarten entdeckte, kam mir ein Verdacht: »Ich weiß nicht, ob er zu Hause ist, er fährt am Wochenende oft zu seinen Eltern, ich werde nachsehen.«
»Ich werde sie begleiten«, sagte der eine Polizist entschlossen, der Andere eilte ums Haus und bewachte den Gartenausgang.
Wir fanden den Gesuchten in tiefem Schlaf versunken im Bett. Dieser Schlaf erinnerte mich an den des Wolfes in dem Märchen von den sieben Geißlein. Einige Kleidungsstücke hatte er anbehalten, andere lagen weit verstreut herum. Der Beamte weckte ihn unsanft und forderte ihn auf zum Protokoll mit auf die Wache zu kommen.
Der arme Sebastian schien der Welt entrückt zu sein, die Spuren eines kräftigen Rausches waren unverkennbar. Auf der Wache wurde der Restalkohol mit eins Komma vier gemessen und die Fahrerlaubnis einbehalten. Der fröhliche Zecher war mit seinem Auto, vom Betriebsfest kommend, in der letzten Kurve an der Leitplanke hängen geblieben, hatte den fahruntüchtigen Wagen stehen lassen und war zu Fuß nach Hause gelaufen, ohne sich an Details erinnern zu können.
Die Fahrerlaubnis erhielt er erst nach bestandenem »Idiotentest« und neun Monaten Wartezeit zurück. In dieser Zeit war der Sünder oft auf Geschäftsreisen und Angie durfte sein Auto fahren.
Sebastian haderte oft mit der Obrigkeit und beklagte die übertriebene Regulierung in Deutschland, die seiner Kreativität und seinem Freiheitsdrang die Flügel stutzen würde. An dem Tag, an dem er seinen Einkommenssteuerbescheid erhielt, rastete er vollends aus. Bei den Stellen, wo er keine Angaben gemacht hatte, nahm das Finanzamt eine steuerzahlerunfreundliche Schätzung vor: »Diesen Sklavenaufsehern und Raubrittern der Neuzeit sollte man Einhalt gebieten und sie daran hindern, weiterhin diesen Unsinn auszuhecken!«
Am nächsten Morgen führte mich mein Weg zufällig am Finanzamt vorbei. Dort versperrte ein gelbes Band den Eingang. Einige Ziegelsteine waren vor dem Zugang geschichtet und eine große Tafel informierte: Wegen dringender Reparaturarbeiten bleibt das Finanzamt heute geschlossen. Ich sah ankommende Finanzbeamte, die den Kopf schütteln und fröhlich lächelnd umkehrten. Erst als der Abteilungsleiter aufkreuzte, flog der Schwindel auf. Ich hatte mich gewundert, dass Sebastian gestern Nacht Ziegel eingeladen hatte, lautlos, wie ein anschleichender Dieb. Jetzt kam mir ein Verdacht.
Mit den Nachbarn verstand sich Sebastian gut. Er half ihnen gelegentlich beim Ausladen oder beriet sie bei der Urlaubsplanung, denn er hatte viele Länder der Erde bereist. An einem Abend saß er verzweifelt auf der Eingangstreppe, er hatte den Hausschlüssel vergessen, sich ausgesperrt, und wir waren verreist. Der Schlüsseldienst verlangte für das Öffnen der Türe Hundert Euro. Unser Chaot überlegte, ob es nicht billiger wäre das Kellerfenster einzuschlagen und dort einzusteigen. Der Nachbar hatte den Ausgesperrten beobachtet und ahnte welcher Kummer ihn bedrücken könnte. Ein Grinsen im Gesicht und den Ersatzschlüssel schwenkend, den wir bei ihm hinterlegt hatten, ging er auf Sebastian zu, wie ein Dompteur, der die Peitsche schwingt. Der alte Mann schloss ihm die Tür auf und konnte sich die Bemerkung nicht verkneifen: »In der Stunde der Not helfe ich der vergesslichen Jugend gerne.«
Nur mit dem meist schlecht gelaunten Herrn Staubmüller hatte Sebastian Spannungen, wie andere Anwohner auch. Dieser nörgelnde Nachbar hatte auch die Funktion eines Hausmeisters für die gemeinsam benutzte Tiefgarage übernommen. Er stellte überall Verbotsschilder auf, vertrieb spielende Kinder und brandmarkte Raucher, die ihre Kippen wegwarfen. Unser Mieter erregte den Zorn des Beflissenen, weil er es wagte, sein Fahrrad am Gitter für die Tiefgarage anzuschließen, obwohl er nicht Eigentümer eines Garagenplatzes war. Als an einem Morgen beide Ventile von seinem Rad fehlten, hatte Sebastian sofort einen Verdacht.
Für Heiterkeitsausbrüche und Schadensfreude bei den anderen Nachbarn sorgte das Fahrrad von Herrn Staubmüller, das eines Tages am höchsten Baum der Siedlung, zehn Meter über der Straße müde im Wind drehte. Jeder fragte sich, wie konnte der Täter ein komplettes Fahrrad auf diese Höhe befördern, und wie könnte der Besitzer es wieder herunterholen? Die Wäscheleine, die der Täter benutzt hatte, kam mir vertraut vor. Ich hatte eine treffliche Vorstellung vom Täter und bewunderte sein Werk.
Viel zu schnell neigte sich die gemeinsame Zeit mit dem liebenswerten Chaoten dem Ende zu. Er erhielt ein verlockendes Angebot aus Malaysia und gab die Wohnung in unserm Haus auf. Angie wollte ihr Studium hier abschließen, fürchtete sich vor dem Klima in Malaysia und der Trennung von ihren geliebten Schwestern. Sie wollte nicht mitgehen. Das nahm Sebastian mit bemerkenswerter Gelassenheit hin. Ich hatte den Eindruck, dass Beziehungen, die auf eine feste Bindung hinausliefen, ihm Angst bereiteten. Er wollte seine Ungebundenheit nicht aufgeben. Das Angebot aus Malaysia schien zu einem passenden Zeitpunkt gekommen zu sein.
Das Holzbrett aus Namibia, das mit viel Aufwand nach Deutschland gelangt war, ließ er uns als Andenken zurück. Es erhielt einen Ehrenplatz im Garten, den Sebastian-Gedächtnis-Platz. Das Schild provozierte neugierige und besorgte Fragen unserer Nachbarn: »Müssen wir uns hier auf Drohnen oder gar Flugverkehr einstellen?«
02.Der verführte Student
Noch bis zwölf Uhr war die Hauptkasse geöffnet, und heute war der letzte Tag zur Entrichtung der Studiengebühren. Ich musste mich beeilen. Nach Bezahlung der Gebühr blieben mir noch drei Euro für ein Mensaessen. Am Nachmittag nahm ich den Job des Kassierers einer Tankstelle wahr, der mir wenig Freude machte, aber einen Beitrag zu meinem Lebensunterhalt leistete. Beim Eintippen von Zahlen und Geldwechseln durften keine Fehler entstehen, die Endabrechnung musste auf den Cent genau stimmen, wie es früher bei der doppelten Buchhaltung verlangt wurde. Es gehörte zu meinen Aufgaben die Regale aufzufüllen, das war eine Belastung für den Rücken und konnte nicht als anspruchsvolle Tätigkeit betrachtet werden. Der einzige Lichtblick war die Übergabe der Kasse an Katarina, eine gutaussehende, junge Frau, die stets gut gelaunt war und gerne mit mir schäkerte. Sie übernahm mit ihrem asiatischen Lächeln die ruhige Spätschicht.
Katarina erschien auch heute wieder pünktlich um achtzehn Uhr: »Na, wie viele falsche Fünfziger hast du mir heute in die Kasse geschmuggelt?«
»Ich wünschte dein Konterfei wäre auf einem Schein zu finden, leider müsste er dann zu den Fälschungen gezählt werden«, spöttelte ich.
»Ich habe dir ein paar Pflaumen aus dem Garten mitgebracht, damit du dich nicht nur von Ölsardinen ernähren musst.«
»Danke, ich mag Pflaumen sehr. Lass dir die Tankstelleneinnahmen nicht von Räubern abnehmen! Ciao!«, sagte ich und wollte gehen. In diesem Augenblick fuhr ein knall roter Ferrari auf die Tankstelle, dem eine aufgedonnerte Frau mit Sonnenbrille entstieg. Die männlichen Tankkunden warfen ihr und dem flachen Flitzer bewundernde Blicke zu. Sie lief mit wippendem Gang zu einem Regal, kam dann auf mich zu, musterte mich von oben bis unten und fragte: »Gibt es hier keinen Champagner?«
»Wir führen verschiedene Sektsorten, Champagner haben wir leider nicht im Sortiment«, informierte ich sie.
Über die Sonnenbrille hinweg sah sie mir in die Augen: »Wo kann ich Champagner kaufen? Ich benötige dringend ein Geburtstagsgeschenk.«
»Ich kaufe dieses Getränk nie, aber ich denke, bei Edeka könnten sie fündig werden.«
»Mein Orientierungssinn ist miserabel. Könnten sie mich dorthin begleiten?«, schlug sie unumwunden vor, als sei sie gewohnt, dass ihre Einladungen angenommen werden.
»Gerne, mein Dienst ist ohnehin beendet, und ich bin noch nie in einem Ferrari gefahren«, gestand ich.
Die junge Frau hatte Schwierigkeiten mit ihren hochhackigen Schuhen in den Sportwagen zu steigen: »Der Ferrari ist zwar schnell, aber nicht sonderlich bequem«, bekannte sie und fuhr mit quietschenden Reifen von der Tankstelle. Der Start presste mich in den Sitz, und ich musste den Kopf recken um herausblicken zu können.
»Bitte fahren sie an der nächsten Kreuzung links und die zweite Straße rechts, dann können sie die Edeka-Filiale schon sehen.«
Sie parkte mit Schwung ein und bat mich mitzukommen. Vor der Kasse überließ ihr ein älterer Herr den Vortritt und bedachte sie mit einem bewundernden Lächeln. Ich folgte ihr, wie ein Schatten, der sich nicht abschütteln ließ. Die Lady hatte zwei Flaschen des französischen Edelgetränks gekauft und überreichte mir eine davon: »Damit du das kennenlernst, was du nie kaufst. Ich heiße Chantal.«
»Ich bin Robert, Jurastudent im zweiten Semester« antwortete ich und reichte ihr die Hand.
An der Uni duzten wir uns alle, bei ihr hatte mich das schnelle Umschwenken überrascht und verunsichert. Ich hielt es für unsinnig vierzig Euro für eine Flasche Champagner auszugeben und überlegte, ob ich sie später heimlich umtauschen sollte. Es schmeichelte mir, dass eine schöne, fremde Frau mir ein so teures Geschenk machte, aber es beunruhigte mich zugleich. Ich schätzte ihr Alter auf dreißig Jahre, sie hatte eine schlanke, wohlgeformte Figur, lange, dunkle Haare, einen großen Mund und besonders ausdrucksstarke Augen. Durch ihre Garderobe und ihr Auftreten kam ich zu der Überzeugung, dass sie dem Geldadel angehörte und sicherlich viel attraktivere Männer, als mich, bekommen konnte. Warum interessierte sie sich ausgerechnet für mich?
»Hast du heute schon etwas vor?«, fragte sie leise, als wir den Wagen wieder erreicht hatten.
»Abendessen zubereiten und mich auf die Klausur vorbereiten.«
»Und was gibt es heute zum Abendessen?«
»Ölsardinen mit Pflaumen«, antwortete ich wahrheitsgemäß. Diese Beschreibung meiner Mahlzeit kam mir albern vor, schon als ich es aussprach.
Sie lachte laut: »Eine wahrhaft exotische Mischung! Da weiß ich etwas Besseres. Begleite mich auf eine Geburtstagsfeier, da wartet ein exquisites Buffet auf dich, und mir wäre es recht, wenn ich dort nicht alleine hin gehen müsste.«
Vor die Wahl gestellt zwischen Partybesuch und Klausurvorbereitung fehlte mir die Kraft das Angebot dieser hübschen Verführerin abzulehnen. Erneut fragte ich mich, warum wählt sie keinen Partner aus ihren Kreisen, was findet diese Starfrau an einem Jüngling, der nur in der Lage ist ihr Ölsardinen anzubieten?
Wir rasten mit röhrendem Auspuff nach Baden-Baden. Während der Fahrt schärfte sie mir ein, ich sei Bildhauer und wir hätten uns auf einer Vernissage kennengelernt: »Lass dich nicht in ein Fachgespräch verwickeln, höre nur zu. Die meisten Gäste interessieren sich ohnehin nicht für andere sondern hören sich selbst gern reden.«
Wir parkten vor einer luxuriösen Villa oberhalb der Stadt. Die dort abgestellten Edelkarossen, teilweise mit Chauffeur, machten einen überwältigenden Eindruck auf mich und verstärkten mein Gefühl der Unsicherheit. Chantal stellte mich dem Gastgeber und einigen Freunden vor und wurde bald von anderen Gästen vereinnahmt. Ich kam mir hilflos vor in meinen speckigen Jeans und dem bedruckten T-Shirt zwischen all den Menschen in exquisiter Garderobe, wahrscheinlich hatte sie mich deshalb auch als Bildhauer eingeführt. Mir fiel das Märchen vom Froschkönig und der Prinzessin ein, die ihn nur benutzte, um ihre goldene Kugel zu bekommen.
Um Gesprächen auszuweichen, schlenderte ich zum Buffet, das mit einer beeindruckenden Fülle der erlesensten Spezialitäten bestückt war, die meine Ölsardinen leicht ersetzen konnten. Ich füllte mehrfach meinen Teller und suchte Gerichte aus, die ich mir sonst nicht leisten konnte: Filet Chateaubriand, Kaviar, Avocados…Als der Herr neben mir erfuhr, dass ich der vermeintliche Bildhauer sei, berichtete er mir ausführlich von seiner wertvollen Sammlung von Bildern und Skulpturen. Wie Chantal es prophezeit hatte, interessierte er sich nicht für meine Meinung sondern wollte mit seinen Schätzen prahlen.
Plötzlich tauchte meine geheimnisumwitterte Prinzessin wieder auf, erlöste mich von dem Prahler und lockte mich auf die Tanzfläche. Sie drückte sich an mich, als seien wir seit Jahren liiert. Ich spürte ihr Knie zwischen meinen Schenkeln, ihre schwingende Hüfte, die wohlgeformten Brüste und schlürfte ihren champagnergeschwängerten Atem: »Du bist ein toller Tänzer! Ich bin heilfroh, dass du mitgekommen bist, und ich mich bei dir entspannen kann«, flüsterte sie mir ins Ohr.
»Ich fühle mich auf diesem Nobelfest in meiner Kleidung deplatziert.«
»Du gibst als Bildhauer eine überzeugende Figur ab, aber an deinem Outfit sollten wir morgen arbeiten.«
Ich fragte mich, was gemeint war: Am Outfit arbeiten, will sie damit andeuten, dass bei mir Schwerstarbeit erforderlich ist, um mich einigermaßen ansehnlich zu machen? »Ich verfüge über einen dunklen Anzug und ein weißes Hemd, hätte es nur holen müssen«, protestierte ich.
»Ich kann mir vorstellen, wie das aussieht! Lass uns morgen einen Bummel machen, vielleicht finden wir etwas Passendes.«
»Morgen Vormittag habe ich Vorlesung bei Professor Schwenn zum Thema: Vertragswesen.«
Meine Gönnerin war sich offensichtlich sicher, dass ich die Vorlesung sausen lasse und ihr zu dem Bummel folgen werde: »Das trifft sich ausgezeichnet, du kannst die Theorie des Vertragswesens durch die Praxis mit Einkaufsverträgen ergänzen. Ich würde jetzt gerne heimgehen. Kommst du noch auf einen Schlummertrunk mit zu mir?«
Diese Circe hatte mich so stimuliert, dass ich alle Vorlesungen der Welt vergas und mich nur nach ihrem göttlichen Körper sehnte. Ich hatte nicht die Kraft dieses Angebot abzulehnen und war neugierig auf ihre Geldadel-Wohnung. Sie parkte den Ferrari in einer Tiefgarage. Wir nahmen den Fahrstuhl, fuhren in das oberste Stockwerk und befanden uns beim Aussteigen mitten in ihrer Penthouse-Wohnung. Chantal warf die Schlüssel auf das Regal, schleuderte ihre Schuhe ab, hängte ihr Jäckchen an einen Ständer und rief: »Mathilde, ich bin zurück! Bringe uns bitte zwei Gin-Tonic!«