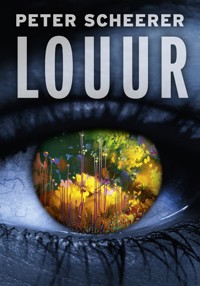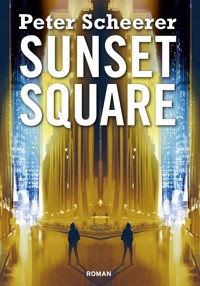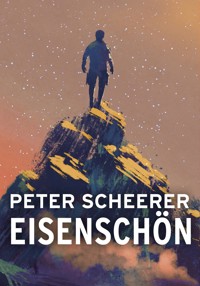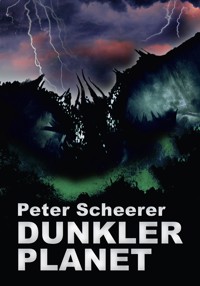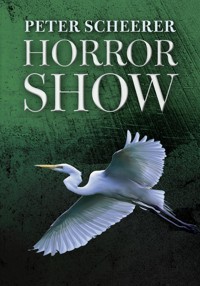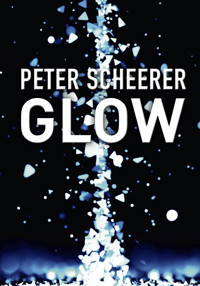
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Lorraine Andersson ist jung, reich und schön. Sie könnte ein perfektes Leben haben, doch seit ihre Eltern überraschend an der SLS-Krankheit, dem mysteriösen „Glow“, verstorben sind, widmet sie sich der Suche nach Ungereimtheiten in der Darstellung durch Politik und Medien. Als „Lady in Blue“ betreibt sie einen anonymen Podcast, in dem sie die Menschen zum Hinschauen und Nachdenken bewegen will. Ihre Begegnung mit der faszinierenden Becca und dem zwielichten Polizisten Kenzie löst schließlich eine Kette von Ereignissen aus, die sie mehr als einmal in große Gefahr bringen – und ständig neue Fragen aufwerfen: Stammt der „Glow“ aus dem Weltraum? Zu welchem Zweck unterhält der schwerreiche Finanzmakler Jonas Thanhauser eine private Söldnerarmee? Und welches Geheimnis verbirgt sich hinter den Mauern des obskuren Humanity Progress Centers, das von einem mächtigen Pharmakonzern finanziert wird?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Peter Scheerer
Glow
Ein futuristischer Thriller, der mit schillernden Figuren und energiegeladener Action ebenso souverän aufwartet wie mit geschliffenen Dialogen, dichter Atmosphäre sowie einer Prise sarkastischen Humors.Inhaltsverzeichnis
KAPITEL 1: LADY IN BLUE
KAPITEL 2: OPTIONEN
KAPITEL 4: MUSTANG SALLY
KAPITEL 5: BECCA
KAPITEL 6: ZWISCHEN KIESHALDEN
KAPITEL 7: KENZIE
KAPITEL 8: FRÜHSCHICHT
Es war mitten in der Nacht, als Becca sie mit vorsichtigen Stupsern in den Rücken aufweckte.
»Hey, Raine – schläfst du? Bitte wach auf, ich muss dir was sagen!«
KAPITEL 9: GESCHENK
KAPITEL 10: FOUR ROSES
KAPITEL 11: MAGICAL
KAPITEL 12: WIEDERSEHEN
KAPITEL 13: FLÜSSIGER AZURIT
KAPITEL 14: AUF SENDUNG
KAPITEL 15: BRIEFING
KAPITEL 16: TROYA
KAPITEL 17: ÜBERFALL
KAPITEL 18: ÜBERGABE
KAPITEL 19: GLOW
KAPITEL 20: SANKT JAKOB
KAPITEL 21: SYMPTOME
KAPITEL 22: KRITISCHES STADIUM
KAPITEL 23: DAS LAZARETT
KAPITEL 24: FLUCHT
KAPITEL 25: HINTER DEM HÜGEL
KAPITEL 26: EINE WOCHE
KAPITEL 27: NUR EINE IDEE
KAPITEL 28: NACH DEM STURM (IST VOR DEM STURM)
KAPITEL 29: ALIAS
KAPITEL 30: DEUS EX MACHINA
KAPITEL 31: VERHÖR
KAPITEL 32: VATER
KAPITEL 33: DAS VERTRACKTE LORRAINE-ANDERSSON-SYSTEM
KAPITEL 34: ERSTES ZIMMER LINKS
KAPITEL 35: ANT
KAPITEL 36: KEINE SCHAFE
KAPITEL 37: KAFFEE MIT KENZIE
KAPITEL 38: DATE MIT CASTOR
KAPITEL 39: CLOUDVIEW
KAPITEL 40: SKYLARK
KAPITEL 41: NACH UNTEN
KAPITEL 42: ARTEFAKT
KAPITEL 43: SCHULD
KAPITEL 44: AUFS DACH!
KAPITEL 45: DIE VIOLINE
KAPITEL 46: UNENDLICHE WEITEN
KAPITEL 47: BREAKING NEWS
KAPITEL 48: WIEDER ZUHAUSE
KAPITEL 49: BLUE MONDAY
Impressum
GLOW
Roman
© Peter Scheerer 2023
Titelgrafik: frey-d-sign
Covermotiv: 123rf
Kleine StimmeDie Kurzgeschichte, aus der
irgendwann der Roman „Glow“ entstanden ist.
KAPITEL 1: LADY IN BLUE
Der Regen hatte am frühen Abend eingesetzt, nachdem schon den ganzen Tag dichte graue Wolken am Himmel gehangen hatten, und war später in beständiges Nieseln übergegangen. Raine öffnete eines der hohen Fenster an der Südseite ihrer Fünf-Zimmer-Mansardenwohnung und blickte auf die Straße hinab, die tief unter ihr in der Dunkelheit glänzte. Es war eine großzügig angelegte Straße nahe des alten Stadtzentrums, gesäumt von geschichtsträchtigen, Ehrfurcht einflößenden Gebäuden mit kantigen Erkern, steilen Dächern und grotesken Giebelfiguren. Nach dem Tod ihrer Eltern hatte sie den ganzen Block gekauft, dabei hätte sie das Herrenhaus im Süden der Stadt ganz für sich gehabt. Doch überall zwischen den hohen, holzgetäfelten Wänden hatten Erinnerungen gelauert, denen sie entfliehen wollte: ihre behütete Kindheit im Reichenghetto, die sterbenslangweiligen Sommerfeste, die Missverständnisse und angespannten Momente mit ihren Freunden und ihrer Familie.
Sie setzte sich auf das Fenstersims und zündete eine Zigarette an. Von draußen sprühten feine Tropfen auf ihr Gesicht, während in der Dämmerung des Zimmers die Stimme einer Nachrichtensprecherin die aktuellen Glow-Statistiken herunterbetete. Gefolgt von der üblichen Auflistung der Symptome: Schwäche, Benommenheit, Gleichgewichtsstörungen, vorübergehender Verlust der Orientierung und des Gedächtnisses. Und natürlich das Leuchten, das den anderen Symptomen vorausging und die Erkrankten kurzfristig in eine bläuliche Aura hüllte. Deshalb lautete die offizielle Bezeichnung Subakutes Lumineszenz-Syndrom, kurz SLS. Aber alle nannten es den Glow.
Zuletzt der obligatorische Aufruf, eine der spezialisierten Kliniken aufzusuchen, falls sich Symptome zeigten. Es werde jedoch dringend geraten, zur eigenen Sicherheit das Abklingen des Leuchtphänomens abzuwarten. Die weiteren Symptome würden frühestens nach einer halben Stunde einsetzen, in manchen Fällen bis zu sechs Stunden später.
Unten auf der Straße glitt wieder dieser plumpe, graue SUV vorbei, der Raine in letzter Zeit schon mehrmals aufgefallen war. Bei der Polizei fuhren sie solche monströsen Dinger, doch die anfänglichen Paranoia-Schübe hatten rasch nachgelassen – wäre man ihrem anonymen Blog auf die Spur gekommen, hätte sie längst wegen der Verbreitung subversiver Inhalte in Untersuchungshaft gesessen.
Raine schloss das Fenster, saugte noch einmal kräftig an ihrer Zigarette und drückte sie in dem Art Déco-Aschenbecher auf dem Couchtisch aus. Sie knipste den Nachrichtensender weg und ging nach nebenan in das kleine HiTec-Studio, das Ant für sie eingerichtet hatte. Ant leitete die technische Abteilung bei der Plattform Magical, für die sie gelegentlich über Mode, Lifestyle und Promi-Tratsch berichtete. Ihr war klar, dass auf Ant nicht zu hundert Prozent Verlass war; er hielt sich mit seinen kritischen Kommentaren zur Lage der Gesellschaft kaum zurück, und es lag wohl an seinem Image als weltfremder IT-Nerd, dass man es ihm als tagesformabhängige Nörgelei durchgehen ließ. Dennoch hatte es zu einem vorsichtigen Abtasten zwischen ihm und Raine geführt. Mit dem Resultat, dass die Lady in Blue auf verzwickten Umwegen über satellitengestützte Proxies ihre Sicht der Dinge im Web verbreiten konnte.
Raine ließ sich im Schneidersitz auf dem quadratischen Teppich mit dem Mandalamuster nieder – ein Erbstück ihres Vaters, auf dem er seine täglichen Meditationen durchgeführt hatte. Damals hatte sie ihn dafür belächelt, jetzt stellte der Teppich für sie eine unmittelbare Verbindung zu ihm her.
Sie prüfte den Voice Transformer, der sie wie eine ins Charakterfach übergewechselte Mickey Mouse klingen ließ. Akribisch konfigurierte Algorithmen veränderten den Sprachrhythmus und tauschten verräterische Phrasierungen gegen unverbindliche Wortkombinationen aus. Und ihr KI-gesteuerter Avatar, ein blauhäutiger Teenager im Robin-Hood-Look, folgte in Gesten und Mimik den emotionalen Parametern des jeweiligen Vortrags.
Sie ging im Kopf ein letztes Mal die Schwerpunkte ihrer Sendung durch, dann legte sie das Headset an und klickte die Aufnahmetaste.
»Hallo zusammen«, begann sie, »hier ist wieder eure Lady in Blue. Für alle, die mich noch nicht kennen: Ich halte Augen und Ohren offen, und ich sammle Eindrücke und Informationen, die ich mit dem vergleiche, was uns von Behörden und Medien aufgetischt wird. Ich will euch weder gegen irgendwas aufhetzen noch die Laune verderben. Aber ich weiß, dass sich viele von euch darüber Sorgen machen, was alles schief läuft seit dem Einschlag. Es besteht zwar kein Zweifel an der Existenz des Kristalls, den können wir in jeder sternenklaren Nacht über unsere Köpfe hinweg ziehen sehen. Aber dass dieses riesige Objekt aus der Tiefe des Alls zu uns gekommen ist, um so eine Art galaktischen Taubenschiss abzuwerfen, das passt irgendwie nicht zusammen, oder? Und dass die Ausbreitung des Glow ausgerechnet durch diesen Taubenschiss verursacht worden sein soll, ist reine Vermutung. Was die angeblichen Fakten betrifft, die man uns vorsetzt, so ergeben sie nicht annähernd ein stimmiges Bild. Vor allem in Bezug auf den Glow und seine Folgen.
Ich habe mit Leuten geredet, die den Glow hatten, und die meisten von ihnen haben von leichten Symptomen gesprochen. Die wären nicht einmal zum Arzt gegangen, wäre nicht dieses Leuchten aufgetreten. Und dann gibt es da noch die Todesfälle. Schwere Verläufe mit Organversagen, über die es keine exakten Zahlen gibt. Diese Leute verschwinden einfach von der Bildfläche, angeblich aus seuchenhygienischen Gründen. Das mag aus medizinischen Erwägungen durchaus berechtigt sein, aber ich frage mich: Warum liegt da nichts dazwischen? Wo bleiben die mittelschweren Verläufe, bei denen es die Leute für eine Weile aus den Socken haut, ehe sie sich wieder erholen?
Vielleicht bin ich naiv, wenn ich solche Fragen stelle. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Ungereimtheiten den Damen und Herren von der Wissenschaft komplett entgangen sind. Auch das hat mich zu einer Skeptikerin gemacht, und ich schwöre euch, dass es mir nicht leicht gefallen ist. Auch ich würde mich lieber darauf verlassen, was uns Politik, Forschung und Medien erzählen – wenn es nur ein stimmiges Bild ergäbe. Aber das tut es nicht.
Nein, ich will euch nicht aufwiegeln. Ich will nicht, dass ihr auf die Straße geht wie diese Narren, die Plakate schwingen, auf denen sie TOD DEN LEUCHTENDEN oder FICKT DIE REGIERUNG fordern. Alles, was ich will, ist, meine Gedanken mit euch teilen.
Das war’s für heute von eurer Lady in Blue. Vielleicht konnte ich wieder ein paar von euch zum Hinschauen und Nachdenken motivieren. Das würde mich freuen. Dann also bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und habt euch verdammt noch mal lieb!«
Raine stoppte die Aufnahme, dachte einen Moment lang nach und schickte die Datei in den digitalen Äther. Sie hatte schon fundiertere und ausführlichere Sendungen abgeliefert, doch hin und wieder hielt sie eine Zusammenfassung ihrer Argumente für angebracht.
Sie nahm das Headset ab, legte sich auf den Rücken und blickte auf das Foto, das mit Reißzwecken über ihr an der Schalldämmung befestigt war. Es zeigte ihre Eltern vor einem tiefblauen Meereshorizont, fröhlich lächelnd und Gläser mit apricotfarbigenen Aperitifs in die Kamera haltend. Raine hatte das Foto gemacht, auf einer Hotelterrasse in der Bucht von Capri. Sie war siebzehn gewesen, ein chronisch angepisstes Emo-Girl, und hatte sich nur mit viel Mühe zu der gemeinsamen Reise überreden lassen.
Raine verließ das Studio, schenkte sich an der Bar ein Glas Bourbon ein und zündete eine Zigarette an. Sie kehrte ans Fenster zurück und blickte noch lange in die verregnete Nacht hinaus.
KAPITEL 2: OPTIONEN
Für einen Moment hing Raine waagrecht in der Luft, ehe die Schwerkraft nach ihr griff und sie mit Vehemenz auf die Matte schleuderte. Der Aufprall erschütterte sie bis ins Mark. Ihr ganzer Körper fühlte sich taub an. Ganz bestimmt würde sie nie wieder atmen können.
Cassandra Cheng beugte sich mit einem frechen Grinsen über sie und streckte die Hand aus. Raine ließ sich von ihr auf die Beine helfen und blickte sie zerknirscht an.
»Ich werd’s wohl nie lernen, hm?«
Cassandra legte ihr eine Hand auf die Schulter, mit der anderen strich sie über ihre Wange. »Du bist gut, Raine«, sagte sie und blickte ihr tief in die Augen. »Viel besser, als du glaubst. Aber…«
»Ich war wütend«, sagte Raine. »Weil du mich provoziert hast.«
»Und genau das war dein Fehler.«
Sie nickte verständig. Cassandra hatte recht: Sie war gut, aber ihr Temperament stand ihr immer wieder im Weg. Dieser eine Satz – »Jetzt zeig mal, dass du mehr zu bieten hast als einen süßen Hintern« – hatte sie für einen Moment aus der Balance gebracht und eine unsinnige Attacke starten lassen. Vielleicht aus dem Grund, dass sie sich auf eine verdrehte Art lebendig fühlte, wenn sie Cassandras Schläge und Tritte einsteckte und ihren freundlichen Spott über sich ergehen ließ.
Aber diesen Kommentar hätte sie sich sparen sollen.
»Machen wir Schluss für heute«, sagte Cassandra. »Nimm ein heißes Bad, entspanne dich und meditiere über die Wut, die in dir steckt. Werde Herrin über deine Emotionen. Dann wirst du es mit jedem Gegner aufnehmen können.«
Sie wandte sich ab und verschwand in ihrem flatternden Keikogi hinter dem Paravent, der einen Teil des Trainingsraums als Umkleidekammer auswies. Cassandra war, bildlich gesprochen, ein weiteres Erbstück, das Raine von ihrem Vater geblieben war. Er hatte sich von Cassandra in Aikido unterrichten lassen – angeblich nur als Ausgleichssport, aber bei Henri Andersson wusste man nie. Vielleicht hatte er sich bedroht gefühlt, oder er wollte einfach nur sicher gehen, dass er im Falle eines Falles in der Lage war, seine Familie zu beschützen? Zum Beispiel, um allzu aufdringliche Verehrer seiner heranwachsenden Tochter in die Schranken zu weisen?
Raine ging raus in den Flur mit den großformatigen Kunstdrucken an den Wänden: Caspar David Friedrich, Arnold Böcklin, Franz von Stuck – sie hatte ein Semester Kunstgeschichte studiert, was sie beinahe ihrer Faszination für die alten Meister beraubt hätte. Ihre Beziehung zur Kunst war träumerisch, intuitiv und romantisch geprägt. Die wissenschaftliche Haarspalterei an der Akademie hatte sie nur kurz fasziniert, ehe sie sich davon abgestoßen gefühlt hatte. Es war ihr wie eine Vivisektion vorgekommen, die jeglichen Zauber auslöschte.
Sie schenkte sich an der langgestreckten Küchenzeile ein Glas isotonisches Wasser ein und trat ans Fenster. Bedeckter Himmel, kein Regen. Auch kein verdächtiger SUV unten auf der Straße. Nur Leute, die ihren Besorgungen nachgingen.
Raine hörte das diskrete Klicken des Türschlosses, als Cassandra die Wohnung verließ, und ging ins Badezimmer. Während das Wasser in die Wanne einlief, zog sie sich aus und betrachtete ihre frischen blauen Flecken im Spiegel. Einen Kampfsport zu erlernen war die eine Sache, sich an seinen eigenen Blessuren ergötzen, eine andere. War das einfach nur ihre Art, gegen ihr privilegiertes Dasein aufzubegehren?
Sie setzte sich vorsichtig in die Wanne. Die Knie an die Brust gezogen und die Arme fest darum geschlungen, ging sie, einer Art Ritual folgend, ihre Optionen für die Zukunft durch. Der Job bei Magical war keine davon, auch wenn ihr das Schreiben manchmal Spaß machte. Dabei hatte sie keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Als Spross der Andersson-Familie standen ihr viele Möglichkeiten offen. Doch die Ratschläge ihrer Finanzberater, ihr Vermögen in angeblich zukunftsträchtige Branchen zu investieren, waren nicht nach ihrem Geschmack. Wozu weiteres Vermögen ansammeln, wenn man mehr Geld hatte, als man in einem Leben ausgeben konnte?
Reichtum bedeutet auch Verantwortung, hatte Raine einmal gehört, und sie hatte Riesensummen für Naturschutz, Flüchtlingshilfen und kulturelle Projekte gespendet. Sie hatte bei einer Armenküche in der Nordstadt Erbsensuppe ausgeteilt und in den Parks zusammen mit anderen Freiwilligen Plastikflaschen, leere Chipstüten und benutzte Kondome aufgesammelt. Dabei war ihr klar geworden, dass ihr Engagement nicht so sehr von einer echten Überzeugung, denn von tief sitzenden Schuldgefühlen gesteuert wurde.
Als Kind hatte sie die soziale Stellung ihrer Familie nicht wahrgenommen. Der Reichtum war einfach dagewesen, und die anderen Kinder in ihrem Alter hatten einen ähnlichen gesellschaftlichen Hintergrund gehabt. Als Teenager hatte sie angefangen, sich wie ein Punk zu kleiden und sich auch so zu benehmen – und gleichzeitig mit Geld um sich zu werfen. Bis der Tod ihrer Eltern sie in eine Phase von totaler Sinnlosigkeit gestürzt hatte. Für eine Weile hatte sie alle Drogen eingeworfen, an die sie rangekommen war. Nach dem Aufstehen war ihr erster Weg der zur Hausbar gewesen, wenn nicht noch eine angebrochene Flasche hochpreisigen Alkohols neben dem Bett gestanden hatte. Der Kristall, der Einschlag, der Glow und die darauf erfolgten restriktiven Maßnahmen – all das war in eine weite, nebelverhangene Ferne gerückt.
Bis sie eines Tages beschlossen hatte, dass sie so nicht weitermachen wollte. Aber das Gefühl, dass ein großes, dunkles Loch in ihrem Leben klaffte, war geblieben.
KAPITEL 3: CASTOR
Raine stieg aus der Wanne, trocknete sich ab und verließ, das Handtuch um den Körper gewickelt, das Badezimmer. Auf dem Couchtisch summte ihr Telefon: ein Anruf von Ant. Sie legte ihn auf das Display über der Bar, auch wenn sie keine Bildverbindung erwartete. Ant war ein notorischer Geheimniskrämer, grobkörniges weißes Rauschen seine Signatur.
»Ant, was gibt’s?«
Zuerst ein Räuspern, dann Ants immer leicht gepresst wirkende, jugendliche Stimme.
»Bist du allein, Raine? Ich hab da was, das könnte vielleicht interessant für dich sein…«
»Du kannst reden, ich bin allein. Schieß einfach los, Ant.«
»Das wäre so ’ne Art Interview. Mit jemand, der ganz nah dran war, als es… äh, als es gekracht hat.«
»Habt ihr gesprochen?«
»Ja, auf einer Therapieparty, wo ich einmal im Monat hingehe. Diese Events zum Quatschen über alles, was einen bedrückt. Und du weißt ja, dass mich so einiges…«
»Ja, Ant, weiß ich. Hast du einen Namen für mich? E-Mail, oder…?«
»Wollte sie mir nicht geben. Aber sie ist heute Abend draußen im Seeblick. Du kannst an der Bar nach ihr fragen, sie nennt sich Becca.«
»Und du hältst sie für vertrauenswürdig? Oder will sie sich einfach nur interessant machen?«
»Kann ich mir nicht vorstellen. Sie war im Lager, Raine. Das hat ihr schwer zugesetzt, so kam das jedenfalls rüber. Sie will reden, das schwöre ich dir.«
Ausgerechnet das Seeblick, dachte Raine. Hatte das irgendwas zu bedeuten?
Sie blickte zum Fenster, hinter dem sich die Abenddämmerung in die Straßen hinabsenkte. Wolkenstreifen hoch über den Dächern, die Ränder von der untergehenden Sonne vergoldet.
»Ich mach das«, sagte sie. »Danke für den Tipp, Ant.«
»Alles klar. Aber pass auf dich auf, okay?«
Raine drückte die Verbindung weg, ging ins Schlafzimmer und stellte ein Outfit zusammen, das sie für den bevorstehenden Trip als angemessen empfand: eine uralte, abgewetzte Hose im vintage Jeans-Look mit ausgefransten Löchern an Knien und Oberschenkeln, ein knappes Shirt mit verblasstem holografischem Aufdruck, eine hüftlange Armeejacke sowie die martialischen Schnürstiefel, die sie kürzlich bei einem Händler in der Südstadt erstanden hatte.
Sie hatte sich aufs Sofa gesetzt, um die Stiefel zu binden, als von der Eingangstür ein sanftes Schnurren ertönte. CASTOR LEEDER, verriet das Display über der Bar. Die Pförtner ließen ihn ohne Voranmeldung rein, das hatte Raine irgendwann mal arrangiert.
Sie kannte Castor seit dem Kindergarten. Seither hatte er sich beharrlich geweigert, aus ihrem Leben zu verschwinden. Eigentlich ein netter Kerl, doch fand sie ihn lästig in seinem Bemühen, eine anständige junge Dame aus ihr zu machen. Dass er im Begriff war, bei Medicon, dem Pharma-Konzern seines Vaters, Karriere zu machen, sorgte für zusätzliche Entfremdung. Denn Medicon war nicht irgendein großer Konzern – dort arbeitete man an einem Gegenmittel für den Glow, was der Firma einen beinahe religiösen Status eingebracht hatte.
»Er soll reinkommen«, sagte sie.
Und Castor Leeder kam rein. Groß und schlank, das gewellte dunkle Haar mit Gel in Form gebracht. Eigentlich sah er nicht übel aus, musste sich Raine immer wieder eingestehen. Vor allem, wenn er wie heute einen dieser todschicken Dreiteiler mit Einstecktuch trug, dazu eine breite, silbergraue Krawatte.
»Sind wir verabredet?«, fragte sie kühl und band weiter ihre Stiefel zu.
Castor blieb an der Tür stehen und legte in einer verlegenen Geste die Hände ineinander. »Ich hatte in der Nähe zu tun«, sagte er. »Und wir haben uns schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen.«
»Sagen wir mal so: Du hattest zwischen zwei Terminen noch etwas Zeit zu verplempern und wolltest nicht allein in einem Bistro deine Nudelsuppe anstarren.«
Er trat vor und baute sich mitten im Zimmer auf, die Schultern gestreckt und einen angespannten Ausdruck auf seinem schmalen, blassen Gesicht.
»Ich bin besorgt um dich, Lorraine. Dass du mit mir nicht mehr viel anfangen kannst, seit mein Vater mich zu seinem Assistenten gemacht hat, verstehe ich ja. Das war noch nie deine Welt. Aber erst gestern habe ich mit Laura und Lily gesprochen…«
»Sag bloß, sie fühlen sich von ihrem Grufti-Maskottchen vernachlässigt«, fiel sie ihm ins Wort. »Mir kommen die Tränen.«
»Du tust ihnen unrecht«, widersprach Castor. »Sie mögen dich und würden gerne wieder einmal etwas mit dir unternehmen.«
Raine gab ein trockenes Lachen von sich. »Oh, ich liebe endloses Gequassel über nuttige Klamotten, die angesagtesten Clubs und die heißesten Neuzugänge auf dem Beischlafsektor…«
Er hob beschwörend die Hände, am kleinen Finger seiner linken Hand blitzte der Siegelring seiner Studentenverbindung auf.
»Stopp! Was steigerst du dich so hinein? Klar, du hast eine schwere Zeit durchgemacht, aber musst du deswegen jeden und alles mit Verachtung überziehen? Einschließlich deiner selbst, möchte ich anmerken.«
Manchmal gefiel ihr seine gestelzte Ausdrucksweise, doch jetzt war sie auf Krawall gebürstet. Sie stand vom Sofa auf und trat vor Castor hin, legte demonstrative Gleichgültigkeit in ihren Blick.
»Als nächstes rätst du mir wahrscheinlich, ich soll mir endlich einen festen Freund suchen und mich ordentlich flachlegen lassen?«
Castor lächelte versöhnlich, es wirkte gekünstelt.
»Du verstehst mich nicht, Lorraine. Ja, da war mal was zwischen uns, und wir waren betrunken…«
»Saumäßig betrunken«, korrigierte sie ihn. »Und wir hatten was geraucht.«
»Aber es ist nichts passiert, oder? Hör mir doch zu – ich will einfach nur, dass du in Sicherheit bist! Kapier das doch, bitte.«
Sie kniff die Augen zusammen. »In Sicherheit? Was meinst du damit?«
Er wich einen kleinen Schritt vor ihr zurück. »Ich habe kein Recht, dich zu kritisieren. Aber hast du schon mal daran gedacht, dass du dich mit dem Glow infizieren könntest? Und du trägst immer noch diese provozierenden Outfits! Ich möchte gar nicht wissen, in welchen Kreisen du dich herumtreibst. Ja, du machst dieses Kampfsporttraining, aber…«
»Ich habe eine Idee«, unterbrach sie ihn. »Du kommst einfach mal mit, wenn ich draußen unterwegs bin. Ich würde dich auch am Stück wieder zuhause abliefern. Was hältst du davon?«
Castor blinzelte irritiert, sie hatte ihn kalt erwischt.
»Ja, warum eigentlich nicht«, setzte er zögernd an. »Auch wenn ich mich wundere, dass du… äh, dass du…«
»Ich bin manchmal gemein zu dir«, fuhr Raine in freundschaftlichem Tonfall fort. »Das tut mir leid, Cas. Wir waren eine Zeitlang wie Bruder und Schwester, manchmal vergesse ich das.« Sie tätschelte burschikos seinen Arm. »Hey, ich breche jetzt auf! Kommst du mit? Aber bestimmt hast du schon etwas vor…«
»Ein Dinner mit dem Vorstand. Das kann ich unmöglich absagen.«
»Schon gut. Aber es bleibt dabei, okay? Melde dich einfach, wenn es für dich passt.«
Castor nickte entschlossen. »Ja, das werde ich. Wie schön, Lorraine! Dass wir endlich wieder etwas zusammen unternehmen.«
»Versprich dir nicht zu viel«, erwiderte sie sanft. »Du könntest dich schrecklich langweilen.«
»Langweilen? Mit dir?« Er lachte. »Da fällt mir ein – nächste Woche hält meine Cousine einen Vortrag im Medicon Arts Pavillon. Vielleicht möchtest du…?«
»Troya!?«, fuhr Raine auf. »Mit ihrem pseudo-philosophischen Bullshit zum Wohl der Menschheit? Das kann nicht dein Ernst sein, Cas.«
»Manche Leute halten sie für ein Genie«, sagte Castor. »Mit ihrer Firma geht es steil nach oben, vielleicht solltest du rechtzeitig investieren? Ja, ich weiß – Scope ist ein rotes Tuch für dich… aber es wäre eine gute Gelegenheit, dich wieder einmal in der Öffentlichkeit blicken zu lassen.«
Raine schnaubte wütend durch die Nase. »Damit sie danach über mich herziehen können? Nein danke, ich verzichte.«
»Man spricht über dich«, fuhr Castor fort. »Dass du depressiv und mental instabil wärst. Dass du trinkst, Drogen nimmst und dich in sexuelle Exzesse flüchtest. Sogar deine Vermögensverwalter sind mittlerweile beunruhigt.«
»Die sollen erst mal herausfinden, wie sich dreißig Millionen von meinem Erbe über Nacht in Luft auflösen konnten«, erwiderte sie harsch.
»Ich bin mir sicher, sie arbeiten Tag und Nacht daran…«
»Die reißen sich wegen mir doch keinen Fuß aus«, unterbrach sie ihn. »Außerdem ist genug für mich übrig geblieben, dass ich mir keine Sorgen machen muss.«
Castor runzelte die Stirn, ihr Standpunkt entsprach nicht seiner ökonomischen Philosophie.
»Dann bleibt es also dabei?«, hakte er vorsichtig nach. »Dass du nicht zu dem Vortrag mitkommen willst?«
»Glaubst du im Ernst, dass meine Anwesenheit auf Troyas Ego-Show etwas an meinem Lost-Girl-Image ändern würde?«
Castor machte eine beschwichtigende Geste. »Du müsstest für ein paar Stunden schauspielern. Ich weiß, dass du das kannst. Und das ganze dumme Gerede wäre vom Tisch.«
Raine starrte auf ihre Schuhe. »Weißt du, was ich am schlimmsten finde? Dass du es ehrlich meinst.«
»Weil es dir schwer fällt, meine Unterstützung anzunehmen?«
Sie zuckte mit den Achseln. »Ja, vielleicht.«
Castor atmete tief durch. »Mein Angebot steht, Lorraine. Ich bin vielleicht auf dem besten Weg, ein Corporate-Arschloch zu werden. Aber meine Freunde lasse ich nicht hängen. Vor allem nicht dich. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie sehr sie da draußen danach gieren, dass du unter Vormundschaft gestellt wirst?«
»Es ist nun mal eine Scheiß-Welt«, murmelte sie. »Und seit dem Glow wird es immer schlimmer.«
»Ich bin auch nicht glücklich darüber, wie es läuft«, sagte Castor. »Aber als Rebell kommst du nicht weit. Erst recht nicht in deiner Situation.«
Raine hob den Kopf und blickte ihn resigniert an. »Ich hab’s verstanden, Cas. Nur dass du’s weißt: Ich bin kein Rebell. Ich will einfach nur so leben, wie ich leben will. Und Troyas aufgeblasene Ideen passen da nun mal nicht dazu.«
KAPITEL 4: MUSTANG SALLY
Raine legte dezentes Makeup auf. Kajal und Lidschatten, sonst nichts. Vor einer Weile hatte sie sich mal geschminkt wie der Android aus diesem alten Film, Blade Runner oder so ähnlich. Was ihr vorübergehend den Spitznamen Waschbär eingebracht hatte.
Sie fuhr mit dem antiken Lift nach unten. Im Dritten stieg ein junges Paar zu. Teure Klamotten, eine Spur zu aufgetakelt. Wahrscheinlich auf dem Weg zu einem Event, bei dem man sich zu Tode langweilte, wenn das Gehirn noch nicht völlig ausgetrocknet war. Die beiden musterten Raine verstohlen. Wahrscheinlich wussten sie nicht, dass sie es mit ihrer Vermieterin zu tun hatten – um die Geschäfte kümmerte sich eine anonyme Hausverwaltung. Raine starrte zurück, bis sie den Blick senkten.
Das Paar stieg im Foyer aus, Raine fuhr zur Tiefgarage weiter. Sie holte den silberblauen 67er Mustang Convertible aus seiner Box. Das Schmuckstück stammte aus dem Besitz ihres Vaters, der es über Jahrzehnte gehätschelt und gepflegt hatte. Die Sechs-Liter-Maschine blubberte selbstbewusst unter der langen Motorhaube, als Raine zur Ausfahrt rollte. Jeden Sommer hatte ihr Vater „seine“ Sally – er hatte das Auto nach einer alten Soulnummer benannt – aus der Garage geholt und sie waren kreuz und quer durch die Gegend gefahren, meistens bis runter an die Küste. Sie waren in Fernfahrerkneipen und Straßencafés eingekehrt und hatten eine gute Zeit gehabt. Cas war das eine oder andere Mal mitgekommen, sie hätte ihn lieber nicht dabei gehabt. Doch die Familien waren eng befreundet gewesen. Da galt es, Kompromisse zu machen.
Olympia, Lorraines Mutter, war kein einziges Mal mitgefahren. Sie wolle die kostbare Vater/Tochter-Zeit nicht durch ihre Anwesenheit entweihen, hatte sie gesagt. Vielleicht war das wirklich so gemeint gewesen, doch Raine hatte geahnt, dass sie eifersüchtig gewesen war. Auf Mustang Sally und auf das, was Raine mit ihrem Vater teilte in den wenigen Stunden, die er für sie übrig hatte.
Der Feierabendverkehr war abgeflaut, die Abendsonne spiegelte sich auf den gläsernen Fassaden der City. Raine fuhr unter der Ringautobahn durch und gelangte in eines der Viertel, die sich bis zum Stadtrand nach Westen hinaus erstreckten. Fünf- bis sechsstöckige Wohnsilos wechselten mit Reihenhausblocks und Einfamilienhäusern, dazwischen vereinzelte Supermärkte, Tankstellen, Bürogebäude. Hier und dort spannten sich die stählernen Skelette von Hochbahntrassen über den Straßen.
Eine Plakatwand markierte den Beginn der Evakuierungszone. Ein Relikt aus der Zeit unmittelbar nach dem Einschlag. Die Grenzen der Zone waren in blindem Aktionismus mehr oder weniger willkürlich festgelegt worden. Mit dem Ergebnis, dass die meisten Bewohner der Region zu den hektisch eingerichteten Auffanglagern geflüchtet waren. Dabei gab es bis heute keine Erklärung für den Einschlag, jedenfalls nicht von offizieller Seite. Dafür um so mehr wilde Spekulationen, auch was seine angeblichen Auswirkungen betraf. Zum Beispiel, dass sich der Glow von der Einschlagstelle her ausgebreitet hatte. Raine glaubte nicht daran.
Kaum hatte sie die Plakatwand passiert, trat Raine aufs Gaspedal und ließ die dreihundert Pferdestärken von der Leine – ein elementares Hochgefühl, für das sie an die fünfhundert Bäume im Stadtgebiet hatte pflanzen lassen. Der Tacho kletterte auf einhundertzwanzig und darüber, hier draußen im Niemandsland gab es keine Verkehrskontrollen. Höchstens ein paar Überwachungsdrohnen, die nach dem Zufallsprinzip umherschwirrten und die Gegend auf Brände, verdächtige Zusammenrottungen und andere Unregelmäßigkeiten absuchten.
Die verlassenen Wohnsiedlungen links und rechts der Straße wurden nach und nach von der Dunkelheit verschluckt. Vereinzelte Inseln aus trübem, von Solaranlagen oder Generatoren erzeugtem Lichtschein verrieten, wo sich kleine Gemeinschaften in der Zone gehalten hatten. Es war nicht mehr verboten, sich dort aufzuhalten. Vielleicht war es inoffiziell sogar erwünscht und die Menschen, die im Niemandsland die Stellung hielten, dienten den Behörden und Wissenschaftlern als Versuchskaninchen.
Raine bog in Richtung Küste ab. Den Weg hätte sie auch ohne die immer noch intakten Hinweisschilder gefunden, denn hier war sie oft mit ihrem Vater unterwegs gewesen. Doch ihre Ausflüge in die Zone waren mehr als sentimentale Trips in eine glücklichere Vergangenheit. Sie mochte diese besondere Art von Einsamkeit, umgeben von leeren Straßen und unbewohnten Ortschaften, in denen die Geister ihrer ehemaligen Bewohner auf deren Rückkehr zu warten schienen.
Eine ausgebleichte Reklametafel am Straßenrand warb für das Seeblick: früher einmal ein klassisches Ausflugsrestaurant, wo sie mit ihrem Vater einige Male gegessen hatte. Sie erinnerte sich an paniertes Schnitzel mit Pommes und Ketchup, Erwachsenenportionen. Dazu Limonade und zum Finale eine Riesenportion gemischtes Eis – sowie das Gefühl, sich übergeben zu müssen. Nach der Evakuierung war es mit dem Seeblick den Bach runter gegangen, doch eine bunt zusammengewürfelte Clique von Überzeugungstätern war dabei, das Gebäude zu renovieren, und hatte bereits die Ausschankanlagen in Schuss gebracht: junge Leute aus der Stadt und ein paar Einheimische, die entweder aus dem Exil zurückgekehrt waren oder die angebliche Gefahrenzone erst gar nicht verlassen hatten.
Ein verschwommenes, helles Objekt zog Raines Aufmerksamkeit auf sich. Der Kristall auf seiner Umlaufbahn, irgendwo auf halber Strecke zum Mond. Hinterließ auf Messgeräten rätselhafte Ausschläge, aus denen niemand schlau wurde. Der Versuch, ein Forscherteam raufzuschicken, war grandios gescheitert – das Raumschiff war an der flimmernden Aura des gigantischen Objekts sanft abgeprallt und hatte den Rückzug antreten müssen. Eines Tages würde der Kristall bestimmt wieder in den Tiefen des Weltraums verschwinden. Und einen Berg unbeantworteter Fragen hinterlassen.
Beinahe hätte sie die Abbiegung verpasst. Raine riss das Steuer herum und ließ den Wagen temperamentvoll nach links schleudern. Und dann die kerzengerade Allee entlang, den Kopf zum offenen Seitenfenster hin geneigt und lauwarmen Nachtwind in den Haaren.
Über dem hügeligen Horizont, hinter dem sich das Meer verbarg, bildete sich ein Teppich aus bläulichem Schimmern. Raine ging vom Gas, blinzelte, dachte nach. Sie hatte von seltsamen Vorgängen hier draußen gehört, hatte sie jedoch als Legenden abgetan. Doch das, was sich nun vor ihren Augen abspielte, war eindeutig real. Der blaue Schein kroch über die Hügel und Felder, verfing sich in den Alleebäumen neben der Straße und hüllte schließlich den Mustang ein. Raine fuhr noch langsamer, als zuerst das Armaturenbrett, dann das Lenkrad und schließlich ihre Hände von dem Lichtphänomen erfasst wurden.
Sie hielt an, stellte den Motor ab. Eine Windbö brachte die Bäume zum Rascheln, ließ blaue Irrlichter funkeln wie Diademe.
Raine bekam Herzklopfen. Ein Schauer kroch über ihren Rücken und sie begann zu frösteln. Zögernd wandte sie den Kopf und blickte zurück, um nach einer Lichtquelle Ausschau zu halten. Nach einem möglichen Zufluchtsort, an dem Menschen versammelt waren. Menschen, die hier draußen lebten und wussten, was man von so einer Erscheinung zu halten hatte. Aber die letzten Orte, durch die sie gefahren war, lagen hinter einem Hügel verborgen, der nun ebenfalls von dem Schimmern überzogen wurde.
Im Osten war der Mond aufgegangen. Raine, mitsamt dem Mustang in bläuliches Glühen getaucht wie die Weihnachtsdekoration vor einer Gebrauchtwagenhandlung, versuchte, zwischen dem Phänomen und dem Mondlicht eine Plausibilität herzustellen. Dabei war ihr bewusst, dass beides nichts miteinander zu tun hatte.
Wie lange dauerte dieses Spektakel nun bereits? Ein paar Minuten, eine halbe Stunde? Sie hatte das Zeitgefühl verloren, was sie stärker beunruhigte als der Spuk selbst. Und ihr war kalt, scheißkalt. Die Kälte fühlte sich an wie nasse Lumpen auf der Haut.
Kurz entschlossen ließ sie den Motor an und startete mit durchdrehenden Reifen. Zuerst dachte sie daran, zu wenden und in die City zurückzukehren. Doch dieses Jetzt-erst-recht-Gefühl, das ihr an einem sonnig-warmen Frühlingstag in die Wiege gelegt worden war, erwies sich als stärker.
Im Kassettenspieler steckte immer noch Sing to God von den Cardiacs. Das hatte ihr Vater auf ihren gemeinsamen Ausflügen oft gespielt und sie hatte sich auf dem Beifahrersitz wie ein Derwisch aufgeführt. Raine schob die Kassette rein, drehte das Volume auf und ließ die Cardiacs in voller Lautstärke auf die vorbeihuschende Umgebung los.
Während sie den Mustang, den bleichen Lichtkegeln der Scheinwerfer folgend, über die Landstraße hetzte, verlor das gespenstische Leuchten an Kraft und die Landschaft sank in nächtliche, von schüchternem Mondlicht übergossene Unscheinbarkeit zurück. Raine beschloss, jegliche Gedanken über das Phänomen auf später zu verschieben.
Zwischen den Alleebäumen auf der rechten Straßenseite bewegte sich etwas. Ein Tier? Raine ging erneut vom Gas, bremste behutsam ab. Ein schattenhaftes Etwas löste sich aus dem Gebüsch und sprang, nur wenige dutzend Meter vor ihr, auf die Straße.
Das Tier war etwa so groß wie ein Pony, hatte jedoch den Körperbau eines Windhunds. Aus seinem schmalen, langgestreckten Kopf sprießte ein kleines Geweih und sein Schwanz war lang und dünn wie der eines Leguans. Außerdem hatte es kein Fell, seine Haut war von undefinierbarer Färbung und schien das Scheinwerferlicht zu absorbieren.
Der Mustang kam mit einem Ruck zum Stehen. Raine drehte die Musik leise und beobachtete gespannt das seltsame Wesen, das nun witternd die Schnauze in die Luft streckte und den Kopf langsam in ihre Richtung wandte.
»Zwei Dinge«, murmelte sie, die Hände ums Lenkrad gekrampft. »Friss mich nicht, und mach keinen Kratzer in mein Auto.«
Weitere Kreaturen glitten aus dem Gebüsch hervor und versammelten sich auf der Straße. Es mussten mindestens acht sein, vielleicht auch zehn oder elf. Raine kniff die Augen zusammen. War da gerade wirklich eines der Biester durch den Stamm einer hundert Jahre alten Pappel gelaufen?
Die gespenstischen Tiere tänzelten umeinander herum. Fast so, wie richtige Hunde das machten. Immerhin beschnüffelten sie sich nicht gegenseitig am Hintern. Doch wie lange wollte diese Meute noch die Straße blockieren? Oder konnte man einfach durch sie hindurch fahren, so wie sie anscheinend durch einen meterdicken Baumstamm spazieren konnten?
Sie drückte auf die Hupe. Die Kreaturen schreckten auf und starrten aus kleinen, schwarzen Knopfaugen zum Mustang herüber.
Jetzt nur nicht die Nerven verlieren.
Im nächsten Moment warfen sich die Geschöpfe in einer synchronen, geschmeidigen Bewegung herum und verschwanden mit eleganten Sprüngen zwischen den Bäumen auf der anderen Straßenseite.
KAPITEL 5: BECCA
Das Seeblick lag auf einer Anhöhe, nicht weiter als zwei Kilometer von der Küste entfernt. Die Aussichtsterrasse wurde von Lampions und Lichterketten aus der Nacht geschält. Auf dem kiesbestreuten Parkplatz waren etwa zwei dutzend Autos und motorisierte Zweiräder abgestellt, vom einfachen Roller bis hin zur gepimpten Motocross-Maschine.
Raine würgte den Mustang ab und starrte zum Eingang hinüber. Sie war sich nicht sicher, was sie zehn Minuten vorher gesehen hatte. Mit den harten Drogen hatte sie schon lange aufgehört. Also ein Flashback, oder doch eine reale Erfahrung?
Sie stieg die Sandsteinstufen zur Terrasse hinauf und sah sich um. Das zumeist junge Publikum, auf die kuscheligen Rattan-Sitzgruppen verteilt, wirkte durch die Bank harmlos. Auch das Personal unterschied sich nicht von dem einer durchschnittlichen Kneipe in der City.
Die Theke war ein Stück in den Innenraum zurückgesetzt, in dem noch Malerleitern, Farbkübel und andere Renovierungsutensilien herumstanden. Raine lehnte sich an die Theke und ein hübscher junger Kerl mit Fusselbart und angehender Rastamähne wurde auf sie aufmerksam.
»Hi, ich bin Flo«, sagte er mit einem gewinnenden, jedoch unaufdringlichen Lächeln. »Zum ersten Mal hier?«,
Sie schüttelte den Kopf. »Ich kenne den Platz. Von früher, vor dem Einschlag.«
»Da musst du noch ziemlich jung gewesen sein«, erwiderte der junge Mann. »Wäre toll, wenn du öfter bei uns vorbeischau’n würdest. Im Moment hat nur die Terrasse offen, der Innenbereich ist noch nicht fertig.«
»Also ist hier draußen alles in Ordnung soweit?«
»Fragst du aus einem bestimmten Grund?«
»Vorhin ist mir was Verrücktes passiert«, sagte Raine. »Ich bin in einen blauen Nebel reingeraten, der kam wohl vom Meer herauf. Und dann waren auf einmal so merkwürdige Viecher auf der Straße. Wie große Hunde, aber mit Geweih.«
Flo neigte abwägend den Kopf. »Ja, hier draußen passieren seltsame Dinge. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich komme aus der Stadt und bin noch nicht lange dabei.«
Raine zuckte mit den Schultern. »Schon gut, ich bin nur neugierig. Bringst du mir einen großen braunen Kaffee und ein Glas Wasser? Ohne Kohlensäure, wenn’s geht.«
Flo nickte dienstfertig. »Alles klar, kommt sofort.«
»Und noch etwas«, fuhr Raine fort. »Ich soll hier jemanden treffen. Sie nennt sich Becca.«
»Becca? Ja, die ist heute da.« Flo deutete auf eine Gruppe junger, unauffällig gekleideter Leute, die eine Sitzgruppe am Ende der Terrasse besetzt hatten. »Wenn du möchtest, sag ich ihr Bescheid.«
»Ja, bitte sei so lieb.«
Sie stellte fest, dass nun ihre Knie zitterten, und setzte sich auf einen der Barhocker. Aus dem Augenwinkel beobachtete sie eine schlanke, dunkle Gestalt, die sich von der Gruppe löste und ohne Hast auf sie zu kam.
»Hey, ich bin Becca. Eigentlich Rebecca. Aber das Re in meinem Namen klingt mir zu sehr nach Wiederholung. Und du bist Raine, stimmt’s?«
»Eigentlich Lorraine. Aber das Lo am Anfang klingt zu sehr nach low. Passt irgendwie nicht zu mir, finde ich.«
Der Kellner stellte das Wasser und den Kaffee vor Raine auf die Theke, zwinkerte Becca verschwörerisch zu und entfernte sich wieder.
Raine trank einen Schluck Wasser, nippte am Kaffee.
»Warum hat er dich angezwinkert?«
»Willst du das wirklich wissen?«
Raine wandte sich ihr langsam zu. Becca war relativ groß, ungefähr eins fünfundsiebzig. Langes dunkles Haar mit einem rötlichen Schimmer, an den Enden stilvoll ausgefranst. Nussbrauner Teint, hohe Stirn, aristokratische Nase. Die schmalen Augen von rätselhaftem Dunkel, die ungeschminkten Lippen blass-rosig mit einem Zug ins Skeptische.
»Ich kann’s mir denken«, sagte Raine.
Becca reagierte mit einem freundlichen Schmunzeln. »Ant sagt, du würdest interessante Fragen stellen.«
Sie trug eine hüftlange braune Lederjacke, darunter ein kurzes Kleid: dunkelrote Blüten, jugendstilhaft angeordnet, auf samtschwarzem Grund. Dazu schwarze Netzstrümpfe und Schnürstiefel mit Metallkappen.
»Du kommst also von hier«, stellte Raine fest.
Becca nickte. »Was willst du wissen? Und warum? Bist du so ’ne Art Touristin? Von den Medien kommst du jedenfalls nicht, die interessieren sich schon lange nicht mehr für den Einschlag. Und solche todschicken Oldtimer haben sie auch nicht.«
»Erzähl mir was über den blauen Nebel.«
Becca hob eine Augenbraue an. »Bist wohl gerade erst in einen reingeraten?«
»Ja, ein paar Kilometer von hier. Habt ihr nichts davon mitgekriegt?«
»Der Nebel zieht nördlich von hier vorbei in Richtung Osten. Wenn man nicht genau hinsieht, erkennt man ihn nicht.«
»Gibt es einen Zusammenhang mit dem Einschlag?«
Becca zuckte mit den Schultern. »Ich hab das Theater damals aus der ersten Reihe mitgekriegt, aber blauen Nebel gab’s da noch keinen.«
»Wie ist es dann abgelaufen?«, hakte Raine nach.
»Das Gebiet wurde abgesperrt. Überall Leute in Schutzanzügen, wie bei einem Chemieunfall. Haben die Erde aufgebuddelt und anscheinend nichts gefunden. Und sind dann wieder abgezogen.«
»Und diese Viecher mit dem Geweih auf dem Kopf? Wie lange treiben die sich hier schon herum?«
Becca runzelte die Stirn. »Geisterhunde. Die haben sich lange nicht mehr blicken lassen.«
»Wie kommt’s, dass man davon nichts erfährt?«
»Es passieren noch andere Dinge, von denen niemand erfährt. Und wenn jemand was im Web postet, wird’s sofort gelöscht.«
Flo stellte einen Drink vor Becca auf den Tresen und zwinkerte ihr erneut zu.
»Sag ihm, er soll mit dem Zwinkern aufhören«, brummte Raine.
»Er meint das nicht so«, erwiderte Becca.
Raine blickte sie auffordernd an. »Wie ging das dann weiter nach dem Einschlag?«
»Anfangs fand ich’s total aufregend. Erst als wir evakuiert wurden, bekam ich es mit der Angst. Es hieß, wir würden bald zurückkehren können. Aber die Zeit verging, und wir saßen im Lager fest.«
»Wie bist du aus dem Lager rausgekommen?«
»Mit sechzehn bin ich abgehauen. War ganz einfach. Es sind ständig Leute gegangen, niemand hat sie aufgehalten. Ich habe mir eine Bleibe im Westbezirk gesucht, im alten Industrieviertel. Da wohne ich immer noch, die Leute dort halten zusammen.«
»Und von was lebst du?«, fragte Raine.
»Ich kann Dinge reparieren«, antwortete Becca. »Fahrräder, Spielzeug, Computer, Solarzeugs. Das war schon immer so.«
Becca nippte an ihrem Drink, Raine mit den Augen fixierend. »Und jetzt du«, sagte sie. »Wo warst du, als es passiert ist?«
Raine gab ein resigniertes Seufzen von sich und umschloss ihre Kaffeetasse mit beiden Händen. »Ich hatte Geburtstag«, begann sie leise. »Große Feier im Skylark. Plötzlich gingen die Alarmsirenen auf den Dächern los. Niemand wusste, warum. Später haben wir es aus den Nachrichten erfahren. Für mich hat sich durch den Einschlag kaum etwas geändert.«
Becca machte große Augen. »Das Skylark? Auf dem Cloudview Tower? Normale Sterbliche bekommen dort keinen Tisch.«
»Mein Vater… er hatte Beziehungen«, setzte Raine an. Sie schluckte und versuchte, die bitteren Gefühle zurückzuhalten. Warum wollten die ausgerechnet jetzt nach oben kommen?
Becca beugte sich zu ihr vor, legte eine Hand auf Raines Arm. »Schwieriges Thema? Tut mir leid.«
»Geht schon wieder«, murmelte Raine.
»Hey«, wisperte Becca. »Lass uns über etwas anderes reden… oder auch über gar nichts, okay?«
»Sie hatten den Glow«, presste Raine hervor. »Gingen ins Krankenhaus. Ich konnte sie nicht besuchen, wegen der Quarantäne. Und dann bekam ich die Nachricht, dass sie…«
»Scheiße«, flüsterte Becca.
»Ich komme damit klar«, sagte Raine, während Tränen ihren Blick verschwimmen ließen. »Und jetzt nimm bitte deine Hand weg.«
Becca zog ihre Hand zurück. Raine wandte sich ihr langsam zu.
»War nicht so gemeint. Ich lasse mich nur nicht gern anfassen.«
»Schon klar. War ja auch eine halbe Vergewaltigung.«
Raine wischte mit dem Ärmel Tränen aus ihrem Gesicht. »Ich weiß, dass du mich nur trösten willst, aber… ich bin da vielleicht ein bisschen empfindlich. Hat nichts damit zu tun, dass du auf Frauen stehst.«aytH
»Ich denke, es hat sehr wohl etwas damit zu tun«, entgegnete Becca. »Aber daran hab ich mich gewöhnt.«
Raine setzte sich entschlossen auf. Von plötzlichem liebevollem Eifer getrieben, griff sie nach Beccas Hand.
»Eigentlich wollte ich mit dir über etwas ganz anderes reden. Über den Einschlag, das Lager, deine Beobachtungen. Und wenn es die ganze Nacht dauert.«
Becca wirkte für einen Moment irritiert, dann knabberte sie mit den Schneidezähnen an ihrer Unterlippe.
»Du bist die Lady in Blue, richtig?«
Raine erstarrte für einen Moment. »Wie kommst du ausgerechnet darauf?«
»Na, die Fragen die du stellst. Außerdem hab ich mir die Lady ungefähr so vorgestellt.«
»Und wenn ich sie wäre – hättest du ein Problem damit?«
»Ich bin fast so ’ne Art Fan von dir«, sagte Becca. »Hab mich in deinen Avatar verliebt. Voll peinlich, was?«
»Jedenfalls finde ich das ziemlich infantil.«
»Ich stehe dazu. Und wenn du meine Hand noch länger hältst, kann ich für nichts mehr garantieren.«
Raine drückte Beccas Hand ein bisschen fester. »Wollen wir woanders weiter quatschen? Wie wär’s mit einer kleinen Spritztour? Du bestimmst, wohin.«
Auf Beccas Gesicht zeichnete sich ein feines Lächeln ab. »Mit deinem tollen Wagen?«, fragte sie schließlich. »Ich glaube, das gefällt mir. Wie wär’s mit dem Einschlag? Dort wo es angefangen hat.«
»Gute Idee«, sagte Raine.
»Ich gebe nur mal eben meinen Leuten Bescheid«, sagte Becca. »Und wir sollten was zum Trinken mitnehmen. Magst du Tequila?«
KAPITEL 6: ZWISCHEN KIESHALDEN
Sie fuhren ein Stück nach Westen, dann eine Weile parallel zur Küste und schließlich auf der Einundsiebzig wieder in Richtung Stadt. Raine erinnerte sich, dass sie hier mit ihrem Vater einige Male im Stau festgesteckt war. Seit dem Einschlag war die vierspurige Schnellstraße weitgehend verwaist; auf der Standspur rosteten liegen gebliebene Fahrzeuge vor sich hin.
»Sie klauen die Autos in der City«, sagte Becca. »Und fahren sie hier draußen zu Schrott. Idioten.«
Sie entstöpselte die Tequilaflasche, nahm einen Schluck und wollte sie an Raine weiterreichen, doch Raine winkte ab. Sie war die Strecke noch nie selbst gefahren und hätte es sich nicht verziehen, wenn sie Mustang Sally für ein bisschen Hochprozentiges in den Straßengraben gepflanzt hätte.
Von hinten näherte sich ein Scheinwerferpaar, aggressives Röhren brachte die Nacht zum Erzittern. Ein flacher Sportwagen holte auf, setzte sich neben den Mustang. Ein Porsche, silberne Lackierung, älteres Baujahr. Zwei junge Typen gestikulierten grinsend durchs offene Seitenfenster, riefen irgendwas Anzügliches. Raine grinste zurück und drückte das Gaspedal durch.
Becca sah sie alarmiert an. »Wettrennen? Komm, lass das.«
Der Porsche holte erneut auf. Raine ging vom Gas und ließ ihn vorbeirasen.
»Passiert mir öfter«, sagte sie. »Wie weit noch?«
»Nächste Ausfahrt.« Becca nuckelte wieder am Tequila. »Und fahr langsam. Ist ’ne Schlaglochpiste.«
Damit hatte sie nicht übertrieben. Nach wenigen hundert Metern ging die asphaltierte Straße in eine ungemütliche Schotterstrecke über, die von einer Reihe Einfamilienhäuser im Rohbaustadium gesäumt war. Die Straße endete an einer Brachfläche, die Scheinwerfer stachen ins Nichts.
»Noch ein Stück weiter«, sagte Becca. »Halte dich links. Bei den Kieshalden kannst du anhalten.«
Im Scheinwerferlicht formten sich die bleichen, kegelförmigen Halden aus der Nacht. Raine hielt an, schaltete den Motor aus und starrte durch die Windschutzscheibe ins Dunkel.
»Und?«, fragte sie.
»Wir warten«, sagte Becca.
»Auf was?«
»Auf einen Freund. Ich bin mir nicht sicher, ob er heute kommt, aber… hey, magst du nicht doch was trinken?«
Raine blickte sie skeptisch von der Seite an. »Von einem Freund war keine Rede.