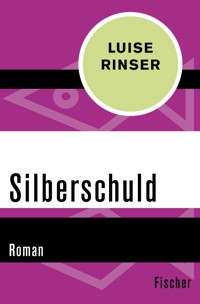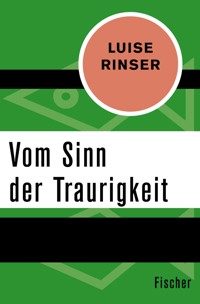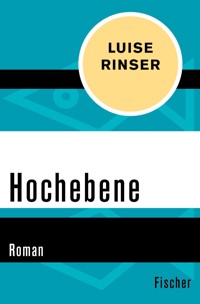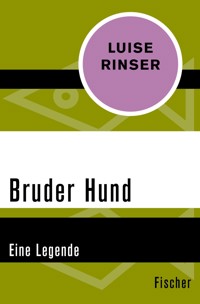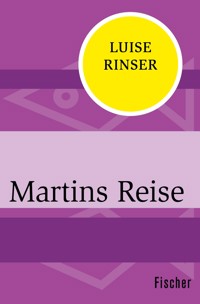14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Luise Rinser und Karl Rahner haben 22 Jahre lang Briefe ausgetauscht, die ein Zeugnis ihrer innigen Freundschaft sind, ihres intensiven Gedankenaustausches und ihrer Treue zum einmal gewählten Lebensweg. Ein intimes Tagebuch in Briefen. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 724
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Luise Rinser
Gratwanderung
Briefe der Freundschaft an Karl Rahner 1962–1984
Über dieses Buch
Luise Rinser und Karl Rahner haben 22 Jahre lang Briefe ausgetauscht, die ein Zeugnis ihrer innigen Freundschaft sind, ihres intensiven Gedankenaustausches und ihrer Treue zum einmal gewählten Lebensweg.
Ein intimes Tagebuch in Briefen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Erschienen bei FISCHER Digital
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Copyright © by Christoph Rinser
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Montasser Medienagentur, München
Covergestaltung: buxdesign, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-561212-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Mit 12 Fotos und mehreren [...]
Vorwort
Mit welchem Namen nennst Du mich vor Gott? (1962)
Sich ins Geheimnis vortasten
Ganz Mensch geworden
Du hast mein Innerstes berührt
Die tiefe Spur in unseren Herzen
Wir sind Alles-oder-Nichts-Menschen
Wie nennst Du mich vor Gott?
Laß mich diesem Menschen keine Fessel sein
Ich freue mich auf Dich mit Haut und Haar
Heiterkeit und Freiheit – die Frucht des Verzichts (1963)
Das Problem Priester – Frau modellhaft lösen
Liebender Schauder vor dem Abgrund der Fülle
Es gibt Augenblicke, da man schlechthin lebt
Ein aufgerissenes Herz
Versuch des Ausbruchs
In Verbindung mit dem Kern und Urgrund
Wie an einem Seil bei einer Gratwanderung (1964)
Ich hab gar nichts Sicheres mehr unter den Füßen
Wieder einmal an einen Anfang zurückgeworfen
Das Ineinanderspiel von Phantasie und Realität
In den Abgrund hinein
Geschleppt als Klotz den Berg hinauf
Spüren das im Wort Verschwiegene
Behalt mich lieb, auch wenn ich Dir wehtun muß
Laß uns nun ruhiger miteinander weitergehen
Im Banne der Schwermut (1965)
Ehrfurcht habe ich vor Deinem Schmerz
Du bist Reichtum auch wo Du Schmerz bist
Ich bin trotz aller Schwermut glücklich
Denn Genie und hohes Talent sind störend
Dunkle und bittere Seite der Liebe
Durch ein Schlangental gegangen
Der Ausweg ist uns noch dunkel
Lieben und Leben auf die endgültige Erfüllung hin (1966–1984)
Wenn ich die Nachricht von Deinem Tod bekäme
Auf den Knien meines Herzens
Ich kann mir eine Trennung von uns beiden nicht vorstellen
Ob Zölibat heute sinnvoll ist?
Den Raum der Stille in mir wiederfinden
Liebe ist doch nicht Abhängigkeit
Im Schweigen sind wir uns viel näher
Das ist das Problem, daß Gott schweigt
Der letzte Brief (30. März 1994)
Lebensdaten von Karl Rahner (1962–1984)
Lebensdaten von Luise Rinser (1962–1984)
Bildnachweis:
Mit 12 Fotos und mehreren Handzeichnungen aus dem Archiv von Luise Rinser, Rocca di Papa/München.
Vorwort
Diese Briefe sind eine Auswahl aus den hunderten, die ich in mehr als zwei Jahrzehnten an Karl Rahner schrieb, die meisten als Antworten auf die seinen. Der vollständige Briefwechsel würde Tausende von Seiten umfassen[1]. Daß hier und jetzt nur meine Briefe veröffentlicht werden, hat einen juristischen Grund: Rahner war Jesuit, und sein Orden erlaubt die Publikation seiner Briefe nicht, obwohl ich die rechtmäßige Besitzerin bin, und obwohl Rahner nie die Rückgabe seiner Briefe an den Orden verlangte, ja nicht einmal in Erwägung zog. Wir sprachen im Lauf der Jahre einige Male über die Publikation unsres Briefwechsels[2]. Hätte er sie nicht gewollt, hätte er meine Briefe verbrennen können. Er gab sie mir, Päckchen um Päckchen, zurück. Auf manche Päckchen schrieb er eigenhändig: »Nach meinem Tod ungeöffnet an Frau Luise Rinser zurück«. Einige Male waren wir uns darüber einig, daß der gesamte Briefwechsel nach seinem und meinem Tod veröffentlicht werden soll. Aber wir haben den Gedanken daran fallengelassen, genau gesagt: einfach vergessen. Daß Rahner mir unser beider Briefe anvertraute, und nie die Rückgabe der seinen erbat, beweist, was er auch mehrmals sagte, daß er sie nicht in den Händen seines Ordens sehen wollte. »Bei dir sind sie wohl verwahrt.«
Verwahrt, wozu? Für wen? Wenn sie nicht publiziert werden sollten, warum dann nicht die Vernichtung? Was sollte denn sonst geschehen damit?
Ich besitze alle seine Briefe an mich, an die achtzehnhundert[3], und einen Teil meiner Briefe an ihn. Ein Teil meiner Briefe aus den letzten Jahren fehlt. Ich weiß nicht, wo sie sich befinden[4]. Es sind die am wenigsten wichtigen, am wenigsten interessanten meiner Briefe an ihn. Nun: ich habe mir seit Rahners Tod 1984 keine Gedanken darüber gemacht, was mit unsern Briefen geschehen sollte. Meine Söhne würden nach meinem Tod schon das Richtige damit tun.
Eines Tages[5] sagte ich in einem Gespräch mit Dr. Snela (Schüler Rahners) so nebenher und ohne jede Absicht, daß ich viele hunderte von Briefen besitze, die meinen und die Rahners. Dr. Snela meinte, es sei doch schade, wenn sie nicht veröffentlicht würden. Ich erinnerte mich nicht mehr recht, was in diesen Briefen stand und hatte keine Lust, sie wiederzulesen oder vielmehr: mich ängstigte die Fülle und wohl auch, soweit meine Erinnerung reichte, die Problematik des Inhalts. So übergab ich sie in großem Vertrauen Dr. Snela. Er sollte sie lesen und dann urteilen, ob sie veröffentlicht werden können. Er fand den Briefwechsel faszinierend, menschlich tief berührend und vor allem theologisch und kirchenhistorisch wichtig[6]. Schließlich willigte ich ein, wenn auch die Jesuiten einverstanden wären. Sie waren es nicht, was Rahners Briefe angeht[7]. (Über ihre Begründung schweige ich.) Über meine Briefe kann ich frei verfügen[8]. Da sie vielfach Antworten sind auf Rahners Briefe, vermitteln sie, was er mir schrieb. So ist denn dieses Rahner-Kapitel mit dabei. Ich meine, der Orden sollte stolz sein darauf, einen nicht nur theologisch, sondern auch menschlich so großartigen Mann in seiner geistigen Ahnenreihe zu haben. Denn man muß schon sehr großes Format haben, um als Zölibatär zu wagen, was er wagte: eine Frau zu lieben und an dieser Liebe tief zu leiden. Aber warum das verschweigen? Warum nicht zeigen, wie ein Zölibatär eine Frau lieben kann, ohne als Ordensmann zu scheitern, im Gegenteil: daran zu wachsen.
Nun: Rahners Briefe bleiben also vorläufig leider unveröffentlicht. Die meinen aber lasse ich publizieren. Ich bin mir bewußt, welches Wagnis ich damit eingehe. Nicht als gehe es um Skandalöses. (Das, was heutigentags innerhalb der katholischen Kirche um den Pflichtzölibat geschieht, durch Schuld der Kirche, ist tausendmal skandalöser als das, was zwischen Rahner und mir geschah.) Es ging bei uns nicht um »verbotene Liebe«, es ging um das Erfahren-Wollen dessen, was wir »Beides« nannten: das göttliche Experiment, ganz Mensch, ganz Mann, ganz Frau zu sein, ganz »Fleisch und Blut«, und dennoch ganz und gar spirituell zu leben.
Wir haben diese Gratwanderung gewagt. Wir gingen dabei zeitweise wie auf dem scharfen Messer-Rücken, denn wir waren eben nicht nur spirituell, und wir waren auch nicht simpel Fromme, sondern höchst kritische Zeitgenossen, aus mancher kirchlichen Sicht nahe an der »Häresie«. Das eigentlich Schwierige aber lag nicht auf meiner Seite. Es war auf Rahners Seite: er litt. Mein Leiden war nur Echo und Spiegel des seinen. Denn er liebte mich, ich aber war an einen andern Mann, ebenfalls Ordensmann, seit vielen Jahren gebunden. Rahner wußte das von Anfang an, aber wir glaubten, »beides« zu leisten: meine Liebe zu einem andern und die tiefe Beziehung zwischen Rahner und mir. Wir haben auch dieses »Beides« geleistet, aber Rahner bezahlte dafür einen zu hohen Preis.
Der Anlaß zu meiner Begegnung mit Rahner war die Anfrage des Moraltheologen Egenter, ob ich ein Buch über die spezifische Art der Askese der Frau schreiben wollte. Ich suchte in meiner Bibliothek nach Material und fand ein Buch über »Askese und Mystik«. Der Co-Autor war Karl Rahner[9]. Ihn also konnte ich um Rat und Hilfe bitten. So schrieb ich ihm denn, ob ich ihn in Innsbruck besuchen könne. Kaum war mein Brief fort, wollte ich ihm einen zweiten nachschicken. Ich wollte um Entschuldigung für die Belästigung bitten, er habe natürlich keine Zeit, und ich zöge meine Bitte zurück. Doch schon war seine Antwort auf den ersten Brief unterwegs: er erwarte mich also am 27. Februar (1962) mittag an der Pforte des Jesuitenkollegs, Sillgasse 6 in Innsbruck[10]. Ich erwartete einen hochgewachsenen, hageren, strengen Mann, der mir eine halbe Stunde Audienz gewähren würde. Vor zwölf Uhr schon öffnete sich die Pforte (immer waren wir beide überpünktlich, so daß unsre Treffen im Lauf der Jahrzehnte immer früher sich ereigneten als abgemacht.) Der berühmte Jesuit: er war klein und unscheinbar, er trug unterm Arm zusammengeknautscht einen Regenmantel, und an der Hand eine Mappe. Wir schauten uns an, dann fragte er: »Und wohin gehen wir jetzt?«. Ich sagte ebenso trocken: »Zum Essen im ›Grauen Bären‹«. »Der graue Bär«, er wurde unser Treffpunkt für viele Jahre. Wir gingen also essen, und der Ecktisch wurde später immer für uns reserviert.
Und was redeten wir? Nun: über die Ursache meines Kommens. Ein theologisches Gespräch. Aber war ich wirklich deshalb, nur deshalb, gekommen? Es war die Zeit meiner tiefen verworrenen Leiden um »M.A.«. Ich sprach einem Zölibatär, einem Ordensmann, von meiner Liebe zu einem andern Zölibatär und Ordensmann. Rahner hörte zu (mit einem Ohr, denn auf dem andern war er taub seit seinem Kinder-Scharlach). Und dann fragte er trocken: »Ist das (diese Liebe) exclusiv?« »Ja«, sagte ich. Dieses »exclusiv« war später Ursache zu Rahners großem Leiden. Er wußte von der ersten Stunde an, daß es einen Mann gab, den ich »exclusiv« liebte. Kein Geheimnis.
In der Nacht hatte ich einen Traum, an den ich mich nicht mehr erinnerte. Aber am Morgen fand ich auf dem Nachttisch einen Zettel, einen Briefumschlag, auf dessen Rückseite ich, im Traum, geschrieben hatte: »Ist Liebe Liebe nur, wenn sie geht der Liebe Spur.« Hatte ich das geschrieben? Es war (und ist) meine Handschrift, aber seltsam verfremdet. Wer schrieb das?
Am Morgen kam Rahner, nach der Messe, zum Frühstück und ich zeigte ihm den Zettel. Was bedeutet der Satz?
»Ha no«, sagte er in seinem badischen Dialekt, »des isch doch einfach. Es bedeutet, daß es nicht nur eine einzige Art von Liebe gibt.« Für ihn war alles klar, so schien es. Später freilich wurde aus dem einfachen klaren Satz ein herz-abschnürendes Problem. Konnte ich denn zwei Männer lieben? Auf verschiedene Art lieben? Wir glaubten, »beides« gehe. Liebte ich denn Rahner? Er faszinierte mich, und ich liebte seine ungemein schönen braunen Augen, auch seine Stimme. Und er tauchte in meinem Leben auf in just dem Augenblick, in dem mich der Dritte, M.A., entsetzlich quälte, von seiner klerikalen Verformung eingeholt, mich zurückstieß, sich wieder näherte, um das Spiel von neuem zu beginnen mit immer höherem Einsatz. Da nun kam Rahner und gab mir, was der andere mir vorenthielt: Wärme, brüderliche Nähe, scheue Zärtlichkeit auch, und unauffällige aber authentische spirituelle Führung. Während der Dritte sich brüsk zurückzuziehen und zu verstecken versuchte und seine Gefühle leugnete, war Rahner jederzeit erreichbar, telefonisch und besuchsweise, und er schrieb mir. Er schrieb schöne Briefe, fast täglich, manchmal fünf Briefe am Tag, und seine jesuitische Erziehung und Selbstkontrolle wurde langsam überwachsen von seiner tiefen warmen Menschlichkeit. Er »blühte auf«. Kein Wunder, daß ich mit meinem ganzen Wesen mich ihm anvertraute. Ich hielt mein Gefühl für Liebe und war so unvorsichtig, diese Liebe Rahner zu zeigen. Vermutlich hoffte ich auch, dadurch den andern zu vergessen.
Zwei Jahre etwa waren Rahner und ich (meist) heiterglücklich. Meine Briefe bezeugen es. Aber schließlich brach die dünne Eisdecke ein, die sich über meiner großen Liebe zu M.A. gebildet hatte, und ich sah, daß ich nur ihn liebte mit jener Liebe, die »exclusiv« ist. Auch brachten es die Konzilsjahre mit sich, daß ich M.A. sehr oft sah und er es nun wagte, mir seine Gefühle zu zeigen.
Rahner erlebte das und ich sagte es ihm auch. Er fühlte sich von mir verraten und tief verletzt, und er vergaß, was ich ihm von Anfang an und immer wieder gesagt hatte: daß ich M.A.liebte, »exclusiv«.
Jetzt, beim qualvollen Wiederlesen jener Briefe erscheint mir meine Aufrichtigkeit grausam. Aber wie anders hätte ich mich verhalten sollen? Ich war das Weizenkorn, das zwischen den Mühlsteinen gemahlen wurde. Ich litt. Rahner litt. M.A. litt. Was für eine unerträgliche Situation, was für eine unlösbare Aufgabe.
Wir lösten sie schließlich. Der Kampf endete in Frieden. Mit Rahner verband mich eine tiefe treue Freundschaft, bis zu seinem Tod. Buchstäblich bis zu seinem Tod, denn ich hörte seine Stimme durchs Telefon wenige Stunden vor seinem Heimgang.
Wenn ich, nach langem Zögern und mit Widerstreben meine Briefe veröffentliche, so hat es einen triftigen Grund: Sie enthalten, als Echo zu Rahners Briefen, sehr viele seiner Gedanken und Gefühle, die wichtig sind zum Verständnis seiner Person und auch seiner Theologie. Sie sind mehr als eine Ergänzung zu allem, was bereits über ihn geschrieben und publiziert wurde; sie sind, gespiegelt in meinen Briefen, sein intimes Tagebuch, das Tagebuch eines großen Theologen, der ein großer Mensch war.
Was bei dieser Publikation mein eigenes Problem ist, daß ich mich dem Unverständnis der Leser preisgebe, weniger in meinem Verhalten zu Rahner als in dem, wovon zu sprechen eigentlich unmöglich ist. Ich rede von dem Gebiet, das man, weil es so überhell ist, für dunkel hält. Ich rede von dem, was man »Mystik« nennt. Ich rede nicht von »okkulten« Dingen, auch nicht von Parapsychologie, nicht von »Esoterik«. Ich rede simpel von Mystik, das heißt von jener besonderen Art, in Verbindung mit dem universellen namenlosen Geist zu leben, der sich in jeder Weltreligion jenen offenbart, die dafür offen sind. Ich lebte als Kind (möglicherweise als Frucht aus einem früheren Leben) eine authentische Form mystischer Frömmigkeit, die später überdeckt wurde von meiner Intellektualität und meiner Befassung mit dogmatischer Theologie, die mich zum Agnostizismus bis zur Grenze des Atheismus führte, viel später aber, auf dem Weg meiner Begegnungen mit fernöstlichen Religionen, wieder einholte.
Ich sprach zu niemand über meine Erlebnisse, nur zu Rahner, der von sich behauptete, nie Mystik erlebt zu haben, der aber ganz gewiß jene Art der Verbindung zu seinem Gott hatte, die mystischer Natur war: das wortlose Weilen im »Heiligen Geist«.
Meine eigenen Erfahrungen dieser Art gebe ich notgedrungen teilweise preis, weil sie Teil meiner Korrespondenz mit Rahner sind.
Aber nicht nur deshalb. Ich versuche zu zeigen, daß sich auch auf diesem Gebiet »Beides« verbinden kann. Man kennt mich als »Links-Katholikin«, als politisch engagierte Zeitgenossin, als Teilnehmerin an Protestmärschen, als Unterzeichnerin, auch Verfasserin »revolutionärer« Aufsätze, kurzum: als eine »aufmüpfige« nüchterne Person, die fest auf beiden Beinen steht. Zwar lassen sich in fast allen meinen Büchern Spuren finden, die das Vorhandensein einer besonderen Art von Sprititualität verraten, aber eben nur Spuren[11]. In meinen Briefen an Rahner rede ich deutlich. Freilich habe ich nicht alle diese Briefe zum Abdruck freigegeben. Einige bedürfen des Schleiers der Intimität zwischen Mensch und dem, was man Gott nennt.
Ich bin nicht die einzige, die »beides« lebt: ich erinnere an den ehemaligen ägyptischen (ermordeten) Staatspräsidenten Sadat, der in seiner politischen Autobiographie im Gefängnis der Engländer über seine mystischen Erlebnisse schrieb. Und ich erinnere an Dag Hammarskjöld, Generalsekretär der UN, Finanzmann und Politiker von Beruf, der sein intimes Tagebuch (»Zeichen am Weg«) seinem Freund übergab zur Veröffentlichung, und der seine Leser enttäuschte, die Politik erwarteten und Mystik fanden.
Es wäre eine reizvolle Aufgabe, ein Buch zusammenzustellen mit Dokumenten mystischer Frömmigkeit politischer oder sonstwie »weltlicher« Personen, von denen man das nicht erwartet.
Was mich beim Wiederlesen meiner Briefe ungemein stört, und was meine Leser stören, befremden, schockieren kann, ist meine Sprache von damals. Es ist die Sprache der Theologie und Frömmigkeit, eine Sprache, die viele »Klischees« enthält. Aber damals kannten wir keine andere Sprache für spirituelle Erfahrungen. In meinen Briefen sprach ich zu einem Theologen, der mein »Guru« war und der die »Klischees« verstand als Symbol-Sprache.
Der Leser wird bald bemerken, daß ich mich nach und nach von dieser Sprache löste, so wie ich mich von veralteten Glaubensvorstellungen löste, so weit löste, daß meine kirchengebundene Religiosität zum Zweifel, zum Agnostizismus bis zum Atheismus führte, was meinem Briefpartner, der Jesuit und als Theologe Dogmatiker war, große Probleme schuf. Aber ich mußte meinen Weg gehen. Er führte mich über meine Befassung mit östlichen Religionen zu einer universellen Religion, in der auch das Christentum seinen Platz hat. Mit großem Widerstreben lasse ich jene meiner Briefe veröffentlichen, die von meinen spirituellen Erfahrungen sprechen. Wen sie befremden, der möge bedenken, wie heiß sich heutzutage viele Zeitgenossen, besonders jüngere, bemühen, mit Hilfe esoterischer Praktiken das zu erreichen, was mir ganz natürlich gegeben war, wie es allen gegeben ist, aber von den meisten nicht wahrgenommen wird, weil sie sich nicht dafür öffnen.
Nun: so wage ich denn diese in doppelter Hinsicht riskante Publikation in der Hoffnung, die Leser mögen nicht nur die Größe Rahners begreifen, sondern auch das einfache klare Phänomen der Mystik, befreit von jeder modern esoterischen Scharlatanerie, jenes Phänomen, das die Menschheit durch viele Jahrtausende auf ihrem Weg begleitet: das Phänomen, das einfach darin besteht, daß man sich öffnet für die Welt des Geistes. Aber ich betone: es geht nicht um mich, es geht um Rahner, diesen außerordentlichen Menschen, der es wagte, liebend und leidend zu leben und von dem das Wort Jesu über einen seiner Jünger, Nathanael, gelten kann: »Seht, ein Mensch ohne Falsch.«
Rocca di Papa, 30. 3. 1994, 10. Todestag K. Rahners
Luise Rinser
Mit welchem Namen nennst Du mich vor Gott? (1962)
Sich ins Geheimnis vortasten
Verehrter Pater Rahner,
gestern abend hatte ich beschlossen, Ihnen zu schreiben, daß ich meine Bitte, Sie zu sehen, zurücknehme, da ich mir denken kann, daß es Sie einfach nicht interessiert, mit Nicht-Theologen zu diskutieren, denen viele Voraussetzungen fehlen. – Nun aber überfällt mich plötzlich ein derartiger Zorn auf die ganze Theologie, daß ich es Ihnen sagen, nicht schreiben muß. Mir ist, nachdem ich mich lange mit den Fragen der Jungfräulichkeit beschäftigt habe, verschiedenes aufgegangen.
1. Daß diese ganze Frage – wie die gesamte Theologie – vom Manne aus gesehen ist, nicht vom Menschen aus.
2. Daß eine Theologie, die am Leben vorbeiredet, nichts taugt, denn auch Christus redete immer zum Leben. Ich meine »Leben« in allen seinen Ebenen. Jedes seiner Worte ist brauchbar, »versteh-bar« auch für den »kleinen Mann«.
3. Daß die Theologie der Jungfräulichkeit nichts anderes ist (ich meine die Überschätzung der Jungfräulichkeit) als die Sucht
a. nach einer Bestätigung und Erhöhung des eigenen Wesens, des eigenen, jungfräulichen Standes zuungunsten der anderen (also Hochmut);
b. nach der Bildung eines exclusiven Standes: »Die Priester-Kaste« oder der Zirkel der »Höchst-Eingeweihten«. (Ich verallgemeinere, das ist schlecht, aber auch richtig. Ich kenne natürlich ganz wunderbare Priester auch!!)
So werden die jungen Leute im Germanicum erzogen, und so soll ich meinen Sohn erziehen lassen? In diesem Hochmut, dieser Lieblosigkeit, diesem manichäisch-gnostizistischen »Ideal«? Welche Verantwortung auch für mich.
Ach, Pater Rahner! Jetzt weiß ich übrigens, warum ich Sie so schätze: Weil Sie »unsicher« in einem sehr schönen Sinne sind. Ihnen fehlt jeglicher Theologen-Hochmut. Sie lassen alle Fragen offen. Sie lernen, indem Sie denken; Sie tasten sich vor ins Geheimnis und lassen uns nicht im Zweifel darüber, daß Sie nur tasten. In dieser Ihrer Demut ist es begründet, daß Sie mir wirklich ein Führer sein können.
Und ich möchte Sie doch sprechen! Wenn es irgend geht – bitte, machen Sie es möglich.
Ihre (von der Theologie verstörte)
Luise Rinser
Lieber Pater Rahner,
da diese Arbeit [Felix Tristitia][2] beim ersten Schreiben offenbar verloren ging, (falls sie sich nicht eines Tages unter Ihren anderen unerledigten Papieren findet …) schicke ich sie noch einmal. Hoffentlich geht’s damit nicht so wie mit den scheußlichen Hochzeitsgeschenken, die man kaputtschlägt, um sie nicht sehen und haben zu müssen – und dann kommt die gute Tante, die Geberin, – und schenkt einem die selbe lästige Sache noch einmal! (Aber Sie müssen sie ja nicht lesen. Freilich hätte ich es gern, täten Sie es doch!)
Es war schön bei Ihnen, schön und heiter, und so ganz anders, als ich mir’s, falls ich mir etwas Bestimmtes überhaupt vorgestellt hätte, vorausgedacht hatte. Ich danke Ihnen von Herzen. Ich habe vieles zu sagen, nicht von mir, sondern von Ihnen, denn am 2. Tag war ich ganz passiv und ließ Sie auf mich wirken, da weiß man dann manches. –
Ihre Luise Rinser
Lieber Pater Rahner,
da, wie Sie schreiben, Briefe gut in die Fastenzeit hineinpassen und da Sie mir ja Autorität in allen Fragen sind, die in etwa zur Theologie gehören, schreibe ich Ihnen einen Brief, der aber nicht ganz den Geist der Fastenzeit spiegelt insofern, als darin nicht von Fasten die Rede ist, sondern vielmehr von Reichtum, Fülle, Freude. Ich schreibe nämlich in der ersten Freude über Ihren Brief. Ich freue mich, daß Sie überhaupt geschrieben haben (ich hatte doch, jetzt gestehe ich mir’s ein, recht sehr auf ein Zeichen gewartet), und ich freue mich über die Tonart, in der Sie schrieben, die so viel heiterer (und bekömmlicher) ist als die M.A.’s, und ich freue mich über das, was Sie schrieben – vor allem natürlich darüber, daß Sie mir Mut machen können, so weiter zu arbeiten. Sie wissen gar nicht, wie gut Ihr Brief für mich ist. Ich bin nämlich inmitten vieler Freunde und trotz M.A. ein sehr »alleiniger« Mensch, weil mich eigentlich niemand ganz versteht. Nicht als fühlte ich mich »unverstanden« (gräßlich »eine unverstandene Frau«!!) und als hätte ich das dringende Bedürfnis, von jemand anderem als dem HERRNverstanden zu werden. Aber beim ersten Zusammensein mit Ihnen war mir klar, daß Sie meine Sprache sprechen (zwar nicht was Ihren Stil, Ihre Worte anlangt, aber was Ihre Gedanken betrifft). Auch Sie sind einsam mit Gott, undERgenügt. Aber dennoch ist es schön, wunderbar schön und in tiefstem Dank »auf den Knien des Herzens« (stammt von Kleist!) hinzunehmen, wenn man einem Menschen begegnet, bei dem man das Gefühl selbstverständlicher Nähe hat. Darum waren wir ja auch so heiter mitsammen. Wir haben viel gelächelt und gelacht. In meiner Erinnerung sind die acht(!) Stunden (fünf plus drei) im »Grauen Bären« wie ein einziges Lächeln, und immer, wenn ich an Sie denke, überkommt mich diese himmlische Heiterkeit. Ich habe in meinem Leben so etwas noch nicht erlebt, ehe ich Sie sah. Ob Sie nicht auch in ähnlicher Weise an mich denken? Heiter, schwerelos, selbst-verständlich? Können Sie es mir sagen?
Ich freue mich innigst auf jedes Zeichen von Ihnen (ein Satz auf einer Karte kann mich für eine Woche ernähren, wenigstens in der Fastenzeit …) und auf das so schön angebotene Wiedersehen.
Gerne wüßte ich, wo meine Gedanken Sie finden, jetzt, wenn Sie nicht in Innsbruck sind. Wohin darf ich, wenn ich will oder muß, schreiben? Wie lang sind Sie fort? Schreiben Sie mir ein Kärtchen darüber, bitte.
Nun aber genug vom Persönlichen (obgleich ich finde, daß man – mit dem Mitteilen vom Persönlichen – nicht so hochmütig sparsam sein soll, wie es sich manche egoistische Leute schuldig zu sein glauben). – Ich habe gestern einen großen Schmerz erlebt: Ist es wahr, daß Papst Giovanni einen Erlaß herausgegeben hat, in dem befohlen wird, alle theologischen Schriften in Latein abzufassen? Kardinal Doepfner soll sehr böse sein darüber. Mit Recht. Man will offenbar damit erreichen, daß sich jene italienischen Cardinäle, dicht um den Papst, jederzeit mühelos über alle theologischen Schriften orientieren können. Außerdem will man, daß die Laien die oft prekären neuen Schriften nicht (mehr ohne weiteres) lesen können (als ob es nicht genug Laien gäbe, die Latein können, und als ob man nicht raschestens Übersetzungen machen lassen könnte!!). Diese ganze Bewegung scheint mir als Symptom beängstigend, und allen Bestrebungen, Laien (=Charismatiker) und Lehramt näher zusammenzubringen, ins Gesicht zu schlagen. Wie verhalten Sie sich dazu? Werden Sie in Latein schreiben? Tun Sie es nicht! Alle Theologen der Welt sollten sich zusammenschließen in dieser Frage. Haben Sie schon etwas unternommen? Sie können es sich trotz allem leisten! Ich bete sehr intensiv für Sie um Mut und Kraft. – Ihre Schrift (in »Stimmen der Zeit«)[4] zum Konzil ist großartig! Sie haben ein Charisma ohne Zweifel. (Wie dankbar bin ich Gott, daß ich nicht nur Ihre Schriften, sondern Sie selbst kennenlernen durfte).
Ich fand übrigens bei der Beschäftigung mit der Geschichte des 14. Jahrhunderts (ich muß für den Bayrischen Rundfunk eine Sendung zum Tag der S. Caterina machen), daß jene Epoche Ähnlichkeit mit der unseren hat: vorreformatorischer Geist, Anfechtung der Allmacht des Papstes, Aufbruch der Laien-Frömmigkeit, Beachtung des Charismatischen in der Kirche, symptomatisch: keine neuen Orden, aber »Säkular-Institute«, die große allgemeine Unruhe, und sofort. Man müßte eine Arbeit schreiben darüber. – Ich schrieb noch ein ganzes Blatt voller Einfälle, teils zum Thema der Jungfräulichkeit, teils zu Ihrem Thema der Entwicklung Jesu, aber Sie tun mir leid, wenn Sie das alles lesen müßten. So schicke ich das Blatt nicht mit. – Für Ihre Schwermütige bete ich. Wollen Sie ihr vielleicht meine Schrift über die Schwermut[5] geben? Kann ich mich sonstwie um sie annehmen? Manchmal habe ich auch so etwas wie eine charismatische Fähigkeit, weit über meine Kraft hinaus zu wirken und Ursachen aufzudecken (intuitiv), die kein Analytiker fand. –
Daß Sie meiner (geliebten) Buben so lieb gedenken, wärmt mein Herz. Dank! – Die beiden kommen Ende März für eine Woche zu mir und fahren dann mit ihrem VW nach Griechenland, während ich am 11.4. für zwei bis drei Wochen (Ostern!) nach Jordanien und Israel gehe. – Auf der Fahrt nach München (etwa 7. Mai) werde ich also nach Innsbruck kommen. Ich freue mich darauf! (Mehr als auf alle bevorstehenden Reisen: Israel – Holland, – Polen).
Zu Ihrer Frage: Über Mischehe schrieb Frau Dr. Gertrude Reidick eine gute Arbeit in »Una Sancta« (ich weiß nicht genau, wann, etwa Herbst 61).
Ich lege Ihnen ein Gedicht von mir bei. Ich kann keine Lyrik –, ich schrieb es mit etwa 24 Jahren so wies dasteht[6]. Ohne Korrektur, »in Trance« fast. Jetzt erschrecke ich über das, was ich da sagte oder vielmehr: was mir da gesagt wurde.
Ihre dankbare Luise Rinser
für Karl Rahner, März 1962
Anhauch des nächtlichen Weltraums
Verharrt vor umfriedetem Pferch.
Dunkle Vögel voller Anruf werfen mächtig
Sich in die Stauung um die ausgesparte Insel.
Doch hier ist Schlaf der satten Lämmer
Und Traum von Gräsern und von Wolle.
Nur Eines Traum steht, aufgerissen, offen.
Das Innre der gewohnten Frucht schmeckt
Plötzlich bitter. Und fernher aus der Fülle
Der aufgehäuften Nacht ruft eine fremde
Stimme, die es meint: Steh auf und komm.
Es läßt die Wärme nachbarlichen Tiers
Und überschreitet blind den Kreis der Hut.
Draußen empfängt es voller Aufbruch die Nacht.
Zitternd einrollt sein festliches Fahnentuch
Der fortgewiesne Himmel, aus dem Stürme stürzen,
Und aus dem Dunkel jäh springt auf das Tier,
Das jagende, voll Übermacht und Strenge.
Nicht Stern noch Bergung. Nur das Lamm.
Und Jagd und Ruf. Und Bäume voller Schrecken
Nehmen sich zurück.
Da wölbt sich aus der Nacht
Die fürchterliche Stimme: Steh, Steh!
Entflieh nicht mehr.
Schonung ist nirgendwo.
Und überall bin Ich.
Gezeichnet hab Ich dich.
Sieh, dunkel ist dein Fell von Blut,
Fremd deine Spur vom scharfen Ruch
Des frischen Brandmals meiner Hand.
Knie nun, knie,
Daß du im Knien
Empfängst den besonderen Auftrag:
Verwehrt ist der Pferch dir und das gewohnte
Süße Tal der Nahrung. Siehe dort
Das Verworfne des unfruchtbaren,
Des unaufhörlichen Gebirgs!
Erstarrt dein Blut? Dort weide.
Denn dort
Bin Ich.
Warum nur machen mich Ihre Briefe so heiter? So heiter sind sie (Sie) doch gar nicht! Aber das alles ist in der Serenität der sacra indifferentia daheim – das wird’s sein. Oder? Man weiß so wenig, und alles bleibt Geheimnis, und das ist gut so. Ich rede viel mit Ihnen. Hören Sie’s? Stört es Sie?
Ihre Luise Rinser
Lieber Pater Rahner,
ich habe eben bei Ihnen in Innsbruck angerufen, um Ihnen etwas zu sagen, aber ich hörte, Sie seien nicht da und kämen erst Sonntagabend wieder (so hatte ich’s doch recht im Kopf behalten, daß Sie ab 14. nicht in Innsbruck seien! Ich muß nämlich nach Frankfurt, morgen 16.), weil mein Verleger wünscht, daß ich bei einer Fernsehsendung »Bücher und Dichter« mitmachen soll, und ich tu’s seufzend. Was für ein unruhiges Leben. Aber ein gutes Training für Gelassenheit und für’s Bewahren der »inneren Zelle«!
Nun: Da ich von Frankfurt nach München fliege, um dort, für einen Tag meine Buben zu sehen, liegt der Gedanke nahe – – – usw. Sie ahnen alles! Ich könnte am Dienstag, 20., morgens acht in München abfahren, wäre um 10.46 Uhr in Innsbruck und könnte um 15.57 Uhr wieder weiterfahren nach Rom. (München-Rom also mit Zug … mit starkem Zug nach Innsbruck!!!) Ich könnte aber natürlich auch am Nachmittag kommen und am nächsten Tag weiterfahren. Aber ich will Ihnen diesmal ganz wenig Zeit wegnehmen – wenn’s Ihnen nicht paßt (mein Kommen, meine ich), sagen Sie’s, aber erfinden Sie bitte, eine liebevolle Ausrede. Ich ertrüge jetzt (trotz Fastenzeit) ein glattes Nein schlecht, da ich mich so kindlich auf Sie freue. Für mich ist einfach jetzt »Rebhuhn« und nicht »Fasten«, und so soll es sein. Ich bin dem Oberbefehl M.A.s entlaufen und flüchte unter Ihre menschlichere Flagge. Bergen Sie mich dort, bitte.
Ihre Luise Rinser
Lieber Pater Rahner,
eben bin ich angekommen, es ist Mitternacht und es regnet (wäre ich doch in der Innsbrucker Sonne geblieben …), ein Postberg liegt da, (wiewohl nur fünf Tage alt), aber ich habe wie der Hund nach dem Knochen nur nach einem Brief gegraben und ihn auch gefunden. Dank. Dank für alles. Wenn ich heute früh (vor 700 Kilometern) sagte, ich wäre doch nicht mehr ganz so himmlisch heiter in unserer Beziehung, so war das nur ein Schatten, er kam von Müdigkeit und ich spürte wohl auch voraus Ihre Sorge Ihres Bruders wegen, ich bin nämlich eine Antenne, und außerdem hatte ich in der Nacht einen Traum von uns beiden (ist das ein süßes Wort: von uns beiden –, sagen Sie sich das einmal vor, ganz leise) einen Traum der schön war, aber mich ein wenig befangen machte. Aber jetzt ist die reine Freude wieder da, stärker noch. Was sind Sie doch für ein bezaubernder Mensch! Ihre Augen – diese schönen Augen, die ganz ruhig sind und rein und warm, in denen die meinen stundenlang ruhen können, diese Augen liebe ich innig. Manchmal werden sie dunkel – kastanienbraun, das habe ich noch nie bei einem Menschen gesehen. Hoffentlich störe ich Sie jetzt nicht in Ihrem Schlaf, weil ich allzu intensiv bei Ihnen bin. Ich werde mich behutsam wiederzurücknehmen.
Ob Sie »Liebe Luise Rinser« schreiben dürfen? Dürfen? Es ist mir ein Geschenk. Wenn Sie ganz generös sein wollen, dann dürfen Sie auch noch anders schreiben, wie, das überlasse ich Ihrem schöpferischen Herzen. Ich meine, wir werden eines Tages ganz von selbst eine noch andere Anrede gefunden haben. Das ergibt sich bei uns alles ganz von selbst, das wächst pflanzenhaft. Sie werden auch einen neuen Namen für mich finden, da Sie ja etwas Neues aus mir machen. Und wie soll ich schreiben? Pater, das bezeichnet das, was Sie mir sind, nicht richtig.
Daß Sie mich gernhaben, ach das ist schön, das macht mich tief innen glücklich. Aber was bin ich Ihnen denn, was kann ich einem Manne wie Ihnen sein? Vielleicht genügt es, wenn ich Sie einfach liebhabe. Das Angenommen-Sein von einem Menschen ist eine Quelle der Kraft, das ist wahr. Und wir beide haben uns angenommen, im ersten Augenblick.
Sie haben gestern beim Tee da oben (säßen wir doch wieder dort) gefragt, was denn Liebe sei, da man ja »das Heil« jedem, nicht nur dem besonders geliebten Menschen wünsche. Ich möchte dazu sagen, daß andere als ich schon recht Gescheites darüber geschrieben haben und daß dennoch nichts geklärt ist und alles Geheimnis blieb. Und was da zwischen uns ist, das ist dreimal ein Geheimnis. Genug, daß es da ist. Danken wir dem guten Gott, der uns dies gab. Freuen Sie sich dessen, nehmen Sie von mir alles, was ich geben kann. Ich spare nie mit mir, ich werde ganz da sein für Sie und auch für M.A., denn beides ist etwas für sich Ganzes und Heiles. Daß Sie mir in gewisser Weise näher sind als er, weiß ich. Was er falsch macht, das machen Sie richtig. Ich lege mich ganz vertrauensvoll in Ihre Hand oder wenn die zu klein ist, in Ihren Arm und lasse mich beschützen und wärmen. –
Daß Sie meine Aufsätze mögen, macht mich stolz. Und Sie, wenn Sie mir schon ein Urteil zutrauen, dürfen auch ein klein wenig stolz sein, wenn ich Ihnen sage, daß ich Ihren Geist schlechthin bewundere und daß ich Ihre Vorlesung ausgezeichnet fand. Sie war so klar, daß selbst ich, die ich da so mittenhinein kam und nicht vom Fache bin (freilich brennend interessiert), alles verstand, – ich kann es Ihnen jederzeit beweisen!
Die Fahrt (gestern) war unseres Zusammenseins würdig, sie hatte etwas von einem Märchen. Ich ging Mittag in den Speisewagen und setzte mich an einen Tisch zusammen mit einem Paar (einem älteren Mann und einem irgendwie dazugehörenden Mädchen), und dann kam noch ein italienischer Ingenieur. Der andere Mann war ein vor langer Zeit in Schweden eingewanderter Deutscher. Wir kamen in ein Gespräch, ich machte die Dolmetscherin zwischen den Deutsch-Schweden und dem lustigen Italiener. Nach einer Weile sprachen wir von deutscher und italienischer Literatur, vom Film her kommend, und der Schweden-Deutsche sagte, die moderne deutsche Literatur sei ihm zu nihilistisch und es gäbe nur eine, die er gelten lasse und ob ich von ihr etwas gelesen habe – nämlich von Luise Rinser. Ich zog schweigend meinen Paß und reichte ihn ihm. – Sie können sich den Knall-Effekt vorstellen. Die Sache mußte dem Italiener erklärt werden, und er bestellte Wein, guten und davon viel, und wir feierten irgendetwas, ich glaube mich, jedenfalls war es ungemein lustig, und der ganze Speisewagen lachte mit uns, weil unsere Heiterkeit ansteckend war. Niemand freilich wußte, daß ich so heiter war, weil ich eineinhalb Tage mit einem großen Theologen verbracht hatte … Ist das eigentlich ein Grund zur Heiterkeit?? Nachher in meinem Abteil (die anderen stiegen in Rovereto aus und schenkten mir noch eine schwedische Puppe) sprach mich ein Deutscher an, ein Ornithologe, und wir waren bald mitten in einem theologischen Gespräch–, er ist »Pantheist« und außerdem glaubt er nicht an »Wunder«, und ich erklärte ihm erst einmal, was Wunder seien, und da er der Kirche vorwarf, sie kümmere sich nicht ums Soziale, mußte ich ihm auseinandersetzen, daß das nicht ihre Aufgabe sei, wohl aber eine ihrer Wirkungen, sofern sie aus der Befolgung des Gebotes der Nächstenliebe hervorgehe, und so fort. Der Mann war sehr beeindruckt, und ich glaube fast, ich habe ihm ein paar Lichter angezündet. Außerdem sage ich solchen Männern, die mich zuerst als moderne, interessante Frau sehen, daß ich jeden Morgen zur Messe gehe, – das frappiert sie. Ist das richtig? Sie sehen, ich nütze jede Gelegenheit, und wenn ich mir auch nicht einbilde, daß solche Leute sich nun zu unserer Kirche bekehren, so meine ich doch, daß der eine oder andere nachdenklich wird. Ich kann es nicht lassen, von diesen Dingen zu sprechen, – »sei es gelegen oder ungelegen«. So wie ein Verliebter immer von der Geliebten reden will auch zu Leuten, die das gar nicht interessiert, so muß ich von meiner großen Liebe reden.
Bitte sagen Sie dem Fr. Wachtler, der mir den Brief schrieb, ich würde ihm bald antworten. Ist es der, der uns vor der Diskussion an der Pforte begrüßte? Und jetzt hoffe ich, daß die liebe Verwandte »net alle Tag’ kommt«, ich möchte sogar wünschen, daß Sie in etwa einer Woche denken: »Die Luise (oder wie nennen Sie mich in Ihren Gedanken?) war aber schon lang net mehr da«… Allen Ernstes wünsche ich Ihnen – bei aller schwebenden Heiterkeit und Freiheit unserer Beziehung –, daß Sie ein wenig Heimweh nach mir haben. So eine bin ich!!! Ist das schlimm oder bloß dumm oder ist es gut? Jetzt wird es aber Zeit, daß ich aufhöre mit dem unmöglichen Nachtgespräch, – es ist zwei Uhr.
Ihre, im Augenblick noch auf einen Namen Wartende.
P.S.: Meine Kinder nennen mich »Wuschel« oder »Wuscha« – siehe »Winnie the Pu.« M.A. nennt (nannte) mich Maria – die Hälfte seines Namens. – Ihnen bleibt ein weites Feld!)
Herzlich willkommen in der Heimat! Ein kleiner Gruß – im Zeichen des guten Grauen Bären, von dem wir beide jetzt weit weg sind. Aber er steht ja auch als sehr großer Bär am Himmel, beiden sichtbar!
Roma, 29.3.62
Anrede am Schluß!!
(Wenn ich doch wüßte, ob Sie wirklich meine Handschrift schwer lesen können und ob es Ihnen lieber ist, wenn ich mit Maschine schreibe! Sagen Sie es mir ehrlich!)
Dank für Ihren Brief, der da heute so unerwartet zu mir kam. Nie im Leben hat mir eine österreichische Briefmarke Herzklopfen gemacht – nie vorher, meine ich. Aber wir zwei, wissen Sie, wir sind sonderbare Leut: Immer meint eines von uns, es hätte vielleicht zuviel gesagt und damit dem anderen ein wenig Schwierigkeit bereitet. Ich glaube, wir müssen so rasch wie möglich lernen, daß wir einander voll vertrauen dürfen, das heißt, daß wir einander zutrauen, alles, alles zu verstehen, was der andere sagt, und zwar mit allen Hintergründen und unter allen Beleuchtungen. Abgemacht? Wenn Sie neulich sagten und auch schrieben, daß Sie unbegrenzt Lob und Ermunterung vertrügen, so sage ich Ihnen jetzt, daß ich unbegrenzt Zärtlichkeit und derlei, wie immer Sie es nennen mögen, vertrage. Ich habe Ihnen gegenüber darin ja auch keine Hemmungen, einfach aus dem Gespür heraus, daß Ihr Herz genau so groß ist wie Ihr Verstand, Ihr Geist. Wenn Sie können, sagen Sie mir viel Liebes, und haben Sie mich lieb (wenn Sie Zeit und Lust dazu haben …) Ich will Ihnen auch Liebes sagen und tun, denn vielleicht brauchen auch (sogar!) Sie das. Sie sind ja nicht so dumm und verbohrt wie M.A., der glaubt, dem lieben Gott etwas wegzunehmen, wenn er seine Gefühle für mich eingesteht, und der glaubt, ich betrüge den lieben Gott, wenn ich jemand Irdisches liebe. Saudumm. Ich kann Ihnen aber, falls Sie je eine ähnliche dumme Versuchung hätten, sagen, daß ich inmitten meiner starken Freude über Sie dem lieben Gott in aller unmißverständlichen Deutlichkeit und ohne mit der Wimper zu zucken angeboten habe, ER (freilich nurER) dürfe, nein müsse Sie mir wieder wegnehmen, falls meine Liebe zu IHM dadurch auch nur die leiseste Einbuße erlitte. Und das würde ER zweifellos tun, denn wir, der liebe Gott und ich, verstehen uns darin sehr gut, und ER macht nicht lange Umstände, wenn IHM etwas nicht paßt an mir. ER hat mir schon verdammt viel weggenommen, so daß ich jetzt volltrainiert bin in der sacra indifferentia wie ein alter Jesuitenzögling. Sie haben es nämlich – ich weiß nicht, ob Sie das bereits bemerkt haben, mit jemand’ zu tun bekommen, der zwar sehr lieb ist oder jedenfalls sein kann, der aber ebenso hart sein kann (eher freilich zu mir als zu anderen), wenn es um Gott geht. Aber da es Ihnen um dasselbe geht, kann da nichts passieren, und wir dürfen unser junges Gefühl füreinander seelenruhig uns zeigen. Wissen Sie, bei unsereinem (darf ich so sagen?) ist es so, daß alles letzten Endes IHM zugute kommt und von IHM gesteuert wird – denn Menschen, die bewußt IHM gehören, stehen ja unter seiner direkten Leitung. Sie sehen, was für Einbildungen in bezug auf mich ich habe, und vielleicht müssen Sie einmal in priesterlicher Funktion mich ausschimpfen meiner Liebesgewißheit wegen – ich meine, meiner Gewißheit wegen, von IHM geliebt zu sein. Aber wenn ich Ihnen eines Tages (und auf diesen Tag freue ich mich) erzählen darf, was mir so auf diesem Gebiet, das man etwa das »mystische« nennen kann, passiert, dann werden Sie mich entweder für leicht verrückt halten oder aber – ich weiß nicht – jedenfalls das oben Gesagte verstehen. Überhaupt, nebenbei gesagt, habe ich Sie als Priester lieb, und ich könnte mir vorstellen, daß ich bei Ihnen beichten würde und all das sagen, was mich in Ihren menschlichen Augen herabsetzen würde.
Für Ihren Bruder bete ich, daß ihm sein Leiden zur letzten Läuterung verhilft. Ist’s recht so? Und für Sie, da bete ich zum Heiligen Geist, dessen Liebling Sie sind. Der erwartet noch allerhand von Ihnen!! Auf Ihre Sendung freue ich mich. Sie tun sich leichter mit der Lektüre meiner Sachen. Rahners Theologie braucht viel Einarbeitung, kann ich Ihnen sagen.
[…]
Was das »Kein-Vater-Sein« anlangt: Nehmen Sie meine Kinder oder einen davon! Freilich, es ist halt nicht das Rechte. Darunter leidet auch M.A. bitter. Das ist weit schwerer als ohne Frau zu sein, nicht wahr?
Vergessen Sie nicht, Ihre Mutter sofort nach Ihrer Geburtsstunde zu fragen! – Und nun eine Bitte: Schicken Sie mir ganz gleich sofort irgendetwas, das Sie viel bei sich tragen, ein Kreuzchen oder meinetwegen ein Taschentuch (es muß nicht unbedingt gebraucht sein), oder sonst etwas von Ihnen-Selbst, das ich mit mir nehmen kann auf die Reise und immer bei mir tragen als Segenszeichen. Sie sagen selbst im letzten Brief, je älter man wird, desto weniger abstrakt soll man sein. Also denn!! Ich lerne alles von Ihnen. Eben, abends, kamen Ihre Schriften. Wie lieb von Ihnen! Ich werde dann, wenn ich alles gelesen habe, bei Ihnen promovieren …
Der Gruß nach Freiburg sollte ein doppelter sein, aber ein Teil kam wohl nicht mehr in Innsbruck an: Das neue Buch und noch ein anderes, und für den Empfang in Freiburg ein Blumenstrauß (ich hoffe, die Person, die ich beauftragt habe, hat’s gut gemacht.)
Bitte, schreiben Sie mir nach Israel, schreiben Sie mir sehr viel Liebes (wenn’s irgend geht), und zwar bin ich am 18. in Jerusalem, schreiben Sie bitte »eingeschrieben« (ich fülle Ihre Portokasse nachher wieder auf), Luftpost und eingeschrieben, denn das ist sicherer, und ich könnte es schwer ertragen, einen Brief von Ihnen verloren zu wissen.
[…]
Der Brief hat keine Anrede. Ich weiß keine. Die, die mein Herz bisweilen gebraucht, vor allem im Gebet, die sag ich nicht (noch nicht). Pater Dold sagte einmal, ehe ich Sie kannte, er habe mit dem »Rahner-Karli« studiert. Das ist auch hübsch, aber ich weiß was anderes.
Ihr Wuschel
Ich begann in der »Hominisation«[9] zu lesen. Das liest sich aufregend, und ich bin ganz gebannt. Ich las bisher Teilhard de Chardin nicht, nur einiges über ihn, und da sind diese Fragen alle sehr interessant für mich geworden. – Eben habe ich auch angefangen, die »Dogmatischen Erwägungen über das Wissen und Selbstbewußtsein Christi«[10] zu lesen. Wenn man sich in Ihren Stil (auch Denk-Stil – und der ist ja derselbe wie der Sprech- und Sprach-Stil, bei Ihnen jedenfalls) eingelesen hat, liest man das alles relativ leicht, und ich bin ein ganz zu- und vorbereiteter Boden für all das, was Sie sagen.
Neulich fiel mir etwas ein: Vielleicht ist das Christentum deshalb so »manichäisch« (durchsetzt), weil wir Christen, ebenso zur Lustbefriedigung neigend wie alle anderen, dennoch (erbsündlich bedingt) stellvertretend am großen Bruch von Leib-Seele-Geist leiden müssen. Uns ist schmerzhaftes Problem (theoretisch wie praktisch, theoretisch vielleicht noch mehr), was anderen ganz entfernt ist: sie lösen die Frage »spielend« im Nicht-Sehen der Frage!
[…]
Manchmal überflutet mich ein zarter Wasserfall von Glück, darüber, daß Sie da sind, für mich so da sind, so nah, so brüderlich. Solche Begegnungen, die man, wäre man jünger, nur mit Komplikationen erlebte, sind in unserem Alter dagegen das reine Glück. Ich hoffe so sehr, daß auch Sie es so empfinden. Manchmal, flüchtig, wie eine aufsteigende Träne, tut es ein wenig weh, daß Sie soweit weg sind. Ich bin halt ein »inkarnierter« Mensch, eine inkarniert Liebende. Macht’s was???
Sagen Sie: Neulich am Telefon, da war mir’s, als ob Sie deutlich, sogar zweimal, gesagt hätten: »Nein, nein, das mußt Du nicht denken …«. Das war sehr süß. – Mögen Sie das Wort »süß«? Douce, dolce, soave, sweet … es ist schön, finde ich, wenn man’s der heutigen Banalität wieder entkleidet. Ich finde, es paßt auf unsere Beziehung. Lachen Sie mich nicht aus – aber in Ihnen ist so viel Poesie –, das wissen Sie ganz sicher nicht.
Ich bin bei Ihnen, soviel Sie’s mir erlauben.
Ihr Wuschel
Ganz Mensch geworden
Nun sag ich das erste Mal »Du«, und das ist ein feierlicher Augenblick. Dieses Du macht mir Herzklopfen, obgleich es doch so selbstverständlich ist zwischen uns, und vom allerersten Augenblick an »da« war, ur-vertraut. Ach, mein lieber Fisch (weil Du doch im Zeichen des Fisches – Eucharistie! – geboren bist), Rahner-Karli, oder Carlo, oder wie magst Du von mir genannt sein? (Es gibt auch einige nicht-schreibbare Namen). Wie glücklich macht mich das! Du brüderliches Herz, Du unerwartetes Gottesgeschenk! Du sagst, Du seist alt und müde. Du bist’s nicht; nicht alt, nicht herzensmüde, Du bist nur erschöpft von vieler Arbeit. Aber in Dir ist viel Junges, sogar Bubenhaftes, viel aufgesparte Liebeskraft auch. Gestatte es Dir ruhig und mit Vertrauen und Freude, Dein Herz mir zu zeigen. Ich tu’s ja auch, denn ich bin »ganz daheim« bei Dir.
Bei Dir bin ich daheim, bei mir (zur Zeit) weniger, ich lebe in einem Wirbel von Arbeit, Besuchern, Post, Laufereien aller Art (vier Visa brauche ich zuletzt: Libanon, Syrien, Jordanien, Israel. Jetzt habe ich sie endlich alle zusammen –, es bedeutete stundenlanges Warten in den Konsulaten!)
[…]
Ach, Fisch, mein Herz ist so voll von Dingen, die ich Dir sagen möchte, aber ich kann’s nicht. Du müßtest hier sein. Ich würde Dich anschauen, in Deinen guten, schönen Augen versinken und schweigen, und Du wüßtest alles. Ich wünsche fast (nein: wirklich), ich wäre schon wieder zurück aus Israel und dürfte nach Innsbruck fahren … Dank für den Rosenkranz!
Das war lieb von Dir. Ich leg Dir was Winziges bei, vorläufig, bis ich was Besseres finde: ein Kreuz –, Du wirst’s schon recht verstehen: M.A. ist mein Kreuz –, trag’s Du mit mir, dann ist’s leichter. Es ist wunderbar, daß Du da bist jetzt. Niemals vorher habe ich dieses Daheim-Sein-Gefühl erlebt, dieses schwebende, ruhige, starke Gefühl.
Ich will Dich nie quälen mit Theologie. Du sollst bei mir ausruhen dürfen von allem. Laß mich einfach warm sein und hilfreich, leicht und heiter. Und arbeit nicht zuviel. Du bist ein bißchen besessen, weißt Du das? Ich möchte, daß Du Deiner Arbeitswut Einhalt gebietest, ganz souverän. Ich bin nicht dafür, daß man sich schont, das meine ich nicht. Aber ich habe erfahren, daß man Sklave der Arbeit werden kann, und auch hierin ist das Maß, die discretio, wichtig. Sonst kommt man in einen großen Automatismus hinein. Da ist Deine Gefahr: daß Dein Intellekt einfach mit Dir durchgeht wie Vollblutpferde, und diese Pferde tun, was sie wollen, statt daß Du einmal sie laufen, einmal sie stille stehen läßt. Darf ich das sagen? Es gibt doch eine Psycho-Hygiene. Du sollst einmal Ferien machen. Auch ich sollte es. Gehen wir halt einmal miteinander wohin, wo man das kann. (Es geht ja niemand’ was an.) Ich habe seit zwölf Jahren niemals Ferien gehabt. Wir sollten ein wenig aufeinander aufpassen, wir zwei.
(Ich red wie eine alte, nüchterne Ehefrau … Aber das gehört auch dazu.)
[…]
Du meinst, ich darf ruhig daran glauben, daß Gott mich liebhat auf eine vielleicht ein wenig besondere Weise? Wie gerne möchte ich glühen vor Liebe zu IHM, aber das kann man nur, wenn er einem die Gnade dazu vorher gibt! Bisweilen, nach der Kommunion, erfahre ich das (als Geschenk aus heiterem Himmel, oft in eine tiefe Morgenmüdigkeit hinein, ganz unerwartet), und das ist zum Sterben schön, und ich weiß dann ahnungsweise, wie es ist, bei IHM zu sein. Aber einmal, als ich es nicht erfuhr und es haben wollte, »hörte« ich deutlich einen Satz, der gewiß nicht von mir stammte: »Du sollst Gott nicht genießen – Du sollst ihn erleiden.« – Wenn ich davon rede, wird mein Herz viel zu eng. – Weißt Du: Ich kann nichts mehr lieben als IHN, und das, was in IHM ist mit mir. Daß Du da bist, ist so schön nur deshalb, weil wir uns in IHM treffen. Aber Du mußt nicht denken, daß ich Dich nicht einfach auch »menschlich« lieb hätte! Doch von einer gewissen Stufe ab fällt das eben zusammen. – Ja, was ist Liebe, lieber Fisch??? –
Ich hab dich wirklich von Herzen lieb. Wenn Du meinst, andere »überrundeten« Dich wissenschaftlich, so glaub ich nicht daran, denn Du bist der schöpferische Geist, und die anderen leben von Dir. Ich glaub’s fest, ich kann das beurteilen, wenn’s auch anmaßend klingt. Du mußt aber daran nicht denken, es ist gleichgültig, denn man gibt ja immer nur weiter, man fügt ein paar Glieder an eine Kette, die uns übergeben wurde und die wir weitergeben. Man muß nicht an der eigenen Leistung hängen. Aber das tust Du ja gar nicht. –
[…]
Mein Gott, wie bin ich glücklich bei Dir, mit Dir, mein lieber Fisch. Fühl meine ganze Wärme, fühl wie leuchtend Du in mir bist (ich kann’s nicht besser sagen). Ich werde im Hl. Land intensivst für Dich beten. Bet nur dafür, daß in Erfüllung geht, worum ich Gott bat – um nichts sonst, als um dies: daß kein Mensch, der in irgendeine Beziehung zu mir tritt, verloren geht. – Ist das vermessen? Dir soll der Heilige Geist große Erkenntnisse geben und die Kraft, sie uns mitzuteilen.
Nun werd ich vielleicht zu allerletzt vor der Reise noch einen Gruß schreiben (Dank übrigens für Deine Karte!) und dann erst wieder aus Jerusalem (dann nach Innsbruck). Vergiß mich nicht …
Und fühl Dich nicht mehr alt und sterbensmüde!
Ich hab Dich lieb. Mein Herz fühlt eine steigende Flut von Dankbarkeit.
Dein Wuschel
P.S.: Ist ein Wuschel masculin, grammatikalisch? Die Kinder sagen: das Wuschel. Aber wie Du meinst!)
Lieber Fisch,
ich sollte eigentlich an so einem Abend nicht schreiben, weil ich da »Dummes« sage. Untertags bin ich heiter, ich habe sogar einen neuen Elan durch Dich. Aber abends, müde und doch noch viel zu wach um zu schlafen, da hab ich halt – darf ich’s sagen? – ganz leise?! – ja, da hab ich Heimweh nach Dir.
Ich lese Deinen Brief drei-, viermal, immer den einen Satz (davon, daß Du dankbar bist, weil Gott mich Dir geschickt hat; – und dem vom »neu geschenkten Lebensgeist mit wahrem Inhalt«, wie Du schriebst); und jedesmal klopft mein Herz so sehr, daß es fast wehtut. Was ist denn das mit uns, sag?
Ja, was ist das Herz? Denkst Du denn auch so an mich? – Ich möchte jetzt weinen, weil ich nicht zu Dir darf, sondern so weit weg fliegen muß. Magst Du das Foto? Da schau ich Dich an, wie eben ein Wuschel schaut, schwermütig, vertrauensvoll und doch zögernd, – ob Du’s nicht verjagen wirst.
Weißt Du, es kam nicht von ungefähr, daß ich gerade über Schwermut einen Aufsatz schrieb. Laß mich nimmer allein, Fisch! Ich bin so leidensfähig, – genauso sehr freilich fähig zur Freude. – Wirklich, Du darfst mich nicht mehr allein lassen. Ich bin ziemlich stark und tapfer und auch gelassen, sogar klug, aber irgendwie bin ich eben ein Wuschel, das liebgehabt werden will. Ich werde geliebt, ja, von M.A., aber so hart, so heftig, so aggressiv, so freudlos auch, glaub ich, (ich weiß aber nicht recht); jedenfalls so unerlöst liebt er mich, eben als Mann nur, nicht als reifer Mensch. Und ich möchte so geliebt werden wie ich liebe: ruhig und stark und treu und ohne Skrupel, »schwebend in IHM«. Du, Fisch, kannst so lieben. Im Lichte lieben. Mit dem Vorgeschmack des Neuen Aion. Meinst Du, es ist so zwischen uns? Diesen Brief schicke ich nicht ab, den bekommst Du in München in Deine Hände, und ich schau Dich an dabei. Jetzt wein ich vor Heimweh, Fisch!
Lieber Fisch,
ich bin jetzt eigens zum Telegrafenamt gefahren, um ein Telefonbuch von Freiburg zu finden, es gibt eines, oh Wunder, aber das Vinzentiushaus ist nicht darin. Wie gibt’s denn das? Ich hab mir die Adresse (Tel.Nr. ) Deines Bruders und die von Herbert Vorgrimler rausgesucht und versucht, einen der beiden zu kriegen, ma nessuno risponde. Was ist denn da los? Soll ich Deine Stimme vor der Reise denn nimmer hören? Und ich hab doch so Heimweh! Ich mag gar nicht fahren, hörst Du?! Ich hab gemeint, es käm noch ein Briefchen vor der Reise, aber wahrscheinlich hast Du den meinen abgewartet und – oder – bist in Genf oder was weiß ich.
Ach, mein lieber Fisch, was ist denn das: daß ich auf einmal nichts mehr will als nach Freiburg (oder Genf oder wo Du eben bist) zu fahren … Was hast Du denn mit mir getan? Verhext hast Du mich, Du Magier, der nicht wußte, daß er einer sei. Gestern abend hab ich Dir einen Brief geschrieben, den ich nicht abschicke, den kriegst Du vielleicht im Mai, wenn wir uns sehen. (»Komm lieber Mai und mache – die Bäume wieder grün –, daß ich nach Innsbruck küm.«)
Kennst Du die Melodie dazu? Kinderlied – paßt also für Dich und mich. Ich mein’s ernst: Wir sind in einer Hinsicht Kinder: spontan, vertrauensvoll, ohne Berechnung, glücklich über den Augenblick, liebevoll auch, und wir möchten spielen, sehr heiter. Was für ein Spiel ist’s denn, lieber Fisch? Weißt Du es?
Schreib mir nach Petah-Tikwah, Dr. A. Frankenstein. – Schreib mir, bitte. Laß mich nicht allein. Nie, nie, nie mehr. Du mein liebes Licht.
Nun sag ich nichts mehr als: auf Wiedersehen, und: Bet für mich, vergiß mich nicht, schau halt meine Augen an auf dem Foto –, es sind Wuschel-Augen.
Sehr Dein Wuschel
Eben las ich Deinen Aufsatz »Weihnacht und die Kraft des Glaubens«. Ich bin ganz aufgeregt davon, weil Du da die schwierigsten Dinge in einer gelassenen Selbstverständlichkeit hinsagst, wie ein Mathematik-Genie etwa das Problem der Quadratur des Kreises approximativ löst, so aus dem Handgelenk! Du denkst ungeheuer leicht, und alles ist durchleuchtet, darum leuchtet’s ja auch sofort ein. Und wie gut Du schreibst, dort, wo Du nicht aus begreiflichen Gründen hundert Einschachtelungen machen mußt, was dann etwas beschwerlich zu lesen ist. Aber bei so »ungefährlichen« Fragen schreibst Du mit einer trockenen Eleganz. – Im Schreiben wie im Leben bist Du ganz Du – das trifft auch für den Gedanken zu. Aber ich, Wuschel, kenne darunter auch Deine Poesie!!! –. Das ist sehr schön, aufregend schön! Wie sicher, aber bescheiden Du die Psychologie in ihre Schranken verweist! Ich, von eben der Psychologie herkommend, bin glücklich zu sehen, daß Du der Gnade einen so viel größeren Raum läßt, als es viele andere tun (die anderen reden nur, theoretisch, davon, bei Dir ist’s Vollzug.) Ich bin stolz und glücklich, daß Du bist, der Du bist!
[…]
Lieber Fisch,
Dein letzter Brief begann mit den Worten »Kannst Du Dir vorstellen« –; also: kannst Du Dir vorstellen, wie ein Wuschel, ein sehr beherztes Tier, allein sitzt? Es hat mich nämlich keine Reisegesellschaft erwartet, wie ich dachte, sondern ein ungeheuer schöner Mann von 35 Jahren, der mich »in die Hand nahm« und über mich verfügte. Mit seinem Chauffeur, einem lieben, sanften, dummen Mann, schickte er mich nach Byblos, und nachmittags kreuz und quer durch die Stadt Beirut, und dann kam der schöne Mann wieder und erzählte mir, ich könne nicht nach Damaskus, und ich könne überhaupt jetzt nicht nach Jerusalem, weil für fünf Tage (mindestens) alle Flugzeuge überfüllt sind, da es ja keinen anderen Weg mehr gibt nach dort, weil man durch Syrien nicht kann der Revolution wegen, sondern nur über Syrien hinweg mit Flugzeug. Was tun? Er meinte kühn, ich sollte eben hierbleiben; er hatte eine Deutsche zur Frau gehabt, aber die trieb Spionage für die Juden und wurde von der Regierung abgeschoben nach Hause, und er trauert ihr nach. Nun: Was soll ich 5–10 Tage hier? So schön ist’s auch nicht. Ich sagte ihm, ich müsse nach Jerusalem, und zwar morgen oder übermorgen, und er soll was für mich tun. Ich machte meine schönsten Augen. Nun, er ging telefonieren mit irgendeinem hohen Tier – und während er telefonierte, betete ich zum Hl. Pius und noch zu einigen anderen, und plötzlich hatte ich die Zusage, und zehn Minuten später das Billet für ein Charter-Flugzeug außerhalb der normalen Flüge. Und so ist alles gut. Morgen früh fahren wir noch nach Balbeck, dann gleich zum Flughafen, und um drei Uhr nachmittag bin ich auf der terra sancta. – Byblos ist schon recht interessant. Ein arg heidnischer Platz: Tempel für Baal, Astarte und Adonis, und man feierte im Frühling hier das Fest. Ich fand einen Ysop, zum ersten Mal lernte ich ihn kennen (Besprenge mich mit …). Ich stellte ihn mir vorher als besseren Weihwasserwedel vor, aber es ist eine Blume wie etwa eine niedrige Königskerze, gelb blühend, mit einem ganz, ganz zarten Duft. – Auf den Bergen liegt ein klein wenig Schnee, aber hier ist’s sehr warm, sommerlich, viel wärmer als in Rom. Die Leute sind sanft, mit Rehaugen, die Mädchen schön, die Männer auch; aber als ich gestern abend ahnungslos ein bißchen zwischen Hotel und Meer spazieren ging, allein (hundert Meter etwa) da hielten immer Autos mit Männern – und so ging ich denn eilends ins Hotel zurück. Ja, ja, ein Wuschel allein im Libanon! Wärst Du doch da! Ich erlebe alles mit Dir zusammen. Ich freue mich so aufs Wiedersehen. Warum bin ich hierher gegangen statt nach Freiburg? (Weil Du in Freiburg keine Zeit für mich hättest, nur deshalb!)
Dein Wuschel
Lieber »Fisch«,
ich hoffe, diese Karte erreicht Dich noch zu Ostern: Ich bin tief bewegt von allem, was ich hier sehe und berühre. Gestern machte ich die große Prozession mit. (Es ist der Weg, den Jesus ging von Bethanien nach Jerusalem.) Heute kniete ich lange an der Stelle, die das Bild zeigt: Unter dem Altar, die Vertiefung im Fels, in der das Kreuz steckte. Ob’s so ist oder anders: Ich fühle, daß es wahr ist. – Übermorgen bin ich in Israel und hoffe auf einen Brief von Dir. – Du bist immer und überall bei mir. Fühlst Du’s?
Dein Wuschel
Lieber Fisch,
es ist wie ein Traum: Ich sitze vor einer Balkontür in einem Hotel außerhalb Jerusalems, hoch auf einem Berg, etwa 900 m hoch, und wenn ich meine Augen von diesem Blatt hebe, sehe ich im Tal und auf den gegenüberliegenden Hängen Jerusalem, das neue und das alte, Israel und Jordanien, getrennt durch einen dunklen Streifen Niemandsland. (Ich bin in Israel nun.) Es ist Vollmond, und gerade vor dem Schreiben habe ich einen Gang über den Hügel gemacht, allein (was nicht jedermanns Geschmack ist in so fremdem Land, in völliger Einsamkeit, denn das Hotel liegt weit ab von allen anderen Behausungen), der Mond stand und steht gerade über Jerusalem.
[…]
Ich kam von Tel Aviv und wußte nicht, wo ich einen Karfreitagsgottesdienst finden würde – und da hörte ich, daß auf dem Zionsberg bei den Benediktinern einer sei, ich kam genau zurecht. Es war schön. Es sind deutsche Benediktiner, und obgleich es ein arg kleiner Convent ist, war’s doch »richtig«. Der Abt ist fein, ich lernte ihn nachher durch Zufall kennen, als ich – wieder durch Zufall – ins Gespräch mit einem (jüdischen) Benediktiner kam, der meinen Aufsatz über die tristitia gelesen hatte und mich dann mit dem Abt bekannt machte, der wiederum mit M.A. in Rom studiert hatte … Kleine, kleine Welt. – Morgen, Osternacht, werde ich wieder dort sein. Und jetzt beim Spazierengehen, war ich voller Sehnsucht – ich dachte, der Herr müsse mir begegnen auf dem Hügel. Ich rief »Rabbuni«, aber ER kam nicht, und ER sagte mir, ER sei doch viel näher bei mir als ER’s sein könnte, käme er jetzt des Weges (ich war ja bei der Kommunion gewesen); aber so bin ich halt, so dumm, daß ich IHNsehen