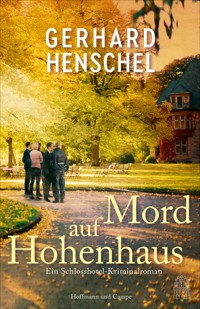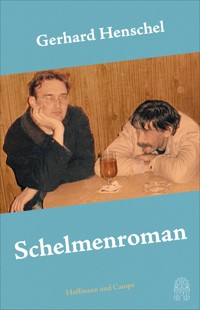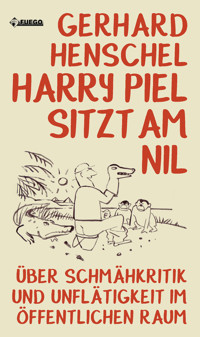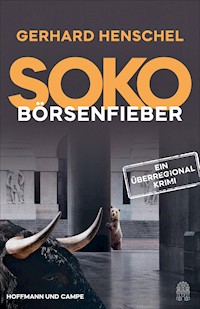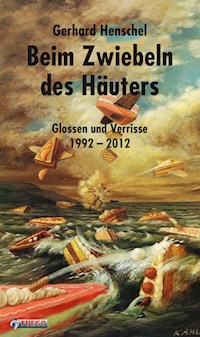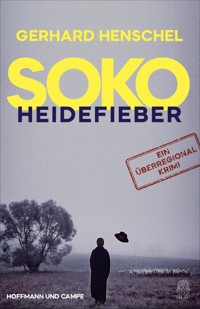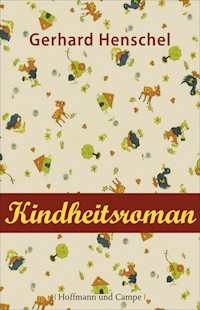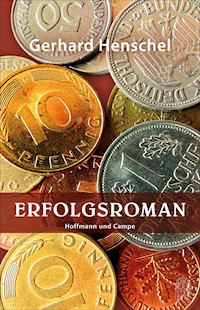22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Martin Schlosser
- Sprache: Deutsch
Y2K-Panik, Debatte um die Einführung des Dosenpfands, Michael Schumacher wird Weltmeister. Und wie ergeht es Martin Schlosser um die Jahrtausendwende? Den zieht es in die Großstadt, nach Hamburg, wo er mit dem Journalisten Rayk Wieland die Veranstaltungsreihe "Toter Salon" ins Leben ruft, die erst im Hamburger Schauspielhaus und dann im Thalia Theater auf großen Bühnen steht. Und seine Literaturkarriere startet endlich richtig durch, als er bei einem gewissen Hamburger Verlag namens Hoffmann und Campe seinen ersten Buchvertrag unterschreibt. Doch das Leben besteht nicht nur aus Arbeit, das weiß auch unser Held, der erst Hochzeit und dann die Geburt seines Sohnes feiert. Das 21. Jahrhundert verspricht, ein gutes zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 760
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Gerhard Henschel
Großstadtroman
Roman
Großstadtroman
Spaghetti mit Meeresfrüchten und Knoblauchsoße, dazu Feldsalat mit Kürbiskernöl und zum Nachtisch Vanilleeis mit heißen Himbeeren: So sah das Menü aus, das ich uns servierte, als Hege von ihrem letzten Arbeitstag im Lüneburger Verlag zu Klampen zurück nach Hamburg gekommen war. Sie hatte dort ein Vierteljahr lang volontiert und war jetzt erst einmal arbeitslos.
»Hättest du nicht lieber drei Kinder von mir als ’n neuen Job?« fragte ich sie. »Ich meine, ich möchte mich nicht dazu verpflichten, monogam zu leben, denn dazu besteht ja keine Notwendigkeit, aber ich würde schon gern ’ne Familie gründen …«
Darüber lachte sie nur, obwohl wir gut zusammenpaßten. Freier Schriftsteller (36) und freie Lektorin (32), beide ungebunden, aus gutem Elternhaus und leicht neben der bürgerlichen Normalspur: Das waren doch keine schlechten Voraussetzungen für ein gemeinsames Leben mit Kindern.
Will you come into my life
With your sorrow and your black carriages …
Aber das konnte ja auch noch später entschieden werden.
In der taz äußerte die Soziologin Sibylle Tönnies ihren Neid auf alle Vertreter der seit ein paar Tagen regierenden rot-grünen Koalition:
Sie sind uns so nahe, daß es geradezu beißt, nicht dabeizusein – wenn sie da so ungezwungen vor den Kameras rumlaufen und Interviews geben – das könnte man doch genausogut selber sein … vielleicht hätte man sich doch etwas mehr engagieren sollen …
Und das dämpft unsere Begeisterung: Wenn wir sehen, daß es sich um unsere eigenen Leute handelt, die da oben agieren, stellt sich die Frage, ob sie nicht schon genauso korrupt sind wie wir selbst.
Ja, war Sibylle Tönnies denn korrupt? Und weshalb hatte man ihr dann kein Ministeramt verliehen?
Hege wußte, daß ich auch eine Freundin in der Schweiz hatte, Rachel, und ich hatte ihr auch von meiner verflossenen Liebe zu Sonja erzählt, die in Köln wohnte und mir noch immer nette Briefe schrieb, die ich auch beantwortete, obschon sie mir deutlich zu verstehen gegeben hatte, daß ich nicht der Vater ihrer Kinder werden könne.
Aus diesem Kuddelmuddel hatte ich noch keinen Ausweg gefunden.
Mehrmals versicherten der Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein und der Schriftsteller Martin Walser einander im Spiegel, daß sie einem ganz normalen Volk angehörten. Augstein:
Sind wir Deutschen wieder ein ganz normales Volk – ich habe das ja auch schon geschrieben –, oder wünschen wir uns das nur, als ältere Zeitgenossen?
Walser:
Nach meiner Kenntnis ist von diesen Menschen, die ich durch all diese Jahrzehnte kenne, nichts mehr zu befürchten. Abgesehen davon, daß einer Bevölkerung, die das einmal hinter sich gebracht hat wie die Deutschen, so etwas nie wieder passieren kann. Das ist so. Das ist eine Immunisierung.
Augstein:
Wir sind ein normales Volk, das Probleme hat, die andere Leute auch haben. Und damit müssen wir anständig umgehen.
Walser:
Du hast jetzt schon zum zweiten Mal gesagt, wir seien ein normales Volk. Ich hoffe, deine Mitarbeiter werden dir solche Unkorrektheiten nicht durchgehen lassen. Aber daß wir gern ein ganz normales Volk wären, das wenigstens wird man doch ungescholten wünschen dürfen.
Das Verlangen, endlich als normal anerkannt zu werden, war jedoch bestimmt nicht normal. Normale Menschen hätte darüber gar nicht erst debattieren müssen.
Sonja schrieb mir, was sie alles an den Hacken habe, nämlich unter anderem einen kräftezehrenden Großeinkauf bei Ikea und das Hinaufschleppen von Möbeln mit 200 Kilogramm Gesamtgewicht, und es stünden noch viele andere zeitraubende Dinge auf der Agenda.
Wenn Du mich unter diesen Umständen immer noch einladen willst – bitte. Ich befürchte nur, dieser Besuch wird irgendwann im Jahr 2000 stattfinden.
Wenn sie mich damit vor den Kopf stoßen wollte, war es ihr geglückt.
Der lange Marsch der 68er durch die Institutionen zeigte jetzt endlich Wirkung: Ein Motoröl wurde mit dem Schlagwort »Revölution« beworben und ein »Traumobjektiv für ultimativen Fotospaß« mit dem Schlagwort »Revoluzoom«, während eine Chemiefirma für ein »Anti-Floh-Präparat« mit dem Schlagwort »Rehflohlution« Reklame machte.
»In der DDR haben wir uns das bis zum Mauerfall natürlich anders vorgestellt«, sagte der konkret-Redakteur Rayk Wieland, als wir einen hoben, und er zuckte zusammen, als ich ihm mitteilte, daß die Liste der Literatur, die ich für mein Buch über das sexuelle Neidmotiv im Antisemitismus heranziehen wollte, mittlerweile fast einhundert Seiten lang sei.
»Und wie viele Titel stehen auf jeder Seite?«
»Rund dreißig.«
»Das heißt, daß du noch mindestens dreitausend Bücher exzerpieren mußt«, sagte Rayk. »Viel Vergnügen!«
In Arbeit war auch das Buch »Jahrhundert der Obszönität«, kurz JdO, in dem Eckhard Henscheid und ich Rückschau halten wollten. Seine jüngste Auskunft dazu lautete:
Hinsichtlich JdO hab ich mir den neuen »Spiegel« gekauft – das Säkulargespräch Augstein–Walser (beide bsuffn?) mir aber noch nicht zumuten können/wollen.
Den Verdacht, daß Augstein und Walser bei ihrer Plauderstunde nicht völlig nüchtern gewesen waren, hielt ich für berechtigt.
Mit einem Bombenanschlag in Jerusalem hatten die islamistischen Terroristen der im Gazastreifen beheimateten Hamas die Ratifizierung eines neuen Friedensabkommens zwischen Israel und dessen Nachbarländern verzögert. Aber wollten denn nicht auch die Palästinenser im Gazastreifen im Frieden leben? Anstatt sich in einen Heiligen Krieg hineinziehen zu lassen, der nur mit dem Untergang aller Bewohner des Nahen Ostens enden konnte?
»Sie haben innerhalb weniger Tage Ihren Staat granatenhaft vergurkt«, rief der FDP-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Gerhardt dem neuen Kanzler Gerhard Schröder nach dessen Regierungserklärung im Bundestag zu.
Ob Gerhardt sich für diesen Quatsch danach wohl schämte?
Fragen über Fragen. Von allen verkaspert zu werden, so wie Jim Carrey als Truman Burbank in dem Spielfilm »The Truman Show«, und das ganze Leben erweist sich als eine Farce zur Belustigung hämischer Zuschauer: Wie steckte man das weg?
In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nahm der Sozialdemokrat Klaus von Dohnanyi Stellung in dem Streit, der entbrannt war, nachdem Martin Walser in der Frankfurter Paulskirche das öffentliche Gedenken an den Holocaust als kaum noch erträgliche »Dauerpräsentation unserer Schande« bezeichnet hatte und deswegen von Ignatz Bubis, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, angegriffen worden war.
Mir scheint: Walser hat recht. Bubis hat ihn nicht verstanden. Vielleicht auch gar nicht verstehen können. Denn Walsers Rede war die Klage eines Deutschen – allerdings eines nichtjüdischen Deutschen – über den allzu häufigen Versuch anderer, aus unserem Gewissen eigene Vorteile zu schlagen. Es zu mißbrauchen, ja zu manipulieren.
Sollte das heißen, daß Walsers Klage nur von reinrassigen Ariern verstanden werden konnte? Und wann und wie genau hatte jemand versucht, Klaus von Dohnanyis Gewissen zu mißbrauchen und zu manipulieren?
Darauf ging er nicht ein. Stattdessen riet er den Juden zur Selbstkritik:
Allerdings müßten sich natürlich auch die jüdischen Bürger in Deutschland fragen, ob sie sich so sehr viel tapferer als die meisten anderen Deutschen verhalten hätten, wenn nach 1933 »nur« die Behinderten, die Homosexuellen oder die Roma in die Vernichtungslager geschleppt worden wären.
Mit anderen Worten: Wir nichtjüdischen Deutschen sind es allmählich leid, daß die Nachkommen der ermordeten Juden sich einbilden, sie hätten sich nicht ebenso schäbig und verbrecherisch benommen wie unsere Eltern und Großeltern.
Von den zehntausend Mark, die meine einstigen Berliner WG-Mitbewohner sich 1993 von mir geliehen hatten, war einstweilen nur ein Bruchteil auf mein Konto zurückgeflossen, und nun hatten sie ihre Zahlungen eingestellt.
Ich hätte deshalb Krach schlagen können, doch mir war nicht danach.
Mit etwas Verspätung las ich Frank McCourts berühmten autobiographischen Roman »Die Asche meiner Mutter«, den Harry Rowohlt übersetzt hatte. Eine ärmliche Kindheit im Irland der vierziger Jahre, der Vater ein Trunkenbold, die Mutter ausgezehrt, die Not riesengroß … Und dann die Blamage, sich zu Weihnachten keinen Gänsebraten leisten zu können, sondern bloß einen Schweinskopf …
Mam sagt, sie hat Rückenschmerzen, ich soll den Schweinskopf tragen. Ich drücke ihn gegen meine Brust, aber er ist feucht, und als Zeitungspapier anfängt abzugehen, kann jeder den Kopf sehen. Mam sagt, ich schäme mich in Grund und Boden; die ganze Welt erfährt, daß es bei uns zu Weihnachten Schweinskopf gibt. Jungens von Leamy’s National School sehen mich und zeigen auf uns und lachen. Gottogott, schauts euch Frankie McCourt mit seiner Schweineschnauze an. Eßts ihr Yanks das immer zu Weihnachten, Frankie?
Als »Yanks« wurden die McCourts gehänselt, weil sie aus den USA remigriert waren.
Einer ruft dem anderen zu, hey, Christy, weißt du, wie man Schweinskopf ißt?
Nein, weiß ich nicht, Paddy.
Man hält ihn an den Ohren fest und kaut ihm das Gesicht weg.
Und Christy sagt, hey, Paddie, kennst du den einzigen Teil vom Schwein, den die McCourts nicht mitessen?
Nein, kenn ich nicht, Christy.
Der einzige Teil, den sie nicht mitessen, ist das Oink.
Wenn einem das nicht ins Herz schnitt, was dann? Und die Schmach vergrößerte sich bei jedem Schritt:
Ein paar Straßen weiter ist das Papier ganz weg, und jeder kann den Schweinskopf sehen. Seine Nase ist flach gegen meine Brust gedrückt und zeigt direkt nach oben auf mein Kinn, und er tut mir leid, weil er tot ist und die ganze Welt über ihn lacht. Meine Schwester und zwei Brüder sind auch tot, aber wenn über die jemand lacht, kriegt er von mir einen Stein an den Kopf.
Für mich war es dann doch bedeutend leichter zu verkraften gewesen, daß die Mittendorfs bereits Anfang der siebziger Jahre einen Farbfernseher besessen hatten und wir nicht.
Der russische Präsident Boris Jelzin hatte eine leichte Schlagseite, als er im Kreml dem Bundeskanzler Gerhard Schröder entgegenkam, und das Statement, das Schröder hinterher abgab, hörte sich etwas eigenartig an: »Ich habe einen sehr informierten, auch in Details informierten und aktiven Präsidenten vorgefunden …«
Was man im Kreml eben so vorfand. Konnten die da keinen gesünderen Greis mehr aufbieten?
Einen schweren Tag hatten die männlichen Zopfträger, als Wiglaf Droste in der taz mit ihnen ins Gericht ging:
Wenn ein Mann seine Haare zu einem Zopf bindet, ist das ein ernstes Signal an die Außenwelt. Der Mann möchte, wenn auch unbewußt, den Menschen etwas sagen. Durch seine Frisur hat sich der zopftragende Mann in eine optische Notrufsäule verwandelt und drückt ständig bei sich selbst auf den Knopf. »Helft einem, der sich selbst nicht mehr helfen kann! Bitte!« fleht es wortlos aus ihm heraus. »Ich bin scheiße, und jeder kann es sehen!«
Ich selbst kannte keine zopftragenden Männer. In meiner Peergroup gab’s die einfach nicht.
Sein Vorhaben, nach São Paulo umzuziehen, hatte mein alter Freund Hermann Gerdes aufgegeben. Als er mich besuchte, berichtete er von ganz anderen Dingen: Im Auftrag seines Arbeitgebers habe er sich neulich in einem sogenannten Assessment-Center einer vierstündigen Befragung durch eine diplomierte Psychologin einer Personalberatungsgesellschaft unterziehen müssen, bei der ermittelt werden sollte, ob er für eine Führungsposition geeignet sei. »Da wollte so ’ne Tante zum Beispiel wissen, was für ein Mensch mein Vater ist, welche Eigenschaften meine Partnerin haben sollte und welche Autoren mir gefallen. Ich hab kurz überlegt, ob ich da opportunerweise jemanden nennen sollte, der angesagt und politically correct ist, aber dann hab ich mir gedacht: ›Ihr könnt mich mal!‹ Und hab gesagt: ›Martin Schlosser.‹ Das sei ’n alter Freund von mir, hab ich noch schnell nachgeschoben. Die Tante hat sich den Namen notiert, und ich hab sie gefragt, ob sie den Autor kennt. ›Nein‹, hat sie gesagt. Der sei wohl nicht so bekannt. ›Doch, in bestimmten Kreisen schon‹, hab ich gesagt, und inzwischen hat sie sich womöglich das eine oder andere Buch von dir vorgenommen. Vielleicht ja das mit den Brunogeschichten, und dann wird sie tausend Rückschlüsse auf meinen Charakter und meine Trinkgewohnheiten ziehen …«
»Dann wirst du wohl nach Rütenbrock zurückkehren und Schweine hüten müssen.«
»So sieht’s aus.«
Auf dem Hamburger Dom wagten Hege, Hermann und ich uns mit meiner Freundin Bettina und dem angesäuselten Großschriftsteller Frank Schulz in eine Achterbahn, in der man nicht drinsaß, sondern an der man dranhing. Infolgedessen sausten wir im Looping nicht innen-, sondern außenherum, und ich starb tausend Tode, als ich den Hamburger Erdboden dreidimensional auf mich zustürzen sah.
Anschließend fragten wir uns an einem Glühweinstand, ob wir es aushielten, wenn es überall so wäre wie auf dem Rummelplatz: Einkaufen in Spiegelkabinetten, Berufsverkehr per Autoscooter, auf dem Bürgersteig pusten einem in unregelmäßigen Abständen Druckluftgeysire ins Hosenbein, im Treppenhaus preschen aus jeder Ecke miserabel gestylte Skelette hervor, im Badezimmer schießen Fremdlinge auf Blechkaninchen, und im Wohnzimmer wird man von einem Losbudenmann begrüßt: »Uuuuuuuuund hereinspaziert, meine Damen und Herren, greifen Sie zu, kommen Sie näher, wir beißen nicht, jedes Los eine Mark, und jedes dritte Los gewinnt!«
»Der Fußboden ist natürlich mit Nieten übersät«, sagte Frank. »Und zum Frühstück gibt’s nur Zuckerwatte und Liebesäpfel …«
Eigentlich war geplant, daß Hermann noch einmal bei mir übernachtete, doch er verschwand in der Nacht mit Bettina und holte sein Gepäck am Sonntagmittag ab.
Es waltete eine knackige Kälte, aber Hege und ich hatten es bei mir schön warm. Wenn wir mal ausgingen, dann nur mit Mütze.
In seiner Stammkneipe Dieze-Köpi machte ich den Dichter Horst Tomayer mit Hege bekannt, und er verlieh ihr den Zunamen »Beauty-Besen«. Er selbst war allem Anschein nach bereits über Gut und Böse hinaus und nur noch dem Trunk und der Reimkunst ergeben.
Es würde »alle zivilen Maßstäbe auf den Kopf stellen«, schrieb Jan Philipp Reemtsma in der FAZ in einer Entgegnung auf den Beitrag von Klaus von Dohnanyi, »wenn jemand, der Opfer eines Verbrechens geworden ist, zunächst glaubhaft versichern müßte, er selber sei konstitutionell unfähig dazu, Verbrechen zu begehen«. Und er wies darauf hin, daß das Problem nicht der Mangel an Tapferkeit der nichtjüdischen Deutschen sei, sondern deren Bereitschaft zur Beihilfe an der Ausrottung der Juden:
Niemand kann von einem anderen verlangen, ein Held zu sein. Wohl aber kann von jedem verlangt werden, daß er kein Schurke und kein Lump sei.
Es war eben ein Unterschied, ob jemand aus Angst um sein eigenes Leben einen Zuflucht suchenden Juden abgewiesen oder ihn denunziert und Jagd auf ihn gemacht hatte.
Gemeinsam mit Bernd Eilert und Günther Willen wollte ich ein Drehbuch für eine TV-Serie über Fahrradkuriere verfassen. Die beiden hatten schon bei mehreren Sendern vorgefühlt, aber wie Günther mir schrieb, konnte sich leider niemand für den »Fahrradbotenstoff« erwärmen. Er, Günther, könne nur sagen, daß in dieser Serie auf keinen Fall Til Schweiger und Katja Riemann mitspielen dürften:
Wenn die zu sehen sind, schaue ich in die »Röhre«. Eher würden Schweine miauen.
Und Eugen Egner schrieb mir, daß er eine katastrophale Lesung hinter sich habe und sich jetzt an seinem vorzüglichen Winterbettzeug erfreue:
Schlafen! Mit Abstand das Beste am Leben ist der Tiefschlaf. Nur dann ist die Existenz glücklich zu nennen, wenn nichts an sie erinnert.
Ganz so schwarz sah ich nicht, denn das Leben hatte mir ja auch manches Angenehme zu bieten – einen Schreibtisch, eine Bibliothek, ein Archiv und einen buntscheckigen Freundeskreis –, und wenn Hege mich besuchte, ging mir jedesmal das Herz auf.
Fein war es, daß der Schriftsteller Joseph von Westphalen die Öffentlichkeit in einem langen Artikel in der Süddeutschen Zeitung darüber unterrichtete, wie der zum Holtzbrinck-Konzern gehörende Verlag Scherz versuchte, Klaus Bittermanns kleine Edition Tiamat juristisch fertigzumachen, weil Klaus es gewagt hatte, mit dem Titel seines bestsellerkritischen Sammelbands »Sorge dich nicht, lese!« auf den von Scherz verlegten Bestseller »Sorge dich nicht – lebe!« anzuspielen.
Streitwert 100000 Mark. Das war nun wahrscheinlich auch dem Scherz-Verlag etwas peinlich.
In Lingen sollte für rund 50 Millionen Mark ein »Zwischenlager« für Atommüll gebaut werden. Und wohin danach mit dem zwischengelagerten Teufelszeug?
Martin Walser berichtete in der FAZ, daß er nach seiner Paulskirchenrede »tausend Briefe« erhalten habe, in denen ihm zugestimmt worden sei.
Meine Rede wurde, das ist unübersehbar, als befreiend empfunden. Das Gewissen befreiend.
Ich hätte lieber eine Million Käfighühner befreit gesehen als das Gewissen der Deutschen.
Im Spiegel legte Rudolf Augstein am Montag nach:
Nun soll in der Mitte der wiedergewonnenen Hauptstadt Berlin ein Mahnmal an unsere fortwährende Schande erinnern. Anderen Nationen wäre ein solcher Umgang mit ihrer Vergangenheit fremd. Man ahnt, daß dieses Schandmal gegen die Hauptstadt und das in Berlin sich neu formierende Deutschland gerichtet ist. Man wird es aber nicht wagen, so sehr die Muskeln auch schwellen, mit Rücksicht auf die New Yorker Presse und die Haifische im Anwaltsgewand, die Mitte Berlins freizuhalten von solch einer Monstrosität.
Mit der New Yorker Presse und den Haifischen war vermutlich das Weltjudentum gemeint. Wer sonst?
Mein alter Lieblingsprofessor Horst Denkler hatte mich dazu eingeladen, seinen Studenten in der Freien Universität Berlin etwas über die Lage der Satire in Deutschland zu erzählen. Das machte ich gern, obwohl ich mich dafür bereits um zehn Uhr vormittags im Seminarraum L 31/19 einfinden mußte.
Christian Y. Schmidt war mitgekommen und setzte sich in die letzte Reihe.
Ich ging unter anderem auf den Satireschutz ein, den manche Minderheiten für sich beanspruchten (»Über alle Menschen darf man Witze machen, nur nicht über uns!«), aber ich tat mich schwer, als ich die Fragen der Studenten beantworten sollte. »Wie wird man Satiriker?« wollten sie wissen. Und: »Warum sind Sie eigentlich Zyniker?«
Wegen der vielen die Titanic betreffenden Fragen rief ich schließlich Christian nach vorn, und er nahm mir den Großteil der Arbeit ab, bis ich nach einer ungefähr anderthalbstündigen Diskussion über den Begriff, das Wesen und die Zukunft der Satire sagte, daß die Literatur nicht der Nabel der Welt sei.
Das sei doch ein schönes Schlußwort, sagte Denkler, und ich war froh, als diese Sache überstanden war.
In einem Café in Kreuzberg traf ich mich mit meiner alten Freundin Kerstin. Sie hatte ihr Neugeborenes im Kinderwagen dabei. »Hätte nicht gedacht, daß es so schön ist mit little baby«, sagte sie. »Glückshormone strömen, und ungeahnte Energieschübe werden mobilisiert …«
Der Scherz-Verlag habe klein beigegeben, sagte Wiglaf Droste, als ich ihn besuchte. »Der will die Edition Tiamat jetzt nicht mehr plattmachen. Ist doch gnädig, oder?«
Zwei, drei Tage lang wollten wir an unserem Kurzroman »Der Mullah von Bullerbü« arbeiten. Wir fingen mit dem Kapitel an, in dem irgendwer, den wir nicht mochten, in der Eisenacher Erlebnis-Buchhandlung im Marktkauf-Einkaufszentrum lesen mußte, wo auch wir einmal gelesen hatten. Unsere Wahl fiel auf den Theologen Hans Küng, der sich in seinem Werk »Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft« als Visionär betätigt hatte:
Eine Vision: Müßten wir in diesem epochalen Paradigmenwechsel, in dem die Welt begriffen ist, nicht von den geistigen Fundamenten der Menschheit her dringend zumindest eine Grundorientierung für die Gegenwart im Blick auf die Zukunft anstreben?
Von diesem Quark fühlte Küngs Publikum sich in unserem Roman in der Erlebnis-Buchhandlung jedoch gelangweilt, und es kamen weitere Ärgernisse hinzu:
Von rechts näherte sich ein Reinemachemann mit Ohrenschützern und heulender Bohnermaschine, und irgendein Steppke zog auf einem Dreirad seine Kreise.
Küng versuchte dagegenzuhalten und hob die Stimme. »Freie Bahn vielleicht nicht nur dem Tüchtigen, sondern auch dem Süchtigen: dem Süchtigen nach Macht, Einfluß, Prestige und Sex? Nein, so weit kann auch größte Toleranz und Liberalität nicht gehen«, sang er, aber gerade an der besten Stelle zischte die Espressomaschine des benachbarten Brutzelgriechen dazwischen.
»Und wie können wir ihn weiter quälen?« fragte Wiglaf.
Darüber mußten wir nicht lange nachdenken:
Das Kind hatte jetzt auch die Vorzüge seiner Dreiradglocke entdeckt und spielte ausgiebig darauf herum. Am liebsten hätte Küng diesem Blag den Hals umgedreht …
»Seine erste menschliche Regung seit Jahrzehnten!‹« rief Wiglaf, während ich am Laptop saß. »Bitte, schreib das so hin!«
Und dann wurde Küngs Publikum unruhig:
»Göht do mo wos ob?« quakte ein Mann, der sich mehr von diesem Abend versprochen hatte. »Gomischör Grimi! Wonn kommt ’n do de Möddo mo?«
Auch nach seiner Lesung ließen wir Küng leiden:
Von allen Seiten drängten sich die Fans an den Präsidenten der Stiftung Weltethos heran und hielten ihm Bücher zum Signieren unter die Nase: »Sie«, »Es«, »Blut«, »Brennen muß Salem«, »Shining«, »Carrie«, »Friedhof der Kuscheltiere« – lauter fremde Schwarten, die Hans Küng noch nie im Leben gesehen hatte.
»Schröiben Se müör mor ’n Oddogromm dodrin: Füör Muddi!«
»Und bei müör füör Silvio!«
»Und bei müör bidde irschendswoss Lüstisches!«
»Soren Se mo, Herr Gieng, wie gommt man äischentlisch off oll die gruselischen Ideen?«
Am Ende konnte Küng nur noch den Mantelkragen hochschlagen und sich verabschieden.
Eiswind schlug dem alten Ketzer ins Gesicht, als er in die Eisenacher Nacht hinaustrat. Es ist deutsch in Kaltland, dachte er und schlingerte den Hotelmedien entgegen …
Wir fanden, daß die Richtung stimmte, und nach drei Nächten hatten wir zwanzig Seiten beisammen.
Für den Frauenroman »Liebhaber bitte anstellen«, an dem meine Freundin Bettina und ich werkelten, bot die Verlagsgruppe Droemer Knaur einen Vorschuß in Höhe von 15000 Mark an, wie Joachim Jessen von der Agentur Schlück uns mitteilte: ein Drittel bei Vertragsunterzeichnung, ein Drittel bei Abgabe und ein Drittel bei Erscheinen. Geteilt durch zwei, verstand sich, und abzüglich fünfzehn Prozent für die Agentur. Jessen riet uns, das Angebot anzunehmen, und das taten wir.
Jetzt nahm auch die Silvesterplanung Gestalt an: Meine Schweizer Freundin Rachel und ich sowie Hermann Gerdes plus Bettina und zwei Freundinnen von ihr wollten uns in Wyk auf Föhr in einer Ferienwohnung tummeln.
»Im Streit um die Friedenspreisrede von Schriftsteller Martin Walser bei der Frankfurter Buchmesse bleiben die Positionen verhärtet«, sagte der Tagesschau-Sprecher Jens Riewa.
Die Rede von Schriftsteller! Kannte man in der ARD den Genitiv nicht mehr?
Eugen Egner litt an einem neuen körperlichen Defekt:
Inzwischen bin ich mit einem soliden, sehr hohen Dauerton im linken Ohr ausgestattet, mal lauter, mal leiser. Es ist der Ton, von dem ich früher glaubte, die Heizung verursache ihn (neben all den Tönen, die sie objektiv und tatsächlich erzeugt hat). Da der Ton aber unverändert anhält, wo immer ich mich befinde, dürfte er wohl endogen zu nennen sein. Am Montag soll der HNO-Arzt da mal nach dem Rechten sehen.
Tinnitus, so nannte man das ja wohl. Zu nichts zu gebrauchen, diese Krankheit.
In meiner taz-Kolumne über wirre Grafiken würdigte ich das »Grundschema einer Semiose« aus einem Lehrbuch von 1978. In dieser selbstgenügsamen Grafik zirkulierten Pfeile zwischen unterschiedlichen Zeichenproduzenten und Zeichenrezipienten sowie zwischen zwei Rechtecken namens »Zeichen« und »Designat«, ohne daß damit irgendwem gedient gewesen wäre, und nachdem ich damit fertig war, ging ich mit Hege ins Kino und gleich darauf mit ihr in ihre Badewanne, wo der Schaum alsbald zur Decke flog.
She feels good, she knows she’s looking fine
I’m so proud to know that she is mine …
Mit Hege machte alles unverschämt viel Spaß.
Für die Europäische Verlagsanstalt arbeitete sie jetzt an einem Korrektorat des Buchs »Der biologische Urknall« von Hans Melderis.
Walter Kempowski erbot sich brieflich, mich in Hamburg zu besuchen, um mich bei der Arbeit an dem Kindheitsroman zu beraten, den ich schreiben wollte, und noch am selben Tag rief Kempowskis Ehefrau Hildegard mich an und sagte, sowas könne ihr Mann gar nicht mehr. »Kommen Sie lieber mal zu uns! Und sagen Sie ihm bitte nicht, daß ich Sie angerufen hab!«
Da gab es aber noch nicht viel zu beraten. Ich hatte bislang nur tausenderlei Erinnerungsschnipsel gesammelt, von Asterix über Carrerabahn, Fliegenpeter, Hotzenplotz, Leckerschmecker und Mengenlehre bis Zorro, und es existierte noch keine einzige Romanseite in Reinschrift.
Zwei Nächte lang hatte ich Wiglaf Droste zu Gast. Die netteste Ausbeute für unseren Roman war dabei die Schilderung von Hans Küngs weiteren Abenteuern in Eisenach. In seinem Hotelzimmer, schrieben wir, habe er nachts zum Telefonhörer gegriffen:
»Hallo, Hotel Sacher, Portier? Können Sie mir ein Feinripp-Unterhemd, eine Büchse Köstritzer und ein Snickers bringen? Ich geb mir selbst eine Party.«
Küng stülpte sich die Minibar über den Kopf. Es sollte schneller gehen mit dem Kick. Er brauchte es jetzt ganz hart.
»Wie damals in Sprockhövel!« rief Wiglaf. »Bitte, schreib das hin!«
Im weiteren Verlauf der Nacht, behaupteten wir, habe Küng »Ethik! Ethik!« aus dem Fenster gejallert, an seine wilden Jahre in Paris zurückgedacht und mit rostiger Stimme ein von ihm selbst für Irma la Douce getextetes Chanson gesungen:
Éthique planétaire,
gib mir maire, gib mir maire.
Ab und ßu mal ein Fique
und ansonsten Éthique
planétaire, planétaire, planétaire …
Isch brauch keine Million,
keinen Fennisch zum Glüque,
isch brauch nur die Éthique planétaire,
und wenn du disch mir gibst,
misch von Kopf bis Fuß liebst,
geb isch dir mein ßweitbestes Stüque haire:
die Éthique, die Éthique planétaire …
Wiglaf hatte den Einfall, in einer weiteren Strophe »kleines Boxenludaire« auf »planétaire« zu reimen, und uns war beiden klar, daß wir hier gerade unsere ohnehin sehr geringen Chancen verspielten, jemals den Büchner-Preis zu bekommen.
In Heges Wohnungsflur brach ich mir fast den Hals, als ich nachts über ein Paar Schuhe von ihr stolperte. Sie hatte die Angewohnheit, ihre Schuhe einfach irgendwo im Flur abzustreifen und liegenzulassen.
Ich nahm mir vor, darüber mal ein ernstes Wort mit ihr zu reden.
Martin Walser und Ignatz Bubis hatten ein langes Streitgespräch miteinander geführt, das man in der FAZ nachlesen konnte. Walser ging da abermals auf seine Fanpost ein:
Also die Leute, die mir geschrieben haben, haben wirklich gesagt, wenn ich das zusammenfassen darf: Was wir – und jetzt hören Sie, diese Formulierung ist mir am meisten im Gedächtnis geblieben – was wir bis jetzt hinter vorgehaltener Hand sagten oder unter Freunden sagten, das haben Sie öffentlich ausgesprochen, und dafür sind wir Ihnen dankbar. So, und ich denke, das müssen wir jetzt ernst nehmen.
Und er warf Bubis vor, daß er 1992 nach den ausländerfeindlichen Krawallen in Rostock-Lichtenhagen vor die Kameras getreten sei:
Ja, aber verstehen Sie, wenn Sie auftauchen, dann ist das sofort zurückgebunden an 1933.
Demnach hätte der Jude Bubis sich dort besser nicht blicken lassen sollen, damit es uns allen erspart geblieben wäre, wieder einmal an die Nazizeit erinnert zu werden.
Was ging nur in Walsers Kopf vor?
In dem Käseblatt Focus wurde Walter Kempowskis neuer Roman bespöttelt:
Seine »Heile Welt« eignet sich als Weihnachtsgeschenk für frisch pensionierte oder kurz vor der Pensionierung stehende Schulmeister, die nur noch in Erinnerungen schwelgen und beim Lesen gern ein Pfeifchen rauchen. Doch Vorsicht! Auch geneigten Lesern fallen bei der Lektüre des Romans gelegentlich die Augen zu.
Über Kempowski fühlten sich selbst die jämmerlichsten kleinen Medienvertreter erhaben. So hatten sie’s nun mal gelernt.
Bill Clinton weilte zu Besuch bei Yassir Arafat im Gazastreifen, und der palästinensische Nationalkongreß erklärte die israelfeindlichen Passagen in seiner Charta für null und nichtig: Na, das war doch mal ein Fortschritt!
»Wenn die Palästinenser merken, daß ihre Wirtschaft boomt, sobald sie mit den Israelis Handel treiben, anstatt ihnen nach dem Leben zu trachten, könnte sich manches zum Positiven entwickeln«, meinte Hermann Gerdes, als ich mich telefonisch mit ihm über den Nahostkonflikt austauschte. »Aber ich fürchte, daß die destruktiven Kräfte das nicht zulassen werden. Da gibt’s einfach zu viele Haßprediger, und hinter denen stecken mächtige Geldgeber, die alle Juden ins Meer treiben wollen …«
Für eine Aufführung von »Lucia di Lammermoor« in der Hamburger Staatsoper hatten Hege und ich uns zwei Karten gesichert: Loge, vierter Rang. Wir waren etwas spät dran, und als die Logentür für uns geöffnet wurde, wich ich zurück. Ich hatte nicht gewußt, daß man schwindelfrei sein mußte, wenn man sich auf einen Logenplatz setzen wollte. Vor der Brüstung gähnte ein gespenstischer Abgrund, ja, ein wahrer Höllenrachen.
»Was ist jetzt?« wurde ich von der Türschließerin gefragt. »Rein oder raus?«
Es hatte keinen Zweck. Ich wünschte Hege einen genußreichen Abend, radelte wieder heim und verfluchte alle Architekten, denen es egal war, daß es auch Menschen gab wie mich.
Friedrich Jahn war gestorben, der Gründer der Wienerwald-Imbißkette, aus dessen unvergleichlichen Memoiren Christian Y. Schmidt, Oliver Schmitt und ich oft gelesen hatten. Im Dezember 1996 war uns von ihm auf einer Bühne in München jeweils ein silberner Ehrentaler mit Jahns Konterfei verliehen worden, nachdem er »I Did It My Way« und »Kann denn Liebe Sünde sein?« gesungen hatte …
Einer der letzten Wirtschaftswunderkapitäne. Gab es nun überhaupt noch welche?
Post vom Finanzamt: Ich sollte 1770,78 DM zurückbekommen. Das freute mich, aber als ich dort anrief, um meine Bankverbindung durchzugeben, sagte man mir, daß die Überschußsumme aus zuviel gezahlten Abschlägen zufällig exakt bis auf die zweite Stelle hinter dem Komma einer noch ausstehenden Umsatzsteuernachzahlung in Höhe von 1770,78 DM entspreche, und daher seien wir quitt.
Wie gewonnen, so zerronnen.
Walter Kempowski rief an. Ich könne doch mal nach Nartum kommen, sagte er. »Dann setzen wir uns ins Turmzimmer, Sie lesen mir was aus Ihrem Kindheitsroman vor, und dann kucken wir mal, nich?«
Ich hätte aber immer noch nicht groß was anderes vorlesen können als Notizen wie »Lego-Eisenbahn, glatte und geriffelte Schienen«, »Schuhputzbürsten mit aufgemalten Großbuchstaben« und »Sommer ’71, im Wambachtal ein Prinz-Eisenschwanz-Heft gefunden«.
Weil Bill Clinton über seine Seitensprünge mit der Praktikantin Monica Lewinsky gelogen hatte, leiteten die Republikaner nun allen Ernstes ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn ein, und zugleich trat mit großem Tamtam der designierte republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses zurück, ein gewisser Bob Livingston, dem außereheliche Affären nachgewiesen worden waren. »I hope President Clinton will follow!« rief er feierlich aus.
Von den Republikanern, die über Clinton Gericht hielten, als wäre er der größte Schuft aller Zeiten, hatte sonst sicherlich noch nie einer seines Nächsten Weib, Knecht, Magd oder Rindvieh begehrt.
Als ich merkte, daß mal wieder eine dicke Erkältung im Anzug war, schaufelte ich meinen Kühlschrank voll, kaufte auch vorsorglich Hustenbonbons, verschob die Glotze in mein Schlafzimmer und sah mir halb im Tran wieder einmal alle drei Teile von »The Godfather« auf Video an.
Genaugenommen war es nicht statthaft, einem Mafiaboß die Daumen zu drücken, aber bei Al Pacino machte ich eine Ausnahme, obwohl ich Verständnis dafür hatte, daß Diane Keaton sich von ihm trennte.
»Just when I thought I was out, they pull me back in«, knurrte Al Pacino als Michael Corleone, doch so schlecht wie ihm ging es mir nicht. Ich war trotz Schnupfen ein freier Mann.
Nach drei Tagen besaß ich wieder genug Kraft, meinen Briefkasten aufzuschließen.
Eine Karte von Sonja:
Lieber Martin, ich wünsche Dir ganz schöne Weihnachten, ein lustiges Silvester und ein ereignisreiches 1999. Und mir wünsche ich, daß ich einen halbwegs gelungenen Jahreswechsel hinkriege, aber so wunderbar wie der letzte kann’s gar nie mehr werden …
Alles Liebe schickt Sonja
Den letzten Jahreswechsel hatten wir miteinander in Karlsbad verbracht, und bald darauf war ich von ihr freundlich, aber bestimmt darüber aufgeklärt worden, daß ich nicht der Mann ihrer Träume sei. Es war mir nicht klar, was sie jetzt noch von mir wollte.
Auch Eugen Egner hatte mir geschrieben.
Daß Walter Kempowski Dir demnächst beim Dichten assistieren (oder wie sagt man da?) will, ist schlicht ein »Ding« zu nennen. Da muß gestaunt werden.
Mit seinen Ohren sei im übrigen alles in bester Ordnung. Ein HNO-Arzt habe ihm gesteckt, daß er das Dauerpfeifen einfach »als gegeben« hinnehmen müsse …
Wahrscheinlich kommt alles von den »Nerven«. Neurastheniker haben so etwas, das gehört zum Berufsbild. Hatte Kafka bestimmt auch.
Einen Dauerpfeifton in den Ohren hätte ich keine drei Tage lang ausgehalten, ohne an Selbstmord zu denken.
Renate hatte mich zum Weihnachtsfest nach Bonn eingeladen, und Hege kam mit.
Im Zug erteilte ich ihr ein bißchen Familiengeschichtsunterricht: »Meine große Schwester Renate lebt von ihrem Ehemann Olaf getrennt, und ihre Kinder Lisa, Julius und Nantje wohnen noch bei ihr. Nantje ist meine Patentochter. Die ist jetzt elf. Und es wird auch mein Bruder Volker anwesend sein, der drei Jahre älter ist als ich …«
»Hast du nicht noch ’ne andere Schwester?« fragte Hege.
»Ja. Wiebke. Die ist vier Jahre jünger als ich und wohnt in Hannover. Da wohnen auch meine Patentante Dagmar und meine Kusinen Hedda und Corinna, die beiden Töchter meiner Tante Luise, die mit ihrem Mann Immo in Hildesheim wohnt.«
»Und die ’ne Schwester deiner Mutter ist …«
»Korrekt. Meine Mutter war die Älteste in der Geschwisterreihe: Inge, Therese, Gisela, Luise, Dagmar.«
»Therese, das ist die, die letztes Jahr gestorben ist, oder?«
»Ja. Das war die, die einen Engländer geheiratet hatte.«
»Und wo soll man dann deinen Onkel Rudi verorten?«
»Das ist einer der drei Brüder meines Vaters. Die anderen heißen Walter und Dietrich, und dann gibt’s noch die Schwestern Gertrud und Doro.«
»Wohnt dieser Rudi nicht auch in Hannover?«
»Richtig. Mit seiner Frau Hilde. Die haben drei Töchter: Franziska, Alexandra und Kirstin. Walter und Dietrich haben ebenfalls jeweils drei Töchter, wohingegen meine Tante Doro drei Söhne hat und meine Tante Gertrud nur einen …«
»Deren Namen merk ich mir dann ’n andermal«, sagte Hege.
Als Geschenke hatte ich mein Buch »Die gnadenlose Jagd« und Eckhard Henscheids »Kleine Poesien« für Hege dabei und für die anderen einige Videos: »Gone With the Wind« für Renate, »1941« für Volker, drei Stan-und-Ollie-Klassiker für die Kinder und für Nantje außerdem noch Disneys »Aladdin«.
Was ich selbst geschenkt bekam, war mir nicht so wichtig.
Renate konnte noch immer die Wortspiele aufsagen, die sie irgendwann als Kind auswendig gelernt hatte: »Paprikaschnitzel, Piprikaschnatzel, Schnaprikapitzel, Schniprikapatzel.« Und: »Ka a ka, pe u pu, apu, kapu, zett i zi, uzi, puzi, apuzi, Kapuzi, en e er, ner, iner, ziner, uziner, puziner, apuziner, Kapuziner.«
Ich schrieb das auf, denn das gehörte natürlich in meinen Kindheitsroman.
»Und gab’s da nicht auch noch so ’nen Schnack mit dem Wort Lokomotive?«
»Na klar«, sagte Renate. »El o lo, ka o ko, oko, loko, em o mo, omo, komo, okomo, Lokomo, te i ti, oti, moti, omoti, komoti, okomoti, Lokomoti, vau e ve, ive, tive, otive, motive, omotive, komotive, okomotive, Lokomotive!«
Am ersten Weihnachtsfeiertag lief auf RTL der zu Herzen gehende Film »Ein Schweinchen namens Babe«, den ich schon kannte. Wir sahen ihn uns alle an. Ein kleines Schwein, das eine Bauernhofgesellschaft revolutioniert und am Ende bei einer Dressurnummer höchste Ehren erlangt …
Hege fand das alles jedoch so kitschig, daß sie das Weite suchte.
Als Erzähler hatte Robert Gernhardt sich die Verwandlung »von Wirklichkeit in Schnirklichkeit« zum Ziel gesetzt, und ich trug die Fackel weiter, indem ich Julius verriet, daß man jede Autoritätsperson durch diesen Konsonantenaustausch veralbern könne: »Lehrer – Schnehrer. Direktor – Schnirektor. Pastor – Schnastor. Gott – Schnott.«
»Jesus – Schnesus«, sagte Julius.
Er hatte es begriffen.
Auf mein Betreiben unternahmen wir am zweiten Weihnachtsfeiertag einen Ausflug nach Koblenz: Renate, Nantje, Hege, ich und Volker, der uns zunächst nach Lützel chauffierte, zu der Mietskaserne, in der wir von 1964 bis 1967 gehaust hatten. Straßburger Straße 5: eine der miesesten Adressen in ganz Koblenz. Auf der anderen Rheinseite, in dem Reihenendhaus auf der Horchheimer Höhe, unserer nächsten Station, hatten wir schon etwas standesgemäßer gewohnt, bis wir 1970 in das neue Haus auf dem Mallendarer Berg gezogen waren.
»Und wo ist dein Zimmer gewesen?« fragte Hege, als wir dort anhielten.
»Das über der Garage.«
Da hatte Günter Netzer noch bei Borussia Mönchengladbach gespielt, und Raimund Harmstorf war als Seewolf auf die Robbenjagd gegangen.
Owê war sint verswunden alliu mîniu jâr!
ist mir mîn leben getroumet, oder ist ez wâr?
1975 waren wir nach Meppen umgezogen, und ich hatte unter schwerem Heimweh gelitten, doch der Mallendarer Berg gebot jetzt nur noch über eine schwache Anziehungskraft, weil ich kein Kind mehr war.
Als Eigenbrötler hätte Papa ja überall ansässig sein können, aber für Mama mußten die neun Jahre im Rheinland eine Qual gewesen sein. Und in Meppen war’s dann auch nicht besser geworden.
Weil ich Lisa zugesagt hatte, ein Stück für ihren Theaterkurs zu schreiben, kamen ihr Deutschlehrer Dieter Dresen und ein paar Mitschüler von ihr auf eine Runde Kaffee und Kuchen vorbei. Herr Dresen sagte, er habe in der Gesamtschule Bonn-Beuel schon viele Stücke inszeniert, unter anderem Schnitzlers »Reigen« und den »Marat« von Peter Weiss, und es freue ihn, nun auch einmal »ein originäres Stück auf die Bretter zu bringen«. Die Parallelklasse werde im Dezember 1999 in derselben Aula »Macbeth« aufführen.
Harte Konkurrenz! Ich sagte, mir schwebe eine Komödie vor, rund um einen Klassenausflug, mit kriminellen Aspekten, und ich versprach allen, mein Bestes zu geben.
Als ich Hege zum Zug brachte, stellte sich heraus, daß sie noch nichts von meinen Plänen für Silvester wußte. Hatte ich die denn gar nicht angesprochen?
»Dann muß ich mir für mich was eigenes überlegen«, sagte sie.
Ich sah ihr die Enttäuschung an und sagte, daß wir nächstes Jahr Silvester auf jeden Fall gemeinsam verbringen sollten. »Wo auch immer du willst!«
Sie schlug die Hallig Hooge dafür vor, und dann fuhr der Zug ab.
Um mein schlechtes Gewissen einzuschläfern, ging ich ins Kino und sah mir den Disney-Film »Hercules« an, den ich leider grottenschlecht fand, obwohl Andreas Platthaus ihn in der FAZ als Meisterwerk gepriesen hatte: Mit »Hercules« sei der Zeichentrickfilm erwachsen geworden.
Ich wollte aber keinen erwachsenen Zeichentrickfilm sehen, sondern einen für das Kind im Manne.
Am Montag fuhr ich zum Haus der Geschichte und sah mir die Ausstellung »Bilder, die lügen« an. In einem der Räume konnte man sich anhand einer Video-Dauerschleife davon überzeugen, daß das dritte Tor von Wembley drin gewesen war, und anhand einer anderen Video-Dauerschleife, daß es doch nicht drin gewesen war.
Für diese Ausstellung hatten Günther Willen und ich dem Haus der Geschichte ein paar Briefe ausgeborgt, die uns 1995 anläßlich der für unser Buch »Drin oder Linie?« veranstalteten Umfrage zum dritten Tor von Prominenten zugeschickt worden waren. Zwei dieser Briefe – der von Reinhard Mey und der von Gerhard Schröder – lagen hinter Panzerglas aus, aber unser Buch »Drin oder Linie?« befand sich nicht daneben, und es wurde nirgendwo erwähnt. Die Besucher mußten daher annehmen, daß wir die Herren Mey und Schröder bloß aus Daffke angeschrieben hätten.
»Mir egal, mir egal, mir egal«, sagte Günther, als wir abends miteinander telefonierten. »Hauptsache, die geben uns die Briefe wieder …«
Als Interviewpartner des Nachrichtenmagazins Focus nahm der vom Apo-Opa zum Neonazi mutierte Wirrkopf Horst Mahler den Friedenspreisträger Martin Walser in Schutz und warb um Verständnis für alle Deutschen, die vom Holocaust nichts mehr wissen wollten:
Diese negativen Komponenten, die heute vom Geist und vom Gefühl abgefordert werden – Buße, Scham, Schuldbekenntnis und Reue –, bewirken eher das Gegenteil dessen, was die Einpeitscher bezwecken. Wer derart auf den blankliegenden Nerven der Deutschen herumtrampelt, macht sie böse.
Selbst für die Auschwitzleugner durfte Mahler in Focus eine Lanze brechen:
Sie ertragen den Gedanken nicht, daß Deutsche das zu verantworten haben, und erweisen sich damit geradezu als Gutmenschen mit moralischem Kompaß. Im Glauben, daß ihnen Unrecht geschieht, nehmen sie es auf sich, für die nationale Sache ins Gefängnis zu gehen.
Die Ärmsten! Wer konnte es ihnen da noch verübeln, daß sie böse wurden, wenn jemand auf ihren blankliegenden Nerven herumtrampelte?
In Wyk auf Föhr bezog die Silvestergesellschaft am 29. Dezember eine Ferienwohnung, die Hermann und Bettina aufgetrieben hatten, und mir passierte ein Malheur: Ich kam im Vorübergehen mit meinem rechten Bein einem Heizungsregler zu nahe. Er brach ab und fiel zu Boden.
Klonk.
»Dafür wirst du geradestehen müssen«, sagte Hermann.
Am Strand ließen wir einen Drachen steigen, den Bettina mitgebracht hatte, und wir befürworteten alle den »Föhrer Dosenschwur«, demzufolge auf Föhr keine Getränke in Dosen verkauft werden durften.
Nebenbei arbeiteten Bettina und ich ein bißchen an unserem Frauenroman. Da müßten jetzt auch mal mit Mangomarmelade gefüllte Berliner drin vorkommen, sagte sie. »Und kapverdisches Dressing: so ’ne Mischung aus Nußöl, Schnaps und Barbecuesoße!«
In einer Szene setzten wir unsere Romanheldin Nina den Schwaden aus einem Shillum aus, die sie zum Husten brachten.
Zum ersten- und bis heute letztenmal geraucht hatte sie mit siebzehn Jahren. Da war sie aus Mangel an schauspielerischem Talent im Schülertheater bei einer Dramatisierung von »Jim Knopf« als köchelnder Vulkan vor der Drachenstadt aufgetreten und hatte Zigarrenqualm nach oben pusten müssen …
»Das nennt ihr also Arbeit«, sagte Rachel, als sie einmal mitbekam, wie Bettina und ich uns beömmelten.
Es ging unentwegt ein großes Gekoche vonstatten, vor dem Hermann und ich uns nach Möglichkeit drückten.
Bei einem Dünenspaziergang teilte er mir mit, daß er nicht begreife, weshalb die Leute im Kosovo keinen Frieden halten könnten. »Serbische Artilleristen, albanische Untergrundkämpfer, kosovarische Rebellen – könnten die sich nicht darauf verständigen, daß es jetzt mal gut ist mit den Fehden ihrer Urgroßväter? Stell dir vor, die Emsländer würden auf einmal das Kriegsbeil ausgraben und auf die Ostfriesen losgehen! Oder die Oberpfälzer auf die Niederbayern! Wer hätte denn was davon? Es springt doch sehr viel mehr für alle raus, wenn man sich arrangiert!«
In der neuen Emma, die eine von Bettinas Freundinnen angeschleppt hatte, stand eine von Alice Schwarzer verfaßte Titelgeschichte über Leni Riefenstahl.
Wie alle Legenden ist auch die Riefenstahl aus der Nähe nur ein Mensch, in dem Fall noch ein weiblicher dazu, also bescheiden und verbindlich im Auftritt.
Man wußte ja, daß ausnahmslos alle Frauen bescheiden waren. Und dennoch hatte Leni Riefenstahl leiden müssen:
70 Jahre Arbeit, davon drei Monate im Dienste Hitlers – und sie gilt lebenslang als Nazi-Künstlerin.
Obwohl sie doch nur ein paar vernachlässigenswerte Propagandafilme wie »Der Sieg des Glaubens« und »Triumph des Willens« gedreht hatte!
Die Verfolgung dieser einen Frau wurde vor allem in Deutschland zu einer Hexenjagd, die bis heute andauert.
Er finde, daß die Feministinnen ehrwürdigere Aufgaben hätten als die Rehabilitation von Leni Riefenstahl, sagte Hermann, während wir Zwiebeln schnitten und Möhren schälten. »Vielleicht will Alice Schwarzer uns ja noch aufbinden, daß auch Eva Braun und Magda Goebbels irgendwie ganz dufte drauf gewesen sind …«
Fast bis zur Verblödung spielten wir Ligretto. Bei diesem Kartenspiel mußte man nicht darauf warten, daß man wieder an die Reihe kam, sondern aufpassen wie ein Luchs und alle paar Sekunden Karten ablegen und aufnehmen.
»Gebt euch geschlagen!« schrie Hermann, als er eine Glückssträhne hatte. »I’m the Master of the Universe!«
Auf Bettinas Wunsch wurden am Silvesterabend Scharaden aufgeführt. Jeder sollte einen berühmten Filmhelden darstellen. Als die Reihe an mich kam, gab ich mich als trippelndes und liebreizend äugelndes Rehlein aus, um Bambi zu personifizieren.
»Kretin!« rief Hermann, aber so hieß kein Filmheld.
Auch von den anderen erriet niemand, wer ich war, und nachdem ich mich als Bambi zu erkennen gegeben hatte, sagte Rachel: »Wie soll man denn von einem angestrengt in umgekehrter Klappmesserstellung posierenden und Grimassen schneidenden Dichter auf Bambi schließen, den Inbegriff von Grazie, leichtfüßiger Eleganz und Unschuld?«
Mit Rachel verstand ich mich sonst jedoch gut. Sie hakte sich bei mir ein, als wir die spärlichen Neujahrsraketen über Föhr explodieren sahen, und als sie nach unserer Rückkehr nach Hamburg erkältet und röchelnd in meinem Bett lag, besorgte ich ihr Zwieback und japanisches Heilpflanzenöl. Und weil sie es so wollte, legte ich ihr sogar essiggetränkte Fußwickel an.
In der FAZ raunte der Dichterpriester Botho Strauß über »das letzte Jahrhundert des Menschen«:
Zwei große Kriege, unvergleichliche Energien. Niemals wieder wird man solche Zentralgewalten herrschen sehen, solche Zäsuren so nah beieinander finden. Niemals werden Kriege wieder so bestimmend und befördernd sein für das Schicksal der Wissenschaft, der Völkerverständigung, der Sozialität und der Kunst. Niemals wieder solche Hochzeiten von Weh und Wohl, Böse und Gut! Kein dramatischeres, kein menschengemäßeres Jahrhundert je! Was folgt, gehört den Nachfolgern des Menschen. Gewissen ausführenden Organen.
Die Völkerverständigung hatten der Erste und Zweite Weltkrieg ja nun nicht gerade befördert. Und welche Nachfolger des Menschen wollte Strauß damit schmähen, daß er sie als gewisse ausführende Organe qualifizierte? Hatte er überhaupt noch alle Tassen im Schrank?
Ich las Rachel eine Postkarte vor, die Oliver Schmitt, Christian Y. Schmidt und Max Goldt mir aus Peking zugesandt hatten. Oliver beklagte sich darüber, daß Christian ständig über die schwerverständliche Bedienungsanleitung seines neuen Fotoapparats stöhne, und Max schrieb:
Das Gute an Christian ist, daß er alles frißt, auch fette, sehnige und ranzige Batzen. Das Schlechte ist, daß seine endlosen Vorträge über seine kaputte alte und seine unverständliche neue Kamera nur von nächtlichem Extremschnarchen unterbrochen werden.
Zur Rache dafür wurde Max in einem Nachsatz von Christian als »Essensmäkler« gedisst.
Solche Freunde hätte sie auch gern, sagte Rachel. »Mir hat noch nie jemand was aus Peking geschrieben …«
Am Sonntag war sie genesen, und ich brachte sie zum Zug.
»Of Wiederluege!« rief sie mir beim Abschiednehmen zu.
Aber sollte ich mich nicht enger mit Hege zusammenschließen?
Wie ich hörte, war Rowohlt daran interessiert, ein Taschenbuch mit meinen gesammelten Lügengeschichten zu veröffentlichen, und ich stellte welche zusammen, von meiner Verleumdung der Verbandsgemeinde Vallendar als Hort der am schlimmsten schwitzenden Frauen Deutschlands bis zu meiner Fälschung einer Steinzeitzeichnung in der Jettenhöhle bei Düna im Landkreis Göttingen.
Bei ihrem nächsten Besuch bewirtete ich Hege mit Putenfleisch, Reis und Feldsalat. Sie hatte eine Halbtagsstelle in dem Jugendbuchverlag Eulenhof an Land gezogen.
»Und was mußt du da machen?«
»Projektsteuerung in Zusammenarbeit mit Druckereien und sonstigen Zulieferern, Vorbereitung der Buchhaltungsbelege, Büroorganisation, Büromaterialverwaltung …«
Als ich später die vielen Texte für Rowohlt ausdruckte, schlief Hege bereits tief und fest.
Erst am frühen Morgen legte ich mich zu ihr.
Soft as a rain drop, fresh as the sea
Warm as the sunshine shinin’ on me …
War überhaupt schon einmal eine Frau so rundum liebevoll zu mir gewesen?
Am Mittwoch stand ein Fremder vor der Tür, der sich als NDR-Mitarbeiter ausgab und wissen wollte, ob ich ein Radio besäße.
»Nein«, sagte ich.
»Wirklich nicht? Kein Radio?«
Das war ein Typ von der Gebühreneinzugszentrale, aber ich besaß tatsächlich kein Radio. Ich fand es schon anstrengend genug, einen Fernseher zu installieren.
Für meine Artikelreihe über wirre Grafiken erhielt ich von Lesern der taz fortlaufend neues Material: über das »Organomodell der Sprache« und die »Mikrogeographie der Prostitution« sowie zur »differenten Gestaltung des privaten Alltagslebens«, zu den »Konstruktionshorizonten« im Bereich der instrumentellen Kompetenz und der zivilgesellschaftlichen Kommunikationszusammenhänge und zu den »Vergesellschaftungsmodi« im Spannungsfeld zwischen Individualisierung und »Institutskonformität«. Da taten sich Abgründe auf, von denen ich nichts geahnt hatte.
Garstig war auch vieles, was ich beim Studium für JdO über Kaiser Wilhelm II. erfuhr. Im November 1904 hatte dessen Hofmarschall Robert Graf von Zedlitz-Trützschler »die burschikosen Handgreiflichkeiten« des Kaisers bei der Jagd in Schlesien verzeichnet:
Besonders schlecht soll es dem Obersten v. B., Kommandeur eines Kavallerieregiments, ergangen sein. Seine Majestät drückte ihn längere Zeit in den Schnee und rieb ihn dann zur Freude aller Umstehenden mit Schnee ein, so etwa wie ein stärkerer Schuljunge einen schwächeren behandelt. Die ganze Jagdgesellschaft und Hunderte von oberschlesischen Treibern waren dabei. Noch schlimmer erging es dem Grafen Roger Seherr-Dobrau. Man bedenke, er ist preußischer Kammerherr, Mitglied des preußischen Herrenhauses auf Lebenszeit, hat zwei Söhne als Offiziere bei den Leibgarde-Husaren, ist 53 Jahre alt und hat durch seine großen Besitzungen eine sehr angesehene Stellung in Schlesien. Bei der ersten Begrüßung sagte ihm der Kaiser ganz laut: »Was, Sie altes Schwein sind hier auch eingeladen?«
Und zur höheren Ehre dieses Menschen waren Hunderttausende ins Feld gezogen und verreckt …
Manchmal kam Hege abends überraschend zu Besuch. Ich ließ dann immer alles stehen und liegen, und nachdem ich sie mit dem Ligrettofieber infiziert hatte, saßen wir mitunter bis zwei Uhr nachts lachend und kartendreschend in meiner Küche.
Wolfgang Herrndorf schrieb mir, daß er Weihnachten in Hamburg gewesen sei.
Ich habe versucht, Dich anzurufen, weil ich mich gern wieder mal mit Dir betrunken hätte, habe Dich aber leider nicht erreicht.
Sehr bedauerlich war es auch, daß Bettinas Notebook ihr plötzlich den Zugang zu der Frauenromandatei verwehrte, an der wir auf Föhr gearbeitet hatten.
Sie werde mal einen Notarzt für Notebooks konsultieren, sagte sie.
Von Hege lieh ich mir Raul Hilbergs dreibändiges Werk »Die Vernichtung der europäischen Juden« aus. Wie gut hatten die Deutschen alle logistischen Schwierigkeiten bei der Deportation der Juden in die Vernichtungslager überwunden!
Die deutschen Behörden ließen sich durch Probleme nicht abschrecken; nie nahmen sie zu Vorwänden Zuflucht, wie die Italiener, zu Scheinmaßnahmen, wie die Ungarn, oder zu Hinhaltungen, wie die Bulgaren. Die deutschen Verwalter drängte es nach Perfektion. Anders als ihre Kollaborateure begnügten sie sich niemals mit dem Minimum. Sie taten stets das Maximum.
Laut Hilberg hatten sich vor allem die Italiener ganz anders verhalten:
Immer wieder weigerten sich die italienischen Generäle und Konsuln, Präfekten und Polizeiinspektoren, an den Deportationen mitzuwirken. In Italien und den italienisch kontrollierten Gebieten wurde der Vernichtungsprozeß gegen den unermüdlichen italienischen Widerstand abgewickelt. Von einem solchen Widerstand war auf deutscher Seite nichts zu spüren. Der deutschen Vernichtungsmaschinerie wurden keinerlei Hindernisse in den Weg gelegt. Kein moralisches Problem erwies sich als unüberwindlich. Auf den Prüfstand gestellt, gab es unter den Beteiligten nur wenige Zögernde und so gut wie gar keinen Deserteur. Das sittliche Erbe gelangte nirgendwo zum Durchbruch.
Das sittliche Erbe! Wie es darum in Deutschland bestellt gewesen war, wußte man ja aus den von Kurt Tucholsky überlieferten Klosettinschriften in der Universität Rostock aus dem Jahr 1920 (»Du beschnittener Rotzjude!«). Und trotzdem war es erschütternd, wie selten sich in Deutschland eine helfende Hand geregt hatte und wie eilfertig alle Bürokraten dem Führer zugearbeitet hatten.
Ein Anruf von Bettina: Die Reparatur ihres Notebooks würde rund 450 Mark kosten. »Das kann ich mir nicht leisten …«
Nun gut. Dann waren die Texte eben weg, und wir mußten neue schreiben.
Dreitausend Mark von dem Vorschuß für dieses Buchprojekt hatten meine Vermieterfirma SAGA und das Finanzamt bereits gemeinsam verjuxt.
In der Tagesschau waren streikende rumänische Bergleute zu sehen, und es hieß: »Polizeihubschrauber setzten Tränengas gegen die Marschierenden ein.«
Die Marschierenden? Was war denn das für ein Plural? Hätte man nicht einfach von Demonstranten sprechen können?
Wie aus einer Rechnung des Vermieters des Ferienhauses auf Föhr hervorging, mußte ich für ein neues Heizungsventil und einen neuen Drehkopfregler sowie zwei Lohnstunden à 70 Mark plus 16 % Mehrwertsteuer insgesamt 200,81 DM zahlen. Der Preis für meine Tölpelei.
Ein Arzt, den ich aufsuchte, weil ich Rückenschmerzen hatte, stellte fest, daß mein Ischiasnerv klemme, und verschrieb mir Tabletten, die ich aber nicht einzunehmen wagte, denn laut Beipackzettel drohten als Nebenwirkungen Magen-Darm-Blutungen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Blähungen, Bauchkrämpfe, Schwarzfärbung des Stuhls, Zungenentzündung, Ösophagusläsionen, unspezifisch blutende Dickdarmentzündungen, Darmverengung, Erregung, Kopfschmerzen, Schwindel, Doppeltsehen, Ohrensausen, Hörstörungen, Gedächtnisstörungen, Angstgefühle, Albträume, Fieber, Nackensteifigkeit und Bewußtseinstrübung.
Und die Liste war noch länger: Nesselsucht, Haarausfall, Ekzeme, Lichtüberempfindlichkeit, Hautjucken, Nierenfunktionsstörungen, Ödeme, Leberschäden, Halsschmerzen, Nasenbluten, innere Kehlkopfschwellung, Verengung der Atemwege, Luftnot bis zum Asthmaanfall, Herzjagen und Blutdruckabfall bis zum bedrohlichen Schock.
Nein danke.
Bei einem Arbeitstreffen mit der freundlichen Lektorin Barbara Wenner von Rowohlt kam das Gespräch auf Synonymwörterbücher. Ich benutzte seit fast einem Jahrzehnt Karl Peltzers veralteten Schinken »Das treffende Wort« aus dem Nachlaß meines Vetters Gustav, und Frau Wenner empfahl mir das Handbuch »Sag es treffender«. Darin gebe es nicht nur ein Wörterverzeichnis, sondern auch ein Register mit Querverweisen. »Wenn Sie da beispielsweise das Wort ›veraltet‹ nachschlagen, können Sie auch sehen, für welche anderen Wörter es seinerseits als Synonym vorgeschlagen wird …«
Als veraltet durften wohl auch die Verse gelten, mit denen Gerhart Hauptmann sich 1914 öffentlich zum Kriegsdienst gemeldet hatte:
Diesen Leib, den halt’ ich hin
Flintenkugeln und Granaten:
eh’ ich nicht durchlöchert bin
kann der Feldzug nicht geraten.
Mit seinen 52 Jahren wäre der großmäulige Hauptmann überhaupt nicht mehr feldzugsverwendungsfähig gewesen, und das hatte er natürlich auch gewußt.
Für JdO sammelte ich noch viele andere Zitate dieser Art ein.
Zum Stand der Diskussion über die Atomkraft war in der Tagesschau zu hören, daß das Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll in Morsleben geschlossen werden solle. Ach? Und wohin dann mit diesem Müll? Und wohin mit dem hochradioaktiven Atommüll?
Davon hatten weder die Atomkraftwerksbetreiber noch die von ihnen bezahlten Politiker irgendeinen blauen Dunst.
Beim abendlichen Zappen geriet ich im WDR in eine Diskussionsrunde, an der auch Hermann L. Gremliza teilnahm. Er sagte, daß es noch immer 35 nach Hitlergenerälen benannte Bundeswehrkasernen gebe, worauf der sozialdemokratische Staatsminister für Kultur und Medien, Michael Naumann, erwiderte: »Das ändern wir jetzt, ich schwör’s Ihnen. In zwei Jahren finden Sie keine mehr!«
Aus Hilbergs Werk war auch manches über die Aktivitäten von Hitlers Rüstungsminister Albert Speer zu erfahren. Im Frühjahr 1943 hatte er Arbeiter für die serbischen Kupferminen benötigt:
Da sämtliche serbischen Juden im Vorjahr umgebracht worden waren und im Lande keine Ersatzarbeitskräfte zur Verfügung standen, bat Speer (mit Himmlers Zustimmung) das Auswärtige Amt um Überstellung von 10000 ungarischen Juden.
Für den Bau von Häftlingsbaracken im KZ Auschwitz hatte Speer 13,7 Millionen Reichsmark bewilligt, und gegenüber der SS hatte er auf eine kostensparende »Primitivbauweise« gedrungen, doch von der Vernichtung der Juden hatte er angeblich nichts gewußt, und im Nürnberger Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher war er mit zwanzig Jahren Haft davongekommen.
Dann war ich wieder einmal im hannoverschen Künstlerhaus bei Dietrich zur Nedden und Michael Quasthoff zu Gast in ihrer famosen Fitz-Oblong-Show und freundete mich danach beim Bier mit einer außerordentlich charmanten Dame namens Edith an, die mir zusicherte, daß es auch bei ihr daheim noch etwas zu trinken gebe.
Im Taxi wurde ihr leider schlecht. Sie übergab sich bei voller Fahrt aus dem Fenster, was den Fahrer erzürnte, und in der Wohnung ging es im gleichen Stil weiter.
Auch hinter mir war unter ähnlichen Umständen schon einmal hergewischt worden, wie ich leider wußte, und nun wischte ich hinter Edith her, ging ihr zur Hand, half ihr beim Zähneputzen und kümmerte mich auch sonst um alles.
Schon um sechs müsse sie wieder aufstehen, sagte sie noch. »Unbedingt! Kannst du den Wecker stellen? Der steht da rechts …«
Ich stellte ihn.
»Isser gestellt?«
»Ja, isser.«
»Auf sechs?«
»Ja, auf sechs.«
»Ganz sicher?«
»Ja, ganz sicher.«
»Auf sechs?«
»Ja, auf sechs.«
Als ich erwachte, war sie fort.
Ein Blick auf den Wecker: halb zwölf.
Von Ediths Aufbruch hatte ich nichts mitbekommen.
Nach dem Duschen klappte ich versuchshalber das Brotschapp auf und erblickte ein Graubrot mit einer langhaarigen, schlohweißen Schimmelpilzperücke. Man hätte daraus ein Toupet für Schauspieler anfertigen können, die in schlechten US-Serien Patriarchen spielten.
Hazel, stardust in your eye
You’re goin’ somewhere and so am I …
Ich hinterließ Edith einen freundlichen Abschiedsgruß auf Papier und schlug mich zur Baumstraße durch, wo meine gute alte Tante Dagmar mich mit einer Bratwurst, Kartoffelbrei, Mangoldsalat und Vanillepudding beköstigte.
Dabei kamen wir auf Fritz Levy zu sprechen, einen der wenigen Juden aus Jever, die den Holocaust überlebt hatten. Irgendwann in den fünfziger Jahren, sagte Dagmar, sei der mal an Oma und ihr vorbeigefahren, mit einem Fahrrad, an das er eine ganze Kette klappernder Konservenbüchsen gehängt hatte. »Und meine Mutter hat sich zu Tode geschämt!«
Fritz Levy, der Bürgerschreck. Ein lebender Vorwurf an die Adresse der jeverschen Nazis bis zu seinem Selbstmord im Oktober 1982.
Bei Schmorl & Seefeld hatte ich mir Rolf Dieter Brinkmanns »Briefe an Hartmut« gekauft. In einem Brief vom 2. August 1974 hieß es:
Ich könnte eine ganze Straße zusammenschlagen, jede Wohnung zusammenprügeln, jede dressierte Menschenform auf der Straße in den Arsch treten, daß die Fetzen nur so fliegen, Gesichter ohrfeigen, grundlos und ohne eine Erklärung abzugeben, Hunde durchtreten, Autos mit Brechstangen kaputtschlagen, die Gesichter in den Läden, die rausglotzen, immer reinschlagen, ihnen ihr mieses Stinkmaul mit den angelernten Redensarten und Ansichten stopfen, faule Putzlumpen ihnen in ihre Mäuler stopfen …
Bitterarm war Brinkmann damals gewesen, aber was hatten die Hunde dafür gekonnt?
Zuhause fiel mir mein Kandistopf runter, wobei der Henkel vom Deckel abbrach, und dann unterlag ich Hege auch noch lang und schmutzig in Ligretto, aber das Handbuch »Sag es treffender« erwies sich als Goldgrube. Für das Wort »Scheusal« hielt das Buch »Das treffende Wort« zum Beispiel nur die Synonyme »Bandit«, »Bestie«, »Fratze« und »Mißgestalt« bereit, während »Sag es treffender« mit mehr Begriffen aufwartete: »Vogelscheuche«, »Monstrum«, »Monstrosität«, »Popanz«, »Schreckgespenst«, »Ungetüm«, »Ungeheuer«, »Ausgeburt«, »Spottgeburt«, »Ekel«, »Greuel«, »Widerling«, »Biest« und »Kotzbrocken«. In »Das treffende Wort« kamen solch unfeine Wörter wie »Kotzbrocken« gar nicht vor.
Auf dem Weg zur Toilette stolperte ich bei Hege nachts wieder einmal über eine ihrer Schuhfallen im Flur und legte mich lang hin.
Hätte ich ihr einen Schuhschrank schenken sollen?
Für JdO war auch der General Erich Ludendorff ein interessanter Fall. Nachdem er im Ersten Weltkrieg auf ganzer Linie versagt hatte, war er nach Schweden ausgerückt. Später hatte er sich in Deutschland an Putschversuchen und völkischen Raufhändeln beteiligt und 1926 die Antisemitin Mathilde von Kemnitz geheiratet, aus deren Feder Schriften wie »Deutscher Gottglaube«, »Der göttliche Sinn der völkischen Bewegung« und »Weihnachten im Lichte der Rasseerkenntnis« stammten, doch erst 1937 hatte Ludendorff in dem von ihm herausgegebenen Brevier »Mathilde Ludendorff, ihr Werk und Wirken« die volle Tragweite seiner Hochzeit mit Mathilde offenbart:
Am 14. September 1926 schlossen wir die Ehe. Sie ist ein tiefer Wendepunkt in meinem Leben, ja auch im Leben unseres Volkes, vielleicht aller Völker. Das werden spätere Geschichtsschreiber einmal festzustellen haben.
Dazu stellte ich fest:
Nach allem, was man heute weiß, bedeutete Ludendorffs Hochzeit zumindest im Leben der Khmer, der Baschkiren und der Schoschonen durchaus keinen Wendepunkt. Der Einfluß jener Hochzeit auf das Leben aller übrigen Völker wird von den Geschichtsschreibern zur Zeit noch untersucht und wohlwollend geprüft.
Zeitlebens war Ludendorff darum bemüht gewesen, der größte deutsche Schweinehund zu sein, doch es hatte einen noch größeren gegeben.
Nach einer bei offenem Fenster verbrachten Februarnacht konnte ich meinen Kopf nicht mehr ordnungsgemäß drehen und wenden.
Ich rief Hege an, und sie erschien nicht nur mit einem ABC-Pflaster für meinen steifen Hals, sondern auch mit einem neuen Kandistopf, was ich ihr hoch anrechnete.
Nur lausige 480 Stück waren 1998 von Eckhard Henscheids, Brigitte Kronauers und meinem Buch »Kulturgeschichte der Mißverständnisse« verkauft worden, was mir gerade mal 538,08 DM einbrachte, und mein Ex-Verleger Michael Rudolf, dem ich Geld geliehen hatte, faxte mir, daß er seine Schulden nicht mehr abstottern könne.
Und das kommt so: Ich bin blank. Völlig. Wenn wieder was reinkommt, leite ich’s sofort weiter.
Für den Sammelband mit meinen Satiren wollte Rowohlt mir aber immerhin 7000 Mark vorschießen. Irgendwie ging es dann doch immer weiter.
Obwohl Hege in der Neustädter Straße im dritten Stock wohnte, blieb man dort nachts nicht von dem Lärm aus einer Absturzkneipe verschont, die sich unten auf der anderen Straßenseite befand. Sie hieß »Zum Schauermann« und sah so aus, als ob sie besser »Zum Klabautermann« geheißen hätte. Hinter der Fensterfront hingen tiefbraune, nikotingesättigte Gardinen, und die Leute, die sich dort einen auf die Lampe gossen, hatten alle Brücken hinter sich abgebrochen. Da wurden Schlager mitgegrölt, die sonst fast niemand mehr kannte …
Aber heidschi bum beidschi bum bum …
Sowie »Anita«, »Eviva España«, »Fiesta Mexicana« und »Das Lied der Schlümpfe«. Es war zum Steinerweichen.
Mein guter Patenonkel Dietrich hatte Renate, Volker, Wiebke und mir anheimgestellt, ein Wochenende lang in seiner sturmfreien Villa in Werder an der Havel zu logieren.
Am frühen Freitagnachmittag wollten Hege und ich aufbrechen, aber sie konnte ihr Schlüsselbund nicht finden. Ein Riesengesuche ging los, und ich half mit, indem ich selbst an den unmöglichsten Stellen nachsah – im Backofen, unterm Bett, in der Besteckschublade, im Kleiderschrank und in Heges Winterstiefeln.
Als sie das Schlüsselbund schließlich unter einem Papierkonvolut auf ihrem Schreibtisch aufspürte, waren wir bereits verdammt spät dran. Im Hauptbahnhof mußten wir rennen, um unseren Zug noch zu erwischen, und nachdem ich mich hingesetzt hatte, brach mir der Schweiß aus allen Poren.
Wenn ich verreiste, erschien ich sonst gern schon eine halbe Stunde vor der Abfahrtzeit im Bahnhof, um in Ruhe eine Fahrkarte kaufen, in der Buchhandlung lustwandeln und vielleicht noch einen Kaffee trinken zu können. Eine Hetzjagd wie diese hatte ich seit langem nicht mehr erlebt.
In Werder war es am Freitagabend ganz nett – ich lernte dabei Wiebkes neuen Freund Claus kennen, einen Tontechniker, der so wie sie im NDR-Funkhaus Hannover arbeitete –, und um den Samstagabend noch netter zu gestalten, hatte ich einigen Freunden aus Berlin vorgeschlagen, uns zu besuchen und Getränke, Snacks und Schlafsäcke mitzubringen.
On a night like this …
So wurde die Bude recht voll. Es kamen Kathrin Passig, Wolfgang Herrndorf, Yvonne Kuschel und ihr Freund Detlef Beck mit Baby sowie Christian Y. Schmidt und dessen neue Freundin Dominique, und ich fachte das Kaminfeuer an.
»Und wo bleibt die Musik?« fragte Hege.
Daraufhin holte Volker drei Musikkassetten aus seinem Auto. Sie waren mit »KR7«, »KR8« und »KR9« beschriftet, wobei »KR« für »Kuschelrock« stand, und Wolfgang rief: »Ja! Legt doch mal so’n richtig fetzigen Blues-Rock auf!«
Für einen gelungenen Abend war unsere Runde etwas zu inhomogen, aber was ich aus Werder mitnahm, war Wolfgangs Rat, mich mit der römisch-katholischen Krawallschachtel Adelgunde Mertensacker zu befassen, die einer Sekte namens »Christliche Mitte« vorstehe und nonstop gegen islamische Dämonen kämpfe.
Im Hamburger Literaturhaus wurde Max Goldt der Richard-Schönfeld-Preis für literarische Satire verliehen, von dem ich vorher noch nie etwas gehört hatte.
Hege und ich nahmen an der Zeremonie teil und zogen danach mit Max in die Bodega Nagel am Hauptbahnhof um, wo wir gut mit Bier versorgt wurden. Mit dabei waren die Kabarettistin Lisa Politt und ihr Gefährte Gunter Schmidt, die ich beide sehr sympathisch fand.
In Hohenlimburg im Sauerland, sagte Max, habe er letztes Jahr ein Kaltwalzmuseum besucht, und seither sei er »ein heimlicher Kaltwalzexperte«, wozu aber niemand viel zu sagen wußte. Irgendwie schlingerte die Unterhaltung dann zu der Beschaffenheit des Inneren von Menschenohren und der Frage, ob es darin etwas gebe, das man Eustachische Röhre nenne.
»Heißt diese Röhre nicht Rosenmüllerscher Gang oder so ähnlich?« fragte Gunter Schmidt, und Max fragte zurück: »Warum nicht Konrad-Adenauer-Straße?«
Ich liebte solche Zusammenkünfte, und ich liebte Hege.