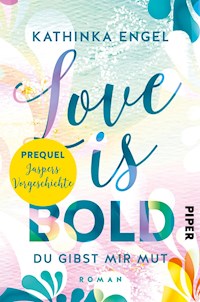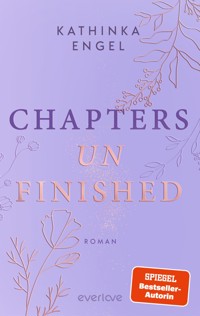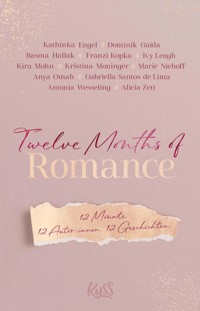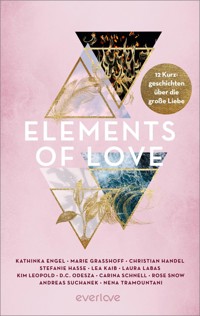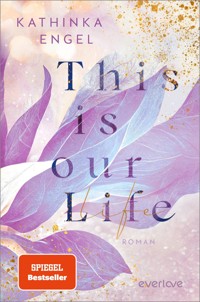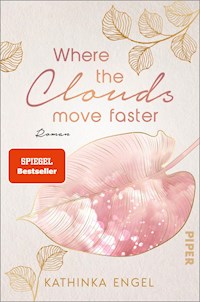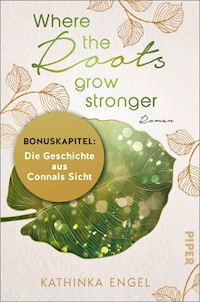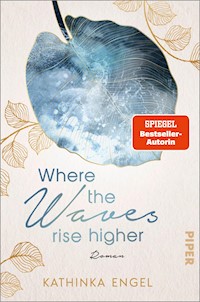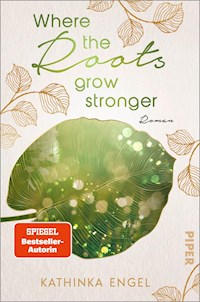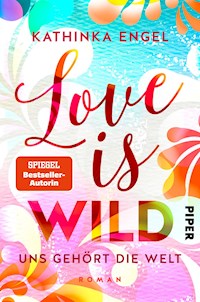9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die große Neuentdeckung der deutschen Romance – ein Bad Boy, eine Erbin und ein reißender Strudel aus großen Gefühlen Drei Liebesgeschichten, drei außergewöhnliche Paare, drei wundervolle Schmökerideen mit Herzklopfen: Die Finde-mich-Reihe ist Romantik pur, denn Kathinka Engel setzt der Liebe ein dramatisches Denkmal. Band 2 schlägt auch ernste Töne an. Die Liebe ist farbenblind. Die Gesellschaft nicht. Das müssen Zelda und Malik schnell erkennen. Zelda ist reich, weiß und ein heißer Kandidat für eine standesgemäße Ehe. Malik ist schwarz, stammt aus armen Verhältnissen, und ist ein Freigeist, der Zelda sofort in seinen Bann zieht. Als zwischen den beiden aus Funken ein Feuer wird, stellt sich ihr familiäres Umfeld gegen sie. Welche Chance hat diese Liebe? Im zweiten Teil »Halte mich. Hier« stellt die literarische Neuentdeckung Kathinka Engel die gleichen großen Fragen wie schon im romantischen Überraschungserfolg »Finde mich. Jetzt«: Was bringt uns zusammen, wenn uns alles trennt? Was sind wir bereit, für unser Herz zu wagen? Ihre wundervollen New-Adult-Romance-Geschichten gehen keinen direkten Weg zur Antwort. Stattdessen zeichnen sie Liebe in all ihren abgründigen, schillernden Farben. Die schönste Botschaft des Lebens: »Believe in second chances!« Lass dich in der »Finde mich«-Reihe fallen und vertraue darauf, von dieser berührenden New-Adult-Reihe aufgefangen zu werden. Die schönste Botschaft der Trilogie? Glaub an zweite Chancen. Denn manchmal braucht die Liebe einfach sehr viele Anläufe… Noch nicht genug von Kathinka Engel? Mit der »Love-is-« und der »Shetland-Love-Reihe« gibt es noch mehr von der deutschen Autorin zu lesen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover & Impressum
1 Zelda
2 Malik
3 Zelda
4 Malik
5 Zelda
6 Malik
7 Zelda
8 Malik
9 Zelda
10 Malik
11 Zelda
12 Malik
13 Zelda
14 Malik
15 Zelda
16 Malik
17 Zelda
18 Malik
19 Zelda
20 Malik
21 Zelda
22 Malik
23 Zelda
24 Malik
25 Zelda
26 Malik
27 Zelda
28 Malik
29 Zelda
30 Malik
31 Zelda
32 Malik
33 Zelda
34 Malik
35 Zelda
36 Malik
37 Zelda
38 Malik
39 Zelda
40 Malik
41 Zelda
42 Malik
43 Zelda
44 Malik
Danksagung
Zu Besuch bei Kathinka Engel -– ein Werkstattbericht
1 Zelda
Eine blonde Perücke überdeckt meine leuchtend pinken Haare. Meine Sommersprossen sind unter einer dicken Schicht Make-up verschwunden. Ich habe meine Fingernägel in einem konservativen Dunkelrot lackiert und einen farblich passenden Lippenstift verwendet. Allerdings ist der Großteil der Farbe in einem Kosmetiktuch gelandet, damit ich nicht zu puppenhaft aussehe. Mit etwas Rouge belebe ich meinen vollkommen ebenmäßigen Teint. Jedes Mal erscheint es mir wieder seltsam, meine natürliche Gesichtsfärbung zu überschminken, um mir danach künstliche Röte aufzumalen.
Die junge Frau, die mir aus dem Spiegel entgegenblickt, hat mit dem Mädchen, das ich bis vor zwanzig Minuten war, nicht mehr viel zu tun. Perfekt. Wenn ich jetzt noch meine Persönlichkeit überschminken könnte, wäre ich der absolute Traum meiner Mutter.
Vorsichtig öffne ich die Badezimmertür. Ich will um jeden Preis vermeiden, dass mich einer meiner Mitbewohner so sieht. Die Luft ist rein, und ich husche schnell in mein Zimmer. Auf dem Bett liegt bereits das dunkelgraue Kleid, das vor ein paar Tagen mit der Post geliefert wurde und vermutlich ein kleines Vermögen gekostet hat. Das Oberteil ist aus Spitze und betont meine eher zierliche Figur, während der ausladende Tüllrock meine Beine noch dünner wirken lässt, als sie ohnehin schon sind. Ich entledige mich meines Bademantels, schlüpfe von unten in das Kleid hinein und zupfe es zurecht. Mit der rechten Hand schiebe ich den Reißverschluss am Rücken so weit hoch, bis ich mit der linken Hand von oben drankomme und ihn ganz schließen kann. Es wäre leichter, Leon oder Arush um Hilfe zu bitten, aber dieser ganze Aufzug ist mir viel zu peinlich.
Die farblich passenden Wildlederpumps, die zusammen mit dem Kleid angekommen sind, packe ich in meine Handtasche. Jede Minute, die ich meine Füße nicht damit malträtieren muss, ist ein Geschenk. Ich schlüpfe in meine Sneakers, ziehe mir einen schwarzen Blazer über und schleiche mich aus meinem Zimmer. Von der Kommode im Flur schnappe ich mir meinen Schlüssel, den ich zu den Pumps in meine Tasche fallen lasse. Als ich schon beinahe aus der Tür bin, rufe ich schnell ein »Tschüss, Jungs, bis morgen« in die Wohnung. Ohne eine Antwort abzuwarten, ziehe ich die Tür hinter mir zu.
Von Pearley, wo ich studiere, ist es eine einstündige Autofahrt nach Paloma Bay. Das Haus meiner Eltern liegt hinter dem idyllischen Badeort auf einem Hügel. Von dort hat man an klaren Tagen einen traumhaften Blick über die Bucht – eines der beliebtesten Motive auf den Postkarten, die jedes Jahr von Unmengen Touristen ins ganze Land geschickt werden.
Auf der Hinfahrt verzichte ich immer darauf, Musik zu hören, um mich in die richtige geistige Verfassung zu bringen. Das bedeutet: Ich male mir das Schlimmste aus, was an diesem Abend eintreten kann. Ich stelle mir die Situation plastisch vor. Ein uninteressanter Schleimbolzen in perfekt sitzendem Anzug versucht, meinen Eltern in den Allerwertesten zu kriechen, während er mir gleichzeitig durch seine erbärmlichen Fummelversuche unter dem Tisch zeigt, dass er keinerlei Respekt vor Frauen im Allgemeinen und vor mir im Besonderen hat. Wenn ich dann diese Vorstellung potenziere, weiß ich ungefähr, was mich erwartet.
Wäre ich nicht finanziell von meinen Eltern abhängig, hätten sie mich nicht komplett im Griff, würde ich mir diesen ganzen Käse gar nicht geben. Aber zu studieren ist teuer. Und die Studienzeit ist meine letzte Chance, ich selbst zu sein. Deshalb lasse ich mich beinahe jedes Wochenende von meinen Eltern in diese demütigende Rolle drängen, im Gegenzug für ein wenig Freiheit.
Ich nehme die Straße, die mich durch Paloma Bay führt, auch wenn die Umgehungsstraße mich schneller ans Ziel bringen würde. Allerdings steht ein frühes Ankommen ganz weit unten auf meiner Prioritätenliste. Ich fahre gern durch die kleine Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Hier laufen die Uhren langsamer. Wenn es einen Ort der Entschleunigung gibt, dann ist es Paloma Bay. Neben Hotels in modernen Glaspalästen, vor denen Limousinen auf Gäste warten, gibt es hier vor allem hübsche kleine Strandbars und edle Fischrestaurants, deren Terrassen hinter der palmengesäumten Straße einen direkten Blick auf den Strand bieten. Die Hälfte davon gehört vermutlich meinen Eltern. Die Saison hat noch nicht angefangen, obwohl hier, direkt am Meer, eigentlich das ganze Jahr über angenehme Temperaturen herrschen. Die Promenade ist kaum bevölkert, und die Strandbäder – eine der sinnlosesten Erfindungen überhaupt – haben noch nicht einmal geöffnet. Denn nur Touristen zahlen in dieser Gegend Geld, um im Meer schwimmen zu gehen.
Gleich hinter dem Ortsausgang biege ich ab und folge einer schmalen Straße, die sich den Paloma Hill hinaufschlängelt. Hier und da sind beeindruckende moderne Villen in die Landschaft gebaut. Je weiter ich hinauffahre, desto einsamer wird es – bis ich an einem schweren Eisentor zum Stehen komme. Ich muss nur einen kurzen Augenblick warten, dann öffnen sich wie durch Geisterhand die beiden Torflügel. Ich weiß allerdings, dass es Rory, unser Pförtner, war.
Ich rolle langsam die Auffahrt zum Haus hinauf, das sich groß und mächtig gegen den dunkelblauen Himmel abhebt. Die weiße Fassade ist beleuchtet, und aus den meisten Fenstern im Erdgeschoss und im ersten Stock scheint ebenfalls ein kaltes Licht. Ich parke meinen Mini – ein Geschenk meiner Eltern zum Schulabschluss – vor dem Haus. Aus meiner Handtasche hole ich die Pumps und tausche Fußkomfort gegen blutleere Zehen. Etwas staksig steige ich aus. Sofort eilt Miloš, der Fahrer meiner Eltern, herbei, um mein Auto umzuparken.
»Guten Abend, Ms Zelda«, begrüßt er mich. »Schön, Sie zu sehen.«
»Nur ›Zelda‹, Miloš, wir haben darüber gesprochen«, korrigiere ich ihn. »Geht’s Ihnen gut?«
»Danke, sehr gut«, sagt er und lächelt. »Allerdings fehlen Sie uns allen sehr.«
»Sie fehlen mir auch«, sage ich und meine es absolut ernst. Die Angestellten meiner Eltern waren für mich immer so etwas wie ein Familienersatz. Unter ihnen sind die besten Menschen, die ich je kennengelernt habe.
»Kommen Sie nachher in der Küche vorbei?«, fragt Miloš, als ich ihm meinen Autoschlüssel gebe.
»Wenn ich mich wegstehlen kann, auf jeden Fall!«, verspreche ich. Ohne die Aussicht auf einen Kaffee mit den einzig sympathischen Personen im Haus wäre dieser Abend nicht auszuhalten.
Ich gehe auf die massive Eingangstür zu. Nach nur drei Schritten muss ich schon stehen bleiben, um das erste Mal meinen linken Schuh zurechtzurücken. Ich balanciere auf dem rechten Bein, was gar nicht so leicht ist, wenn man sein ganzes Körpergewicht auf einem Pfennigabsatz und einer verschwindend kleinen Schuhspitze verteilen muss. Seiltänzerin werde ich in diesem Leben nicht mehr. Das steht fest.
Plötzlich höre ich hinter mir ein Auto vorfahren. Ich will mich umdrehen, vergesse aber, dass mein linker Fuß noch keinen Halt im Schuh hat. Beinahe komme ich aus dem Gleichgewicht und kann mich gerade so an einer der großen weißen Säulen festhalten, die den Eingangsbereich zieren. Na toll, jetzt bin ich auch aus dem anderen Schuh rausgerutscht.
»Vorsicht«, sagt der Fahrer des Wagens, der in diesem Moment die Tür geöffnet hat. Er lächelt mich an. »Philip Englander. Ich glaube, ich bin deinetwegen hier?«
Ich beeile mich, meine Schuhe wieder anzuziehen. »Hi, ich bin Zelda«, sage ich.
Philip Englander kommt auf mich zu und streckt seine Hand aus. »Freut mich, dich kennenzulernen.«
»Die Freude ist ganz meinerseits«, sage ich und versuche, den ironischen Unterton, der sich bei diesem Satz immer automatisch in meine Stimme mischt, auf ein Minimum zu beschränken. Wenn ich ihn jetzt schon brüskiere, wird der Abend für mich unerträglich.
Miloš kehrt zurück, um Philips Wagen wegzufahren. Während ihrer Interaktion mustere ich mein Date für heute Abend das erste Mal. Er sieht nett aus – und intelligent. Das ist immerhin mal etwas Neues. Er hat rotblonde Locken, einen sauber getrimmten Bart und trägt eine runde Brille. Im Gegensatz zu den anderen jungen Männern, die meine Eltern an vergangenen Wochenenden eingeladen hatten, ist er nicht im Anzug erschienen, sondern in einer etwas legereren dunkelblauen Stoffhose, einem hellblauen Hemd und einer grauen Anzugweste. Mir fällt außerdem auf, dass er nett zu Miloš ist. Ich habe gelernt, dass Nettigkeit gegenüber Hausangestellten keine Selbstverständlichkeit ist, weswegen ich angenehm überrascht bin, als Philip sich bedankt.
»Also dann«, sagt er, während Miloš seinen Wagen parkt, »lasset die Spiele beginnen.« Er zwinkert mir zu.
»Du sagst es«, gebe ich zurück.
In dem Moment, da ich die Tür öffnen will, wird sie von innen aufgerissen.
»Ich wusste, dass ich etwas gehört habe«, ertönt die süßlich-überdrehte Stimme meiner Mutter. Nach hinten ruft sie: »Ich habe doch gesagt, sie sind da.« Wieder an uns gewandt: »Ich habe Agnes dreimal gesagt, sie soll nachsehen, aber anscheinend muss man hier alles selbst machen.« Sie lächelt betont gequält.
»Verzeihung, Mrs Redstone-Laurie«, hört man nun Agnes, die vermutlich aus der Küche herbeieilt, wo sie eigentlich alle Hände voll zu tun hat. Ich lächle ihr aufmunternd zu, als sie in die Eingangshalle kommt.
»Darf ich Ihnen die Garderobe abnehmen?«, fragt sie an Philip und mich gewandt, und wir händigen ihr unsere Jacken aus.
»Sie haben wirklich ein atemberaubendes Haus, Mrs Redstone-Laurie«, sagt Philip zu meiner Mutter. Er blickt sich in der Eingangshalle um, die mit den Augen eines Fremden wohl tatsächlich relativ beeindruckend ist. Der Boden ist ein Mosaik aus rotem, weißem und grünem Marmor, das in der Mitte unser Familienwappen zeigt: im Zentrum ein aufgebäumter Hirsch, um den herum sich Ornamente ranken, darauf ein Ritterhelm, der das Wappen krönt. Eine Galerie aus Porträts unserer Vorfahren schmückt links und rechts die geschwungenen Treppen, die in den ersten Stock führen. Von der Decke hängt ein riesiger Kronleuchter, der mit Sicherheit eines Tages irgendjemanden erschlagen wird.
»Wir nehmen einen Aperitif im Salon«, sagt meine Mutter. »Mr Redstone-Laurie erwartet uns bereits.«
Meine Mutter hat die nervige Angewohnheit, meinen Vater im Beisein von anderen »Mr Redstone-Laurie« zu nennen. Ich fand das schon immer furchtbar affektiert.
Wir gehen hinter ihr in den Salon. Philip, ganz Gentleman, lässt mir den Vortritt. Als wir eintreten, erhebt sich mein Vater von einem der antiken Sofas, die meine Eltern im letzten Herbst mit sündhaft teurer türkis gestreifter Seide haben neu beziehen lassen.
Mein Vater reicht Philip die Hand und sagt mit seinem autoritären Bariton: »Philip, wie schön, Sie zu sehen. Ihren Vater treffe ich regelmäßig im Club. Sie Sind wohl kein Golfer?«
Das ist typisch für meinen Vater: sein Gegenüber sofort einzuschüchtern. Beispielsweise mit einem höflich verpackten Vorwurf wie jetzt gerade.
»Nein, Sir. Mir bleibt neben dem Studium kaum Zeit für Hobbys«, sagt Philip gelassen und nimmt meinem Vater so jeden Wind aus den Segeln. Hut ab, Philip Englander.
Nun wendet sich mein Vater mir zu. »Zelda!« Seine Stimme klingt überschwänglicher, als er es meint, da bin ich mir sicher. Er täuscht einen Wangenkuss an. Sein Dreitagebart fühlt sich an meiner Haut an wie Schleifpapier.
Während mein Vater und Philip weitere Höflichkeiten austauschen, packt mich meine Mutter am Arm und zieht mich zur Seite. »Ist das eine Perücke?«, zischt sie mir zu, nachdem sie sich vergewissert hat, dass keiner Notiz von uns nimmt.
»Und wenn schon«, sage ich achselzuckend. »Ich habe keine Lust, jedes Mal meine Haarfarbe zu ändern, wenn ich zu euch komme.«
»Ich hoffe für dich, du hast sie gut befestigt. Wenn sie verrutscht, dann gnade dir Gott.«
Ihre Fingernägel schneiden schmerzhaft in meinen Oberarm, und ihr viel zu süßes Parfüm steigt mir in die Nase. Ich versuche mich an einem unbeschwerten Lächeln und schiebe ihre Hand von meinem Arm. Ich verstehe ihr Problem nicht. Die Perücke sieht täuschend echt aus. Die Einzige, die darunter zu leiden hat, bin ich. Denn meine Kopfhaut ist irrsinnig heiß. Aber sie ist natürlich diejenige, die ein Fass aufmachen muss. Sieht irgendjemand, dass ich mich beschwere und Fässer öffne? I don’t think so, Mrs Redstone-Laurie. In ungefähr vier Stunden ist der Abend vorbei, und ich kann ins Bett gehen. Und vor dem Frühstück bin ich wieder auf dem Weg nach Hause. Mit einer – wie ich hoffe – relativ graziösen halben Pirouette drehe ich mich um und gehe zu meinem Vater und Philip zurück. Genau im richtigen Moment.
»Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?«, fragt Agnes in die Runde und hält uns ein silbernes Tablett mit Champagnerflöten entgegen.
Für einen kurzen Moment folgt mein Blick dem von Philip durch den Raum und bleibt am überdimensionalen Familienporträt über dem Kamin hängen. Es ist ein unsägliches Bild, aber meine Eltern haben ein Vermögen dafür ausgegeben. Auf dem Bild bin ich elf und trage ein abscheuliches gelbes Kleid mit rosa Schleife, weiße Spitzensöckchen und weiße Lackschuhe. Mein Vater sieht aus, als halte er sich für den Präsidenten höchstpersönlich, während meine Mutter im Hintergrund die perfekte Mischung aus schmuckem Anhängsel und stolzer Ehefrau und Mutter mimt.
Philips Lippen zucken kaum merklich nach oben, als sein Blick von dem Porträt zu mir wandert.
»Auf einen schönen Abend«, verkündet mein Vater, und wir lassen unsere Gläser aneinanderklirren, ehe wir Platz nehmen.
Auf dem Couchtisch – ebenfalls antik – liegen Untersetzer für unsere Gläser bereit. Philip und ich nehmen auf der einen Couch Platz, meine Eltern lassen sich gegenüber auf der anderen nieder.
»Ihr Vater hat erzählt, Sie studieren Jura, Philip«, beginnt mein Vater sein Verhör.
»Das ist richtig. Ich bin in Berkeley.«
»Sehr beachtlich, sehr beachtlich. Unser ältester Sohn Elijah hat dort auch seinen Juraabschluss gemacht, und Sebastian ist noch dort. Hervorragende Professoren. Finden Sie auch?«
»In der Tat.«
»Wann machen Sie Ihren Abschluss?«, fragt meine Mutter.
»Wenn alles nach Plan läuft, nächstes Jahr. Und dann steige ich in der Kanzlei meines Vaters ein. Das Ziel ist, so schnell wie möglich Partner zu werden.«
Ich nehme noch einen großen Schluck Champagner. Diese Gespräche laufen immer gleich ab. Meine Eltern fragen den jungen Mann neben mir aus, der auf all ihre Fragen eine zufriedenstellende Antwort weiß. Bei diesen Abendessen gibt es keine Überraschungen. Philip unterscheidet sich allerdings insofern von seinen Vorgängern, als dass seine Ohren nicht vor Eifer rot glühen. Seine sind angenehm hautfarben.
»Berkeley hätten wir uns für Zelda auch gewünscht«, fährt mein Vater fort und lenkt das Thema auf das Unausweichliche: mein Versagen. »Aber ihre Prioritäten lagen andernorts. Wir unterstützen ihren Wunsch, einen Blick auf das einfache Leben zu werfen.«
Ich sitze unbeweglich auf meinem Platz, da alles, was ich tue, als provokante Reaktion gewertet wird. Meine langjährige Erfahrung hat mich gelehrt, dass es in solchen Momenten das Beste ist, einfach zu erstarren. Aber in mir brodelt es. Mein Vater ist ein verdammter Heuchler. Wenn ich mich an den Kampf erinnere, den ich ausfechten musste, damit sie mich nach meinem miserablen Schulabschluss überhaupt studieren lassen! Hätte ich nicht versprochen, in der Nähe zu bleiben und mich um meine »Zukunft« nach der Uni zu bemühen, hätten sie mich vermutlich sofort an irgendeinen reichen Erben verheiratet. Mein Herzschlag beschleunigt sich.
»Weißt du schon, auf was du dich spezialisieren willst?«, fragt Philip. Es ist das erste Mal, dass sich jemand direkt an mich wendet, seitdem wir uns gesetzt haben.
Ich atme tief ein, um etwas Passendes zu sagen. Doch als ich gerade ansetzen will …
»Bislang hat sie einfach noch nicht das Richtige gefunden«, antwortet meine Mutter an meiner Stelle. »Stimmt’s, Schatz?«
»Messerscharf analysiert, Mom«, sage ich leise, weil ich mir sicher bin, dass meine Antwort ohnehin niemanden interessiert. Nicht zum ersten Mal frage ich mich, ob es wirklich so ungewöhnlich ist, mit achtzehn Jahren noch nicht das ganze Leben durchgeplant zu haben.
»Wir sind froh, dass Zeldas Brüder alle frühzeitig wussten, was sie aus ihrem Leben machen wollten. Glücklicherweise ist der Druck bei den jungen Damen ja nicht so groß. Natürlich möchte niemand eine ungebildete Partnerin, aber ebenso wenig soll sie schließlich ihren Mann übertrumpfen. Ist es nicht so?«, fragt meine Mutter an meinen Vater gewandt. Er nickt und tätschelt ihre Hand. Mir wird schlecht.
Ich nehme noch einen Schluck Champagner. Mein Glas ist beinahe leer, und ich sehe mich nach der Flasche um. Leider kann ich sie nirgends entdecken.
Meine Kopfhaut wird unter der Perücke immer heißer, und ich habe das Gefühl, dass mein Gesicht unter der dicken Schicht Make-up zu ersticken droht. Vielleicht bin es auch ich, die von der enormen Last dieser Familie zerquetscht wird. Jedenfalls wäre es gut, noch einen Schluck trinken zu können.
Als hätte Agnes meine Gedanken gelesen, taucht sie neben mir auf und schenkt nach.
»Danke«, flüstere ich und trinke einen tiefen Schluck.
Als ich mich wieder dem Gespräch zuwenden will, ist mein Vater gerade dabei, mit Philip die Vor- und Nachteile bestimmter Geldanlagen zu diskutieren. Meine Mutter blickt bewundernd von einem zum anderen und nickt eifrig, als hätte sie auch nur den Hauch einer Ahnung, worum es geht.
Ich bin erleichtert, als wir endlich mit einem leisen Klingeln ins Esszimmer beordert werden.
Die Tafel ist wie immer festlich gedeckt. Weiße Kerzen, weiße Blumen, weiße Stoffservietten, die nun, eine nach der anderen, auf dem Schoß ihres Besitzers verschwinden. Meine Mutter ist besessen von Farbkonzepten. Im Hintergrund läuft leise klassische Musik.
Der erste Gang – Frühlingssalate mit Forellentatar – wird aufgetragen. Dazu gibt es phänomenalen Weißwein, der meiner Erfahrung nach runtergeht wie Wasser. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, diesen Abend nüchtern zu überstehen. Aber ich muss etwas aufpassen, sonst kommt es zum Eklat. Alles schon da gewesen. Been there, done that. Deshalb zwinge ich mich, zur Vorspeise Wasser zu trinken.
Mein Vater und Philip sind inzwischen zum Thema Autos übergegangen.
»Ich sammle Oldtimer«, sagt mein Vater gerade. »Eine Leidenschaft, die ich mit meinem jüngsten Sohn teile. Doch seit er uns an die Brown University verlassen hat, kümmere ich mich allein um unseren Fuhrpark.«
Mit »kümmern« meint er »kaufen«, und ich würde so gerne meinen Kopf kratzen.
Zur Hauptspeise gibt es Kalbsfilet mit verschiedenem Gemüse, und ich erlaube mir ein Glas Rotwein. Aber nur eines – um die Gleichgültigkeit aufrechtzuerhalten.
»Wo wir gerade von ihm sprechen«, sagt meine Mutter, »Zachary lässt dich schön grüßen. Er hat einen begehrten Praktikumsplatz bei einer großen Unternehmensberatung ergattert, wo er den Sommer über arbeiten wird.«
»Schön für ihn«, sage ich mit vollem Mund, weil ich nicht damit gerechnet hatte, heute Abend noch mal direkt angesprochen zu werden. Was mein Bruder mit seinem Sommer macht, ist auf der Liste der Dinge, für die ich mich interessiere, ziemlich weit unten.
Es wäre schön zu erfahren, was auf dieser Liste ganz weit oben steht. Als meine Mutter gesagt hat, ich hätte das Richtige noch nicht gefunden, war das gar nicht mal so falsch. Ich wünschte, ich wüsste, was diese eine Sache ist, für die ich eine Leidenschaft habe. Denn wie soll ich meinen Eltern beweisen, dass ich gut in etwas sein kann, dass sie stolz auf mich sein können, wenn ich dieses »Etwas« nicht kenne?
Andererseits müsste ich mich früher oder später ohnehin davon verabschieden. Schließlich möchte kein Mann von seiner zu gebildeten Frau übertrumpft werden.
Stimmt’s, Mom?, füge ich in Gedanken hinzu.
Zum Nachtisch gibt es Waldbeeren-Sorbet. Und ich weiß genau, was jetzt kommt. Denn die Auswahl der Speisen ist kein Zufall.
»Sorbet ist in unserer Familie ein viel diskutiertes Thema«, sagt meine Mutter, und ich verdrehe die Augen. Here we go. Das ist ihre Lieblingsanekdote. Ich bin mir sicher, sie serviert nur deswegen ständig Sorbet, um ein Gesprächsthema zu haben, bei dem sie sich sicher fühlt. »Meine jüngeren Söhne, Zachary und Sebastian, sowie ich selbst finden, es ist der perfekte Nachtisch nach einem üppigen Mahl. Während unser ältester Sohn Elijah und Zelda der Ansicht sind, geeister Fruchtsaft sei kein Nachtisch.« Sie lacht schrill.
Ich tue meiner Mutter den Gefallen und beteilige mich am Gespräch. »Ich finde einfach, wenn man sich schon die Mühe macht, einen Nachtisch zu servieren, sollte es der Höhepunkt des Dinners sein. Crème brûlée, Mousse au Chocolat, Millionaire’s Cheesecake. Aber Sorbet?«
Das Lachen meiner Mutter wird noch höher. Gleich zerspringt irgendwo eine Kristallvase. »Sehen Sie, Philip, es ist ein heikles Thema. Was meinen Sie dazu?«
Er räuspert sich, wischt seinen Mund an der Serviette ab und legt sie auf den Tisch. »Ich meine, das war ein ausgezeichnetes Sorbet.«
Triumphierend blickt meine Mutter von Philip zu mir.
»Dessertwein?«, fragt mein Vater, dem dieses Schauspiel wohl inzwischen ähnlich peinlich ist wie mir.
»Gern, Sir«, sagt Philip und lässt sich von meinem Vater ein kleines Glas einschenken. »Ich könnte ein wenig frische Luft vertragen nach diesem wunderbaren Essen. Vielleicht hast du Lust, mir den Garten zu zeigen, Zelda?«
»Eine hervorragende Idee«, flötet meine Mutter. Sie hört schon die Hochzeitsglocken läuten.
Ich weiß allerdings ganz genau, worauf das hinausläuft. Er wird versuchen, mir an die Wäsche zu gehen, ich werde ihm eine scheuern. Ihm wird es peinlich sein. Mir wird meine Hand wehtun.
Ich stehe auf und bedeute Philip, mir zu folgen. Das Glas mit dem Dessertwein nehme ich mit.
Auf der Terrasse atme ich einmal tief ein. Die Nachtluft duftet gut nach Frühling und Leben. Ich habe das Gefühl, es ist der Geruch von allem, was ich gerade verpasse.
»Wollen wir ein paar Schritte gehen?«, fragt Philip, als wüsste ich nicht, was er damit bezweckt. Abseits der Beleuchtung am Haus sind wir unbeobachtet. Mir soll es recht sein. Ein weiterer Kandidat, den ich dann los bin.
Wir laufen die Stufen der Terrasse hinunter. Unten ziehe ich meine Schuhe aus, weil ich sie nicht auf der feuchten Wiese ruinieren will. Barfuß mache ich ein paar Schritte. Ich würde gern ein bisschen herumspringen, aber das ziemt sich nicht für eine Dame meines Standes. Das hat es vor zwölf Jahren nicht und tut es jetzt erst recht nicht. Ich drehe mich um, um zu sehen, ob Philip mir folgt. Er ist kurz stehen geblieben und betrachtet die Hinterseite unseres Hauses, das hell erleuchtet vor dem Nachthimmel erstrahlt.
»So ein Anwesen kann ganz schön einschüchternd sein, oder?«, fragt er.
»Du sagst es.«
Wir schlendern eine Weile schweigend nebeneinander her, weil ich keine Lust habe, in Himmelsrichtungen zu weisen und zu erklären, was die Skulpturen darstellen sollen, die meine Mutter aus Langeweile kauft und dann in den Garten stellt. Ich spüre das feuchte Gras zwischen meinen Zehen. Das Gefühl der frischen Halme beruhigt mich. Wir steuern eine Steinbank an, die links vom Haupthaus etwas versteckt zwischen zwei hohen Bäumen steht. Je schneller Philip versucht, mir seine Zunge in den Hals zu stecken, desto eher ist der Abend vorbei.
Ich lasse mich nieder, und Philip setzt sich neben mich.
»Also«, sagt er, »wie oft musst du diese Verkupplungsversuche über dich ergehen lassen?«
Seine Direktheit überrascht mich. Sollten wir nicht so tun, als wäre es Zufall, dass wir heute Abend hier zusammengekommen sind? Das ist definitiv gegen die Etikette.
»Beinahe jedes Wochenende«, antworte ich.
»Wow, sie meinen es also wirklich ernst, hm?«
Ich seufze. »Scheint so.«
»Nimm es mir bitte nicht übel«, sagt er, »aber ich bin nicht bereit, dich zu heiraten.«
Ich hebe meinen Blick und sehe ihn direkt an. Er lächelt freundlich. »Das trifft sich gut«, gebe ich zurück. »Denn ich bin sicher auch nicht bereit, dich zu heiraten.«
»Puh. Ich bin froh, dass wir das geklärt haben. Ich bin ja der Meinung, man sollte sich erst mal kennenlernen.« Er gluckst. »Beispielsweise würde ich gern wissen, ob deine Mom dich wirklich vorhin gefragt hat, ob du eine Perücke trägst.« Er zupft leicht an meinen Haaren.
»Äh, ja, das hat sie«, sage ich. Er hat es also gehört. »Unter den blonden Haaren und dem Make-up bin ich so ziemlich der Albtraum meiner Eltern.«
Philip lacht. »Und wie sieht dieser Albtraum aus?«
Ich ziehe langsam die Perücke von meinem Kopf, und zum Vorschein kommt die pinke Farbe.
»Wow!«, sagt Philip. »Gefällt mir, ehrlich gesagt, besser so. Ich fand dich drinnen ein bisschen farblos.«
»Oh, vielen Dank für das Kompliment, Mr Ich-rede-über-Geldanlagen-und-steige-in-die-Kanzlei-meines-Vaters-ein. Wann wirst du noch mal Partner?«
»Vielleicht hätte ich sagen sollen, dass ich nach dem Studium ein Jahr lang barfuß durch die Welt reisen will.« Im Zwielicht erkenne ich, dass er schelmisch grinst.
»Vermutlich war es so besser für uns alle.«
»Vermutlich.«
Wir sitzen einen Moment schweigend nebeneinander. Dann sagt Philip: »Ich finde übrigens auch, dass Sorbet kein Nachtisch ist. Wenn ich einen Smoothie will, kaufe ich mir einen Mixer.«
Als wir uns verabschieden und meiner Mutter zum dritten Mal versichert haben, dass wir Nummern ausgetauscht haben, flüstert Philip mir ins Ohr: »Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Auch wenn wir nicht heiraten.«
Er umarmt mich, und ich bin froh, dass mich Menschen doch noch überraschen können – und ich sie trotzdem nicht heiraten muss.
2 Malik
Als ich am Sonntagmorgen die Tür von Mal’s Café öffne, ist noch nicht viel los. Es ist zu früh, die Menschen schlafen ihren Rausch von letzter Nacht aus.
»Gut, dass du da bist! Du rettest mir echt den Arsch«, begrüßt mich mein Mitbewohner Rhys, der hinter dem Tresen steht und Tassen einräumt.
»Kein Problem, Mann. Wo soll ich anfangen?«
Rhys hat mich vor einer halben Stunde aus dem Bett geklingelt. Der Koch und Bäcker des Cafés hat sich spontan krank gemeldet, und es gibt weder Frühstück noch frische Muffins oder Kuchen. An einem Sonntag kommt das einer mittleren Katastrophe gleich. Also hat Rhys mich gebeten, einzuspringen. Ich fühle mich geehrt, dass er sofort an mich gedacht hat, weil es zeigt, dass er von meinen Fähigkeiten überzeugt ist. Das ist genau die Art von Zuspruch, die ich gebrauchen kann. Dass ich dabei noch ein bisschen Geld verdiene und durch die Arbeit in der Küche bis zum Nachmittag abgelenkt bin und keine Zeit für Nervosität oder Selbstzweifel habe, kommt mir auch sehr gelegen. Denn morgen beginne ich meine Ausbildung zum Koch in einem stinkfeinen Hotel. Das ist für mich ein riesiger Schritt, weil es bedeutet, dass ich meine Komfortzone hinter mir lasse und in eine mir bisher unbekannte Welt eintrete. Eine reichere Welt, die mit meinen Wurzeln wenig gemein hat. Wenn auch erst einmal nur als Lakai.
»Du musst dir keinen Stress machen. Im Kühlschrank sind noch ein Karottenkuchen und einige Cupcakes, mit denen wir hoffentlich eine Weile hinkommen.«
»Also, was brauchst du als Erstes?«, frage ich.
»Muffins. Schokolade und Blaubeere. Che hat außerdem das Rezept für seinen Erdbeer-Käsekuchen geschickt.« Rhys hält mir sein Handy hin. Das Display zeigt das etwas unscharfe Foto einer handschriftlichen Notiz.
»Den Käsekuchen kriege ich auch ohne Rezept hin. Wann fängt der Frühstücksstress an?«
»Stell dich darauf ein, dass ab neun Uhr Bestellungen eingehen. Wenn wir Glück haben, bleibt es noch etwas länger ruhig.«
Ich folge Rhys in die Küche. Während der Laden vorne in ein warmes Licht getaucht ist und mit Holzmöbeln, Zeitschriften, Büchern und gerahmten Bildern an der Wand eine gemütliche Atmosphäre ausstrahlt, ist hier hinten glänzender Edelstahl das vorherrschende Material. Ich fahre mit der Hand über die Arbeitsfläche. Sie ist angenehm kalt.
»Ich kenne mich hier nicht wirklich aus«, sagt Rhys. »Aber du solltest in den Schränken alles finden, was du brauchst.« Er öffnet alibimäßig ein paar Schranktüren und schließt sie wieder.
»Keine Sorge, ich komme klar.« Mit wenigen Blicken habe ich die Küche ausgelotet. Sie ist nicht sehr groß. Der Herd sieht aus, als hätte er schon bessere Zeiten gesehen, aber ihm gegenüber glänzt ein nagelneuer Ofen, der auf Brusthöhe in die Metallregale integriert ist. An der Stirnseite steht links vom Fenster ein überdimensionaler Kühlschrank. Die hüfthohen Regale daneben sind mit Lebensmitteln gefüllt.
»Noch mal danke, dass du so spontan einspringst. Ich weiß, dass du an deinem letzten freien Tag eigentlich Besseres zu tun hast.«
»Ach was, mach dir keinen Kopf. Ich freue mich über die Ablenkung.« Ich klopfe Rhys auf die Schulter. Er ist nicht nur mein Mitbewohner, sondern gleichzeitig mein bester – und einziger weißer – Freund. Ich würde ihn nie hängen lassen. »Und jetzt verschwinde, damit ich arbeiten kann.« Mit diesen Worten schiebe ich Rhys in Richtung Tür.
»Melde dich, wenn du Hilfe brauchst. Che sagt, er ist erreichbar.«
Als Rhys die Küche verlassen hat, atme ich einmal tief durch. Dann klatsche ich in die Hände und reibe sie voller Vorfreude aneinander. Ich öffne nacheinander alle Schränke und ziehe Rührschüsseln, Mixer, Messbecher und alles, was ich für die Muffins brauche, heraus. Als Nächstes widme ich mich den Lebensmitteln. Ich kenne Che, den Koch von Mal’s Café, zwar kaum, aber ich hätte ihm nicht zugetraut, so ordentlich und organisiert in seiner Küche zu sein. Er wirkte auf mich immer wie ein ziemlicher Chaot. Glücklicherweise habe ich mich getäuscht und finde alle Zutaten sofort.
Als Erstes mache ich mich an den Teig für die Schokomuffins. Auf der Suche nach Zartbitterschokolade entdecke ich ein paar rote Chilis, und mir kommt eine Idee. Ich weiß nicht, wie experimentierfreudig die Gäste in Mal’s Café sind, aber vielleicht haben die ein oder anderen ja Lust, mal etwas Neues auszuprobieren.
Nachdem ich die Muffinbleche mit Papierförmchen ausgelegt habe, verteile ich den Teig gleichmäßig darin. Die eine Hälfte wird zu klassischen Schokomuffins, die andere Hälfte habe ich mit ein wenig Chili so verfeinert, dass das Ergebnis zwar nicht zu scharf ist, sich beim Essen aber trotzdem eine leichte Hitze im Mund entfaltet. Ich schiebe alles in den Ofen und stelle die Gradzahl und die Backzeit ein. In zwanzig Minuten sollten sie fertig sein.
Dann mache ich mich an die Blaubeermuffins. Es sind die Lieblingsmuffins meiner kleinen Schwester Jasmine. Für sie können es nie genug Blaubeeren im Teig sein. Allerdings ist die Gefahr dabei groß, dass die Beeren zu viel Flüssigkeit abgeben. Es ist eine Gratwanderung zwischen zu matschigen und zu trockenen Muffins, die ich glücklicherweise im Schlaf beherrsche. Denn auch ich bin der Meinung, dass man mit Blaubeeren nicht geizen darf.
Da der Ofen noch von den Schokomuffins belegt ist, beginne ich schon mal mit dem Erdbeer-Käsekuchen. Der Boden ist schnell aus Keksbröseln und zerlaufener Butter gemacht. In die Füllung rühre ich frisches Erdbeermousse.
»Malik«, ertönt Rhys’ Stimme. Er hat seinen Kopf zur Tür reingesteckt. »Einen Frischkäse-Lachs-Bagel und ein Thunfisch-Sandwich, bitte.«
»Kommt sofort«, sage ich.
Der Ofen beginnt zu piepsen, und ich schalte ihn aus. Die Muffins sehen toll aus, als ich sie herausnehme. Ich schiebe die vorbereiteten Blaubeermuffins hinein, programmiere den Ofen erneut – diesmal gebe ich dem Ganzen fünf Minuten länger – und mache mich an Rhys’ Bestellung.
Ich arbeite wie im Flow. Jeder Handgriff hat einen Sinn. Das ist das Befriedigende am Kochen. Nichts passiert umsonst. Kein Handgriff ist verschwendet. Und am Ende macht man Leute nicht nur satt, sondern im besten Fall glücklich.
Während ich mit der einen Hand Pancakes brate und mit der anderen Hand Eier pochiere, ist auch die zweite Ladung Muffins fertig. Als Nächstes wandert der Käsekuchen in den Ofen.
Die Arbeit in der Küche hat beinahe etwas Meditatives für mich. Meine Hände sind so beschäftigt, dass mein Kopf nichts anderes tun kann, als ihnen Befehle zu geben, um dann ihren Bewegungen zu folgen. Mein Körper ist in völligem Einklang mit meiner Umgebung. Das Multitasking beim Kochen hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Tanz. Doch statt eines Beats geben hier die gewohnten Handgriffe vor, was geschieht.
So vergeht Stunde um Stunde. Ich belege Bagels, brate Eier, toaste Brotscheiben, stampfe Avocado. Ich würze und schmecke ab, hacke, würfle, presse. Dazwischen schaffe ich in jeder freien Minute Platz, um dann von Neuem zu beginnen.
»Hey, Malik«, ruft Rhys schließlich in die Küche hinein. »Es ist zwei Uhr. Ich habe die Frühstückskarten abgeräumt. Du kannst dich entspannen.«
Ich drehe mich um und recke meinen Daumen nach oben. Dann wische ich meine Hände an der ehemals weißen Schürze ab.
»Danke, Mann. Das kommt wie gerufen.«
Ich hatte, ehrlich gesagt, gar nicht wirklich gemerkt, wie anstrengend die letzten Stunden waren. Aber jetzt, da ich durchatme, spüre ich, dass ich erschöpft bin.
»Lass die Schürze hier und komm mit nach vorne. Ich mache dir einen Kaffee«, sagt Rhys.
Dankbar nicke ich. Koffein ist genau das, was ich jetzt brauche.
Ich wasche mir meine Hände und das Gesicht und betrete den Laden. Drei der kleinen Tische sind besetzt. Alle haben zu essen. Meine Arbeit ist getan.
Als ich den Blick ein zweites Mal durch den Laden schweifen lasse, erkenne ich die beiden jungen Frauen an einem der Tische. In diesem Moment schaut eine der zwei auf und erblickt mich.
»Malik«, ruft sie. »Schön, dich zu sehen!« Es ist Tamsin, Rhys’ Freundin, die einen nicht unwesentlichen Teil dazu beigetragen hat, dass es ihm heute so gut geht. Seine Geschichte gehört zu den unglaublichsten, die ich je gehört habe. Er saß sechs Jahre lang im Gefängnis, und zwar unschuldig. Nach seiner Entlassung dauerte es einige Monate, bis er sich an die Welt gewöhnt hatte. Ich kann gut nachvollziehen, wie er sich gefühlt haben muss, denn auch ich habe eine Vergangenheit im Pearley Juvenile Prison. Allerdings ist meine einzige Entschuldigung jugendliche Dummheit und eine Hautfarbe, die bei gewissen Institutionen nicht ganz so hoch im Kurs steht. Aber im Gegensatz zu Rhys musste ich nicht meine gesamte Jugend hinter Gittern verbringen.
Tamsin kommt auf mich zu und umarmt mich. Ich muss mich hinunterbeugen, weil sie um einiges kleiner ist als ich. Besser gesagt: Ich bin um einiges größer als sie. Mit meiner Körpergröße von zwei Metern kommen mir fast alle Menschen klein vor.
»Setzt du dich zu uns?«, fragt sie.
Rhys drückt mir einen Becher mit heißem Kaffee in die Hand, und ich folge Tamsin zu ihrem Tisch. Am Hinterkopf des Mädchens, das dort sitzt, erkenne ich, dass es sich um Tamsins Freundin Zelda handelt. Sie hat leuchtend pinke Haare und ist deswegen leicht auf Anhieb zu erkennen.
»Du erinnerst dich noch an Zelda?«, fragt Tamsin, und ihre Freundin wendet den Kopf. Was für eine Frage. Als könnte man Zelda je vergessen. Ich habe sie zwar erst einmal gesehen, aber schon bei unserem ersten Zusammentreffen sind mir ihre Unbefangenheit, ihre Quirligkeit und ihr seltsamer Humor aufgefallen. Sie ist witzig, aber auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise. Und sie ist wirklich niedlich mit ihren Sommersprossen und ihren leuchtenden, frechen Augen.
»Hi, Malik«, sagt sie. »Wie geht’s?«
»Sehr gut. Und dir?«
»Ich bin schlecht gelaunt.«
»Frag besser nicht«, sagt Tamsin und lacht.
»Was ist los?«, will ich trotz der Warnung wissen.
»Ich hatte keinen Nachtisch«, sagt Zelda und schiebt in gespielter Traurigkeit die Unterlippe nach vorn. »Und ich fühle mich fremdbestimmt.«
»Das sind zwei … äh … gute Gründe für schlechte Laune. Wovon fühlst du dich denn fremdbestimmt?«, frage ich grinsend.
»Werbung, Determinismus, such dir etwas aus.« Sie verdreht übertrieben die Augen. »Aber dass ich keinen Nachtisch hatte, ist schlimmer.«
»Das können wir ändern«, sage ich. »Was darf es sein? Schoko-Chili-Muffins? Käsekuchen? Blaubeermuffins?«
»Kann ich alles haben?«, fragt sie. »Garçon?« Sie schnippt mit dem Finger in Rhys’ Richtung. »Einmal alles mit Zucker, bitte.« An mich gewandt, schiebt sie hinterher: »Vielleicht wird das ja doch noch mit mir und diesem Tag.«
Nach ein paar Minuten kommt Rhys mit Muffins und Käsekuchen. »Wer kriegt was?«, fragt er.
»Ich kriege alles«, sagt Zelda und zieht die Teller, die Rhys einen nach dem anderen in die Mitte des Tisches stellt, vor sich.
»Beeindruckend«, sagt Rhys und nimmt sich einen Stuhl. Die anderen Gäste haben soeben gezahlt und sind gerade am Gehen, sodass er erst einmal nichts zu tun hat.
Zelda beginnt, den Käsekuchen in sich hineinzuschaufeln. Ihr Gesichtsausdruck wird dabei immer fröhlicher.
»Mmmmh, das war genau das, was ich gebraucht habe. Kein Nachtisch! Das muss man sich mal vorstellen. Hast du das gebacken, Malik?«
»Damit habe ich meinen Morgen verbracht.«
»Che sollte öfter krank sein.«
»Sag das nicht«, schaltet sich Rhys ein, »ab morgen ist Malik nicht mehr verfügbar. Dann gibt es gar keinen Käsekuchen mehr, wenn Che krank ist.«
»Ich fange morgen meine Ausbildung zum Koch an«, erkläre ich – nicht ohne Stolz in meiner Stimme.
»Dann bin ich bei dir an der absolut richtigen Adresse«, sagt Zelda. Als sie meinen fragenden Blick sieht, erklärt sie: »Es geht um die großen Fragen des Lebens. Als Experte, was würdest du sagen: Ist Sorbet Nachtisch oder nicht?«
Ihre Frage verblüfft mich, so wie das meiste an ihr. Es scheint, als würde ihr Kopf unentwegt zwischen Gedanken hin und her springen. Ich frage mich, ob es anstrengend ist, so zu sein. Langweilig hat man es mit Zelda sicher nie. Das ist mir schon bei unserem ersten Treffen aufgefallen.
»Ich würde sagen, Sorbet ist ein fabelhafter Zwischengang für Menschen mit kleinem Magen«, sage ich.
»Ha! Ganz genau! Kannst du mir das schriftlich geben?«
Ihre Begeisterung wirkt echt, auch wenn ich nicht so ganz verstehe, warum sie meine Antwort so euphorisiert. Sie reicht mir ein abgerissenes Blockblatt und einen Kugelschreiber.
Ich, Malik Capela, bin der Ansicht, dass Sorbet ein Zwischengang ist, schreibe ich auf den Zettel. Ich unterschreibe und datiere den Zettel, falte ihn und reiche ihn an Zelda zurück. Sie liest, was ich geschrieben habe, und nickt zufrieden.
»Ich danke dir, Malik Capela, Sorbet-Experte. Du hast mich sehr glücklich gemacht.« Bei diesen Worten beißt sie in den Schokomuffin und schließt kauend die Augen. »Das schmeckt einfach umwerfend.«
Ich grinse in mich hinein. Ihr Lob bestärkt mich nur noch einmal darin, dass ich mit der Ausbildung ab morgen den richtigen Weg einschlage.
»Jetzt ich, jetzt ich!«, ruft Esther und zerrt an meiner Hand. Ich habe meinen Eltern versprochen, am Nachmittag mit meinen Geschwistern auf den Spielplatz zu gehen. Obwohl ich nach den sechs Stunden im Café eigentlich zu müde bin, wollte ich nicht absagen. Sie können die Zeit zu zweit gut brauchen, und meine Geschwister freuen sich, wenn ich etwas mit ihnen unternehme. Und ich freue mich auch.
»Nein, du durftest länger!« Ellie krallt sich in meine Haare, als hätte sie Angst, ich könnte sie gleich von meinen Schultern werfen.
»Bis zur nächsten Straße noch. Dann tauschen wir wieder. Das ist fair«, sage ich in der Hoffnung, einen Streit zu vermeiden. Aber Esther schmollt trotzdem und weigert sich weiterzugehen. Sie hat ihre Arme vor der Brust verschränkt und schiebt die Unterlippe nach vorne. Im Gegensatz zu Zeldas gespielter Traurigkeit vorhin ist das hier kein Spaß.
»Hey, Theo, nimmst du bitte deine Schwester an der Hand?«, frage ich meinen achtjährigen Bruder, der ein bisschen zurückgefallen ist, weil er mal wieder vor sich hin geträumt hat. »Und kannst du ein bisschen schneller machen, Kumpel? Schau mal, wie weit vorne Jasmine und Ebony schon sind!«
Theo, der mit einem Stock auf den Gehweg klopft, blickt hoch und kommt dann auf uns zugerannt, um die Lücke wieder zu schließen. Er streckt Esther die Hand hin, doch sie schüttelt den Kopf und dreht sich weg.
»O Mann, sei kein Baby«, sage ich. »Du willst doch auch auf den Spielplatz.«
Kurz entschlossen schlingt Theo die Arme um Esther und hebt sie hoch. Sie ist viel zu schwer für ihn, aber es gelingt ihm tatsächlich, sie ein paar Meter zu tragen. Wobei – »tragen« ist vielleicht zu viel gesagt. Eher schleift er sie. Esther kreischt, inzwischen aber vor Vergnügen.
Als wir die Straße erreichen, lasse ich Ellie vorsichtig runter und hebe Esther auf meine Schultern. Ellie ist eindeutig die Vernünftigere von beiden. Ohne Widerworte läuft sie die letzten hundert Meter zum Spielplatz selbst. Vom Haus meiner Eltern ist es eigentlich kein weiter Weg. Wenn man allerdings zwei Dreijährige und einen Achtjährigen im Schlepptau hat, kann es sich ziehen. Auf dem Rückweg kümmere ich mich um Ebony, die mit ihren fünf Jahren leichter unter Kontrolle zu halten ist – soll Jasmine sich mit den Zwillingen rumschlagen.
Der Spielplatz ist seit einigen Monaten die Hauptattraktion im Viertel. Eine gemeinnützige Organisation hat ihn gebaut. Es sind ordentlich Spendengelder zusammengekommen. Sie wollten Kindern aus dem Süden von Pearley – oder »Poorley«, wie wir es nennen – einen Ort geben, der mehr bereithält als durchweichte Pappkartons und verbeulte Tonnen. Vorher waren versiffte Hinterhöfe das Aufregendste, was die Gegend zu bieten hatte. So schmutzig und rattenverseucht, dass ich mich nicht wundere, warum hier niemand eine Perspektive sieht. Warum die Hälfte der jungen Männer eine Knast-Vergangenheit und -Zukunft hat. Mal sehen, wie lange der Spielplatz noch so neu und gepflegt aussieht. Am Abend ist er jedenfalls jetzt schon Treffpunkt für Dealer und User. Ma hat mir erzählt, dass Esther vor ein paar Wochen eine Spritze im Sand gefunden hat.
Ellie und Esther rennen sofort auf das Karussell zu. Ebony sitzt schon drin.
»Schubst du uns an?«, fragt Ellie ihren älteren Bruder. Theo ist mal wieder auf halbem Weg stehen geblieben. Irgendwas hat ihn von seinem Ziel abgelenkt. Jetzt erinnert er sich aber wieder daran, wo er ist. Und natürlich schubst er seine Schwester an.
Ich setze mich zu Jasmine auf eine Bank.
»Puh«, stöhne ich. »Auf dem Rückweg kriegst du die Zwillinge.«
»Vergiss es«, sagt Jasmine. Sie tippt auf ihrem Handy herum. »Ab nächster Woche bin ich eh alleine mit ihnen.«
Beim Gedanken an morgen muss ich lächeln. Für mich fängt ein neues Leben an. Der erste Schritt auf dem Weg zu meinem Traum. Meine Sozialarbeiterin Amy hat mir die Stelle besorgt. Ich habe im Gefängnis mit dem Kochen angefangen. Ohne die Knastküche würde ich jetzt wahrscheinlich nicht hier mit meinen Geschwistern sitzen, grinsend.
»Bist du aufgeregt?«, fragt Jasmine.
»Ein bisschen. Aber auf eine gute Art.«
»Aber du hast dann viel weniger Zeit, oder? Du kommst bestimmt nicht mehr so oft vorbei.«
Ich lege den Arm um meine fünfzehnjährige Schwester. Jasmine und ich haben uns immer gut verstanden. Und seit ich wieder draußen bin, hängt sie sehr an mir. Und ich an ihr. Ich liebe alle meine Geschwister. Manchmal macht es mich traurig, dass ich schon so viel Zeit mit ihnen verpasst habe. Aber genau deswegen ist es so wichtig, dass ich jetzt endlich alles richtig mache. Einen ordentlichen Job. »Routine« nennt Amy das. Und ich will tun, was Amy sagt, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren.
»Ich komme zu euch, so oft ich kann.« Aber natürlich hat Jasmine recht. Mit der Arbeit und der Fahrerei werden meine Besuche sicher weniger.
»Ich wünschte, du würdest wieder bei uns wohnen. Dann könnten wir uns wenigstens sehen, wenn du nach Hause kommst«, sagt Jasmine und lehnt ihren Kopf gegen meine Schulter.
Während ich im Gefängnis war, sind die Zwillinge zu Theo gezogen, sodass dort kein Platz mehr für mich ist. Ebony und Jasmine teilen sich schon länger ein Zimmer.
»Soll ich vielleicht bei dir im Bett schlafen? Oder mir irgendwo auf dem Boden was freiräumen? Ehrlich gesagt bin ich ganz froh, dass ich jetzt mein eigenes Zimmer habe.«
»Ich hätte auch gern ein eigenes Zimmer. Vielleicht sollte ich auch eine Tankstelle überfallen.«
Mir wird ganz heiß, als sie das sagt. Um Himmels willen. »Sag das noch mal, und ich vergesse mich!« In meiner Stimme schwingt Panik mit. Es ist meine größte Angst, dass eins meiner Geschwister den gleichen Scheiß durchmachen muss wie ich. Ich hoffe, mein Beispiel war abschreckend genug. »Und du weißt ganz genau, dass ich die beschissene Tankstelle nicht überfallen habe«, presse ich noch zwischen den Zähnen hindurch.
»Komm mal wieder runter. Das war ein Scherz.«
»Ich will nicht, dass du darüber Witze machst. Schon gar nicht vor den Kleinen. Im Ernst, Jas, das ist wichtig.«
»Ja, ist ja gut.«
Ich merke, dass ihr die dumme Aussage peinlich ist. Aber sie muss verstehen, was sie damit anrichten kann. »Ich hatte einfach verdammtes Glück, dass ich in Amys Programm reingerutscht bin und noch mal eine Chance bekomme. Ich bin ihr wirklich verflucht dankbar. Aber jede Sekunde im Knast war eine zu viel. Ich habe meine Lektion gelernt. Und ich hoffe, ihr auch. Haltet euch fern von Leuten, die euch in solche scheiß Situationen bringen.« Sofort sehe ich vor meinem inneren Auge meinen Cousin Darius und seine Kumpels, Andre und Xavier. Möchtegern-Gangster auf Dope oder härteren Sachen. Falsche Vorbilder in jeder Hinsicht. Hätte ich das schon damals gewusst, als ich ein dummer Teenager war, hätte ich meiner Familie und mir einiges erspart.
Ich sehe Jasmine direkt an, und sie verdreht die Augen. Ihr Verhalten ist wirklich uncool.
»Du klingst schon wie Pop. Tu nicht so erwachsen. Ich hab’ einfach nur einen Witz gemacht.«
Einen Witz, vielleicht. Aber darüber lachen kann ich nicht. Es kann sogar sein, dass sie recht hat. Kann sein, dass ich wirklich nicht so erwachsen bin, wie ich es von mir selbst erwarte. Aber das liegt vor allem daran, dass ich seit meiner Entlassung keine negativen Gefühle mehr zulasse. Den dunklen Nebel, der mir nach meiner zweiten Festnahme die Luft abgeschnürt hat und mich fast gekillt hat, habe ich ein für alle Mal vertrieben.
»Ich bin erwachsen«, ermahne ich meine Schwester trotz des leisen Zweifels und gebe ihr einen leichten Klaps auf den Hinterkopf. Die Unterhaltung ist beendet, das weiß ich. Ich weiß auch, dass sie begriffen hat, dass es für mich kein Spaß ist.
Zurück bei meinen Eltern, bringt Jasmine die Zwillinge ins Bett. Sie haben auf dem Rückweg nur noch gejammert und sind am Küchentisch beinahe über ihren Sandwiches eingeschlafen. Sie hatten nicht einmal mehr die Kraft, sich darüber zu beschweren, dass Ma die Kruste des Weißbrots nicht abgeschnitten hat.
Meine Eltern sitzen eng aneinandergekuschelt auf einem der Sofas. Ich lasse mich ihnen gegenüber auf einem alten Cordsessel nieder.
»Danke, dass ihr mit den Kleinen rausgegangen seid«, sagt Ma. »Wir brauchten wirklich mal ein bisschen Ruhe.«
Pop drückt ihr einen Kuss auf den Kopf. Meine Eltern sind seit der Highschool ein Paar. Ma war siebzehn, als sie mit mir schwanger wurde, und nur ein paar Monate später haben sie geheiratet. Sie sind jetzt seit fast einundzwanzig Jahren zusammen und wirken immer noch glücklich wie am ersten Tag.
»Hast du für morgen alles, was du brauchst?«, fragt Pop.
»Ich denke schon.« In meinem Magen kribbelt es vor Aufregung und Vorfreude.
»Ich bin mir sicher, dass du das ohne Probleme meistern wirst. Ich bin stolz auf dich, dass du so weit gekommen bist, Sohn«, sagt er.
»Jetzt übertreib nicht. Es ist ja nicht so, als hätte ich bisher eine Bilderbuchkarriere hingelegt.« Ich fahre mir beschämt mit der Hand über den Hinterkopf. Ich weiß, dass meine Eltern meinetwegen viel durchmachen mussten. Deswegen versuche ich jetzt die beste Version von mir zu sein. Die Version, die nichts mehr verkackt, die nicht wieder und wieder Chancen vermasselt. Ich könnte es nicht ertragen, zu wissen, dass Ma noch mal meinetwegen weinen muss. Würde Pops enttäuschten Blick nicht noch einmal aushalten. Der Anblick meiner Eltern, als ich zum zweiten Mal in einem Polizeiwagen abtransportiert wurde, hat sich für immer in meine Erinnerung eingebrannt. Nie wieder. Nie wieder tue ich meiner Familie das an.
»Du weißt, dass wir dir nie etwas vorgeworfen haben, Malik. Und das bleibt auch so. Egal, was du aus dir machst, du bleibst unser Sohn«, sagt Ma.
Ich schlucke schwer. In meinem Hals hat sich ein Kloß gebildet. Wir haben noch nie offen über die Dinge gesprochen, die in meiner Vergangenheit schiefgelaufen sind.
»Du warst zur falschen Zeit am falschen Ort«, sagt Ma. »Du warst gerade mal ein Teenager.«
Aber selbst wenn. Ich weiß genau, dass ich einfach hätte abhauen sollen, als der bescheuerte Darius und die anderen auf die Idee kamen, eine Tankstelle auszurauben. Ich wusste auch als Jugendlicher, dass es falsch war. Und doch glaubte ich, meiner Familie einen größeren Gefallen zu tun, wenn ich das Fluchtauto für meinen Cousin fuhr. Immerhin war ich bei dem Überfall an sich nicht beteiligt. Darius sitzt immer noch.
»Das zweite Mal war natürlich einfach nur dämlich«, sagt Pop jetzt und lacht.
Das zweite Mal. Damit meint er den Ladendiebstahl. Ich wollte Jasmine zu ihrem Geburtstag ihren größten Wunsch erfüllen, hatte aber kein Geld. Und dann war es, als würde mein Gehirn für einen kurzen Moment einfach aussetzen. Das Frisierset verschwand unter meinem Pulli. Und ich verschwand daraufhin für fast ein weiteres Jahr im Pearley Juvy, weil ich gegen meine Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Als Afroamerikaner aus ärmlichen Verhältnissen darf man sich so etwas nicht erlauben. »Dämlich« trifft es also nicht einmal im Ansatz.
»Aber du bist ein guter Sohn, Malik. Das sollst du wissen.«
»Habt ihr was geraucht?«, frage ich und versuche, das leichte Beben in meiner Stimme mit einem Kichern zu verbergen.
In diesem Moment kommen Ebony und Theo in ihren Schlafanzügen nach unten, um Gute Nacht zu sagen. Sie reiben sich die Augen.
»Bleibst du heute hier, Malik?«, fragt Ebony mit ihrer hohen Mädchenstimme. Die drei Zöpfe, die Jasmine ihr geflochten hat, stehen beinahe im Neunzig-Grad-Winkel von ihrem Kopf ab.
»Das geht nicht, Süße. Ich muss heute Nacht gut schlafen, damit ich morgen für die Arbeit fit bin.«
»Okay«, sagt sie und klettert auf meinen Schoß. Sie kuschelt sich in meinen Arm und schließt die Augen.
Theo setzt sich zu meinen Eltern und wickelt sich in eine Decke. Die Kleinen schlafen oft auf dem Sofa ein, während wir uns noch unterhalten. Später wird Pop sie in ihre Betten tragen. Ich lege meine Arme um Ebonys kleinen Körper. Sie riecht nach Geborgenheit und Familie. Schon bald geht ihr Atem regelmäßig.
Jasmine kommt nach unten, holt sich aus der Küche eine Limonade und setzt sich vor mich auf den Boden. Sie lehnt ihren Kopf an mein Knie und öffnet mit einem Zischen ihre Getränkedose.
»Die Zwillinge sind schon wieder in meinem Bett eingeschlafen«, sagt sie. »Ich will endlich ein eigenes Zimmer. Wenn ihr mir erlauben würdet …«
Hier unterbricht Pop sie, denn diese Unterhaltung haben meine Eltern mit Jasmine in den letzten Wochen zur Genüge geführt. »Nichts da. Du machst die Schule fertig. Dann kannst du arbeiten, wo du willst. Meinetwegen auch in diesem Nagelstudio. Aber solange wir für dich verantwortlich sind, wird zur Schule gegangen.«
Unsere Eltern sind nicht sonderlich streng. Aber in diesem Punkt geben sie nicht nach. Zum Glück. Manchmal wünschte ich, sie hätten auch mir weniger Freiheiten gelassen. Ich würde ihnen deswegen nie einen Vorwurf machen. Aber als ich anfing, nach der Schule immer weniger nach Hause zu kommen, um mit Darius, Andre und Xavier in Parks abzuhängen und mich wie ein Gangster zu fühlen, hätten sie vielleicht besorgter sein sollen. Ab und zu frage ich mich, ob dann alles anders gekommen wäre.
Jasmine stöhnt genervt auf. »Das ist gemein.«
»Das Leben ist gemein«, sagt Ma.
Ich unterdrücke ein Lachen, um Ebony nicht aufzuwecken.
Dies ist einer der Momente, die mir im Gefängnis am meisten gefehlt haben und die ich nie wieder in meinem Leben missen will. Zu sehen, wie meine Geschwister aufwachsen, ein Teil dieser Familie zu sein – das ist für mich das Wichtigste. Für sie will ich für immer der fröhliche große Bruder sein. Sie sollen mich ansehen und wissen, dass sie alles schaffen können. Für sie werde ich etwas aus mir machen.
3 Zelda
Nachdem ich mein Wochenende mit solch lebensverändernden Fragen wie Heirate ich diesen Fremden? und Ist Sorbet Nachtisch? (Antwort: Nein und Nein) verbracht habe, sitze ich heute schon seit zwei Stunden in der Bibliothek und schreibe an einem Essay über Moralphilosophie. Oder besser gesagt: Ich sitze in der Bibliothek und sollte an meinem Essay schreiben. Aber meine Gedanken schweifen dauernd ab. Den letzten Satz habe ich vor ungefähr zwanzig Minuten geschrieben, und bei nochmaligem Lesen muss ich sagen, dass er absoluter Schrott ist. Aber ich lasse ihn stehen, damit ich wenigstens so tun kann, als hätte ich etwas geleistet.
Ich finde meinen Philosophie-Kurs nicht uninteressant. Im Gegenteil. Aber je länger ich mich mit verschiedenen Philosophen und Strömungen beschäftige, desto weniger leidenschaftlich werde ich. So geht es mir eigentlich mit allem. Ich brenne für nichts. Manchmal denke ich, es liegt an mir. Vielleicht bin ich zu oberflächlich? Oder zu faul? Manchmal bin ich mir sicher, dass es an meinen Brüdern liegt. Sie sind allesamt so besessen davon, Erfolg zu haben, dass ich versuche, so anders wie nur irgend möglich zu sein. An wieder anderen Tagen mache ich meine Eltern dafür verantwortlich. Denn ich weiß ganz genau, selbst wenn ich etwas finde, für das ich brenne, muss ich es bald wieder aufgeben. Vielleicht ist auch mein komischer Kopf schuld, der sich weigert, bei einem Thema zu bleiben, und von einem Gedanken zum nächsten springt. Am Ende ist es wohl eine Mischung aus all diesen Faktoren.
»Hey«, flüstert jemand in mein Ohr.
Ich drehe mich um und blicke in Tamsins Gesicht.
»Hey!« Meine Laune hellt sich augenblicklich auf. Es ist unmöglich, Tamsin zu sehen und nicht zu lächeln. Sie hat ein Gesicht, das Menschen froh macht.
»Hast du Lust, mit mir nach draußen zu kommen? Das Wetter ist so schön, und ich habe eine Freistunde.«
»Das hier wird ohnehin nichts mehr«, flüstere ich und klappe meinen Laptop zu.
»Schhhhhhh«, ertönt es vom Eingang. Der Streber hinter dem Tresen nimmt seinen Job viel zu ernst. Aber selbst er brennt für etwas – auch wenn es nur absolute Stille in der Bibliothek ist.
Auf dem Rasen vor der Uni sitzen Studenten allein oder in kleinen Gruppen. Zwischen Platanen und jungen Kiefern lesen sie und trinken Kaffee aus Pappbechern. Ich studiere gern in Pearley. Ich mag die studentische Atmosphäre, die Kneipen und Cafés im Univiertel. Der Campus ist lebendig, die Gebäude sind genau das richtige Maß an beeindruckend und ehrwürdig. Besonders das Hauptgebäude, das die Bibliothek beherbergt und aus dem Tamsin und ich gerade herausgetreten sind. Es ist ein roter Ziegelbau mit eckigen Türmen zu beiden Seiten. Weiße Zierornamente schmücken den gesamten Bau und unterbrechen die rote Fassade. Um das Hauptgebäude herum dehnt sich der Campus weiter aus. Allerdings sind die Gebäude hier moderner. Die Ziegeloptik wurde aber beibehalten, sodass sich die Gebäude nahtlos ins Gesamtkonzept einfügen.
Wir setzen uns auf die Wiese.
»Und? Hast du das Trauma von Samstag überwunden?«, fragt Tamsin. Ich habe sie in die Machenschaften meiner Eltern eingeweiht. In ihr habe ich wenigstens eine Verbündete.
»Maliks Backkünste haben Wunder gewirkt«, sage ich.
»Es ist wirklich erstaunlich, wie du mit der Situation umgehst. Ich meine, ich könnte keine Witze drüber machen.«
»Ich habe ja nicht wirklich eine Wahl. Zumindest, solange ich ihnen nicht bewiesen habe, dass ich zu mehr tauge als zur braven Ehefrau. Und zu Hause sitzen und in mein Kissen weinen – das ist nicht meine Art.«
»Glaubst du denn, sie würden dich in Ruhe lassen, wenn du so erfolgreich wärst wie deine Brüder?«
Ich zucke mit den Schultern. »Es ist die einzige Chance, die ich habe, oder? Es sei denn, ich breche mit ihnen und gebe den Traum vom Studium auf. Die Gebühren könnte ich mir nie leisten.« Nach einer kurzen Pause schiebe ich noch hinterher: »Und ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde. Einfach so zu verschwinden. Wirklich keine Familie mehr zu haben.«