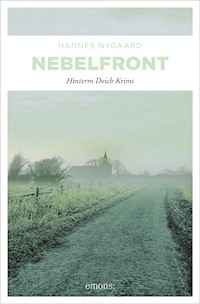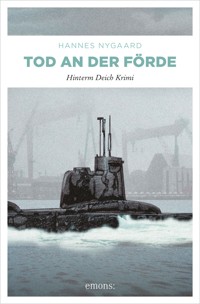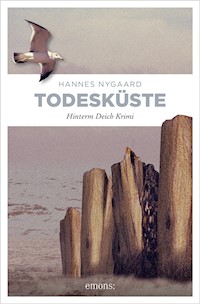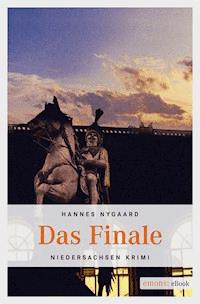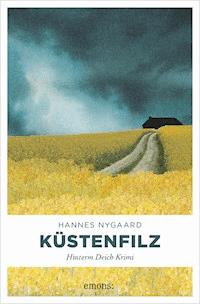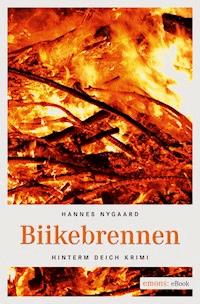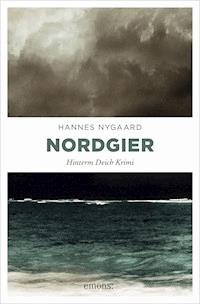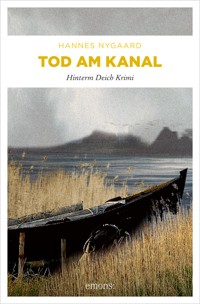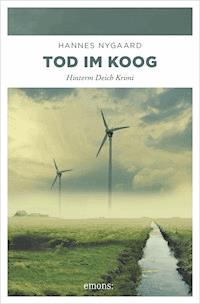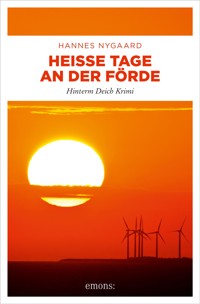
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hinterm Deich Krimi
- Sprache: Deutsch
Der neue Krimi von Erfolgsautor Hannes Nygaard – brandaktuell und schonungslos ehrlich. Der Klimawandel hat den Norden fest im Griff. Hitzewellen wechseln sich mit Hochwasser ab, die wirtschaftlichen Folgen setzen den Menschen zu. Währenddessen häufen sich brutale Übergriffe auf einen großen Tankstellenbetrieb: Fahrer werden ermordet, Tankstellen angegriffen, und schließlich fliegt ein Tanklastzug in die Luft. Als die Situation zu eskalieren droht, stürzt sich Kriminalrat Lüder Lüders in die Ermittlungen, um das tödliche Inferno zu ersticken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Hannes Nygaard ist das Pseudonym von Rainer Dissars-Nygaard. 1949 in Hamburg geboren, hat er mehr als sein halbes Leben in Schleswig-Holstein verbracht. Er studierte Betriebswirtschaft und war viele Jahre als Unternehmensberater tätig. Hannes Nygaard lebt auf der Insel Nordstrand.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Blickwinkel/Alamy/
Alamy Stock Photos
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Dr. Marion Heister
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-086-0
Hinterm Deich Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Agentur Editio Dialog, Dr. Michael Wenzel (www.editio-dialog.com).
Für meine treuen Leserinnen und Leser
Die Menschheit befindet sich heute in einer Krise, deren katastrophaler Höhepunkt wahrscheinlich noch vor uns liegt. Deshalb ist entschlossenes Handeln nötig.
Carl Friedrich von Weizsäcker (1986)
EINS
Es war heiß. Nicht warm, sondern heiß. In den Straßen staute sich die Hitze. Sie strahlte vom Mauerwerk ab. Man mochte es einen Backofen nennen. Es gab nur wenige schattenspendende Bäume. Dafür dampfte der Asphalt. Träge schleppten sich die Menschen durch die Stadt, suchten den Schatten auf und waren froh, wenn sie der Hitze entkommen und sich in klimatisierte Räume flüchten konnten.
Die Landeshauptstadt Kiel lag auf einem Breitengrad, der in Kanada schon zu den unwirtlichen Gegenden wie Labrador gehörte. Über sechstausend Kilometer nördlich des Äquators erwartete man ein gemäßigtes, eher kühles Klima. Besucher waren oft überrascht, dass sich in den skandinavischen Metropolen in den kurzen Sommern ein mediterranes Lebensgefühl breitmachte. Kiel unterschied sich in diesem Punkt nicht von den Städten in den Nachbarländern. Man schrieb es dem Golfstrom zu, der eine wichtige Wärmequelle für Europa darstellte. Nach einer von einem britischen Marineoffizier aufgestellten These hielt sich hartnäckig der Mythos von »Europas Zentralheizung«.
In diesem Sommer hätten die Menschen diese Heizung gern abgestellt. In den Medien wurde empfohlen, die Sonne und körperliche Anstrengungen zu meiden, viel zu trinken und gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Sonnenbrand oder gar Hitzschlägen vorzubeugen. Wären die Schulferien nicht schon angebrochen, hätten sich die Schüler seit Tagen über Hitzefrei freuen können, während Menschen, die ihren Beruf im Freien ausübten, unter der unbarmherzig brennenden Sonne litten. Arbeiter im Straßenbau verrichteten ihren Job nur mit halber Kraft, und Dachdecker stellten ihre Arbeit am späten Vormittag ein, da sie sich sonst an den aufgeheizten Ziegeln verbrannt hätten.
Der Aufenthalt im Inneren bot auch nur geringe Erholung. Die Hauswände hatten sich aufgeheizt und strahlten die gespeicherte Wärme ab. Mit vierunddreißig Grad hatte das Thermometer eine für Kiel rekordverdächtige Temperatur erreicht. Ein aus dem Irak stammender Mitbürger hatte im Radio erklärt, dass er in seiner alten Heimat durchaus höhere Temperaturen erlebt hatte, es aber nicht als so belastend empfand wie hier, da die hier herrschende hohe Luftfeuchtigkeit das öffentliche Leben fast zum Erliegen brachte. Das Gesundheitswesen hatte Warnungen und Verhaltensregeln ausgegeben, die Getränkehersteller freuten sich über Rekordumsätze, und ganz Mutige stürzten sich in das brackige Wasser der Förde. Ihnen galt nicht die Mahnung, Kinder, Kranke und Ältere sollten bei diesen Temperaturen besondere Vorsichtsmaßnahmen einhalten.
Hermann Kronstücken hatte die Warnungen nicht mitbekommen. Der Achtundsiebzigjährige war seit sechs Jahren verwitwet. Fast fünfzig Jahre hatte Gertrud an seiner Seite gestanden, den Haushalt versorgt und die Kinder großgezogen. Der Sohn Harald lebte mit seiner vierköpfigen Familie in Nürnberg, Britta hatte sich in Kaiserslautern mit ihrem Freund niedergelassen. Beide schoben berufliche und familiäre Anforderungen vor, um die Distanz zu den Eltern zu begründen.
Gertrud hatte den Beschwerden im Unterleib zu wenig Beachtung geschenkt. Als sie sich schließlich einem Arzt anvertraute, hatte der Krebs schon zu sehr in ihr gewütet. Hermann Kronstücken, ungeübt in der Haushaltsführung und Pflege, hatte im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht, ihr zur Seite zu stehen, bis ihr Leiden ein Ende fand. Schon damals erwies sich die Wohnung in der Damperhofstraße als nicht seniorengerecht. Nachdem die Kinder aus dem Haus waren, hatte ihnen der Vermieter den Tausch der Drei-Zimmer-Wohnung in der ersten Etage gegen die Wohnung im ausgebauten Dachgeschoss angeboten. Das Angebot war mit einem leichten Druck verbunden gewesen. Die alte Wohnung sollte saniert werden. Ein neues Bad, Fußböden, eine moderne Küche und energetische Maßnahmen hätten eine Mieterhöhung bedeutet, die für den ehemaligen Glasergesellen nicht tragbar gewesen wäre. Fast ein halbes Jahrhundert war Kronstücken für den Traditionsbetrieb Glas-Pförtner tätig gewesen. Er hatte noch Friedrich Pförtner gekannt, einen Handwerksmeister alten Schlages, der selbst noch auf den Baustellen tätig war. Sein Sohn Alfons hatte den Betrieb übernommen, aber schon einen anderen Umgang mit den Angestellten gepflegt. Immerhin hatte er noch seinen Einfluss gelten gemacht, als Eckardt Pförtner den Betrieb übernahm und sich von Kronstücken trennen wollte, der der schweren Arbeit auf den Baustellen nicht mehr gewachsen war. Bei einer Lohnkürzung fand Kronstücken in den letzten Berufsjahren eine Art Gnadenbrot als Hilfskraft. Das machte sich auch bei der Bemessung seiner Rente bemerkbar, und alle Pläne, den mit einfachen Mitteln zur Wohnung ausgebauten Dachboden wieder verlassen zu können, blieben unerfüllt.
Man hatte beim Ausbau »wirtschaftlich« gedacht und nicht nur am Dämmmaterial gespart. An kalten Wintertagen hielt sich Kronstücken ausschließlich im geheizten Wohnzimmer auf, an heißen Sommertagen staute sich die Wärme unter dem Dach. Es gab keine Fluchtmöglichkeit, insbesondere nicht für ihn, seit er vor vier Jahren einen leichten Schlaganfall erlitten hatte, der seine Mobilität zusehends einschränkte. Die früher geschätzte innenstadtnahe Lage, der nahe Schreventeich, die kleinen Parks und der überaus urbane Knooper Weg hatten zu Zeiten der uneingeschränkten Mobilität Lebensqualität bedeutet. Wer es mochte, konnte sich an den phantasievoll gestalteten hundertjährigen Fassaden sattsehen, sofern alliierte Bomben keine Lücken gerissen hatten, die durch profane Nachkriegsbauten geschlossen worden waren.
Kronstücken hatte nie ein Auto besessen. Das war nicht erforderlich. Im »alten Kiel« konnte alles fußläufig erledigt werden. Urlaub hatte man sich nicht leisten können. Das hatten die Kinder den Eltern vorgeworfen. Und die Tagesausflüge an die Ostsee oder andere nahe Ziele waren für den Nachwuchs keine reizvolle Alternative.
Als Kronstückens Gesundheitszustand in zunehmendem Maße Anlass zur Sorge bereitete, hatte der Hausarzt die Anregung gegeben, eine Pflegestufe zu beantragen. Als der Medizinische Dienst ihn aufgesucht hatte, war Kronstückens Stolz entbrannt. Er hatte sich Mühe gegeben, der Gutachterin zu beweisen, dass er seinen Alltag noch allein bewältigen konnte. Das war auch getrieben von der Sorge, den Lebensabend in einer Seniorenunterkunft verbringen zu müssen, abseits seines gewohnten Umfelds und außerhalb seiner wirtschaftlichen Möglichkeiten. Sein Sohn hatte bei einem der seltenen Besuche verlauten lassen: »Komm uns nicht damit, dass du ins Altersheim gehst und Britta und ich zur Kasse gebeten werden. Wir haben schon genug damit zu tun, den Kindern ein akzeptables Dasein zu ermöglichen.«
Zweimal in der Woche suchte ihn Katarzyna Filipowicz vom Pflegedienst Schäfer auf. Viel Zeit blieb der jungen Frau nicht, sich um die notwendigen Dinge zu kümmern. Katarzyna opferte auch ihre Freizeit, um für Kronstücken einzukaufen, nachdem er seine Wohnung seit drei Monaten nicht mehr verlassen konnte und in seinem bescheidenen Reich im Dachboden gefangen war.
Vor vier Tagen hätte sie kommen sollen. Aus einem ihm unbekannten Grund war Katarzyna ferngeblieben. Das Wochenende hatte Kronstücken sich noch selbst behelfen können, aber als die Temperaturen weiter stiegen und auch nachts nicht unter zwanzig Grad fielen, was die Meteorologen als Tropennacht bezeichneten, hatte seine Kraft nicht mehr ausgereicht, das Bett zu verlassen.
Kronstücken hatte versucht aufzustehen, aber der Kreislauf hatte versagt. Er war von der Bettkante wieder zurückgesunken. Auch die folgenden Versuche scheiterten. Gern hätte er Hilfe angefordert, aber das schnurlose Telefon, eine der wenigen modernen Errungenschaften in seinem Haushalt, lag für ihn unerreichbar auf dem Wohnzimmertisch.
Kronstückens Herz begann, heftig zu schlagen, als das verzweifelte Bemühen, die Ausscheidungen zurückzuhalten, vergeblich war. Sein Gehirn war nur noch von dem Gedanken erfüllt, wie er Katarzyna das Geschehen in seiner Lagerstatt erklären sollte. Noch schlimmer war die aufkommende Scham, als er auch die Darmentleerung nicht mehr zu kontrollieren vermochte. Die physischen Folgen der Einnässung traten dagegen fast zurück.
Das war am Sonnabend geschehen. Am Sonntag hatte sich Kronstücken überwunden, um Hilfe zu rufen. Seine dünne Stimme drang nicht aus dem Zimmer. Unterm Dach gab es nur seine Wohnung. Und die Mieter unter ihm waren ihm unbekannt. Früher wohnten die Menschen häufig Jahrzehnte mit denselben Nachbarn unter einem Dach. Heute wechselten die Wohnungen gefühlt alle halbe Jahre den Mieter.
Die Flasche mit dem lauwarmen Mineralwasser war seit gestern leer. Das letzte Drittel des Inhalts hatte sich auf dem Fußboden ergossen, als ihm die Flasche aus der kraftlosen Hand gefallen war. Inzwischen war nicht nur die Hand kraftlos. Kronstücken wehrte sich nicht mehr gegen die Fliegen, die sich auf seinem Gesicht niederließen. Der geschundene Körper begann, mit dem verfügbaren Wasser zu haushalten. Die Fließgeschwindigkeit des Blutes wurde beeinträchtigt, die Sauer- und Nährstoffversorgung im Körper verminderte sich. Der alte Mann schwankte zwischen einem fast segensreichen Dämmerzustand und den Phasen, in denen er wach war. Er blickte zur Dachschräge über seinem Kopf und konnte doch nichts wahrnehmen. Die Luft war stickig. Er hatte Mühe, zu atmen. Den beißenden Geruch im Zimmer registrierte er nicht mehr. Es wäre segensreich gewesen, das kleine Dachfenster zu öffnen, an dem er früher gelegentlich gestanden hatte und doch nur auf die Dächer der umliegenden Häuser starren konnte. Wenn man sich streckte, konnte man noch einen Blick auf die oberste Fensterreihe des gegenüberliegenden Blocks erhaschen. Am Horizont begrenzten gesichtslose Zweckbauten die Sicht. Im Sommer fand das Auge im Grün der Spitze eines Baumes im Hinterhof ein Ziel, das von der Ödnis der anderen Aussichten ablenkte. Kronstücken hatte es seit Gertruds Tod übernommen, die Wohnung mit preiswerten Zimmerpflanzen zu dekorieren, deren Namen er nicht kannte. Hauptsache, sie waren bunt, grün und billig. Jetzt litten die Pflanzen ebenso wie er unter dem Wassermangel. Die Blätter hingen schlaff herab, die Blüten waren abgefallen. Gelegentlich dienten sie den Fliegen als Landeplatz.
Kronstücken plagten Kopfschmerzen. Dann begann das Zimmer um ihn herum zu kreisen. Er fühlte sich wie in einer Zentrifuge, die sich mit mäßiger Geschwindigkeit bewegte. Er hätte gern die Hand gehoben, sich irgendwo festgehalten, aber die Gliedmaßen gehorchten ihm nicht mehr. Die Zunge war geschwollen. Kronstücken hatte das Gefühl, als würde die Zunge den ganzen Mund ausfüllen und den Atemweg verschließen. Schon lange war sein Mund trocken. Der Speichelfluss war zum Erliegen gekommen. Auch der kalte Schweiß, der sein Gesicht bedeckte, war weniger geworden. Gierig hatten sich die Fliegen über das salzige Sekret hergemacht. Auch sie kämpften um das Überleben in der Gluthölle unter dem Dachboden.
In den wenigen lichten Momenten erinnerte sich Kronstücken an Gertrud und einige Begebenheiten aus seinem Leben. Es waren triviale Ereignisse. Das Frühstück auf der Baustelle. Man hockte auf einer Sitzgelegenheit, aß das von Gertrud zubereitete Brot aus der verbeulten Blechbüchse und nahm einen Schluck aus der Thermoskanne. Dann verschwamm dieses Bild. Er fiel in einen Dämmerzustand und verspürte Hunger, ohne zu wissen, dass dieses Bedürfnis eigentlich Durst war.
Plötzliches Herzrasen weckte ihn aus seiner Lethargie. Dann begann wieder das Karussell. Beides verstärkte seine Atemnot. Mit letzter Kraft versuchte Kronstücken, die stickige, verbrauchte Luft einzuatmen. Sein magerer Brustkorb hob und senkte sich. Die dünne Hand fuhr zum Mund, dann legte sie sich auf das Herz. Er keuchte. Weshalb hatte Gertrud ihm die Luft reduziert? Kurz kehrte die Erinnerung zurück. Seine Frau hatte die Dachfenster geöffnet. Klare, kühle Winterluft strömte in die Wohnung. So hatte er es gemocht, auch wenn Gertrud sich dagegen gewehrt hatte. Frauen mochten es warm. So wie jetzt. Es war aber nicht warm, sondern brütend heiß. Ein Gemisch aus stehender Luft, Gestank, Staub. Während Kronstücken erneut nach Luft rang, begann sein Herz zu stolpern. Der Kreislauf geriet aus dem Takt. Der Körper glühte.
Kronstücken hatte nie darüber nachgedacht, dass Wasser das Elixier des Lebens war. Die darin gelösten Elektrolyte benötigte der Körper für die Stoffwechselprodukte. Bei diesen extremen Temperaturen diente es der Kühlung, schmierte die Gelenke und erfüllte zahlreiche weitere Aufgaben.
Der alte Mann versuchte zu schlucken. Nichts. Kein Speichel benetzte die ausgetrocknete Schleimhaut in seinem Mund. Er versuchte zu rufen. Nicht einmal ein Krächzen kam über seine Lippen. Er spürte auch nicht mehr die Fliegen, die sich ungehindert an seinen Körperöffnungen aufhielten. Schließlich gelang es ihm nicht einmal mehr, den Kopf auch nur millimeterweise zu bewegen. Sein Körper kapitulierte und überließ den summenden Insekten das Revier.
Kronstücken breitete die Arme aus. Er war gereinigt von dem, was ihn am Vortag noch gequält hatte. Seine Gedanken waren frei von der Scham, dass man ihn im verschmutzten Bett finden könnte. Jemand hatte das Licht entzündet. Ein helles, freundliches Licht. Die brütende Hitze wandelte sich in eine angenehme Wärme. Der Schwindel wirkte wie ein Strudel, der ihn rotieren ließ und langsam in die Mitte zog. Er spürte, wie der Sog seine Beine packte und ihn langsam, aber unaufhörlich in die Tiefe zog.
ZWEI
Hätte er vor dreißig Jahren festgestellt: »Das war eine heiße Nacht«, wäre das mit einem hintergründigen Schmunzeln geschehen, dem kein weiterer Kommentar gefolgt wäre. Heute Morgen fühlte sich Lüder Lüders müde und zerschlagen. Es war eine weitere Tropennacht gewesen. Meteorologen definierten diese als eine Nacht, in der die Temperaturen nicht unter zwanzig Grad sanken. Seine Frau Margit hatte noch vor Mitternacht die Flucht angetreten und sich auf das Sofa im Wohnzimmer zurückgezogen. Dort war es unmerklich kühler als im Schlafzimmer im Obergeschoss des Einfamilienhauses am Kieler Hedenholz. Nur Sinje, Nesthäkchen und Teenager der Familie, schienen die Temperaturen nichts auszumachen. Wenn man ihren Aussagen Glauben schenken konnte, hatte sie ihren Lebensmittelpunkt in das Freibad verlegt und ernährte sich ausschließlich von Eiscreme.
Lüder hatte sich im Bett hin und her gewälzt, nach Mitternacht die Fenster geöffnet, im Glauben, der Luftzug würde für Abkühlung sorgen. Statt kühler Luft waren Geschwader von Mücken über ihn hergefallen und hatten ihn an Margits Bitte, den Insektenschutz am Fenster zu montieren, erinnert.
Er hatte ausführlich die lauwarme Dusche genossen. Als er die Küche im Erdgeschoss betrat, hatte sie schon das Frühstück zubereitet. Der Kaffeeduft war verlockend, wäre er nicht mit der Tatsache verknüpft, dass Kaffee ein Heißgetränk war.
»Womit ist der gedopt?«, fragte Lüder, nachdem er Margit mit einem Kuss begrüßt und sich an seinem Platz am Küchentisch niedergelassen hatte. Seine Frage galt dem Moderator im Radio, der munter und frisch drauflosplauderte, als käme er gerade von einem mehrwöchigen Urlaub mit Ausschlafgarantie.
»Heute dürfen wir uns wieder über einen wunderbaren Sommertag im schönsten Bundesland der Welt freuen«, verkündete der Plauderer. »Achtzehn Stunden Sonne stehen uns bevor. Und wer es warm mag … In Kiel erwarten wir heute erneut an die vierunddreißig Grad. Keine Wolke trübt die Freude an diesem Sommer. Also, ab in die Förde oder Ostsee, den Dorfteich oder wo Sie sich gerade aufhalten. Selbst die Nordsee hat traumhafte Badetemperaturen. Ihr könnt euch die Reise ans Mittelmeer sparen. Hier ist es genauso warm. Und viiiiiel schöner.«
»Du wohnst auch nicht unter der Dachschräge«, knurrte Lüder und wechselte das Programm.
Auch auf dem nächsten Sender war das Wetter ein Thema. Es liefen noch die Nachrichten, die Sprecherin wies auf die erhöhte Waldbrandgefahr hin und bat um Rücksichtnahme. Lüder schüttelte den Kopf. Seit Langem warteten die Menschen auf Regen. Die Trockenheit war allgegenwärtig. Und dennoch gab es Leute, die ihre Zigarettenkippen achtlos in das trockene Unterholz warfen oder gar im Wald grillten, ganz abgesehen von jenen, die mit Absicht Feuer legten. Die Feuerwehren standen mancherorts vor großen Herausforderungen. Die Landwirtschaft klagte und äußerte Befürchtungen, dass die Ernte geringer ausfallen könnte. Das wäre mit einem weiteren Preisanstieg verbunden. Seen und Flüsse führten Niedrigwasser. Die Sprecherin schloss den Beitrag mit einer allgemeinen Warnung. Die Menschen sollten körperlich anstrengende Tätigkeiten in die Abendstunden verlegen und die Sonne meiden. Es wurde empfohlen, viel zu trinken. Besondere Aufmerksamkeit sollte den Älteren und den Kindern geschenkt werden. Dann folgte Musik.
»Jetzt reicht es mit der Hitze«, sagte Margit. »Mir ist es zu warm. Acht bis zehn Grad weniger genügen. Ist das der Klimawandel?«
»Da gehen die Meinungen auseinander. Es gibt viele Anzeichen, die dafürsprechen.«
»Früher gab es auch heiße Sommer. Im Jahr … ich weiß es nicht mehr so genau, aber da war es auch brütend heiß. Und neulich habe ich gelesen, dass 1959 schlimm war. Vermutlich spotten wieder alle, wenn der nächste Sommer kühl und verregnet ist.«
»Das ist der Unterschied zwischen Klima und Wetter«, meinte Lüder.
Margit stand auf und begann, das Geschirr zusammenzuräumen. »Wie gut, dass ich dich habe«, sagte sie lächelnd. »Da kann mir jemand die Welt erklären. Was liegt heute bei dir auf dem Amt an?«
»Bürokratie.«
Sie hauchte ihm einen Kuss auf die Wange. »Tage wie diese … Da kommen selbst Beamte ins Schwitzen.«
»Du bist reichlich kess.« Lüder nahm sie in den Arm. Er war glücklich, dass sie ihre Krankheit überwunden hatte. Die Psyche war wiederhergestellt, nachdem sie lange unter den Folgen einer Entführung und den terroristischen Übergriffen auf ihn und die Familie gelitten hatte.
»Holst du dir wieder einen Stapel Zeitungen?«, wollte sie wissen.
Er bestätigte es.
»Weshalb liest du sie nicht auf dem Handy?«
»Ich brauche das Haptische. Das Papier muss rascheln.« Er schmunzelte. »Außerdem würden die Kollegen irritiert sein, wenn ich ohne Zeitungen ins Büro käme. Eine Zeitung auf dem Tisch … das kennen sie. Würde man mich mit dem Handy sehen, könnte der Verdacht aufkommen, ich würde herumdaddeln.«
Sie lächelte. »Du hast recht. Es ist schön, beim Bewährten zu bleiben. Das gilt nicht nur für den Zeitungskauf.«
Er verabschiedete sich und trat vor die Tür. Schon um diese Zeit schien es, als würde er gegen eine Hitzewand prallen, als er hinaustrat. Es fehlten der Regen, die Luftbewegung, ein kräftiges Gewitter. Ein Taxifahrer hatte ihm vor ein paar Tagen erklärt, dass er aus dem Irak stamme. Dort hätte er schon sechzig Grad erlebt. Die Luft sei dort aber trocken und deshalb besser zur ertragen als die feuchte Schwüle in Kiel. »Nicht einmal das können die Deutschen«, hatte der Mann angefügt.
Lüder stieg in seinen betagten BMW 520. Er dachte mit Grausen an den Feierabend. Der Wagen würde den ganzen Tag über in der prallen Sonne stehen. Das Lenkrad würde heiß sein, die Polster wie ein Wärmekissen wirken und die herabgedrehten Fenster konnten keine Klimaanlage ersetzen. Der nächste Wagen würde mit einer Klimaanlage ausgestattet werden. Der nächste Wagen? Lüder lächelte und begann, die ersten Takte des Songs aus dem Musical »Anatevka« zu singen, mit dem Shmuel Rodensky weltberühmt wurde. »Wenn ich einmal reich bin …« Das würde auf ihn nicht zutreffen. Er hätte früher einen anderen Berufsweg einschlagen müssen. Seine zwischenzeitlichen Bemühungen, den Polizeidienst zu verlassen und sich als Anwalt niederzulassen, waren gescheitert. Aber im Grunde seines Herzens hing er an seiner Tätigkeit als Kriminalrat in der Abteilung 4 des Landeskriminalamts, dem Polizeilichen Staatsschutz.
Es war zu merken, dass die Schulferien begonnen hatten. Daher zwängten sich deutlich weniger Fahrzeuge über Kiels Straßen. Er erreichte das Polizeizentrum Eichhof, ein großes Areal, wo verschiedene polizeiliche Einrichtungen beheimatet waren. Auf dem Weg vom Parkplatz zum Dienstgebäude traf er einen Kollegen, der sofort nach der Begrüßung über das Wetter stöhnte.
Lüder erreichte sein Büro, startete seinen Rechner, legte mehrere Tageszeitungen auf den Schreibtisch und ging in das Geschäftszimmer, das Reich von Edith Beyer. Die Mitarbeiterin im Vorzimmer des Abteilungsleiters war sommerlich luftig bekleidet. Vor ein paar Jahren wäre es noch undenkbar gewesen, dass sich eine Frau in einer Amtsstube so zeigte. Bei der derzeitigen Witterung war es eine Selbstverständlichkeit. Beim Militär nannte man es wohl Marscherleichterung.
»Moin, Herr Dr. Lüders«, begrüßte sie ihn und sah auf die Armbanduhr. »Haben Sie es vergessen?«
Er sah sie fragend an. »Haben Sie Geburtstag?«
Sie lachte mädchenhaft. »Nein.« Dann zeigte Sie auf die Tür des Abteilungsleiters. »Er wartet auf Sie.«
»Auf mich?«
Dann fiel es ihm siedend heiß ein. Gestern Abend hatte Kriminaldirektor Dr. Starke noch eine Dienstbesprechung anberaumt. Sie sollte schon vor einer halben Stunde beginnen.
»Macht nichts«, stellte Lüder fest. »Die Welt da draußen hat sich trotzdem weitergedreht.« Er legte Daumen und Zeigefinger der rechten Hand aneinander und führte sie zum Mund, als würde er an einer Kaffeetasse nippen.
Edith Beyer nickte. »Ich bringe Ihnen einen Kaffee.«
Lüder klopfte pro forma an das Holz der verschlossenen Tür und trat sofort ein, ohne die Aufforderung dazu abzuwarten. Kriminaldirektor Dr. Starke und Kriminaloberrat Gärtner saßen am Besprechungstisch, auf dem Papiere ausgebreitet waren. Sie sahen Lüder an.
Während Gärtner es bei einem knappen »Moin« beließ, sagte Dr. Starke mit einem tadelnden Unterton: »Du kommst spät. Wir waren früher verabredet.«
»Moin, lieber Jens«, erwiderte Lüder, ohne auf den Vorwurf einzugehen, und setzte sich zu den beiden.
Gärtner trug ein sportliches Sommerhemd mit kurzen Ärmeln, das so weit aufgeknöpft war, dass die grauen Brusthaare am oberen Rand hervorlugten. Dr. Starke war, wie immer, perfekt gekleidet. Er trug ein blütenweißes Hemd, hatte aber auf eine Krawatte verzichtet. Der oberste Knopf war geöffnet. Das Sakko hing auf einem Bügel an einem Garderobenhaken. Dr. Starke wäre es nie in den Sinn gekommen, sein Sakko über der Stuhllehne aufzuhängen. Er zeigte auf ein Schreiben, das zwischen ihm und Gärtner lag, und wollte es Lüder über den Tisch schieben.
»Danke, ich kann über Kopf lesen«, antwortete Lüder. Es war eine Notiz des Innenministeriums, die an die Leitung des LKA gerichtet war. Darin zeigte man sich besorgt über eine Drohung, die an die Geschäftsleitung der Nordic Energi GmbH in Rendsburg gerichtet war.
»Ihr zerstört unsere Welt. Die einzige, die wir haben. Ihr zerstört das Leben. Unser Leben. Das unserer Kinder. Wir haben euch zugerufen: Hört auf. Aber ihr seid blind für das, was ihr anrichtet. Das nur, um kurzfristig Profit zu schöpfen. Ihr zerstört die Natur. Ihr zerstört unsere Zukunft. Nun seid ihr dran. Wir werden euch zerstören. Euch und euer Teufelswerkzeug.«
»Briefe dieser Art tauchen oft auf«, sagte Lüder. »Es soll nicht zynisch klingen, aber manche Politiker oder in der Öffentlichkeit stehende Menschen haben schon viel drastischere Drohungen erhalten. Sachbeschädigungen waren noch die harmlose Variante. Weiblichen Personen wurde sexuelle Gewalt angedroht. Und Morddrohungen sind auch keine Seltenheit mehr. Leider. Manchmal wurden sie auch umgesetzt. Wir haben in Deutschland schon Opfer zu beklagen.«
»Das ist zutreffend«, bestätigte Gärtner, »aber wir sollten es nicht auf die leichte Schulter nehmen.«
»Wer sind die Absender?«, wollte Lüder wissen. »Oder ist es anonym?«
»AA«, antwortete Gärtner und sprach es englisch aus.
»Steht das für Anonyme Alkoholiker?«
»Für Anti Annihilators«, erklärte Gärtner. »Das heißt auf Deutsch: Anti-Vernichter.«
»Ich kenne den Verein. Nein«, relativierte Lüder. »Das wäre übertrieben. Ich habe davon gehört. Mir erscheint der Name ein wenig widersinnig. Annihilator – Vernichter. Das verstehe ich. Aber das ›Anti‹ vorweg … Die wollen etwas zerstören, vernichten.« Er hob den Zeigefinger in die Höhe. »Weshalb nennen sie sich nicht Destroyer?«
»Das ist komplizierter«, meinte Gärtner. »Mit Annihilator, also Vernichter, sind die anderen gemeint, jene, die nach Auffassung der Gruppe unsere Welt vernichten.«
»Ah, dann sind die Anti Annihilators jene, die die auf dem Kicker haben, die ›Vernichter‹ sind.«
Gärtner nickte. »So ungefähr. Und jetzt drohen sie. Zielscheibe ist in diesem Fall die Nordic Energi GmbH mit Sitz in Rendsburg. Es ist die Tochter der gleichnamigen A/S aus Skandinavien, die in Aarhus sitzt.«
»Ein dänisches Unternehmen?«
»Die sind in ganz Skandinavien mit Ausnahme von Finnland aktiv. Seit einigen Jahren auch bei uns, vorerst allerdings nur in Schleswig-Holstein. Ich gehe davon aus, dass sie über unser Bundesland hinaus expandieren werden. Sie kennen die Tankstellen, die sie bei uns betreiben.«
Lüder hob fragend die Schulter.
»Die ›Norden‹-Tankstellen. Das ist die Abkürzung von Nordic Energi.«
»Ach die«, bestätigte Lüder. »Ich habe mich schon oft gefragt, wer dahintersteckt. Die treten in Weiß auf mit einem roten Schriftzug. Im Hintergrund erscheint als Logo eine Kugel, eine Art Drahtkorb.«
Gärtner lächelte. »›Drahtkorb‹ ist gut. Das ist ein Abbild des Globus vom Nordkap, die aus Stahl geformte Skulptur auf dem Nordkapplateau in Norwegen. Sie versinnbildlicht den globalen Treffpunkt am Nordkap, wo sich Menschen aus der ganzen Welt begegnen.«
»Und weshalb greift man mit diesem Pamphlet«, Lüder tippte dabei auf das Schreiben des Innenministeriums, »ausgerechnet die braven Dänen an? Wenn man es auf vermeintliche Umweltsünder abgesehen hat, fallen mir andere Namen ein, die auf diesem Feld größere Sünden begehen.«
»Das kann ich auch nicht beantworten«, gestand Gärtner. »Wir müssten dazu recherchieren, ob die wirklich so brav sind.«
»Und wer oder was verbirgt sich hinter Anti Annihilators?«, ergänzte Dr. Starke und sah auf seine Armbanduhr. »Wir treffen uns in einer Stunde zur nächsten Runde. Mit Ergebnissen.«
Lüder nahm sich vor, über das Unternehmen zu recherchieren.
Im Vorzimmer sah ihn Edith Beyer schuldbewusst an. »Ihr Kaffee steht dort.« Sie zeigte auf einen Becher neben der Kaffeemaschine. »Ich war mir nicht sicher, ob der Chef es gut gefunden hätte, wenn ich die Besprechung wegen des Kaffees gestört hätte.«
Lüder gab ihr recht, griff sich den Becher und kehrte in sein Büro zurück. Er schob den Stapel ungelesener Zeitungen zur Seite und begann mit der Recherche.
Die Nordic Energi war in Dänemarks zweitgrößter Stadt aus der Aarhus Tank Aps hervorgegangen, einer kleinen Gesellschaft, die zunächst eine Reihe von Tankstellen betrieb und Heizöl lieferte. Das war in den fünfziger Jahren. Das Geschäft florierte, und der Aktionsradius dehnte sich zunächst auf Jütland, dann auf ganz Dänemark aus. Ein großer Mineralölkonzern übernahm das Tankstellennetz, änderte den Namen in Nordic Energi, weitete das Geschäftsgebiet auf Schweden und Norwegen aus und vertrieb unter diesem Namen seine eigenen Produkte.
Lüder hatte sich in der Vergangenheit oft über den Unterschied zwischen Managern und Unternehmern gewundert. Unternehmer hatten Betriebe gegründet, sie mit innovativen Ideen und der Unterstützung einer treuen und durch sie versorgten Arbeitnehmerschaft ausgebaut und über einen langen Zeitraum Konzerne von Weltgeltung geschaffen. Nach den Unternehmerpersönlichkeiten kamen, Lüders Meinung nach, Manager an die Macht, denen es nur um kurzfristige Erfolge ging. Langfristige Prosperität, Verantwortung für die Menschen im Betrieb, Kontinuität – das waren vergessene Tugenden. Die Manager folgten oft Modeerscheinungen. Unter dem Motto »Konzentrieren auf die Kernkompetenz« wurden Tochterunternehmen verkauft. Autobauer schraubten nur noch zusammen, was Subunternehmer anlieferten. Händler unterhielten kein eigenes Lager und hatten die Logistik abgegeben. Dann folgte die nächste Phase. Unter dem Schlachtruf »Diversifikation« wurde plötzlich wahllos dazugekauft. Daimler-Benz baute Waschmaschinen, Schiffe, Flugzeuge und glaubte, sich auf dem Softwaremarkt etablieren zu können. Alle Versuche dieser Art scheiterten.
Diesen Trends war auch Nordic Energi gefolgt. Der dahinterstehende Ölmulti hatte sich anders ausgerichtet. Es klang wie eine Schmähung gegenüber den Mitarbeitern, als man verlautbaren ließ, dass man sich vom lokalen Engagement trennen und mehr global aufstellen wolle. Das Unternehmen ging in die Hände von Finanzinvestoren über, denen das Ölbusiness fremd war.
Lüder las eine kritische Notiz, in der ein Insider behauptete, die Hedgefonds, die sich hier engagiert hatten, seien nur an kurzfristigen Gewinnen interessiert. Deshalb wechselten bei Nordic Energi auch regelmäßig die Eigentümer. Derzeit lag der überwiegende Kapitalanteil in Händen eines Hedgefonds, der sich vorwiegend im Energiesektor engagierte. Man suchte wie jene Autofahrer, die im Stau über jeden Parkplatz fuhren, um ein paar Fahrzeuglängen Vorsprung zu gewinnen, die Lücken im System. Dank einer guten Lobbyarbeit und manchmal fragwürdiger Kontakte zur politischen Führung gelang es, die eigenen Interessen denen der Menschen überzuordnen. So lautete manche Kritik, auf die Lüder stieß. Er selbst runzelte die Stirn und dachte, dass die UE Universal Energy Private Equity mit Sitz auf der Kanalinsel Jersey sicher nie etwas vom kürzesten Satz im Grundgesetz gehört hatte. Im Artikel 14 stand kurz und prägnant: »Eigentum verpflichtet.« Im Konzert der Großen war Nordic Energi nur ein kleines Licht, das auf einem begrenzten Markt spielte. Noch. Noch? Weshalb hatte man ausgerechnet dieses Unternehmen ausgewählt und bedrohte es? Das zu ergründen sollte die Aufgabe der Abteilung sein, so wünschte es das Innenministerium. Und auch das Wirtschaftsministerium zeigte an der Aufklärung Interesse.
Er kehrte mit seinen Rechercheerkenntnissen ins Büro des Kriminaldirektors zurück. Kriminaloberrat Gärtner war auch anwesend. Lüder trug seine Ergebnisse vor und wurde dabei mehrfach von seinem Vorgesetzten unterbrochen, der Lüders kritische Wortwahl nicht guthieß.
»Auch wenn man durchaus eine persönliche Meinung zum Auftreten und Agieren von Hedgefonds haben dürfe, sollte man Begriffe wie ›Heuschrecken‹ in dieser Runde nicht verwenden«, mahnte Dr. Starke an.
Gärtner folgte stumm Lüders Worten. Bei seinem Vortrag vermied er es, irgendwelche Wertungen einfließen zu lassen. Das war professionell, befand Lüder und lauschte Gärtners Ausführungen. Die Anti Annihilators wurden den verfügbaren Quellen zufolge vor sieben Jahren in Birmingham in England gegründet. Der lockere Protest ging von Soziologiestudenten aus und richtete sich zunächst im kleinen Kreis, eher spaßhaft, gegen Studierende der Wirtschaftswissenschaften. Die Sache gewann schnell eine eigene Dynamik und verlagerte sich nach London, dem größten Finanzplatz der Welt. In der City of London und den Docklands gab es die größte Konzentration an Niederlassungen von Banken und Finanzdienstleistern. Als sich in den Medien Berichte über die sagenhaften Einkommen der Händler häuften und die Yuppies sich nicht scheuten, diese öffentlich zur Schau zu stellen, etablierte sich eine Untergrundszene, die übergriffig wurde. Als die Behörden gegen sie vorgingen, wanderte der harte Kern in den Untergrund ab und weitete seine Aktionen gegen Unternehmen der Finanzwirtschaft aus. Diese Bewegung hielt sich lange im Untergrund und wurde durch weitere Skandale wie die Panama Papers oder die Cum-ex-Geschäfte genährt. Neu war, dass jetzt unter dem Deckmantel von Umweltaktivismus Drohungen gegen Unternehmen der Energiewirtschaft ausgestoßen wurden.
»Wie ernst sind die zu nehmen?«, fragte Lüder.
»Wir haben zu wenig Erfahrungen mit denen«, bekannte Gärtner. »Bisher sind sie durch lautes Getöse aufgefallen. Es gab Sachbeschädigungen an Einrichtungen aus dem Energiesektor, namentlich an jenen, die sich mit fossilen Stoffen beschäftigen. Erdöl und Derivate. Erdgas. Kohle«, zählte Gärtner auf und steckte bei jedem Begriff einen weiteren Finger in die Höhe.
»Gibt es Verbindungen zu anderen Gruppierungen, die auf diesem Feld agieren?«
Gärtner überlegte kurz. »Sie meinen, zu BUND, Umwelthilfe, Greenpeace und so weiter. Es ist ja nicht alles schlecht, was von dort ausgeht.«
»In der Demokratie soll jeder seine Meinung vortragen. Das zensieren wir nicht«, sagte Lüder.
Dr. Starke nickte zustimmend.
»In Ihrer Aufzählung vermisse ich Fridays for Future«, fuhr Lüder fort.
»Meine Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. So habe ich zum Beispiel den WWF nicht genannt oder Robin Wood.«
»Um Fridays for Future ist es ruhiger geworden«, meinte Lüder. »Die nennen sich ja selbst eine basisdemokratische Graswurzelbewegung. Die früheren Aktivisten haben zum Teil die Schule verlassen und stellen sich jetzt anderen Herausforderungen. Sie haben den Führerschein gemacht, eilen im SUV von Termin zu Termin und suchen im Urlaub Entspannung auf fernen Kontinenten.«
»Lüder!«, erfolgte ein Ordnungsruf des Abteilungsleiters.
Lüder winkte ab. »Es sind idealistische Forderungen, die dort gestellt werden. Man kann drüber diskutieren, ob alles machbar ist. Natürlich müssen die Treibhausemissionen gesenkt werden. Wer will leugnen, dass Tage wie jene, die wir im Augenblick erleiden müssen, mit durch den Klimawandel verursacht werden? Aber schaffen wir es bis 2035 auf null? Wenn wir uns keine Ziele setzen, kommen wir der Sache allerdings auch nicht näher. Der komplette Kohleausstieg … Na ja. Selbst wenn es eine technisch machbare Lösung wäre, tut sich hier der Widerstand jener auf, die wirtschaftlich von der Kohle profitieren. Dagegen wehren sich Leute wie Anti Annihilators. Und wenn man Tage wie diese erlebt … Selbst bei uns in Kiel stöhnen die Leute wegen der Temperaturen. Ich kann mich mit meinem halben Jahrhundert Gegenwart auf diesem Planeten nicht daran erinnern, dass wir eine so lang anhaltende Hitzeperiode hatten.«
»Die Klimaaktivisten haben noch mehr Forderungen aufgestellt«, warf Gärtner ein. »Sie wollen eine komplette Energieversorgung aus erneuerbarer Energie, auch wenn das inzwischen auch Teil des Regierungsprogramms ist. Ich habe meine Zweifel, ob wir das mit dem Energiehunger unserer Industrie hinbekommen. Und für Unternehmen wie Nordic Energi bedeutet es den schleichenden Tod, es sei denn, sie richten sich neu aus und investieren in neue Techniken.«
»Genau darin liegt die Krux«, bestätigte Lüder. »Das ist es, was ich vorhin meinte. Früher haben die Unternehmer so etwas erkannt und den Betrieb neu ausgerichtet. Die Hedgefonds sind daran nicht interessiert. Sie wollen hier und heute Kasse machen. Wenn die Forderungen der Aktivisten durchschlagen, werden die Kohle- und Gaskraftwerke abgeschaltet und alle Subventionen für fossile Energien abgeschafft.«
»Ich habe nirgendwo eine Aussage darüber gefunden, dass Anti Annihilators solche Ideen aufgeworfen hat«, gab Gärtner zu bedenken. »Die drohen nur. Aber nicht nur das. Sie werden auch übergriffig.«
»Aber noch nicht bei uns«, sagte Dr. Starke. »Allerdings ist es unsere Aufgabe, zu analysieren, ob eine reale Gefahr von ihnen ausgeht.«
Lüder fuhr sich nachdenklich mit der Zunge über die Lippen. »Sind es Idealisten, die zur Durchsetzung ihrer Ziele auch vor Gewalt nicht zurückschrecken?«, überlegte er laut. »Wie finanzieren die sich?« Er sah Gärtner an.
»Das frage ich mich auch«, sagte der Kriminaloberrat. »Ich habe in unseren Unterlagen nichts dazu gefunden. Manche terroristischen Gruppierungen begehen Straftaten, meistens Raub. Die RAF hat Banken überfallen oder Geiseln genommen. Dank ausgeklügelter Sicherungssysteme sind Banküberfälle heute selten. Im politischen Bereich werden Terrorgruppen auch von Staaten oder großen ideologischen Gemeinschaften finanziert. Die fünfte Kolonne, wie man sie damals nannte, hat heute ein anderes Gesicht. Aber welche der uns bekannten und global agierenden Terrororganisationen sponsert eine Truppe wie Anti Annihilators?«
»Und aus welchem Grund? Mich würde interessieren, ob die gegen Nordic Energi gerichtete Drohung nur singulär ist oder der Anfang von weiteren Kampagnen, die andere Teilnehmer auf diesem Feld zum Ziel haben. Wie ernst sollen wir es nehmen? Reicht es, wenn wir zunächst einen Beobachterstatus einnehmen?« Lüder sah Dr. Starke an. Nach vielen Jahren der früher durchaus nicht ungetrübten Zusammenarbeit verstand er es, in der Mimik des Vorgesetzten zu lesen. Über das Gesicht huschte kein Schatten, aber die Augen Dr. Starkes wanderten zwischen Lüder und Gärtner hin und her, als suche er bei seinen Mitarbeitern die Antwort.
»Wir sollten die Drohung ernst nehmen. Du, Lüder, solltest der Sache einmal nachgehen.«
Lüder seufzte. »Prima. Ich habe also den Auftrag, einmal eine Ecke der Decke des Schweigens zu lüften, um darunter zu blinzeln, ob sich Böses tut. Nur: Wo finde ich die Decke?«
Jens Starke verzog keine Miene, nicht einmal zu einem angedeuteten Lächeln. Das war der kleine Unterschied zwischen dem Kriminaldirektor, der hoffte, noch nicht am Ende seiner Karriere angekommen zu sein, und ihm, Dr. Lüder Lüders, dem ewigen Kriminalrat. Ausgerechnet Dr. Starke hatte ihm lange Zeit das Leben schwer gemacht, ihn negativ beurteilt, ja – er wollte ihn auf unbedeutende Dienstposten abschieben. Diese Beurteilungen klebten wie Pech an Lüders Hacken. So wartete er immer noch auf die eigentlich lange fällige Routinebeförderung zum Kriminaloberrat. Andererseits fand er Bestätigung in seinem Aufgabenbereich, der ihn immer wieder mit Sonderaufgaben betraute. Eine ausschließliche Schreibtischtätigkeit wie bei den beiden anderen mochte er sich – noch nicht – vorstellen.
Er kehrte in sein Büro zurück und nahm am Schreibtisch Platz. Seine Hand griff automatisch zum Kragen und lüftete ihn ein wenig. Als Kind hatte er sich immer auf den Sommer gefreut, später schätzte er den Wechsel der Jahreszeiten. Selbst der nebelige November, in Kiel oft begleitet von nasskaltem Wetter und Sprühregen, hatte seine Reize. Die Melancholie dieser Jahreszeit, die kurzen Tage, das Anheimelnde im häuslichen Umfeld … Auch dieser Kontrast gehörte für Lüder dazu. Und in diesen extrem heißen Tagen hätten viele Mitbürger manches dafür gegeben, würden ein paar ungemütliche Stunden das »schöne« Wetter ablösen. Nein. In einer Region wie Kalifornien mit ständigem Sonnenschein mochte er nicht leben. Überhaupt. Er konnte sich keine schönere Gegend als Kiel vorstellen. Aber das würden andere Menschen zu Recht von ihrer Heimat auch behaupten. Allerdings heute …
Lüder lächelte. Er sollte die »Decke suchen«, unter der sich das Geheimnis der gegen Nordic Energi gerichteten Drohung verbarg. Aber wie und wo? Früher hätte man bei Ratlosigkeit am Bleistift geknabbert. Das war heute nicht mehr möglich. Die Tastatur seines Rechners gab es nicht mehr her. Er griff zum Telefon und rief Thomas Vollmers an. Der Hauptkommissar war Leiter des K11, des für Straftaten gegen Leib und Leben zuständigen Kommissariats der Bezirkskriminalinspektion Kiel. Im Volksmund nannte man diese Einheit »Mordkommission«.
Nach ein paar einleitenden Worten fragte Lüder, ob Vollmers schon einmal etwas von Anti Annihilators gehört habe.
»Anti – was? Das hört sich nach einem Deodorant an«, erwiderte Vollmers. »Nein. Das ist mir unbekannt. Was soll das heißen?«
Lüder erklärte es ihm und den Hintergrund der Frage.
»Das ist nicht unsere Welt. Wir beschäftigten uns heute mit einem Grenzfall unserer Gesellschaft. Es ist in diesem Jahr schon das zweite Mal, dass wir einen Todesfall dieser Art zu untersuchen haben. Eigentlich ist es Routine. Ein natürlicher Todesfall. Der achtundsiebzigjährige Hermann Kronstücken wurde in seiner Dachgeschosswohnung tot aufgefunden. Er ist dehydriert.«
»Das ist tragisch, dass es alte Menschen gibt, um die sich niemand kümmert. Und wenn sie zudem noch krank und gebrechlich sind, sterben sie einsam.«
»In diesem Fall gibt es noch ein paar Verstrickungen. Kronstücken ist verwitwet. Er war auf Hilfe angewiesen. Ob die ihm zuerkannte Unterstützung ausreichend war, vermag ich nicht zu beurteilen. Das gehört auch nicht zu unseren Aufgaben. Ein Pflegedienst hat sich um ihn gekümmert, genau genommen eine polnische Mitarbeiterin namens …« Vollmers unterbrach kurz seine Ausführungen. Lüder vermutete, der Hauptkommissar suchte in seinen Notizen nach dem Namen. »… Katarzyna Filipowicz«, fuhr Vollmers fort, »war für Kronstücken zuständig. Sie hat sich am letzten Donnerstag kurzfristig mit Kreislaufbeschwerden krankgemeldet, sagte ihre Chefin, mit der wir Kontakt aufgenommen haben. Wir haben Ferienzeit. Die Personaldecke ist ausgedünnt. Es gab keinen Ersatz.«
»Niemand hat sich um den alten Herrn gekümmert?«
»So ist es«, bestätigte Vollmers. »Keiner hat bemerkt, dass er in der Gluthitze seiner Dachgeschosswohnung dehydriert ist. Mitten unter uns. Mitten in Kiel. Einfach so.«
»Da stellt sich die Frage, ob unterlassene Hilfeleistung vorliegt«, dachte Lüder laut nach.
»Das macht Hermann Kronstücken nicht wieder lebendig. Darüber hinaus wird die Staatsanwaltschaft zu prüfen haben, ob beim Ausbau des Dachs gepfuscht wurde. Hat man, um Kosten zu sparen, auf eine ausreichende Isolierung verzichtet? Das wird ein Sachverständiger klären.«
»Hm.«
Vollmers wartete einen Moment. »Wollen Sie noch etwas sagen?«, fragte er schließlich.
»Wenn man den Gedanken sehr weit fasst, könnte man doch behaupten, der alte Herr ist ein Opfer des Klimawandels geworden.«
»Wenn Sie es so sehen … Ja. Indirekt schon. Aber wen wollen Sie dafür strafrechtlich zur Verantwortung ziehen? Petrus, weil der angeblich für das Wetter zuständig ist?«
»Wohl eher unsere Gesellschaft. Wir alle haben durch unsere Sorglosigkeit zu dieser Situation beigetragen.«
»Tja«, ließ Vollmers hören. »Diese Diskussion führt uns nicht weiter. Bleiben wir bei den Fakten. Und die bereiten uns genug Kopfzerbrechen.« Dann wünschte er Lüder einen schönen Tag.
Lüders Gedanken schweiften kurz zur jüngsten Tochter Sinje ab. Das sechzehnjährige Nesthäkchen lieferte ihm im Hause Lüders harte Rededuelle. Hatte Lüders Generation wirklich zu sorglos gelebt? Mussten die Jüngeren es jetzt ausbaden? War die Sorge um die Zukunft der Nährboden, auf dem ausufernde Gewalt à la Anti Annihilators heranwuchs?
Lüder suchte sich die Adresse des bedrohten Unternehmens heraus und nahm Kontakt auf. Er wurde mehrfach verbunden, bis er auf einen Gesprächspartner traf, der sich mit »Sönke Appelhoff« vorstellte und vorgab, Leiter der Betriebsorganisation sein.
Appelhoff war vorsichtig und zögerte zunächst, Lüder am Telefon Auskünfte zu erteilen. Er rief zurück und verzichtete darauf, sich von Lüder die Durchwahl geben zu lassen. Danach war er bereit, mit Lüder zu sprechen.
Ja, bestätigte er, die Drohung sei eingegangen. Man sei nicht besorgt. Solche Worte würden sie nicht ernst nehmen. »Nordic Energi ist ein aufstrebendes Unternehmen, prosperierend, das innovativ in seinem Bereich agiert und mit innovativen Ideen auch Maßstäbe setzt. Überhaupt – das junge und dynamische Team steckt voller Tatendrang. Diese Innovation gefällt dem etablierten Mitbewerber sicher nicht.«
Lüder schmunzelte im Stillen. Ob Appelhoff für jede Verwendung von »Innovation« einen Bonus bezog? Laut sagte er: »Weshalb haben Sie sich an das Innenministerium gewandt, wenn Sie im Unternehmen kein Gefahrenpotenzial in diesem Drohbrief erkennen können?«
»Natürlich haben wir im Leitungskreis darüber gesprochen. Wer sich heute in dem Umfeld betätigt, in dem wir agieren, steht im Fadenkreuz von Aktivisten.«
»Umweltaktivisten«, meinte Lüder.
»So nennen es viele in der Öffentlichkeit. Ich will nicht in Abrede stellen, dass es Menschen gibt, die sich ernsthaft um unsere Umwelt sorgen. Es gibt bestimmt auch zahlreiche Ansätze, die Anlass für ein intensives Nachdenken geben.«
Lüder staunte über die komplizierte Formulierung. Er übersetzte es: »Trotz der Erkenntnis, dass wir unsere Lebensgrundlagen zerstören, machen wir munter weiter. Und dagegen protestieren manche Leute.«
»Sie müssen immer zwei Seiten sehen«, entgegnete Appelhoff. »Aber das sollte nicht unser Thema sein. Wir sind ein engagiertes und innovatives Team und erobern derzeit erfolgreich den deutschen Markt. Das gefällt nicht jedem. Auf dem Mineralölmarkt geht es nicht um die Generierung zusätzlicher Mengen. Was wir verkaufen, fehlt dem Mitbewerber. Es ist ein Verdrängungswettbewerb.«
»Wollen Sie vorsichtig andeuten, dass die Drohung von einem anderen Tankstellenbetreiber kommen könnte? Von einem der großen Mineralölkonzerne, die seit Jahrzehnten bei uns den Markt beherrschen?«
»Ich sagte schon, dass wir diesen Brief nicht ernst nehmen.«
»Sie haben meine Frage nicht beantwortet, weshalb Sie sich an das Innenministerium gewandt haben.«
Appelhoff druckste herum. »Unser Geschäftsführer hielt es für erforderlich, unsere Konzernzentrale zu informieren.«
»In Aarhus?«
»Ja. Und die Dänen haben darauf gedrungen, die Behörden zu verständigen.«
»Aber gleich das Ministerium? Ich hätte mich an die Polizei gewandt.«
»Dänemark ist ein kleines Land. Da funktioniert vieles unkomplizierter. Wenn ein Unternehmer etwas auf dem Herzen hat, greift er zum Telefon und ruft den Minister an. So ist die Sache in Bewegung geraten. Bei uns geht alles über den Dienstweg. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber eine Nachricht ans Innenministerium landet bei Ihnen, Herr, ähhh …? Wie gesagt – ich sehe keine Gefahr für unser Unternehmen.«
Lüder hinterließ seine Kontaktdaten. »Falls sich die Leute noch einmal melden sollten, können Sie mich direkt ansprechen.«
»Danke«, sagte Appelhoff und ließ es klingen wie »Ich sagte schon – kein Bedarf«.
Nachdem Lüder aufgelegt hatte, überlegte er kurz, ob er den Abteilungsleiter informieren sollte. Er beließ es bei einer kurzen Notiz via Mail. Dann nahm er seine Routinetätigkeit wieder auf.
***
Tawfiq Beyrouti wischte sich mit dem stämmigen Unterarm den Schweiß von der Stirn. Er hatte das Wollhemd unter der blauen Latzhose bis zum unteren Ende des Brustbeins aufgeknöpft. Die Ärmel waren bis weit über die Ellenbogen hochgerollt. Die Hitzewelle dauerte schon seit Tagen an. Er hatte sich vorgenommen, hinsichtlich der Bekleidung darauf zu reagieren. Bekime hatte es ihm auch nahegelegt. Sie hätte sicher darauf geachtet, wenn sie heute früh nicht schon vor ihm die gemeinsame Wohnung verlassen hätte, um die Tochter zur Kita zu bringen und anschießend zur Arbeitsstelle als Pickerin in einem Online-Shop zu fahren.
Seit fünf Jahren waren sie verheiratet, Bekime, aus dem Norden Albaniens stammend, und Tawfiq Beyrouti aus Syrien.
Er beugte sich vor, angelte nach der Zigarettenschachtel, fischte sich einen Glimmstängel heraus und setzte ihn mit dem Feuerzeug in Brand. Er kniff kurz das Auge zusammen, als ihm Asche hineinwehte. Rauchen war streng verboten. Es würde ihn sofort den Job kosten. Aber Beyrouti glaubte sich sicher. Beide Seitenscheiben waren heruntergekurbelt. Der Fahrtwind brachte ein wenig Abkühlung. Tawfiq Beyrouti machte sich keine Gedanken, dass er sich mit dem Durchzug eine Erkältung oder andere Unpässlichkeiten einhandeln könnte. Nach jedem zweiten Zug schnippte er die Asche aus dem offenen Fenster.
Vor drei Wochen war sein Kollege Mateusz fristlos entlassen worden. Er hatte sich mit einer Zigarette erwischen lassen. Das wollte er nicht riskieren, aber Beyrouti war leidenschaftlicher Raucher. Er glaubte, ohne seine geliebten schwarzen Zigaretten den Tag nicht überstehen zu können. Es war sein einziges Laster, wenn man von der gelegentlichen Flasche Bier nach Feierabend absah. Das Rauchverbot war sinnvoll, auch wenn er sich an die fast dreißigtausend Liter Benzin in seinem Rücken gewöhnt hatte. Sein Tankwagen fasste diese über mehrere Kammern verteilte Menge. Er war stolz, dass er den Führerschein einschließlich des Gefahrgutscheins machen durfte und man ihm einen Tanklastzug mit dieser brisanten Ladung anvertraute.
Er war 2015 mit dem großen Flüchtlingsstrom nach Deutschland gekommen. Die Kanzlerin hatte ihn und eine große Zahl weiterer Bürgerkriegsflüchtlinge ins Land geholt. Es war vielleicht dem Massenzustrom damals zu verdanken, dass Beyrouti, ohne Papiere ankommend, in Deutschland bleiben durfte. Zu grauenvoll waren die Bilder, die die Medien aus Aleppo verbreiteten. Man hatte Verständnis dafür, dass er dem Chaos und Elend, das in Aleppo herrschte, den Rücken zugekehrt hatte. Heute war er integriert, eine willkommene Arbeitskraft und seit fünf Jahren als Kraftfahrer für Harmsen und Söhne aus Erfde tätig, einen Familienbetrieb, der mit sechs Tanklastwagen Mineralölprodukte aus der einzigen Raffinerie Schleswig-Holsteins in Heide abholte und damit die Tankstellen im nördlichen Landesteil versorgte. Darüber hinaus betrieb sein Arbeitgeber noch einen Handel mit Heizöl in der Eider-Treene-Sorge-Region.
Tawfiq Beyrouti aus Syrien hatte fast schon selbst vergessen, dass er eigentlich Moustapha Al Werfali hieß und aus Ägypten stammte. Nicht einmal seine Ehefrau Bekime, die er in einer Flüchtlingsunterkunft kennengelernt hatte, wusste um sein Geheimnis. Von der Landesunterkunft in Boostedt, in der er nach der Ankunft in Deutschland gelandet war, waren die beiden nach Flensburg weitervermittelt worden. Dort hatten sie ein neues Zuhause gefunden.
Beyrouti sah gewohnheitsmäßig in den Rückspiegel. Es war ein vertrautes Bild, dass sich hinter ihm eine lange Schlange bildete, wenn er mit sechzig bis siebzig Stundenkilometern sein schweres Fahrzeug über die Bundesstraße lenkte. Laien konnten sich nicht vorstellen, welche Kräfte sich entwickelten, wenn die flüssige Ladung beim scharfen Bremsen, aber auch bei der Beschleunigung, in Bewegung geriet und hin und her schwappte.
Die A 23 war von Hamburg bis zu den Orten mit großer Einwohnerdichte, dem sogenannten Speckgürtel, stark frequentiert. Danach ließ sie sich gut fahren. Am Ende der Autobahn bei Heide ging sie in eine Bundesstraße über, die durch die flache Marsch führte. Beyrouti kannte den Anblick. Diese Route befuhr er fast täglich. Hier konnte das Auge ausruhen, wenn es in die unendlich erscheinende Ferne abschweifte und am Horizont bei den dicht an dicht stehenden Windenergieanlagen hängen blieb.
Er ließ den schweren Sattelzug über den Asphalt rollen. Der nächste größere Ort war Tönning. Die Stadt lag aber wie alle anderen Orte neben der Bundesstraße, sodass er seinen Tanklaster ohne behindernde Ortsdurchfahrten gen Norden lenken konnte. Er wusste, dass auf geraden Abschnitten die Pkw hinter ihm auf die Gegenfahrbahn ausscherten, um ihn in waghalsigen Manövern zu überholen. Einheimische und Touristen, die mit dieser Strecke vertraut waren, wussten, dass es hinter Tönning kaum noch eine Überholmöglichkeit gab. Die Straße schlängelte sich zweispurig durch die Ebene, in kurzen Abständen durch enge Kurven die Aufmerksamkeit des Fahrers einfordernd. Die Westküste war von Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur abgehängt, und wenn wirklich einmal etwas in Angriff genommen wurde, scheiterten die Vorhaben oft an einer mangelhaften Planung.
Für Beyrouti war es Alltag. Wenn sich eine Schlange gebildet hatte, war er meistens an der Spitze. Selten musste er das Tempo drosseln, weil ein landwirtschaftliches Fahrzeug noch langsamer fuhr. Auch an die Beeinträchtigung durch Regen, Nebel oder den von Auswärtigen häufig unterschätzten Wind hatte er sich gewöhnt. Noch gefährlicher als diese Witterungsbedingungen waren die ungeduldigen Autofahrer, die glaubten, ihn überholen zu müssen, seien es PS