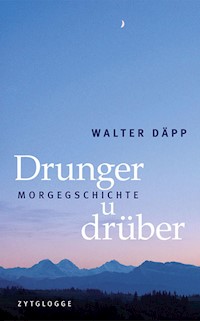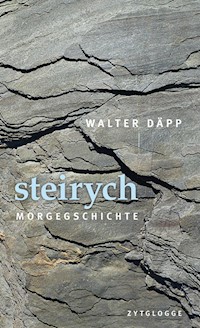22,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Viele Leben erleben «Walter Däpps Berufsarbeit führt ihn immer wieder zu den Menschen. Oft sind es nicht die Berühmtheiten und Prominenten, sondern jene am Rand der Gesellschaft. Ihnen verschafft Gehör. Er schreibt immer wieder Artikel über Themen, die es sonst kaum in die Zeitung brächten: zu Themen, die den Alltag der gewöhnlichen und vielleicht gerade deshalb ungewöhnlichen Menschen spiegeln. Diese besucht er - stellvertretend für seine Leserinnen und Leser. Das Schreiben, das Formulieren steht erst ganz am Schluss eines langen Prozesses. Schauen, beobachten, zuhören, riechen, mitfühlen, empfinden, staunen, überlegen, einordnen, fragen und auch immer wieder hinterfragen: Das gehört bei Walter Däpp dazu und fliesst in seine Artikel ein. Deshalb haben seine Texte Bestand. Man kann sie auch noch lesen, wenn der Aktualitätsbezug nicht mehr da ist - wie nun zum Beispiel in diesem Reportagebuch.» Hansueli Trachsel, Fotograf
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Walter Däpp
Herrlich komplizierter Lauf der Zeit
Walter Däpp
Herrlichkomplizierter Laufder Zeit
REPORTAGEN
Alle Rechte vorbehalten
Copyright: Zytglogge Verlag, 2010
Lektorat: Hugo Ramseyer
Korrektorat: Monika Künzi, Jakob Salzmann
Umschlagsfoto: Paul Gerbers IWC Destriere
Gestaltung/Satz: Franziska Muster, Zytglogge Verlag
ISBN 978-3-7296-0805-4
eISBN (ePUB) 978-3-7296-2192-3
eISBN (mobi) 978-3-7296-2193-0
Zytglogge Verlag · Steinentorstrasse 11 · CH-4010 Basel
[email protected] · www.zytglogge.ch
E-Book: Schwabe AG, www.schwabe.ch
Autor und Verlag danken der Klinik für Herz- und Gefässchirurgie, Bern, für den Druckkostenbeitrag.
Inhalt
Vorwort
Wymanns filigrane Faltervielfalt
Der Friedensruf, der von der Schweibenalp hallt
Eine Begegnung, die unter die Haut geht
Ein Haus zum Leben und ein Haus zum Sterben
Eine Nacht bei den Steinböcken
Familie Wirz ist gut in Dubai gelandet
Herrlich komplizierter Lauf der Zeit
Lob für Standhaftigkeit und Treue
Tierschützer Palmers und Metzger Gerber
Ihre Heimat bleibt das Meer
Wenn Rösi ‹z Alp› geht, bekommt sie Hühnerhaut
Christines lange Nacht in der Antarktis
Mit Meisterhand vom Rumpf getrennt
«Ich war dazu bestimmt, ein Sklave zu sein»
«Andere machen Yoga, ich jodle»
Sainab steht wieder auf eigenen Beinen
Die Alp, auf der man über Leichen geht
Nurfa – ein Mädchen, das überlebte
Nach dem Tod heissts «nichts wie weg»
Mände Leus verlorene zehn Jahre
Der freie Viehverkehr
Frühling auf dem Kindergrab
Jakobs sind über den Berg
Ein Lächeln, trotz allem
800 Mal Matterhorn retour
Eine Gemeinde mit null Einwohnern
Die Golperlaui ist schon gekommen
Mit dem Kaminfeger ins Landesinnere
Benjamin lebt – und spielt wieder Cello
Wie das Kuhhorn wegrationalisiert wird
Zwischen Uzwil und Flawil plötzlich ein Reh
Einer, der im Bachbett der Engstligen seinen Traum lebt
«Als wir oben waren, zogen wir die Sauerstoffmasken aus»
Es begann damit, dass ein Zwanzigjähriger ein Dorf kaufte
«Tanze mit mir in den Morgen, tanze mit mir in das Glück»
Männer, die den Durchbruch schaffen
Ein Emmentaler in Näkkälä
Die Italiener, die uns am nächsten sind
Abschied von Pickel, dem grössten Absamer aller Zeiten
Er war freiwillig lebenslänglich auf dem Thorberg
Der Käse kam trotz allem prompt nach Ossago
«In der Lawine war es nicht weiss, sondern schwarz»
Barry – ein Hund hat einen runden Geburtstag
Der Wegweiser
Dank und Fotonachweis
Vorwort
Walter Däpp ist kein Schreibtischtäter, nicht ein Journalist, der seine Artikel nach zwei Bestätigungstelefonaten im Internet recherchiert. Er muss hinaus, nicht nur für seine sportlichen Aktivitäten, für Ski- und Bergtouren und den Orientierungslauf. Wenn man mit offenen Sinnen durch die Welt (oder auch nur durch die Stadt) gehe, lägen die Geschichten überall herum, man müsse sich nur bücken und sie auflesen, ist er überzeugt. Walter Däpps Berufsarbeit (seit drei Jahrzehnten schreibt «wd.» als Redaktor Reportagen für den Berner «Bund») führt ihn immer wieder zu den Menschen. Oft sind es nicht Berühmtheiten und Prominente, sondern Menschen am Rand der Gesellschaft. Ihnen verschafft er Gehör. Er schreibt immer wieder Artikel über Themen, die es sonst kaum in die Zeitung schafften: Themen, die den Alltag der gewöhnlichen und vielleicht gerade deshalb ungewöhnlichen Menschen spiegeln. Diese besucht er – stellvertretend für seine Leserinnen und Leser.
Das Schreiben, das Formulieren, steht erst ganz am Schluss eines langen Prozesses. Schauen, beobachten, zuhören, riechen, mitfühlen, empfinden, staunen, überlegen, einordnen, fragen und auch immer wieder hinterfragen: Das gehört bei Walter Däpp dazu und fliesst in seine Artikel ein. Er ist kein Schnellschreiber. Er braucht Zeit zum Formulieren. Und er nimmt sich Zeit zum Nachfragen, zum Überprüfen, zum Verbessern, zum Schleifen an einzelnen Sätzen. Erst dann gehen seine Lesekunststücke, die unter anderem auch den «Bund» immer wieder prägen, in den Druck. Deshalb haben seine Texte Bestand. Man kann sie auch noch lesen, wenn der Aktualitätsbezug nicht mehr da ist – wie nun zum Beispiel in diesem Reportagebuch. Diese Däpp-Texte aus den letzten zehn Jahren spiegeln das Leben einer Stadt, einer Region, eines Kantons und eines Landes. Es sind Einblicke in kleine Welten auf dieser grossen Welt.
Als Fotograf bin ich seit bald vierzig Jahren mit Walter Däpp unterwegs – mit keinem anderen Journalisten so oft und so gerne wie mit ihm. Wir haben stets als Team gearbeitet, ohne gross darüber zu reden. Die Einheit von Text und Bild ist uns beiden ein Anliegen. Es gab zwar auch Meinungsverschiedenheiten – etwa, wenn ich das «beste» Bild im Blatt haben wollte und er auf das «passendste» Bild pochte. Wir konnten uns aber immer einigen. Da spielte der Respekt des einen vor dem anderen eine Rolle.
Heute fotografiert Walter Däpp auf Reportagen manchmal selber – wenn die personellen Ressourcen im Fototeam zu knapp sind, wenn der Aufwand zu gross wäre. Oder wenn es noch nicht klar ist, ob eine Geschichte überhaupt zustande kommt. Wenn ich dann glaube, in einem seiner Bilder auch meine fotografische Handschrift zu erkennen, bin ich schon ein bisschen stolz. Hansueli Trachsel, Fotograf
Wymanns filigrane Faltervielfalt
Hans-Peter Wymann ist mit der feinen Formen- und Farbenvielfalt der (noch) etwa 3700 Schmetterlingsarten in der Schweiz vertraut. Er ist wissenschaftlicher Schmetterlingszeichner. Sein Werk ist ein kunstvolles und prachtvolles Archiv der Artenvielfalt.
Er hat es schön. Seit Jahren ist er zwar nicht gerade umschwärmt, aber doch umgeben von Schmetterlingen. Er zeichnet und malt sie. Von Berufes wegen. Zwei Tage pro Woche ist er Lehrer in Jegenstorf, drei Tage ist er im Naturhistorischen Museum der Burgergemeinde Bern wissenschaftlicher Schmetterlingszeichner. «Vielleicht etwa 4000 dieser wundervoll symmetrischen Wesen» hat er in den letzten 25 Jahren zu Papier gebracht – was ihn nun selber ein bisschen zu erstaunen scheint. Er sei nämlich «eher ein ungeduldiger Typ», sagt er. Doch beim Schmetterlingszeichnen habe er auch nach so langer Zeit die Geduld nicht verloren. An gewissen Tagen gehe ihm das Zeichnen zwar besser, an anderen Tagen schlechter von der Hand, doch der Schmetterling als scheinbar stets gleiches und doch immer wieder anderes Sujet sei für ihn nach wie vor faszinierend. «Schmetterlinge sind schlicht und einfach schön», sagt er, «man könnte sie nicht schöner machen – mit ihren wunderbar aufeinander abgestimmten Farben und der Harmonie ihrer Formen.» Ihre «Flügelwelten» seien «unglaublich vielfältig und grossartig». Mit jedem Pinselstrich tue sich, auch bei scheinbar grauen Faltern, eine neue Welt auf. Eine Welt, die ihn schon als Bub interessiert habe.
Im Moment kritzelt und pinselt er mit feinsten Zeichen- und Malutensilien an Eulenfaltern (Noctuidae). Er arbeitet mit Farbstiften und Aquarellfarben und mit verschieden feinen Pinseln. «Wenn ein Pinsel hervorragend ist, kann man auch noch mit einem einzigen Haar malen. Aber nur, wenn dieses Haar die Feuchtigkeit halten kann.» Er malt auf versiegeltes Papier, sodass er filigrane Feinheiten mit dem Japanmesser herauskratzen kann. Wenn auf seinem Zeichenblatt pro Tag ein neuer Falter entsteht («oder manchmal auch zwei»), ist er mit der Arbeit zufrieden. «Eulenfalter heissen sie», erklärt er, «weil gewisse Eulenfalterarten auf der Brust haarartige Büschel haben. Wenn man sie von vorn, axial, betrachtet, erhält man den Eindruck eines Eulenkopfs.» Dies erkenne man aber nur bei lebenden Tieren – «wenn sie die Haarbüschel aufgestellt haben».
Zufrieden, wenn pro Tag ein Schmetterling entsteht: Hans-Peter Wymann.
«So, wie ich sie haben will» | Schmetterling: Das ist nur der weit gefasste Überbegriff. Es gehören nicht nur die wundervollen Prachtexemplare dazu, die man im Sommer manchmal im Freien bewundern kann, sondern auch viele unscheinbare Schmetterlingsarten, die man als Laie fast nicht wahrnimmt und auch kaum auseinanderhalten kann. Alle Tag- und Nachtfalterarten gehören dazu, und «all diese kleinsten Schmetterlinge, die nur drei bis vier Millimeter Spannweite haben und die man als Motten bezeichnet», wie Wymann sagt: «In der Schweiz gibt es etwa 3700 Schmetterlingsarten, davon nur knapp 200 Tagfalterarten. Die allermeisten Schmetterlinge sind also Nachtfalter.»
Inzwischen habe er als Schmetterlingszeichner eine gewisse Routine, lacht er. Die Falter kämen nun jedenfalls «einigermassen so heraus, wie ich sie haben will». Doch warum werden sie im Computerzeitalter noch immer von Hand gezeichnet und nicht fotografiert? Es gebe zwar bereits «hervorragend fotografierte Werke», sagt Wymann, doch winzige und kaum wahrnehmbare Unterscheidungsmerkmale seien zeichnerisch eben nach wie vor besser zu erfassen. Eulenfalter zum Beispiel seien sich äusserlich sehr ähnlich, die einzelnen Merkmale seien sehr fein. «Beim Fotografieren versinken diese Feinheiten», sagt er. Als Zeichner habe er die Möglichkeit, die entsprechenden Objekte «in eine Sprache zu übersetzen, die man lesen kann». Dabei dürfe er den Falter zwar «nicht so überzeichnen, dass er zur Karikatur verkommt». Aber er könne die für die entsprechende Art typischen Merkmale so herausarbeiten, dass das Auge des Betrachters automatisch und gezielt auf diese wichtigen Details gelenkt werde. Auch Fotos könnten heute am Computer zwar ähnlich bearbeitet werden, doch die Aussagekraft der guten Zeichnung sei seiner Meinung nach noch immer unerreicht.
Er illustriert es am Beispiel der Ypsilon-Eule (Agrotis ypsilon), einem Nachtfalter aus der Familie der Eulenfalter – einem sehr verbreiteten subtropischen Falter, der oft tausend- oder sogar millionenfach von Süden her einfliege. «Auffallend an diesem Falter sind seine markanten schwarzen Spickel», sagt Wymann, «das ist ein für ihn typisches Merkmal, das ich als Zeichner diskret und doch klar erkennbar heraushole. Auch diese kleinsten weissen Schuppen, die fotografisch verschwinden würden, kann ich zeigen. Und auch die Adern kann ich sehr schön akzentuieren – die Äderung, in der die Flügel wie ein Schirm am Schirmgestell aufgespannt sind. Erkennbar sind auch die Unterschiede der Falten und Adern im Flügel oder die dunklere vordere und die hellere hintere Flügelhälfte.»
Als Vorlagen stehen Wymann Falterpräparate zur Verfügung, die oft leicht beschädigt sind, die Risse oder schattige Partien haben. Als Zeichner könne er dies ausmerzen. Und er könne sein Werk auch perfektionieren, indem er «eine Symbiose zwischen dem linken und dem rechten Flügel» zeichne. Diese seien meist leicht asymmetrisch.
«Eine Welt ohne Schmetterlinge wäre weniger bunt und weniger lebenswert.»
«Eine generalisierte Synthese» | «Ich zeichne die Falter also nicht ganz so, wie sie in der Natur vorkommen», sagt er, «aber so, dass sie für ihre Art modellhaft sind.» Dies sei möglich, weil er als Zeichner auch generalisieren, also Irritierendes und Täuschendes weglassen und Wichtiges und Typisches hinzufügen könne: «Ich kann mich auf die wesentlichsten Merkmale konzentrieren. Wenn ich für eine Bestimmungshilfe einen präparierten Schmetterling fotografiere, ist er stets ein Individuum. Das will ich aber nicht darstellen. Ich stelle keine strikt naturgetreue Abbildung her, sondern eine generalisierte Synthese.» Dies sei beispielsweise beim Schillerfalter (Apatura iris) heikel, weil die Farben seiner Flügel, je nach Optik, schillerten: «Manchmal ist der ganze Falter braun, manchmal wird er ganz violett. Um dies zu zeigen, zeichne ich beide Flügel. Für die wissenschaftliche Darstellung genügt sonst ein Flügel.»
Der Körper eines Schmetterlings besteht übrigens aus dem Kopf, der Brust (dem Thorax) und dem Hinterleib (dem Abdomen). Die Flügel und Beine sind am Thorax angewachsen, die Verdauungs- und Geschlechtsorgane am Hinterleib. Und das Herz reicht, dorsal, «wie ein Schlauch» über den ganzen Rücken. «Diese Dreiteilung des Körpers ist das klassische Prinzip der Insekten», sagt Wymann, «Insekt heisst ‹das Eingeschnittene›.» Faszinierend ist für ihn auch immer noch die Verwandlungsfähigkeit der Schmetterlinge, ihre vier völlig unterschiedlichen Lebensformen – «das Ei, die Raupe, die Puppe und der Schmetterling». Schmetterlinge seien grösstenteils Nützlinge, betont er, vor allem bei der Blütenbestäubung. Oder als Nahrung für andere Tiere. Ein einziges Meisenpaar benötige für die Aufzucht seines Nachwuchses viele Tausend Raupen. Nur einzelne Arten seien Schädlinge, etwa die Maiszünsler, die als Raupen in Monokulturen grosse Schäden anrichten könnten.
«Unsere 3700 Schmetterlingsarten zeigen, was Biodiversität ist.»
Schmetterlinge sind gefährdet | Schmetterlinge sind durch die heutigen Umwelteinflüsse allerdings bedrängt und gefährdet. Laut Pro Natura hat in den letzten Jahrzehnten keine andere Tiergruppe so grosse Einbussen erlitten wie der Tagfalter. Viele ihrer Lebensräume wie Moore, lichte Wälder und Auen sind verschwunden. Die Landwirtschaft sei «viel zu intensiv», sagt Wymann, das Mittelland sei «eine von Siedlungsbrei und Verkehrswegen zerschnittene Agrarwüste». Und auch in Gärten und Parks mit exotischem Grün hätten Schmetterlinge keinen Platz mehr. Dies sei nicht unbedeutend; Schmetterlinge und ihre Raupen seien auch Indikatoren für den Zustand der Umwelt: «Auf klimatische Veränderungen oder auf Luftverschmutzung reagieren sie viel schneller als Pflanzen. Und eine Welt ohne Schmetterlinge wäre nicht nur weniger bunt, sie wäre auch für andere Lebewesen weniger lebenswert.»
Hans-Peter Wymann stellt fest, dass es heute noch genauso viele Schmetterlinge gibt, wie es «in der Natur für sie Nischen gibt». Für jede einzelne Art gebe es eine Nische. Und mit jeder Nische, die verschwinde, verschwinde eine Schmetterlingsart. An seinem Wohnort Jegenstorf habe er vor einiger Zeit untersucht, wie viele Tagfalterarten vor hundert Jahren hier noch heimisch waren: Von rund 70 Arten seien noch 25 übrig geblieben. Schlimm sei nicht in erster Linie das Verschwinden des einzelnen Schmetterlings, sagt er, schlimm sei die extreme Verarmung der Landschaft generell, die sich eben auch im Verschwinden der Schmetterlinge darstelle: «Je mehr Schmetterlingsarten es gibt, desto reichhaltiger ist die Natur – unser Lebensraum. Trotz schönen Löwenzahnmatten ist unsere Landschaft eben verarmt.» Schmetterlinge illustrierten also modellhaft, was Biodiversität sei. Und sie seien auch Indikatoren für den Klimawandel, weil sie sehr schnell auf Umweltveränderungen reagierten. Gewisse Tagfalterarten, die bislang nur im Wallis oder am Jura-Südfuss vorgekommen seien, breiteten sich plötzlich bis ins Mittelland aus: «Mindestens zehn Wärme liebende Tagfalterarten besiedeln nun neue Nischen im Mittelland und scheinen sich dort bestens zu entwickeln.» Diese «spannende neue Entwicklung» laufe extrem schnell ab.
Hans-Peter Wymann greift wieder zum Pinsel, arbeitet mit Fachwissen, Feingefühl, Geduld und Akribie jene zeichnerischen Details heraus, die für den Eulenfalter typisch sind. Und auf die Frage nach seinem Lieblingsschmetterling überlegt er ein Weilchen. «Im Moment», sagt er, «ist es wohl der Karstweissling (Pieris mannii). Es ist eine jener mediterranen Arten, die wir letztes Jahr erstmals in unserer Region gefunden haben, im Gebiet der Simmenfluh im Berner Oberland. Eine solche Art, die plötzlich überall ist, interessiert mich natürlich sehr. Doch sonst, nein, habe ich keinen eigentlichen Lieblingsschmetterling. Auch unscheinbare Falter haben ihre ganz besonderen Schönheiten.» (9. Januar 2010)
Der Friedensruf, der von der Schweibenalp hallt
Sie heissen Majestro Tlakaelel, Grandmother Sarah, Wai Turoa, Standing Bear oder Angaangaq – Stammesälteste verschiedener Urvölker. Und sie sind unermüdlich unterwegs, um den Frieden auf Erden zu zelebrieren. Auch auf der Schweibenalp ertönt ihr völkerverbindender Alpsegen.
Das Gipfeltreffen findet auf höchster Ebene statt, 1116 Meter über Meer und 550 Meter über dem Brienzersee. Und es geht um nichts Geringeres als um das Streben nach einem weltweit friedlichen Zusammenleben. Hier schickt man sich an, mit Ritualen, Gesprächen, Meditationen, Gebeten, Tänzen und Musik «für Mutter Erde und alle Wesen ein kraftvolles Energiefeld zu kreieren». Das Treffen, das im «Zentrum der Einheit» Schweibenalp etwa 150 Menschen fünf Tage lang friedlich vereinigt, heisst «Universal Peace Celebration» und findet zum sechsten Mal statt. Viele Anwesende scheinen von ähnlichen Zusammenkünften her schon freundschaftlich verbunden zu sein. Und sie sind guten Mutes, allen irdischen Widrigkeiten zum Trotz gemeinsam einer besseren Zukunft entgegenzugehen – auch wenn dieser Alpsegen von der Schweibenalp bei den Menschen unten im Tal und auf der übrigen Welt vorerst wohl kaum ein wahrnehmbares Echo zu erzeugen vermag.
Günter Fleisch, 62-jährig, Diplompsychologe aus dem schwäbischen Eningen, ist aber überzeugt, dass die Botschaft nicht ungehört verhallen wird. «Sie wird wahrgenommen», sagt er, «es ist wie bei den Vögeln vor dem Winterflug. Einer gibt das Signal, dann fliegen die andern mit.» Erschwerend sei allerdings, dass der Friede «im Innern» beginnen müsse. Erst dann werde er auch «im Äusseren» zu erreichen sein. Günter (klar, dass man sich unter Friedensaposteln duzt) ist einer meiner beiden Zimmernachbarn. Im ehemaligen Hotel und Ferienheim, das seit dreissig Jahren ein interreligiöses Kurs- und Meditationszentrum ist, gibt es offenbar nur Mehrbettzimmer – was dem Ziel, sich näherzukommen, natürlich förderlich ist. Der zweite Mitbewohner taucht erst später auf, kurz vor dem Zubettgehen: John Hogan, ein in der mediterranen Wärme Portugals lebender Ire, der sich als intimer Naturfreund ausgibt und dieses Jahr wieder auf die Schweibenalp gekommen ist, um hier, in vertrautem Kreise, «neue Erkenntnisse zu gewinnen und neue Lebensenergien zu tanken». Er ist ein sympathischer, offener, fröhlicher Kerl, der zuvor schon im Speisesaal aufgefallen ist, wo er sich mit Angaangaq, einem Ältesten des Volkes der Eskimo-Kalaallit in Grönland, unterhalten hat – wohl über alte Lehren, Weisheiten und Heiltraditionen der Inuit oder sonst über Gott und die Welt und so.
Grenzen und Vorurteile abbauen: Zentrum der Einheit Schweibenalp.
«Achse des Friedens schmieden» | Im Gegensatz zu John scheint Günter eher schüchtern zu sein. Dass er sich doch in ein Gespräch verwickeln lässt und dabei, so ganz nebenbei, sein neustes Buch erwähnt, bringt ihn sogar fast ein bisschen in Verlegenheit. Vor dem «Talk» mit der Maori-Medizinfrau und Seherin Wai Turoa-Morgan aus Neuseeland legt er es dann aber diskret auf mein Kopfkissen. Es ist sein drittes Buch, trägt den Titel «Aus einer anderen Welt» und ist «der göttlichen Mutter» gewidmet. «Die Hindus nennen sie Parvati», steht im Vorwort, «die Christen Maria, die Muslime Fatima, die Buddhisten Tara und die Chinesen Kuan Jin.» Auf Seite 48 ruft er dazu auf, endlich «die Achse des Friedens zu schmieden». Und auf Seite 17 ändert er das Vaterunser so ab: «Vater-Mutter unser, der Du bist im Himmel wie auf Erden. Geheiligt seien Deine vielen Namen.» Das Verwischen aller kulturellen, religiösen, politischen oder sonstigen Grenzen ist nicht nur Günters Ziel, sondern auch ein Hauptanliegen dieses alljährlichen Schweibenalp-Treffens. Initiant Felix Maria Woschek, laut Programmheft «Weltmusiker, Friedensarbeiter und Brückenbauer», hat damit, wie er sagt, «ein Feld für den interkulturellen und interreligiösen Dialog» geschaffen – einen Ort, wo Menschen «Gemeinsamkeit erleben können». Wenn man den Planeten noch retten wolle, dürften unterschiedliche Glaubensrichtungen oder Hautfarben keine Rolle mehr spielen, betont er: «Dann zählen nur noch Liebe, Respekt und Anerkennung.»
Robert Dreyfus, Arzt, Psychiater, Mystiker, Meditationslehrer und vor dreissig Jahren Gründer der «Schweibenalp», sieht dieses Zentrum als «Teil eines weltweiten Netzes von Menschen, die in Pioniermodellen ausprobieren, wie es ist, ein bisschen einfacher zu leben und gemeinschaftlicher zu denken». Ursprünglich habe sich die Schweibenalp als religiös ausgerichtetes Zentrum verstanden, «fast im Sinne eines interreligiösen Klosters». Doch heute sei man «eine weltoffene interkulturelle Gemeinschaft, die versucht, die Spiritualität im Alltag zu leben und nach dem Motto ‹Wahrheit, Einfachheit, Liebe› transparent und liebevoll miteinander umzugehen – mit weniger Konkurrenz, weniger Egoismus, weniger Konsum und weniger Ausnützung. Aber mit mehr Mitgefühl, mehr Mitfreude, mehr Kooperation und wenn möglich mit mehr Nachhaltigkeit.» Die Schweibenalp sei ein Versuchsgelände für einen anderen Umgang miteinander, sagt Dreyfus: «Wir sind zwar auch nach dreissig Jahren noch immer Anfänger, doch wir glauben, dass die Welt tatsächlich eine grosse Familie sein könnte – so wie wir auch in diesen Tagen eine Familie sind.»
Vorerst, nach dem Zimmerbezug, taste ich mich allerdings noch eher zögernd an diese Familie heran. Das Auto ist auf dem Parkplatz oberhalb des Zentrums zurückgeblieben, versteckt hinter einem Hügel. So bleibt es wie alle anderen Autos für einige Tage aus den Augen und aus dem Sinn – und beeinträchtigt nicht die Sicht auf das, was auf dem weissen Pfosten beim Eingang steht: «Möge Frieden auf Erden sein» (May Peace Prevail on Earth). Immer noch ein bisschen irritiert blicke ich dann hinüber zum Brienzergrat und zwischen den Bäumen hinab auf den milchig-grünen Brienzersee – und stelle fest, dass dieser die Sonnenstrahlen fast symbolhaft wieder gen Himmel schickt. Das Rattern eines Helikopters versuche ich zu ignorieren und bewundere stattdessen die orange leuchtenden Tagetes im Schoss von Buddha, der im Garten sitzt. Ich rieche den Duft der Räucherstäbchen und schütte dann wacker Demeter-Milch in den Kaffee. Und lese, dass Tempel und Feuerzelt (Dhuni) hier oben als geweihte Zeremonienstätten «Kraft und Heilung» verheissen.
«Zweifler leisten der Welt keinen Dienst. Unsere Friedensbotschaft schon.»
«Lieber Gast, liebe Gästin» | Ich erhasche auch einen Blick auf den Büchertisch beim Eingang, wo man sich in Werke wie «Einführung in die buddhistische Psychologie», «Christliche Mandalas», «Kollision mit der Unendlichkeit», «Spuren der Engel» oder «Antworten auf Fragen, die das Leben stellt» vertiefen kann. Fragen gäbe es viele. Und Antworten werden im Rahmen dieses Friedensfestivals nun wohl etliche erhältlich sein. Doch vorerst blicke ich einem älteren Paar nach, das mit Tagesrucksäcken unterwegs ist und etwas ratlos am Zentrum der Einheit vorbeiwandert. Ich erfahre, dass sich die Schweibenalp-Gemeinschaft jeweils um 9 Uhr zu einem 15-minütigen «herzverbindenden Treffen» zusammenfindet, um «der Vision von Einheit und Lebendigkeit des Alltags einen Rahmen zu geben». Und ich nehme zur Kenntnis, dass das Handtuch im Waschraum ein «public towel», ein Handtuch für alle ist. Und dass «der liebe Gast und die liebe Gästin» gebeten werden, «die abgezogene Bettwäsche am Abreisetag bitte hier (im Korridor) abzulegen». An die Abreise ist allerdings noch nicht zu denken, denn sogleich trifft man sich zur Meditation mit Mayapriesterin und Heilerin Christine Muigg. Die sympathische Frau ist Mitbegründerin des Interkulturellen Friedenszentrums «To Om Ra» in Guatemala und macht, laut Programm, «Reisen durch die Welt des Denkens und Fühlens, der Intuition und der zeitlosen Wahrheit». Sie erzählt, wie sie vor zwanzig Jahren nach Guatemala auswanderte, dort ins «Kraftfeld der Maya» eintauchte und lernte, «mit Bäumen und Steinen zu reden». Sie ist überzeugt, dass «die geistige Welt» allen offensteht, und berichtet, wie der «heilige Kalender der Maya den Energiefluss aufzeigt, der hinter allem irdischen Geschehen steht». Grandmother Sarah Smith, Stammesälteste der Mohawk Iroquois Nation, fordert später auf, «die Flügel auszubreiten und zu fliegen», um «die Zukunft unserer Kinder vorzubereiten». Vieles werde sich verändern, die Wasserknappheit werde weltweit grosse Problemen bringen, sagt Sarah. Deshalb seien die Menschen immer mehr aufeinander angewiesen: «Wir brauchen uns gegenseitig mehr denn je. Die Entfernung trennt uns nicht. Unsere Herzen sind für immer verbunden.»
Petra Grünig, Künstlerin aus Thun, die mit ihrem fünfjährigen Sohn auf die Schweibenalp gekommen ist, stimmt Grandmother Sarah zu. Sie erlebt die Peace Celebration als «Lebensschule, als globales Gipfeltreffen»: Vertreterinnen und Vertreter aller Hochkulturen seien hier und wollten alle das Gleiche: Frieden. Hier, in dieser Gemeinschaft, nehme sie sich «als Glied in der Kette» wahr und realisiere, dass Friede nur entstehen könne, wenn jeder Einzelne ihn anstrebe: «So baut sich dann jenes globale Netzwerk des Friedens auf, das hier spürbar ist. Und das ich auch für meinen Sohn spürbar machen will. Auch für ihn soll Spiritualität so selbstverständlich und natürlich sein wie Zähneputzen.»
Auch Majestro Tlakaelel, 89-jährig, ist von seinem Volk, den Anahuak in Mexiko, mit einer «geistigen Mission» beauftragt worden. So ist er nun auf die Schweibenalp gekommen, um auch hier «Friedensgedanken mit den Menschen aller Hautfarben zu teilen». Er stellt fest, dass «wir alle Eingeborene dieses Planeten sind», dass «die Welt grosse Probleme hat» und «die Weltwirtschaft zusammengebrochen ist». Doch er sei hier, um «die Botschaft des Friedens, der Harmonie und der Gerechtigkeit» zu verbreiten. Daran, dass diese Botschaft Gehör finden wird, zweifelt er nicht: «Manchmal beginnt es mit einer einzigen Person, die eine Idee hat. Dann folgen ihr einige – bis sich eine Gruppe bildet. So sind die grossen Veränderungen auf diesem Planeten Tatsache geworden.» Wichtig sei allerdings, «die Angst zu beseitigen», ergänzt Wai Turoa-Morgan, denn Angst «tötet die Kraft der Liebe». Sie mahnt, die Erde benötige Heilung. Und gibt zu bedenken, dass «unsere Verantwortung nicht nur auf diesem Planeten liegt, sondern im Universum» – dass also «das ganze Universum auf uns wartet, damit wir endlich aufräumen». Die Erde benötige Heilung, im Inneren und im Äusseren.
«Hört mit den Augen …» | Cherokee-Medizinmann Robert Standing Bear, unter anderem als «Sonnentänzer und Pfeifenträger» angesagt, ist zuversichtlich. Er geniesst «diese schönste Zeit, um auf der Erde zu sein», und fürchtet sich nicht vor der Zukunft. Er vertraut auf die Kraft der Frauen («die Erde ist weiblich»). Und rät: «Seid aufmerksam. Hört mit den Augen, seht mit den Ohren!» Hören und Sehen, ob mit Augen oder Ohren, dürften allerdings nicht genügen, um eine lebenswerte, friedliche Zukunft auf diesem Planeten vorzubereiten, erfährt man später. Und auch das Reden reiche nicht aus. «Alles beginnt zwar im Geist», sagt Robert Dreyfus, «doch von dort muss es ins Wort kommen. Und dann in die Hand. Wenn die Friedensbotschaft im Geiste stecken bleibt, ändert sich nichts, wir müssen sie in die Hand nehmen.» Auch wenn man hundert Jahre von Ökologie, Nachhaltigkeit und Frieden rede, ändere sich nichts – wir müssten entsprechend zu handeln beginnen: «Es bringt auch nichts, von Weltfrieden zu reden, wenn es uns im Kleinen nicht gelingt, friedlich miteinander umzugehen – in der Familie, in der Gemeinschaft oder im Geschäft. Also bemühen wir uns, das, was wir predigen, auch zu praktizieren. Das heisst üben, üben, üben – und mal wieder Fehler zu machen und daraus zu lernen.» Über den Frieden zu reden, sei immerhin der Anfang, sagt Dreyfus: «Und wenn einmal acht Milliarden Menschen vom Frieden reden, dann haben wir ihn, den Weltfrieden.» Auf der Schweibenalp werde allerdings nicht nur geredet. Es sei immer auch wichtig, Stimmungen zu erleben, Botschaften «mit dem Herzen zu erfahren». Wie zum Beispiel beim gemeinsamen Morgenritual, das für den anbrechenden Tag allseits wieder Kraft und Lebensfreude geben soll. Auch ich begebe mich zum Dhuni, vor das lodernde Feuer – wo die friedliebenden Ritualhabitués mich sogleich in ihren Kreis aufnehmen. Nach gemeinsamem Meditieren, Beten, Singen und Schweigen reicht man sich die Hände und bringt stimmungsvoll zum Ausdruck, wie dankbar man auch diesen neuen Tag wieder begrüsst: «Willkommen Erde, willkommen Welt, Licht und Leben haben wieder gesiegt.»
Trotz seinem Leben in der Schweibenalp-Idylle, weit weg von allem Bösen, sieht Dreyfus auch all die Missstände, die Ungerechtigkeiten, die Kriege, die Konflikte, die Katastrophen- und Schreckenssituationen auf der Welt. Dies stachle ihn erst recht an, positiv zu denken, denn: «Negative Gedanken unterstützen das Negative. Zweifler leisten der Welt keinen guten Dienst. Unsere Friedensbotschaft jedoch schon.» Natürlich möchte auch Dreyfus mit diesen Gedanken möglichst viele Menschen erreichen: «Doch wir missionieren nicht, wollen niemanden zu irgendeiner Religion oder Weltanschauung bekehren. Wir wollen nur dazu beitragen, dass die Menschen in ihren Herzen weiterkommen.» Nächster Fixpunkt auf diesem Weg ist der Workshop mit Angaangaq, dem bärtigen Inuit-Ältesten, Heiler und witzigen Geschichtenerzähler aus Grönland. Er ist kleinwüchsig, begründet dies damit, dass «im kalten Norden eben alles sehr langsam wächst». Dann scherzt er: «In der Schweiz sind alle gross gewachsen – weil ihr gross sein müsst, um über die Berge sehen zu können.»
«Über den Frieden zu reden, ist immerhin der Anfang.»
«Die Schönheit des Friedens» | Er berichtet, dass er sich manchmal stark fühle und dann doch immer wieder merke, nicht stark genug zu sein. Er gesteht, dass er zwischen sich und Gott «manchmal den Vorhang zuzieht». Er zeigt seine Heiler-Utensilien, vom versteinerten Cariboo-Knochen bis zum Walfischzahn. Und er sagt, warum ausgerechnet er ein wahrhafter Friedensexperte ist: «Ich komme aus einem 5000-jährigen Dorf in einem Land, wo es nie Krieg gegeben hat. Deshalb weiss ich nicht, was Krieg ist. Ich kenne also nur die Schönheit des Friedens.» Diese Schönheit sei auch die Schönheit der Erde, meint Angaangaq. Und wer sie erkenne, könne «doch gar nie auf die Idee kommen, sie zu bekämpfen». Doch sie sei gefährdet, diese Schönheit des Friedens. Zum Beispiel durch die Klimaerwärmung. In Grönland gediehen zum Beispiel nun Bäume, während das Eis schmelze. Und wenn Länder, «auch die Schweiz», glaubten, ihre Umweltsünden mit Kompensationszahlungen an Afrika reinwaschen zu können, sei das unehrlich. «Ich staune», sagt Angaangaq, «wie intelligente und gebildete Leute, sei es in Europa oder in Amerika, solche Überlegungen anstellen können.» Trotzdem sei er kein Pessimist: «Ich glaube noch an einen Sinneswandel. Jeder muss aber sich selber ändern, statt bloss andere ändern zu wollen.»
Auch Petra Grünig hat längst begonnen, mit diesem Sinneswandel bei sich selbst zu beginnen. Und auch Günter und John, die beiden Zimmernachbarn. Zusammen mit Angaangaq, Standing Bear oder Grandmother Sarah haben sie voller Zuversicht wieder den Schweibenalp-Alpsegen angestimmt. Und hoffen weiterhin, dass man ihn bald auch unten im Tal wahrnimmt. (10. Oktober 2009)
Eine Begegnung, die unter die Haut geht
Der Bauarbeiter Ernst Rüegg ist von Kopf bis Fuss tätowiert. Mit seinen «Tribal Tattoos» bedrohter Urvölker will er hautnah zeigen, dass es «neben unserer Konsum- und Leistungskultur noch andere Kulturen gibt auf dieser Welt».
Ernst Rüegg, 50-jährig, angelernter Schreiner und Bauarbeiter, wäre eigentlich ein ganz gewöhnlicher, eher unauffälliger Mensch. Aber er fällt auf. Er ist fürs Leben gezeichnet. Von Kopf bis Fuss. Mit Tätowierungen, die er nie mehr wegbringen wird und auch nie mehr wegbringen will. Er zeigt sie stolz, versucht nicht, sie verschämt unter den Kleidern zu verstecken. Dies sei das Faszinierende daran, sagt er, «dass Tätowierungen etwas Verbindliches, etwas Bleibendes sind». Deshalb müssten die Motive sorgfältig ausgewählt werden, damit «etwas wirklich Schönes und Aussagekräftiges entsteht». Ein richtiges Tattoo sei eben mehr als ein modisches Accessoire, wie es sich in den letzten Jahren vor allem auch viele Frauen zugelegt hätten – vornehmlich an Körperstellen, die sich neckisch bedecken oder entblössen liessen.
Dass er sich am ganzen Körper tätowiert hat, heisst für Ernst Rüegg, «zu mir zu stehen, statt mich zu verstecken, mich in graue Kleider zu stecken, möglichst nicht aufzufallen, nichts von meiner Persönlichkeit preiszugeben». Er sei stolz auf sein «anderes» Aussehen, sagt er. Schon als 22-Jähriger spielte er mit dem Gedanken, sich tätowieren zu lassen. Doch die Sujets, die man damals meist zu Gesicht bekam, waren nicht nach seinem Geschmack: «Anker, Pin-up-Girl, Spinnennetz oder Totenschädel auf dem Oberarm – nein, das war nicht das, was ich wollte.» Er wollte seinen Körper «mit etwas Gültigem» zeichnen – «mit etwas Klassischem, das in die Tiefe geht». Und weil das Tätowieren damals in Bern noch verboten war, brachte er sich die ersten Nadelstiche selber bei. Er nahm eine Stecknadel und schwarze Tusche und stach sich ein kleines Lilienmuster auf den linken Handrücken.
«Die Tattoos gehören zu meiner Persönlichkeit»: Ernst Rüegg zeigt sie stolz.
Überbringer von Botschaften | Erst viele Jahre später machte er sich daran, seinem ganzen Körper ein neues Aussehen zu geben. «Ich fand es geil», sagt er, «mit jedem neuen Tattoo reizte es mich, noch mehr zu machen.» Dabei überliess er nichts dem Zufall. Er fand Gefallen an «Tribal Tattoos», an traditionellen, archaischen Tätowierungen bedrohter Völker, und begann, sich mit der Tattoo-Kultur dieser Völker zu befassen. Er las Bücher und Berichte über die symbolischen und psychologischen Hintergründe dieser uralten Körperkunst – und beschloss, fortan mit seinem eigenen Körper Teil dieser «Tribal Tattoo»-Kultur zu sein. Er reiste nach Malaysia, Borneo, Neuseeland, Samoa und Tahiti, um sich dort von einheimischen Ethnokünstlern tätowieren zu lassen. Was dabei herausgekommen ist, betrachtet er nun als «Botschaften der Urvölker an Europa». Er sei «ein Überbringer dieser Botschaften» – und zwar eben einer, der dies «am eigenen Körper» tue. Das sei intensiver und verbindlicher, als wenn er «bloss eine Nachricht, einen Film oder ein Bild» nach Hause brächte. Für alle, die ihm begegnen, sind diese Botschaften nun unübersehbar. Sie gründen tief. Gehen unter die Haut. Können aber auch irritieren.
«Ja», sagt er, «wer mir begegnet, stellt sich unweigerlich Fragen. Zu meiner Person. Oder zu den Beweggründen für meine Tattoos.» Viele zeigten Interesse, nur wenige begegneten ihm mit Vorurteilen. Viele sprächen ihn auch auf die «wahnsinnig schönen Muster» seiner Tätowierungen an. Und das gebe ihm dann die Gelegenheit, auch über die Hintergründe seiner «Tribal Tattoos» zu erzählen – über die Urvölker in Samoa oder in Borneo, in Neuseeland oder in Tahiti. Und so daran zu erinnern, dass es «neben unserer oberflächlichen westlichen Konsum- und Leistungskultur noch andere Kulturen gibt auf dieser Welt».
Auch die Tätowierung des Gesichts und der Schädeldecke war für Ernst Rüegg plötzlich kein Tabu mehr. «Wenn schon mein ganzer Körper tätowiert ist», sagte er sich, «dann soll auch mein Kopf tätowiert sein.» Dabei habe er sich allerdings «nur den besten Künstlern» anvertraut. Die grossen Löcher in seinen Ohrläppchen hat er sich aber selber zugefügt: «Mit Zahnstochern habe ich sie allmählich vergrössert, immer ein bisschen mehr ausgeweitet. Nach drei Wochen konnte ich zwei, nach drei weiteren Wochen drei Zahnstocher ins Loch stecken. Später hatte ein Ästchen Platz oder ein mit Papier eingewickelter Dübel-Stab.» Nun hat er einen spiralförmig geschnitzten Schmuck aus Horn ans linke Ohr gehängt. Und ins Loch im rechten Ohr, das so gross ist wie ein Einfränkler, hat er einen kostbaren blauen Lapislazuli-Ring eingefügt. Und beide Ohren passen, samt Schmuck, gut zu seinem archaischen Amulett – einem von Maoris aus Knochen geschnitzten Haken.
Der Körper als Landkarte | Seine neuste Tattoo-Errungenschaft ziert nun seinen Kopf und ist nur zu sehen, wenn er sich den Schädel rasiert. Es ist ein klassisches Mandala-Muster aus Tibet, das er sich von einem in Lausanne lebenden tibetischen Tattoo-Künstler stechen liess. «Um damit», wie er sagt, «den Tibetern, diesem unterdrückten Volk, meine Verbundenheit auszudrücken.»
Die Stirn, die obere Gesichtshälfte und die Nase hat er sich in Neuseeland vom Maori Inia mit spiralförmigen Maori-Motiven schmücken lassen – «sie bedeuten Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft», sagt er. Auf der unteren Gesichtshälfte trägt er indianische Tattoos von Jack Mosher aus Kalamazoo, Michigan. Der Hals ist seitlich von einem Engländer nach tibetischen Vorgaben tätowiert worden – vorn mit einem Muster aus Borneo. Oberarme und Schultern sind ebenfalls mit Borneo-Tribes verziert, auf der Brust dominieren neben weiteren Borneo-Tattoos und seinem Sternzeichen (Widder) vor allem keltische Muster. Am linken Arm hat ein deutscher Tätowierer Hand angelegt (mit Maori-Mustern), am rechten Arm trägt er ein modernes Tribal-Motiv aus Tahiti, das ihm der Berner Tätowierer Ändu Schwertfeger gestochen hat. Die linke Handoberfläche hat ein Grieche mit filigranen Borneo-Mustern versehen, die rechte Hand ist ihm von einem Tattoo-Künstler in Oxford tätowiert worden. Den Rücken hat ein Tätowierer aus Kerzers nach eigenen Ideen gestaltet – rund um ein Dreieckmuster entlang der Wirbelsäule, das ihm eine Berner Tattoo-Künstlerin schon vorher gestochen hatte. Bei der grössten Tätowierung handelt es sich um eine originale samoanische Pe’a, die er sich auf Samoa stechen liess. Sie reicht vom Bauch über die gesamte Beckenpartie und die Oberschenkel bis über die Knie hinaus. Auf den Unterschenkeln schliesslich prägen Motive aus Hawaii, ein Indianer- und ein Azteken-Muster sein Äusseres. Und obschon er bereits längst von Kopf bis Fuss gezeichnet ist, hat er noch freie Körperstellen. «Ja, es hat noch einiges Platz», sagt er, «zum Beispiel am Bauch, am Kinn oder am linken Bein.»
«Ich geniesse es, nun jemand zu sein.»
Nicht mehr anrüchig | Was motiviert aber viele junge Leute, sich tätowieren zu lassen? In einer Zeit, da Tattoos und Piercings kaum noch anrüchig, aufsehenerregend oder gar provokativ zu sein vermögen? Es ist für viele – wie für Ernst Rüegg – die Sehnsucht nach Verbindlichkeit. Der Wunsch, «ein bisschen anders zu sein», sich in der schnelllebigen Welt von heute eine persönliche Symbolwelt zu schaffen, die Bestand hat – für immer und ewig. Ein Ritual auch. Eine Mutprobe. Die das gute Gefühl vermittelt, dazuzugehören zur grösser werdenden Gemeinschaft der Tätowierten.
Der uralte Brauch des Tätowierens erlebt einen Boom. Der Berner Tätowierer Andreas «Ändu» Schwertfeger spricht von einem «erneuten Trend». Er führt dies vor allem darauf zurück, dass heute viele Stars und TV-Grössen mit Tattoos kokettierten – etwa Filmstars wie Angelina Jolie oder Brad Pitt, Musiker von Madonna bis Eros Ramazzotti oder Sportler wie David Beckham oder Anna Kournikowa. Selbst brav konfektionierte Akteure irgendwelcher gecasteter Boygroups seien heute tätowiert. «So sinkt die Hemmschwelle», sagt Schwertfeger, «Tattoos sind ‹in› und von der Gesellschaft akzeptiert. Viele Jüngere lassen sich auch von tätowierten Freundinnen und Freunden beeinflussen, wollen mit einem eigenen Tattoo auch dazugehören. Und Ältere werden oft zu veritablen Tattoo-Sammlern: Sie wollen immer mehr – bis sie kaum noch freie Körperstellen haben.» Jedes Tattoo sei «eine Investition fürs Leben». Und wer sich tätowiere, wolle sich «von der Masse abheben». Viele Mode-Tattoos seien heute allerdings «Massenware aus dem Internet», sagt Ändu. Und weil die Hemmschwelle gesunken sei, würden immer mehr «extremere, grössere und buntere Sujets» gestochen. Als Tätowierer habe er aber die Vorgaben seiner Kunden zu respektieren – und die Altersgrenze von 18 Jahren einzuhalten. Er selber ist auch tätowiert – mit einem klassischen Borneo-Muster am Hals deutlich über den Hemdkragen hinaus. Weitere Tattoos würden folgen, sagt er.
«Ich wollte meinen Körper mit etwas Gültigem zeichnen.»
«Immer wieder untendurch» | Ernst Rüegg fällt in der Öffentlichkeit auf. Vor allem sein tätowierter Kopf zieht die Blicke magisch an. Ihm ist das recht so. Er geniesst es, «nun plötzlich jemand zu sein», beachtet zu werden – nachdem er zuvor in seinem Leben kaum Beachtung gefunden habe. Als Einjähriger hatte er durch einen Unfall einen schweren Schock erlitten, den Sprachsinn verloren und sich deshalb, wie er sagt, «ein bisschen anders entwickelt als andere Kinder». Als Sechsjähriger habe er bei einem weiteren Unfall einen Schädelbruch erlitten und dabei «wie durch ein Wunder den Sprachsinn zurückgewonnen». Die beiden Unfälle hätten seine Kindheit geprägt. Statt in einer Kleinklasse gefördert zu werden, habe man ihn in die Hilfsschule gesteckt. Sein Vater habe als Beizer «eigentlich rund um die Uhr, sieben Tage pro Woche, gearbeitet», ein richtiges Familienleben habe er nicht gekannt – «ausser an Weihnachten, wenn die Beiz geschlossen war». Später seien seine Eltern weggezogen, ihn habe man in ein «Arbeitsheim für Gebrechliche» gesteckt – für eine zweijährige Schreineranlehre. Dann habe er in einer Wohngemeinschaft und in Untermiete bei einer älteren Frau gelebt – bis er längere Zeit durch Amerika gereist sei. So sei es dann weitergegangen: «Reisen, arbeiten, reisen, arbeiten, reisen, arbeiten.» Und so habe er ganz Europa kennengelernt – «per Velo und Autostopp, mit Übernachten unter Brücken und unter freiem Himmel».
Gegenwärtig ist Ernst Rüegg wieder zu Hause in Bern, arbeitet auf dem Bau. Und wenn man ihn per Handy anruft, muss er sich auf der Baustelle oft in irgendeine ruhigere Nische flüchten, um ein einigermassen verständliches Gespräch führen zu können. In seiner Wohnung in Gümligen taucht er dann aber wieder in seine andere Welt ein – in die leise Welt, nach der er sich sehnt und die er unauslöschlich in seinen Körper geprägt hat: die Welt der Naturvölker. Die Wohnung ist überstellt mit Steinen, Kristallen, Muscheln, Masken, Figuren und Figürchen – von afrikanischen Schnitzereien über Korallen aus der Südsee bis zu balinesischen Totenmasken, von indianischem Kopfschmuck bis zu niedlichen Holz-Babuschkas aus dem Osten oder zu tibetischen Gebetsfahnen. An den Wänden hängen stimmige Tattoo-Poster. In den Büchergestellen findet man, fein säuberlich eingereiht und geordnet, zum Beispiel «Völker, Farben, Rituale», «Geschmückte Haut», «The World of Tattoo», «Die letzten Paradiese der Menschheit» oder Bruno Mansers «Tagebücher aus dem Regenwald». Aus den Lautsprecherboxen dringen zarte, liebliche, unaufdringliche Ethno-Klänge, die Ernst Rüeggs Träume und Sehnsüchte irgendwie auch hörbar machen. Und erwartungsfroh erzählt er von seinen nächsten Reiseplänen: Es zieht ihn wieder nach Samoa, an die «Samoan Tattoo Convention». Auch von dort wird er wohl kaum ohne neues «Tribal Tattoo» heimkehren.
Grenzen sprengen | Mitten in Ernst Rüeggs Wohnzimmer, das zugleich Schlafzimmer ist, steht ein schöner, alter Globus. «Die Welt», wie er sagt. Für ihn sei Bern «Teil, aber nicht Mittelpunkt dieser Welt»: Wenn er in Bern unterwegs sei, bewege er sich schliesslich «auf dem gleichen Boden wie die Menschen in Malaysia – ich käme von Bern dorthin, ohne auf ein Schiff angewiesen zu sein. Die einzigen Grenzen, die es dazwischen gibt, sind künstliche, von Menschen gemachte Grenzen. Doch diese zählen nicht.» Auch andere Grenzen versucht Ernst Rüegg zu sprengen: Grenzen, an die er durch sein Aussehen hie und da stösst. «Ich respektiere und akzeptiere es, wenn jemand mit meinen Tattoos Mühe hat», sagt er, «aber ich möchte, dass man sich deswegen nicht gleich von mir als Mensch abwendet.» Im Innersten sei er noch immer der Gleiche, sagt er, obschon seine Tattoos nicht nur eine Äusserlichkeit seien: «Sie sind Ausdruck meiner Entwicklung. Sie gehören nun zu mir. Zu meiner Persönlichkeit.» Sind tief in seine Haut gestochen. (23. Mai 2009)
Ein Haus zum Leben und ein Haus zum Sterben
Es ist ein Haus zum Leben – das Geburtshaus Villa Oberburg. Es ist ein Haus zum Sterben – die Station für Palliative Therapie der Stiftung Diakonissenhaus Bern. Und es gibt vieles, das beiden Häusern ähnlich ist.
Es ist ein warmes, helles, heimeliges Haus, das Geburtshaus Oberburg: Eine schmucke Jugendstilvilla, das Herrschaftshaus der früheren Ziegelei, von gelborangen Farbtönen durchdrungen. Auf den ersten Blick wirkt es fast so wie eine alternative, aber gepflegte, saubere, wohlgeordnete und familiäre Wohngemeinschaft. Die Fenster sind mit leichten, durchlässigen Seidenvorhängen versehen, die das Sonnenlicht nur sanft zu brechen vermögen. Zentrum des Hauses ist die geräumige Stube im Erdgeschoss, mit grossem Esstisch und Blick in den schönen Garten. Es hat Bébékörbe, die an der Decke befestigt sind. Und Spielsachen. Und viel Platz für die älteren Geschwister, die ungeduldig ihre Brüderchen oder Schwesterchen erwarten – oder bereits mit den so winzig kleinen Neuankömmlingen leben dürfen oder leben müssen. Auf dem Tisch ist alles bereitgestellt für einen reichhaltigen, gesunden Brunch. Verschiedene Teesorten, Kaffee, Milch, Süssmost, Butter, Käse, Müesli, Joghurt, Fruchtsalat, Dörrfrüchte, Nüsse und gluschtige Brote.
Die Köchinnen legen Wert auf gesunde Vollwertkost. Heute ist es Nelly Meyer, die leidenschaftlich gern hier kocht. «Vegetarisch», sagt sie: «Und ich achte darauf, dass nichts auf den Tisch kommt, das zu Blähungen führen kann. Also kein Kohl, keine Peperoni, keine Spargeln. Und nach jeder Geburt koche ich meine nahrhafte Rote-Linsen-Suppe. Sie kommt immer gut an.»
Nino Elia oder Lena Lina | Die Stube ist geschmückt mit Kerzen, Edelsteinen und Rosen. Auf einem Gestell stehen Gläser mit erlesenen und vorwiegend heimischen Teekräutern. An einer Pinnwand erinnern Dutzende von Geburtskarten an grosse Momente – etwa an die Geburten von Andrin oder Maylin Ronja, von Lena Valérie oder Valentin Lukas, von Nino Elia oder Lena Lina. Auf dem Geburtskärtchen von Max haben die Eltern geschrieben: «Wer sagt, es gibt kein Wunder auf dieser Erde, hat noch nie die Geburt eines Kindes erlebt.» Und auf einer anderen Karte steht: «Wenn ein Stern vom Himmel fällt, erblickt ein Kind das Licht der Welt.»