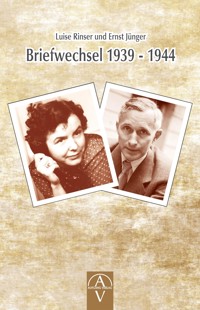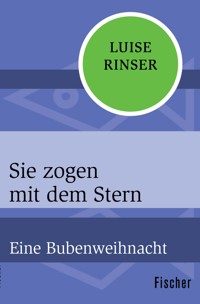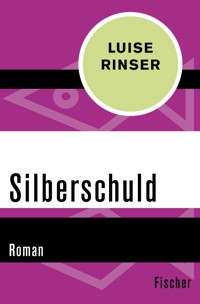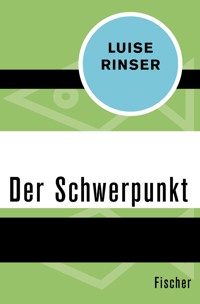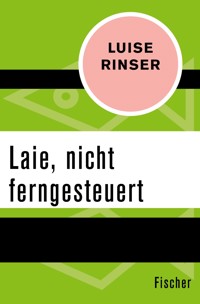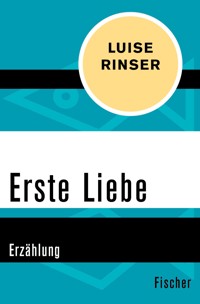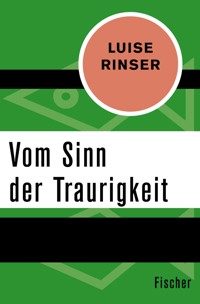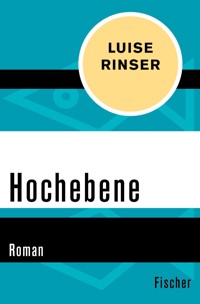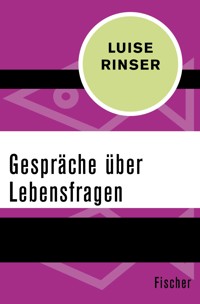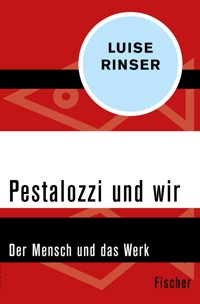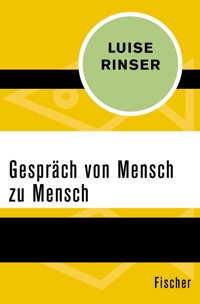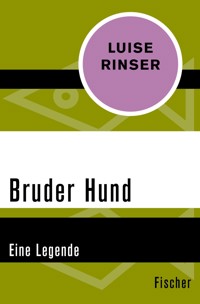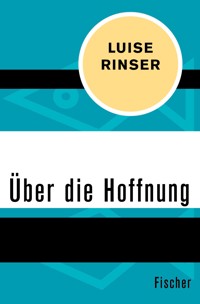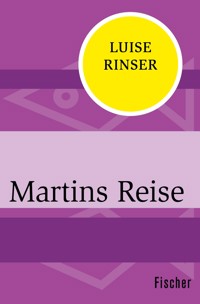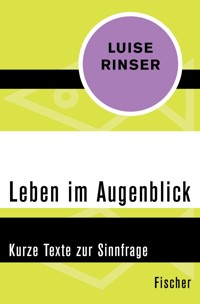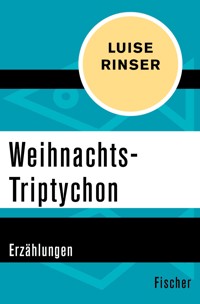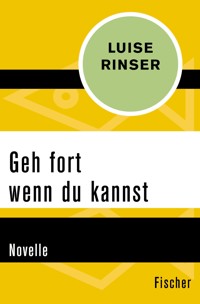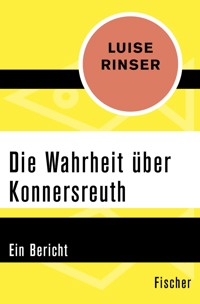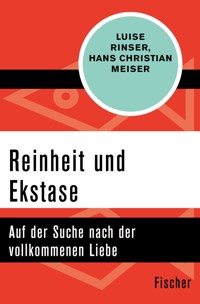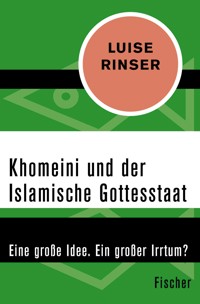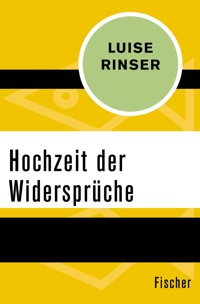
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Aus der Fülle von Briefen, die ich bekomme, wählte ich jene aus, die als signifikant gelten können für unsere Zeit und ihre besondere Problematik. Die am häufigsten und dringlichst gestellten Fragen sind: wie kann man mit Depressionen und Neurosen leben; gibt es "seelische Gesundheit" und besteht sie in der Anpassung an die Gesellschaft oder im Widerspruch zu ihr; ist Politik der Feind der Religion; muß man aus bestehenden Kirchen austreten, um wahrer Christ zu sein; gibt es eine geistige Entwicklung der Menschheit und lohnt es überhaupt, zu leben; ist Selbstmord erlaubt; was ist der Tod und was kommt danach; ist Gott eine "Realität"; wie kann man es ertragen, in Widersprüchen politischer und geistiger Systeme zu leben? Der Titel deutet meinen Versuch an, zu zeigen, daß man aus der Welt der Widersprüchlichkeiten weder in die Resignation noch in die Neurose flüchten muß, sondern daß man die Widersprüche "vermählen" kann auf einer je höheren Bewußtseinsebene.« (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Luise Rinser
Hochzeit der Widersprüche
Über dieses Buch
»Der Titel deutet meinen Versuch an, zu zeigen, daß man aus der Welt der Widersprüchlichkeiten weder in die Resignation noch in die Neurose flüchten muß, sondern daß man die Widersprüche „vermählen“ kann auf einer je höheren Bewußtseinsebene.«
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Erschienen bei FISCHER Digital
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Copyright © by Christoph Rinser
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Montasser Medienagentur, München
Covergestaltung: buxdesign, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-561213-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Vorbemerkung
„Wenn aber niemand sonst [...]
Zwei Briefe über die Grundlage und die Methode meines Nachdenkens
Über Widersprüchliches, Absolutes und Relatives
I Geist und Verzweiflung
An eine ältere Frau, die vom Leben nichts mehr erwartet
An einen Schwerkranken über den Sinn eines großen Leids
An eine Sechzigjährige, die keine Hoffnung mehr hat
An eine Verzweifelte über den Sinn des Lebens
An einen Verzweifelnden, der mich danach fragt, ob ich Verzweiflung kenne
An eine Frau, die von Ängsten gequält wird
II Geist und Religion
An eine Zwanzigjährige
An einen jungen Mann
An einen Soziologie-Studenten
An einen jungen Mann über „Askese“
An einen jungen Naturwissenschaftler über die Wahrheitsfrage
An einen jungen Mann, der sich schämt, für katholisch zu gelten
An einen Studenten über das Verhältnis von Vorbestimmung und Freiheit
III Geist und Krankheit
An eine Frau, die Angst hat, schizophren zu sein
An einen Psychiater
An eine Frau, die es aufgegeben hat, sich geistig weiterzuentwickeln
An eine Einundzwanzigjährige, die an Selbstmord denkt
IV Geist und Liebe
An eine Egoistin, die nicht weiß, daß sie egoistisch ist
An einen Mann, der seinem Bruder nicht verzeihen kann
An eine Bekannte über die „Nächstenliebe“
An eine Frau über die „Annahme seiner selbst“
An eine Frau, die auf nichts verzichten will
V Geist und Ehe
An einen Mann, der seine Probleme auf seine Frau projiziert
An eine Frau, die sich von ihrem Mann scheiden lassen will
An eine Frau, die aus ihrer Ehe ausbrechen will
VI Geist und Kirche
An einen Verteufler der Kirche
An eine Konvertitin, welche an der Krise der katholischen Kirche leidet
An eine Frau, deren Mann wieder zur Kirche zurückkehrte
VII Geist und Politik
An einen Minister, der ein Jugendfestival verbieten wollte
An einen Mann, der zu wissen glaubt, was eine „gesunde Gesellschaft“ ist
An eine Sechzehnjährige, deren Eltern keinen Arbeiter als Schwiegersohn wollen
An eine reiche Frau, die das uneheliche Kind ihrer Tochter abtreiben ließ
An eine Dame der Gesellschaft
An einen älteren katholischen Geistlichen über schizophrenes klerikales Denken
Ist Politik Männersache?
An eine Frau, welche glaubt, Geist und Politik seien Feinde
An den Vater eines „Hippy“
VIII Zu besonderen Problemen
An einen Zwanzigjährigen, der sich mit sexueller Selbstbefriedigung abquält
Drei Briefe an einen Achtzehnjährigen über die Frage, ob es im Bereich des Geistigen Gewißheiten gibt
An eine Frau, die an ihrem Mangel an Bildung leidet
An eine Sechzehnjährige
IX Geist und Tod
An eine Frau, die untröstlich ist über den Tod ihres Mannes
An eine Freundin über Sterben und Auferstehen
An eine Krankenschwester über Gespräche mit Sterbenden
An eine Frau, die meint, die Stimme ihrer verstorbenen Mutter zu hören
Vorbemerkung
Ich habe das Glück und die Mühsal, seit Jahren Tag für Tag eine Anzahl von Leserbriefen zu erhalten. Ich nenne es Glück, weil ich auf diese Weise authentisch erfahre, wie der Mensch unserer Zeit lebt, was ihn ängstet, was ihn leiden macht, was er hofft. Ich nenne es Mühsal, weil es schwierig ist, diese Problembriefe so zu behandeln, daß damit etwas zur Klärung der Lage der Anfragenden beigetragen wird.
Die Leser und Briefschreiber gehören allen möglichen Altersstufen an. Die Spanne reicht von zwölfjährigen Schülerinnen bis zu ganz alten Menschen. Beruflich-gesellschaftlich gehören sie den verschiedensten Kreisen an: es sind Fabrikarbeiterinnen und Verkäuferinnen, Studenten aller Disziplinen, Lehrer, Ordensleute, Priester, Theologen verschiedener Kirchen und Religionen, Hausfrauen, Krankenpflegerinnen, Heimleiterinnen und ihre Zöglinge (schwererziehbare Mädchen), Strafgefangene, in Nervenheilanstalten Internierte. Männer und Frauen.
Natürlich hat jedes von ihnen seine eigenen besonderen Probleme, mit denen ich mich so beschäftigen muß, als wäre es wirklich nur ihr Problem und keines andern. Aber ich meine nach langer Erfahrung doch sagen zu dürfen, daß man die verschiedenen Probleme bündeln kann, so daß sich Haupt- oder Grundthemen zeigen. Diese Hauptfragen richten sich auf das Verhältnis des Menschen zum Besitz, zur Krankheit, zur Institution Ehe, zu Hoffnung und Verzweiflung, zu politischen und religiösen Ideologien und Gruppen (Kirchen und Parteien), zu den verschiedenen Religionen, zum Tod und zum Fortleben nach dem Sterben.
All diesen Fragen zugrunde liegt, ausdrücklich oder unausgesprochen, die Wahrheitsfrage; gibt es DIE Wahrheit, gibt es überhaupt objektive Wahrheiten wo auch immer, gibt es wirklich nur subjektive Meinungen und »Projektionen«, ist wirklich alles »nur relativ«. Die Menschen unserer Zeit leiden daran, daß es keine geschlossenen Denk- und Glaubenssysteme mehr gibt. Das Überangebot an Informationen und Meinungen erweckt eine tiefe Unsicherheit, die leicht zur existentiellen Angst wird und zu Neurosen und Psychosen führt. Daher die wachsende Zahl der Patienten (sogar in Arbeiterkreisen), welche einen Psychotherapeuten braucht. Der Philosoph Kierkegaard schrieb schon im vorigen Jahrhundert vorausschauend, es sei ein Zeichen geistiger Gesundheit, in Widersprüchen leben zu können. Ich möchte den Satz erweitern: wir können dann in Widersprüchen leben ohne wahnsinnig zu werden, wenn wir erkennen, daß es gar keine Widersprüche gibt insofern, als Widersprüche nur Schein-Gegensätze sind, entstehend aus dem Irrtum, Teilansichten von einer Sache als DIE Wahrheit über diese Sache zu nehmen. Es ist die tiefste Erkenntnis, die einem Menschen zuteil werden kann, zu begreifen, daß alle Widersprüche auf einer höheren Ebene sich »vermählen« – ein Ausdruck aus der Psychologie C.G. Jung’s, der ihn wiederum anderswoher hat, nämlich aus der Alchemie. Ich habe mir erlaubt, dieses Wort abzuwandeln und nicht von der Vermählung der Widersprüche zu reden, da Vermählung etwas Vollzogenes ausdrückt, während ich von etwas erst zu Vollziehendem rede, also von der »Hochzeit«, dem Beginn der Ehe. Der Titel des Buches ist ein Arbeitsprogramm, das der Mensch heute und morgen leisten MUSS, will er geistig weiterleben.
„Wenn aber niemand sonst da ist? Wenn Sie sonst nirgendwohin gehen können? Es müßte doch so sein, daß jeder Mensch wenigstens irgendwohin gehen könnte. Denn es kommen Zeiten vor, wo man unbedingt irgendwohin gehen muß.“
F.Dostojewskij „Raskolnikow“
Zwei Briefe über die Grundlage und die Methode meines Nachdenkens
Über Widersprüchliches, Absolutes und Relatives
Sie machen mir in Ihrem Brief den Vorwurf der Zwiespältigkeit, des Wankelmuts, der Widersprüchlichkeit, und Sie meinen daraus ableiten zu müssen, daß ich nicht glaubwürdig sei. Und warum das? Weil ich Ihnen auf Ihre Frage eine andere Antwort gab, als ich sie Ihrer Freundin gab, vor drei Jahren. Ich habe Ihrer Freundin geraten, zum Katholizismus zu konvertieren, während ich Ihnen auf die gleiche Frage mit einem glatten Nein antwortete. Auf Ihre Sache selbst gehe ich jetzt nicht noch einmal ein, ich will nur den Kernsatz wiederholen: Ihr Plan, in die katholische Kirche einzutreten, ist nicht bis zum Ende durchdacht und Sie sind Ihrem Wesen nach den fließenden Ideen östlicher Religionen weit näher als der systematischen katholischen Glaubenslehre. Ihre Freundin aber braucht ihrem Wesen nach feste Strukturen, klare Dogmen und bestimmte Riten und sie sah den östlichen Weg überhaupt nicht als einen für sie möglichen.
Aber darum geht es jetzt gar nicht. Es geht um das Problem der „Widersprüchlichkeit“ an sich. Ich will die Frage, ob es so etwas überhaupt gibt, noch verschieben und zuerst untersuchen, ob ich mir dann widerspreche, wenn ich zwei verschiedene Antworten auf die je gleiche Frage gebe. Eigentlich wundere ich mich, daß Sie nicht selbst sehen, worin Ihr Denkfehler liegt. Wenn zwei verschiedene Menschen die gleiche Frage stellen, ist es dann wirklich die gleiche, selbst wenn der Fragesatz aus den nämlichen Wörtern besteht?
Eine Frage (vor allem eine, welche die Existenz eines Menschen angeht) ist doch nie etwas Isoliertes, sondern steht innerhalb eines Systems von Gegebenheiten äußerer und innerer Art. Da es nicht zwei Systeme gibt, die sich völlig gleichen, können auch zwei Fragen, die zu je einem System gehören, nicht gleich sein, das heißt: nicht das gleiche meinen. Ihre Freundin ist so ein Person-System und Sie sind eines, und beide sind verschieden, auch wenn Sie und Ihre Freundin viele gleiche Lebensdaten haben: Alter, Geschlecht, Sprache, Gesellschaftsklasse, Studium, Beruf, geistiges Interesse, besonders religiöses. Aber Ihrer beider Charaktere sind verschieden und somit bekommt alles Gleiche einen verschiedenen Wert. Das ist wie in einer mathematischen Gleichung: das Gefragte ist X; es soll errechnet werden aus a + b + c. Gut: aber beim lebendigen Menschen sind a, b, c keine konstanten, sondern variable Größen und die Variabilität ergibt sich aus ihrem Verhältnis untereinander und zu ihrer „Um-Zeit“ (in Analogie zur „Um-Welt“; der neue Ausdruck mag gelten). Selbst wenn sie an sich konstante Größen sind (Geschlecht, Beruf, Nationalität usw.), so verändert der Faktor Zeit ihren Wert. Die Zeit wird immer wichtiger als Faktor bei Aussagen jedweder Art, besonders deshalb, weil die Zeit „immer rascher abläuft“. Wenn ich den (isolierten) Satz lese „Die Materie besteht aus Atomen“, so denke ich: „Na schön, das wissen wir nachgerade und wir wissen ja viel mehr, wir wissen, daß ein Atom aus dem Kern und den sich darum bewegenden Neutronen besteht usw.“ Wenn ich aber weiß, daß jener Satz einige Jahrhunderte vor Christi Geburt zum ersten Mal ausgesprochen wurde von einem vorsokratischen Philosophen, dann denke ich: „Großartig, genial, umstürzend.“ Wenn man heute ein physikalisches oder biologisches Buch kaufen will und nicht aus literarischem, sondern aus naturwissenschaftlichem Interesse, so muß man auf das Datum des Erscheinens achten; es kann sein, daß das Buch, vor zehn oder fünf Jahren geschrieben, bereits veraltet ist, weil inzwischen die Forschung beschleunigt weitergegangen ist. Beinahe kann man das auch von theologischen Büchern sagen. „Kirche“, zum Beispiel (und um auf die strittige Frage der Konversion nochmals rasch einzugehen) wird heute nicht nur anders erlebt, sondern (deshalb) auch anders definiert als vor zwanzig Jahren; selbst die einzelnen Dogmen, die uns früher doch so für alle Ewigkeit zementiert erschienen, werden heute anders interpretiert als vor zwanzig Jahren. Zeit ist wirklich ein alle Aussagen bestimmender Faktor. Zeit ist nämlich Lern-Zeit. Zeit ist Entwicklung, Wandlung, Umbruch. Es gibt die Quantensprünge auch in dem, was „Zeit“ heißt.
Ihre Frage vom Frühjahr 1972 ist durch den Faktor Zeit so beeinflußt, daß sie der Frage Ihrer Freundin von 1969 schon nicht mehr wirklich gleicht. Wenn Sie mir vorwerfen, daß ich heute eine andere Antwort gebe als vor drei Jahren, so unterstellen Sie, daß ich immer die gleiche Antwort geben müßte. Das hieße aber, daß ich „Zeit“ gar nicht erlebte! Es gibt eine Anekdote dazu: ein Schüler fragte seinen Professor etwas und dieser antwortete, worauf der Schüler bestürzt ausrief, der Professor habe aber voriges Jahr seinem älteren Bruder auf die gleiche Frage etwas anderes geantwortet, worauf der Professor sagte: „Was geht mich denn mein saudummes Geschwätz vom vorigen Jahr an!“ Das ist, überspitzt gesagt, das, was ich meine.
Selbst wenn also Ihre Frage und die Ihrer Freundin tatsächlich vollkommen deckungsgleich waren, so habe ich nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, jene Antwort zu geben, die mir heute als die richtige erscheint und nicht jene, die ich gebe, weil ich vor drei Jahren die gleiche gab und weil ich immer der gleichen Meinung bleiben müßte. Ich bin nicht nur von Ihnen, sondern auch in der Presse sehr heftig angegriffen worden, weil ich meine Meinung und Haltung in bestimmten Fragen im Lauf der letzten zehn Jahre geändert habe. Ich fände es alarmierend, wenn ich immer die selbe Meinung hätte. Wo bliebe dann meine Entwicklung? Mein Leben ist ein ununterbrochener Lernprozeß. Ich stelle meine eigenen Ansichten immer aufs Neue in Frage, ich stelle mich selbst immer wieder in Frage. Ich bin kein Monument, das Veränderung nur kennt als Verwitterung; ich bin ein lebendiger Organismus!
Wenn Sie (wie viele andere Leser) von mir „sichere Antworten“ erwarten, ja fordern, dann unterstellen Sie, daß ich so ein Monument sei, das, einmal geformt, immer so bleibt. Aber ich bin immer „nach vorne offen“, ich bin ganz un-träge, ich bin ungemein neugierig, ich beharre auf keiner Ansicht, mein Leben besteht im Fragen und jede gefundene Antwort ist mir wieder neuer Anlaß zu einer neuen Frage. Und wenn ich Ihnen oder anderen Menschen eine Antwort gebe, so erwarte ich nie, daß man diese Antwort für eine „absolute“ nimmt; es soll überhaupt keine „Antwort“ sein, etwa so, wie wenn ich einen Deckel auf einen vorher offenen Topf legte, sondern so, wie wenn ich jemand einen Schlüssel gäbe, der vielleicht eine Tür öffnet, von der ich weiß, daß sie in ein Zimmer führt, das nur ein Durchgang ist und wieder eine Tür hat und so fort.
Warum beharren Sie denn darauf, daß es Sicherheiten und Dauerndes geben müsse? In der Natur finden Sie nirgendwo Dauer, sondern ununterbrochene Veränderung. In der heutigen Physik kann man auch nur „Wahrscheinlichkeiten“ als Antworten auf Fragen erhalten. Und dabei ist alles Physische grundsätzlich „faßbar“ (zählbar, meßbar). Im geistigen Bereich, dort, wo es ins eigentlich Metaphysische geht, ist alles noch weit komplizierter und fließender.
Aber ich verstehe Ihren Vorwurf dennoch; eigentlich gilt er nicht mir, sondern unserer Zeit, in der alles „relativiert“ wird. Alles kann so oder auch anders gedeutet und gewertet werden. Einer sagt so, der andere sagt anders und heute sagt einer so, morgen sagt er das Gegenteil, alles schwimmt einem weg, man fühlt sich verraten und verloren.
Aber warum eigentlich? Was Sie wollen, ist Wahrheit. Sie meinen, es gehöre zum Wesen der Wahrheit, daß sie immer und unter allen Umständen gleich wahr und auf die gleiche Weise wahr sei. Aber schauen Sie sich einmal physikalische Wahrheiten an: immer wieder einmal scheint es so, als hätte man ein optimal zutreffendes („wahres“) Weltbild gefunden; aber kaum scheint es so, wird es schon wieder in Frage gestellt und zwar gerade auf Grund des soeben noch gültigen Weltbildes, in dem jemand eine Lücke entdeckt, die mit der vorhandenen Methode nicht ausgefüllt werden kann, so daß man gezwungen wird, eine neue zu suchen und im Suchen danach verwandelt sich das Weltbild als Ganzes. Die Geschichte der Atomphysik ist das klassische Beispiel dafür. Jeder gescheite Physiker weiß, daß das, was augenblicklich für richtig gilt, eben für den Augenblick richtig ist, aber zugleich nur Stufe zu neuer Richtigkeit. Keiner aber wird deshalb seine Arbeit als eine Sisyphus-Arbeit erleiden; jeder weiß, daß es aufs Suchen ankommt, nicht aufs Ein-für-alle-mal-gefunden-Haben. Ein Physiker (vielleicht Heisenberg, ich weiß es nicht mehr sicher) sagte einmal: Unser Naturbild ist nicht ein Bild der Natur, sondern ein Bild unserer Kenntnisse von der Natur. Ich denke mir dazu: was an den Wissenschaften interessant ist, das ist unser Verhalten zu dem, was wir erforschen, und die Geschichte aller Wissenschaften zusammen ergibt die Geschichte des Menschen in seinem Verhältnis zur „Welt“, anders gesagt: die Geschichte seines Fragens im Wechsel der Fragestellungen. Wir kommen nie an, aber wir wollen das Ankommen gar nicht wirklich, wir wollen das Unterwegs-Sein. Einmal sagte mir jemand, er wolle die himmlische „ewige Seligkeit“ nicht, da sie statisch sei; er könne nur selig sein in der Bewegung. Ich glaube, die Seligkeit wird gerade darin beruhen, daß sie Bewegung UND Ruhe ist. Aber auch diese Ansicht ist nur eine Hypothese und kein Dogma.
Sie haben meinen Brief sehr genau gelesen und darum gefunden, was mir entgangen war: daß ich am Anfang schrieb, ich wisse nicht, ob es „Widersprüchlichkeit“ überhaupt gebe, und dann nicht mehr darauf einging. Dabei fällt mir ein, daß ich Sie in jenem Brief provozierend fragen wollte, was Sie denn dazu sagen, wenn ich auch noch freiwillig bekenne, nicht nur meine Ansichten öfters zu ändern, sondern sogar gleichzeitig zwei oder mehr Ansichten in ein und derselben Sache zu haben. Das ist schlimm, nicht wahr, daß ich so eine heillose „Relativistin“ bin. So nennen Sie mich und meinen es als Vorwurf und Abwertung. Aber überlegen Sie doch bitte, ob jemand, der steif und fest etwas als „absolut wahr“ behauptet, der Wahrheit näher kommt, als ein anderer, der sagt: „Von mir und von hier aus und jetzt gesehen scheint die Sache so oder so zu sein; aber von Ihnen aus und von dem aus gesehen, was für Sie das ‚Jetzt und Hier‘ ist, scheint die Sache anders zu sein“?
Ein simples Beispiel: ich sehe, daß eine Katze einen Vogel fängt und frißt; ich liebe Vögel, aber auch Katzen; ich liebe als die, die ich bin, nicht, wenn eine Katze einen Vogel frißt, obwohl ich, da ich die Katze liebe, mich freuen müßte darüber, daß sie auf eine Art, die ihr Lust bereitet (die Jagd) eine Nahrung findet, die sie mag und braucht. Da ich aber auch die Vögel liebe, muß ich die Handlung der Katze verurteilen und verhindern; hierbei denke ich „vom Vogel aus“, während ich vorher „von der Katze aus“ dachte. Ich kann aber auch nur vom Menschen aus denken: da ich den Gesang der Vögel liebe, mag ich nicht, wenn die Katze Singvögel frißt und ich kann ihr zubilligen, daß sie Spatzen frißt; oder ich kann etwa als Bauer oder Gärtner finden, daß insektenfressende Vögel wichtig sind zur Erhaltung des Gleichgewichtes in der Natur, weil ohne Vögel die Insekten überhandnehmen, während ich der Katze das Fressen vom nicht-insekten-vertilgenden Vogel zugestände. Ich kann das Mißliebige im Tun der Katze darin sehen, daß sie eine Tiergattung dezimiert, die ohnehin zahlenmäßig klein und ausrottbar ist. Ich kann aber wiederum der Katze recht geben, wenn ich bedenke, daß sie einfach das Gesetz befolgt, das ihr die Natur gab und kann es daher für richtiger finden, daß sie Vögel frißt als daß ich (der Mensch) Kälber schlachte und esse und auch gar nichts Böses dabei finde, wenn die Katze nicht Vogelfleisch, sondern das Fleisch des vom Menschen getöteten Kalbes, das ihr dieser Mensch vorsetzt, frißt. Ich kann weiter darüber reflektieren, ob ich mit meinem Entsetzen vor der kätzischen Vogelfresserei nicht unbewußt das Blut-Tabu meine, das verbietet, daß man frisches Blut esse, da im Blut „die Seele“ eines Lebewesens sei. Kurzum: wenn ich sage oder fühle „die Katze, die einen Vogel frißt, ist ein böses Raubtier“, so ist das zwar ein klarer einfacher Satz, aber er ist von der „Wahrheit“ der Sache viel weiter entfernt, als wenn ich die vorstehenden Erwägungen anstelle und dadurch die Sache „relativiere“. Je mehr „Relationen“ (Beziehungen) einer Sache ich in Betracht ziehe, desto näher komme ich der Sache selbst.
Wenn ich einen Mann als Beamten am Bankschalter kenne, so kenne ich ihn eindeutig als Bankbeamten, der als solcher bestimmte Eigenschaften hat: Raschheit, Freundlichkeit, Geduld usw. Aber kenne ich ihn deshalb? Wenn seine Frau sagt, er sei gar nicht geduldig und freundlich, daheim nämlich, also in einem anderen Bezugssystem, so lernen wir den Mann schon besser kennen. Wenn wir seine Kinder, seine Mutter, seinen Arzt oder gar, so er einen braucht und hat, seinen Psychotherapeuten befragen, so wird sein Bild immer anders aussehen, nämlich relativ zum Beobachter, und je „relativer“ wir den Mann sehen, um so näher kommen wir der Wahrheit, nämlich der Wahrheit der Komplexität, der Vielschichtigkeit, der Widersprüchlichkeit dieses Mannes. Natürlich ist es viel bequemer, ihn nur als netten Bankbeamten zu sehen und den simplen klaren Satz sagen zu können: Er ist ein netter Mensch. Nur eben: Der Satz stimmt so nicht! Ich mache die Beobachtung, daß bei vielen Leuten das Wort „relativ“ so viel heißt wie beliebig, willkürlich, fragwürdig, zufällig, vage, der Sache nicht recht entsprechend, nur halb wahr (und weniger als das). Laien pflegen auch zu meinen, daß jener Mann (Einstein), der die „Relativitätstheorie“ aufstellte, schuld sei daran, daß alles bloß mehr für relativ wahr gelten könne; sie halten ihn sozusagen für den Begründer des Skeptizismus und Nihilismus. Aber er war und ist vielmehr das andere: der Mann, der eine Sache so genau wie nur möglich erkennen wollte, indem er nicht gestattete, daß man „Momente“ außer Acht ließ, die zur Wahrheitsfindung gehören, z.B. den Beobachter einer Sache und eines Vorgangs selbst. Einstein gab dazu selber das Beispiel an (ich sage es kurz und einfach – und es ist ja auch einfach wie alle gewaltigen Erkenntnisse – und daß ich so auf diesem Gedankengang beharre, hat seinen Grund darin, daß ich Sie zu einer neuen Denkmethode führen möchte, die mir für alle Erkenntnisse und auch für die Ethik wichtig erscheint).
Also: Sie stehen neben dem Bahngeleise genau in der Mitte zwischen zwei Licht-Signalanlagen (A und B) und Sie haben zwei Spiegel in der Hand, die Sie rechtwinkelig zueinander halten, so daß sich im linken Spiegel das Signal von rechts (B) spiegeln kann und im rechten das von links (A).
Die beiden Lichtsignale A und B blitzen auf und spiegeln sich in Ihrem Spiegel. Sie sehen sie in Ihrem Spiegel als „gleichzeitig“ und werden dann, danach befragt, behaupten, die beiden Signale A und B seien tatsächlich gleichzeitig aufgeblitzt.
Nun stehen Sie nicht mehr auf dem Bahndamm, sondern sitzen im Zug, der fährt und zwar von A nach B. Die Signale blitzen auf. Nun fragt Sie jemand, ob die Signale gleichzeitig aufgeblitzt sind. Sie werden sagen: nein, nacheinander. Denn: Sie werden jenes Signal früher sehen, dem Sie näher sind, also – je nach der Zugrichtung – das Licht-Signal A früher als das von B.
Sie können nun erwidern, daß es doch eine „objektive“ Feststellung gebe müsse, ob die Signale gleichzeitig stattfanden oder nicht und danach könne man beurteilen, welche Aussage richtig („wahr“) ist und welche nicht. Aber eben das kann man nicht. Denn das Beobachtete hängt immer vom Beobachter ab und ist „wahr“ innerhalb des Bezugssystems des jeweiligen Beobachters. Das bedeutet nicht, daß „nichts wahr ist“, sondern, daß etwas wahr ist in bezug auf etwas. Es GIBT also „Wahrheiten“. Das Suchen nach solchen „relativen“ Wahrheiten ist zugleich höchst anspruchsvoll und höchst bescheiden. Man bescheidet sich auf eine „relative“ Wahrheit, aber man fordert von dieser relativen Wahrheit, daß sie tatsächlich wahr sei.
Wir können diese Methode des Erkennens auf’s Menschliche und Religiöse anwenden. Zum Beispiel auf „Gott“ oder vielmehr auf die Gottes-Vorstellung. Ein Mensch, der als Kind unterdrückt war und zugleich gesagt bekam, Gott sehe alles und strafe und belohne, der wird sich einen autoritären Gott vorstellen und ihn ablehnen. Ein Mensch, der geliebt wurde und sich darum in der Welt geborgen fühlt, wird es leicht haben, sich Gott als einen Liebenden vorzustellen und ihn wiederzulieben. Ein Mensch, der als Mathematiker gewöhnt ist abstrakt zu denken, wird sich gar keine Vorstellung von Gott machen und ihn gerade so, als abstrakte Größe, akzeptieren. Und so fort. Ist eine dieser Vorstellungen wahr? Nein, in Bezug auf das, was Gott selbst ist, nämlich: der absolut Unerkennbare; ja, in Bezug auf das Verhalten des jeweiligen Menschen zu diesem Unerkennbaren. Mit alldem habe ich Ihre Frage nach der „Widersprüchlichkeit“ beantwortet: Widersprüche sind etwas Scheinbares; Aussagen widersprechen sich nur dann, wenn man sie für absolut hält statt für relativ. Wenn wir diese Denkmethode auf unser Verhalten zu den Mitmenschen und ihren Meinungen anwenden würden, wären wir nicht nur toleranter zueinander, sondern wir kämen der Wahrheit viel näher, und letzten Endes träfe sich das liebevollere Verhalten mit der hohen Erkenntnis dessen, daß Wahrheit Liebe ist und Liebe DIE Wahrheit.
I Geist und Verzweiflung
An eine ältere Frau, die vom Leben nichts mehr erwartet
Als Sie neulich von mir wegfuhren, sagten Sie schon im Auto: „Sie nehmen meine Todesgedanken nicht ernst.“ Ich konnte darauf nichts mehr erwidern, denn Sie fuhren ab. Sie ließen mich also zurück mit diesem Satz. Ich habe mich streng gefragt, ob ich Ihren Selbstmordwunsch ernst nehme oder nicht. Ich nehme auf jeden Fall Sie ernst; ich nehme auch die Schwere Ihres Lebens ernst. Wie ist das nun aber mit dem Selbstmord. Sie sagten während des vorausgegangenen Gespräches mehrmals: „Wozu soll ich weiterleben; ich habe vom Leben nichts mehr zu erwarten.“ Wieso aber eigentlich? Die Verluste, die Sie in den letzten zehn Jahren erlitten, sind doch nicht die Garantie dafür, daß es so weitergehen wird! Das ist doch kein Gesetz! Ich würde eher meinen, daß, wenn schon ein Gesetz, dann das der Serie gilt, so daß nach so vielen Schicksalsschlägen jetzt eine Wende eintreten muß, mit großer Wahrscheinlichkeit.
Aber nehmen wir einmal an, die Serie sei noch nicht zuende und Sie haben weiteres Schlimme zu erwarten. Nun: Sie haben so harte Schläge tapfer hingenommen, daß ich mir nicht denken kann, Sie würden beim nächsten Schlag zusammenbrechen. Freilich, auch das ist wahr, daß der Eimer schließlich durch einen einzigen Tropfen zum Überlaufen gebracht wird. Einmal mag man, kann man nicht mehr. Das bedenke ich wohl. Ich bedenke ebenso, daß Sie mir Ihren Satz vom Selbstmord nicht als Drohung, als Erpressung hinterließen; auch das habe ich schon einige Male erlebt. („Wenn Sie mir nicht helfen, bringe ich mich um.“ Die geforderte Hilfe lag dabei gar nicht in meiner Macht und der Selbstmord wurde dann, als das eingesehen wurde, auch nicht ausgeführt.) Bei Ihnen war es mehr ein Seufzer, der besagte: „Ich kann ja nicht mehr. Mir bleibt nur der Tod.“ Wenn Sie wüßten, wie gut ich Sie darin verstehe. Glauben Sie, daß ich krisenlos, gefahrlos und ohne Todeswünsche durchs Leben kam? Sie kennen doch meine Biographie. Sie wissen, wie es mir, vor allem, zwischen 1940 und 1945 erging. Mehr „am Ende“ konnte kein Mensch sein, als ich es war: Berufsverbot, Angst vor Hitler und der Staatspolizei, Bomben, Verlust eines Teils der Habe, Tod des jungen Ehemannes in einer Strafkompanie an der russischen Front, zwei ganz kleine Kinder zu ernähren in den Hungerjahren, kein Geld und überhaupt keinen Besitz, Verhaftung, Gefängnis, Todesurteil (das Kriegsende kam der Ausführung gerade noch – um Tage – zuvor). Ich hatte alles so satt, so satt, alles war so aussichtslos. Mehr als einmal dachte ich daran, mich und die Kinder umzubringen. Auch später kam ich noch einmal in eine Lage, in der mir der Tod als einziger Ausweg erschien. Obgleich natürlich mein Verhalten, mein Durchhalten, keine Garantie dafür ist, daß jeder Mensch durchhalten kann (es gibt Fälle, in denen, subjektiv gesehen, nichts bleibt als der Tod aus eigener Hand) – so meine ich doch, daß Sie nicht schwächer sind als ich.
Vielleicht ist Ihre Frage falsch, Ihre Frage ans Leben nämlich. Sie fragen: „Was gibt mir denn das Leben noch?“ Sollten Sie nicht besser fragen: „Was habe ich dem Leben noch zu geben?“ Voriges Jahr hat meine Mutter, 88 Jahre alt und halb erblindet, sich plötzlich entschlossen, ihr Haus zu verkaufen und in ein Altenheim zu gehen. Zu mir wollte sie nicht kommen, in ein anderes Land. „Alte Bäume vertragen das Verpflanzen nicht“, sagte sie. Als ich sie zum ersten Mal im Altenheim besuchte, waren wir beide traurig. Sie sagte: „Jetzt habe ich nichts mehr zu erwarten als den Tod.“ Wir waren beide nahe daran, den Vertrag mit dem Heim wieder aufzulösen. Aber sie blieb dann doch. Schon zwei Monate später fand ich sie so lebhaft und heiter, wie ich sie seit langem nicht mehr erlebt hatte: Sie hatte eine Aufgabe gefunden, ganz unerwartet, es hatte sich so ergeben, sie nahm sich der anderen alten Leute an, die zum Teil an Jahren jünger waren als sie, aber viel weniger vital, viel weniger intelligent auch. Sie tröstete die anderen, unterhielt sie, machte sie lachen, beschimpfte sie, wenn sie sich gehen ließen, brachte einigen das Religiöse wieder nahe, kurzum: sie hatte viel zu tun, Sinnvolles, Nötiges, sie wurde gebraucht – und das in einem Augenblick ihres Lebens, in dem sie meinte, zu nichts mehr nütze zu sein und vom Leben nichts mehr erwarten zu dürfen. Sie hatte nur mehr neun Monate zu leben. In dieser kurzen Zeit erfüllte sich die letzte Phase ihres Lebens. Als sie plötzlich erkrankte und bald darauf starb, hinterließ sie neue Freunde und große Trauer im Heim.
So eine überraschende Erfüllung glaube ich, kann es auch bei Ihnen geben, umso wahrscheinlicher, als Sie ja viel jünger sind als meine Mutter war. Irgend etwas liegt vor Ihnen, irgend jemand braucht Sie, irgendeine Aufgabe ist für Sie aufgespart. Wenn Sie nun meinen, das, was Ihnen das Leben noch zu bieten hat, müsse Angenehmes sein, so ist es möglich, daß Sie enttäuscht werden. Es kann gut sein, daß es etwas Schwieriges ist, eine Anstrengung, sogar ein Schmerz. Was es auch ist: es wird LEBEN sein. Jeder Schmerz ist besser als tödliche Langeweile. Ich denke bisweilen jetzt, auf den schon abgelebten Teil meines Lebens zurückschauend, daß ich am intensivsten gelebt habe, wenn ich von einem großen Schmerz heimgesucht war.
Aber wir wollen tapfer allen Mißlichkeiten ins Auge schauen: wie, wenn wirklich „nichts mehr käme“, wenn Ihr weiteres Leben nur ein Wandern in der Wüste wäre? Frage: Hat der Mensch nur eine Zukunft? Hat er nicht auch eine Vergangenheit und ist diese Vergangenheit vergangen, zergangen in Nichts? Sie wissen: alte Menschen erinnern sich genau ihrer frühen Jahre. Vergangenheit IST! Ihre Vergangenheit ist Ihr Besitz, unverlierbar. Sie müssen aber in der richtigen Art auf Ihr abgelegtes Leben zurückblicken: nicht wie man auf ein Feld zurückschaut, das ein für alle Male abgeerntet ist und auf dem statt des fröhlichen Gewoges von Ähren nur mehr scharfe und traurige Stoppeln sind; Sie müssen vielmehr denken, daß das, was auf diesem Feld gewachsen ist, ja nicht zu nichts geworden ist, sondern daß es DA ist, geerntet, in die Scheuer eingebracht. Jetzt kann das Korn nicht mehr verhagelt werden und nicht mehr im Regen verfaulen. Ich habe mich bisweilen gelangweilt und geärgert, wenn alte Leute immer wieder ihre früheren Erlebnisse erzählen. Aber das ist legitim. Sie haben die Ernte eingefahren und jetzt besichtigen sie Garben, Ähren, Körner, das Stroh, die Spreu. Indem sie in die Vergangenheit zurückgehen, gehen sie ihrer Zukunft entgegen. Diese Zukunft liegt in jedem Augenblick, in dem ihre Vergangenheit wieder lebendig wird.
Vielleicht sollten Sie auch bedenken, daß Leben nicht nur im Tun, im Herstellen von etwas besteht, sondern auch im Nicht-Tun, im Geschehenlassen. Vielleicht müssen Sie, die früher so Tätige, jetzt die andere Seite Ihres Lebens, Ihrer Persönlichkeit kennenlernen: die passive, die kontemplative. Vielleicht warten auf dieser Seite noch große geistige Überraschungen auf Sie. Ich bin sicher, daß „das Leben“ noch etwas von Ihnen erwartet und daß auch Sie etwas erwarten dürfen. Nur: Sie müssen es er-warten!
An einen Schwerkranken über den Sinn eines großen Leids
Ihr Brief hat mich bewegt und wenn Sie in persona hier bei mir säßen, so würden Sie fühlen, mit welcher Wärme ich teilnehme an Ihrem Schicksal. Bitte, fühlen Sie diese Wärme mit bei allem, was ich Ihnen nun schreiben werde, nach langem Nachdenken.
Sie fragen, was für einen Sinn es denn habe, daß Ihnen dieser Unfall zustieß, unverschuldet, und daß Sie nun „ein Krüppel“ sind. Sie sagen „Krüppel“, Sie sagen es mit verzweifeltem Nachdruck und wollen damit ausdrücken, daß Sie nun ein Wertloser sind, einer der nicht mehr „mitzählt“, weil er nicht mehr „mitspielen“ kann. Frage: gehört es zum Wesen des Menschen, daß er laufen kann, oder gehört es zum Wesen des Menschen, daß er denken, fühlen und sich geistig entwickeln kann? Sie haben nichts eingebüßt von diesen Fähigkeiten. Wenn Sie den Schock überwunden haben werden, beginnt die Anpassung an eine neue Art zu leben, und eines Tages werden Sie sich nicht nur einfach daran gewöhnt haben, sondern Sie werden „etwas daraus gemacht“ haben.
Zunächst aber quälen Sie sich ab mit der Frage nach dem Warum. „Warum ist mir das zugestoßen, warum fuhr ich an jenem Sonntag an den See, warum gerade in dieser Stunde, warum in dieser Minute, warum gerade diese Straße, warum … Es hatte alles nicht sein müssen, weder das Fortfahren, noch die Wahl der Zeit, also ist alles Zufall gewesen, also sinnlos.“
Sie behaupten damit, daß es Sinnloses gibt. Sie sagen nicht, alles sei sinnlos, nur dieser Vorfall sei sinnlos. Aber: wenn dieser Vorfall sinnlos ist, dann ist es zweifelhaft, ob nicht alles übrige auch sinnlos ist. (Ich wage nur sehr zaghaft, an diese Frage heranzugehen, aber wir müssen es wohl tun.) Sie haben sich mit Ihrer Freundin gestritten und fuhren darum allein weg. Wäre sie dabei gewesen, so wäre sie wohl tot. „Das Schicksal“ hat also einen Menschen gerettet und ein anderer zahlte den Preis dafür, aber keinen zu hohen.
Von dem Mann, der den Zusammenstoß verschuldete, wissen wir nichts, als daß er sehr jung war und betrunken; er ist tot; vielleicht hat ihn der frühe Tod vor einem bösen Schicksal bewahrt. Bitte sagen Sie nicht, so etwas sei ein allzu vager, ausflüchtiger Trost. Den Umstand, daß hinter Ihnen in der Autokolonne ein Arzt fuhr, der Sie vor dem Verbluten rettete, bezeichnen Sie selbst als „günstige Fügung“.
Ist dies eine Fügung (kein Zufall), warum sollte dann nicht auch alles übrige eine Fügung sein? „Fügung“ meint immer etwas, das sinnvoll zusammengebracht wird. Wir können also wohl einmal annehmen, daß der ganze Unfall sinnvoll war: für Ihre Freundin, für den Jungen, für Sie – für Sie zunächst insofern, als an Ihnen „das Schicksal“ sich aufhängte und abspulte.
Das ist Ihnen aber zu wenig. Sie fragen: Aber warum denn gerade ICH?
Sie möchten verstehen, was geschah und das ist Ihr Recht und mehr als das: es ist Ihr Weg. Ich meine, es gibt die Möglichkeit zum Verstehen. Ich meine aber auch, daß wir nie ganz begreifen werden.
Wenn man einer Schlange die Giftzähne ausbricht, um das Serum gegen Schlangenbiß zu gewinnen, so tut das der Schlange vermutlich weh, zumindest ist es eine Amputation, eine Verminderung ihrer Schlangen-Qualität: man beraubt sie ihres Mittels der Verteidigung. Die Schlange versteht ihr Geschick nicht, aber vom Menschen, von der höheren Ebene aus, ist es höchst sinnvoll: Die Schlange wird aus der „Mörderin“ zur Retterin.
Und wenn man einem Affen eine Injektion von Erregern der Kinderlähmung gibt, um das Serum dagegen zu gewinnen, so leidet der Affe; die Spritzen sind schmerzhaft, wie ich höre. Der Affe versteht nicht, warum man ihm wehtut. Aber sein Geschick ist sinnvoll; von der höheren Ebene aus. (Geopfert werden zur Rettung und Heilung anderer IST sinnvoll.) Könnten Schlange und Affe und Meerschweinchen und Ratte und all die Opfer-Tiere der Medizin verstehen, warum sie leiden, so wäre es für sie möglich, weniger zu leiden oder anders zu leiden: sie würden ihr Leben erhöht fühlen, „transzendiert“ auf eine höhere Ebene. Diese Ebene gibt es, die Menschen kennen sie, die Tiere kennen sie nicht, und darum erleben sie das, was ihnen geschieht, als unbegreiflichen Schmerz.
Warum nehmen wir nicht an, daß wir Menschen unsererseits in einen Prozeß eingefügt sind, der auf einer höheren Ebene vor sich geht und den wir nicht (noch nicht) verstehen, so daß das, was uns widerfährt, nicht aus dem „blinden Schicksal“ kommt, sondern aus einem hohen Sinn? Fromme Leute sprachen und sprechen vom „Willen Gottes“, von der „Vorsehung“. Wem das zu simpel klingt, der kann ebensogut von einem „Weltenplan“ reden, von einem kosmischen Sinn-Gefüge, dem Sternsysteme so gut unterstehen wie Menschen, wie Mikroben. Ich meine aber, Sie stehen noch zu sehr unter dem Schock des Schlages, als daß Sie Ihr Geschick schon zu transzendieren und es als „notwendig“ zu sehen vermöchten. Das ist auch sehr, sehr schwer: über seine eigene gewohnte enge Behausung hinauszublicken. Aber meinen Sie nicht, daß es nötig sei? Und meinen Sie nicht, daß Ihr Unfall Ihnen das gerade gibt, was Sie brauchen: Den Zwang, über Ihre Mauer hinauszukommen und etwas ganz Neues zu sehen, was Sie ohne den Unfall nie zu sehen bekommen hätten? Vielleicht werden Sie bald erkennen, daß nicht das Laufen-Können wichtig ist, sondern das Denken. Ihre Warum-Frage wird sich dann als eine Wozu-Frage erweisen und dann werden Sie auch die Antwort auf Wozu und Warum wissen.
An eine Sechzigjährige, die keine Hoffnung mehr hat
Nein, ich teile Ihren Pessimismus nicht, ganz und gar nicht! Es ist nicht eine schier unabänderliche Folge des Älter- oder Altwerdens, daß man die Erde für ein Jammertal hält und die Menschheit für einen in einem unfaßbaren Universum (das so gut wie das „Nichts“ ist) verlorenen Haufen und alles Tun zum Scheitern bestimmt und das Ganze ohne Sinn ist. Sie und ich sind ungefähr gleich alt. Wenn es stimmte, daß die Erfahrungen des Lebens unweigerlich zum Pessimismus führen, so müßte ich auch pessimistisch sein. Auch ich habe schlimme Erfahrungen hinter mir, aber sie waren schlimm nur insofern, als sie mich für eine Weile leiden und „sterben“ machten, aber sie waren gut, ja großartig, insofern, als sie mich neue Erkenntnisse lehrten. Und so, statt bitter zu werden durch die Erfahrung, wurde ich, im Gegenteil, sogar „optimistisch“. Ich möchte aber die Worte optimistisch und pessimistisch lieber nicht gebrauchen, sondern statt pessimistisch sagen: müde, resigniert, ressentiment-beladen, verzweifelt; und für optimistisch: hoffnungsvoll.
Sie sehen nur Abstieg, ich sehe Aufstieg. Sie sehen die Absurdität der technischen Fortschritte, die sich selbständig machten und uns versklaven und vergiften. Ich sehe die Entwicklung des geistigen Bewußtseins der Menschen. Sie sehen nichts als Aggression, ich sehe allerorten das Wachsen des Willens zum Abbau der Aggressionen. Sie sehen den Verlust der Religion und den Zerfall der Kirche; ich sehe das Aufkommen einer neuen bewußten Religiosität. Sind das nun wirklich nur subjektive Meinungen, die da aufeinanderstoßen? Sind es nur charakterbedingte Mutmaßungen, oder hat eine von uns beiden unrecht, oder sind beide Ansichten vielleicht gar keine Gegensätze?
Es ist doch realiter so, daß Abstieg und Aufstieg nebeneinander geschehen: ETWAS steigt ab, ETWAS steigt auf. In meinem Alter steigen die physischen Kräfte ab, die geistigen (Erkenntniskräfte) steigen auf (dann, wenn man sie nicht hindert!).
Die natürlichen Quellen der Erde verarmen, durch intellektuelle Anstrengung der Wissenschaftler werden künstliche Quellen geschaffen. Das biologische Leben ist gefährdet, das geistige übernimmt die Führung. Wenn Sie sagen, das seien Annahmen und als solche Sache des Glaubens, so sage ich: ja, das stimmt; aber „Sache des Glaubens“ sein bedeutet keineswegs: nicht wirklich sein. Das Wirklichste (das am meisten Bewirkende!) in uns ist unser Geist. Das, was den Geist wirksam macht, ist: die Hoffnung (in unlösbarem Zusammenhang mit Glauben und Liebe).
Das, was die Welt biologisch erhält, ist der Instinkt der Fortpflanzung und der Elan der Evolution, der unaufhörlichen Entwicklung; dieser Instinkt, dieser élan vital, ist in allem, was da ist, und drängt alles vorwärts. Die entsprechende Kraft im Geistigen ist die Hoffnung, die auf die Bewußtwerdung und die Vergeistigung der Erde zielt. Das sind zwei Stränge des Lebens. Seit wir von der Physik her wissen, daß die aller-allerkleinsten Teile der „Materie“ eben gar keine Materie mehr sind, sondern Geist, der als Materie erscheint, fällt es uns nicht mehr so schwer zu denken, daß alles, was IST, ohnehin GEIST ist und daß dieser sozusagen in die Materie eingeschlossene Geist durch uns befreit und entwickelt werden kann und muß. Tatsächlich und entgegen Ihrem „Pessimismus“ arbeiten Sie ja selbst an diesem Werk mit: Sie denken! Denken befreit Kräfte (bindet und hindert sie – falls man im Negativen verbleibt). Sie denken und beschäftigen sich auf Ihre Weise mit dem Schicksal der Erde. Damit gehorchen Sie dem geistigen élan vital und damit der Hoffnung. Hätten Sie aufgehört, für die Erde zu hoffen, wäre Ihnen Ihr Schicksal gleichgültig.