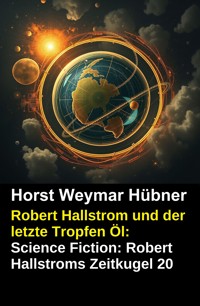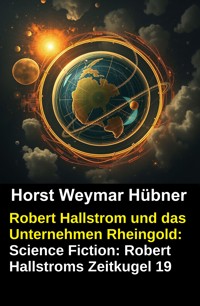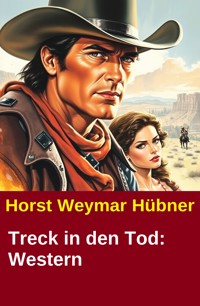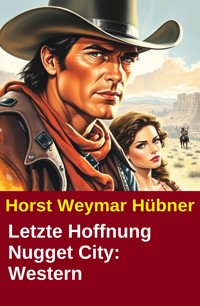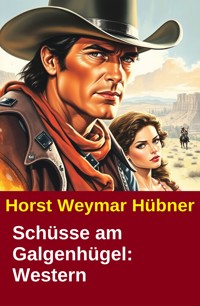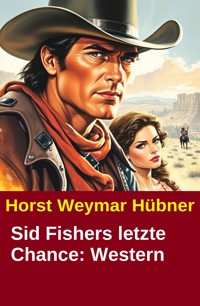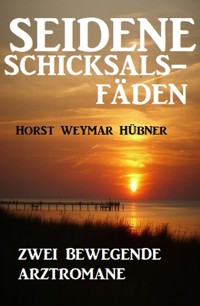3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Romane: Ich verzeih dir nie! (Horst Weymar Hübner) Hoffnung ist stärker als der Tod (Thomas West) Der begabte Mediziner Dr. Manfred Bücken arbeitet als Assistenzarzt von Professor Winter in der Paul-Ehrlich-Klinik. Eine exzellente berufliche Zukunft scheint ihm sicher. Doch mit seinem Privatleben steht es nicht zum Besten: Seine Frau Marietta, eine selbstbezogene, oberflächliche Person, treib sich mit den falschen Leuten herum und wirft sein Geld zum Fenster raus, was zur Folge hat, dass sich das Ehepaar auseinanderlebt. Da lernt Bücken die attraktive Susanne Wilde kennen und lässt sich auf eine Affäre mit ihr ein. Als er bemerkt, dass seine Geliebte medikamentenabhängig ist, scheint es fast zu spät - sein Ruf als Arzt ist gefährdet ... Auf dem Weg nach Mannheim erfährt Felix Söhnker von dem Verhältnis seiner Frau. Es kommt zum Streit, und auf der regennassen Straße verliert Edith die Gewalt über den Wagen. Im Krankenhaus kommen die beiden wieder zu sich. Während Edith mit ihren schweren Verletzungen hadert, wird Felix von Schwester Marianne betreut, die selbst noch nicht über den Tod ihres Verlobten hinweggekommen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Horst Weymar Hübner und Thomas West
Inhaltsverzeichnis
Hoffen und verzeihen: 2 Romane
Copyright
Ich verzeih’ dir nie!
Hoffnung ist stärker als der Tod
Hoffen und verzeihen: 2 Romane
Horst Weymar Hübner und Thomas West
Dieser Band enthält folgende Romane:
Ich verzeih dir nie! (Horst Weymar Hübner)
Hoffnung ist stärker als der Tod (Thomas West)
Der begabte Mediziner Dr. Manfred Bücken arbeitet als Assistenzarzt von Professor Winter in der Paul-Ehrlich-Klinik. Eine exzellente berufliche Zukunft scheint ihm sicher. Doch mit seinem Privatleben steht es nicht zum Besten: Seine Frau Marietta, eine selbstbezogene, oberflächliche Person, treib sich mit den falschen Leuten herum und wirft sein Geld zum Fenster raus, was zur Folge hat, dass sich das Ehepaar auseinanderlebt. Da lernt Bücken die attraktive Susanne Wilde kennen und lässt sich auf eine Affäre mit ihr ein. Als er bemerkt, dass seine Geliebte medikamentenabhängig ist, scheint es fast zu spät - sein Ruf als Arzt ist gefährdet ...
Auf dem Weg nach Mannheim erfährt Felix Söhnker von dem Verhältnis seiner Frau. Es kommt zum Streit, und auf der regennassen Straße verliert Edith die Gewalt über den Wagen. Im Krankenhaus kommen die beiden wieder zu sich. Während Edith mit ihren schweren Verletzungen hadert, wird Felix von Schwester Marianne betreut, die selbst noch nicht über den Tod ihres Verlobten hinweggekommen ist.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author / COVER STEVE MAYER
© dieser Ausgabe 2020 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Ich verzeih’ dir nie!
von Horst Weymar Hübner
Der Umfang dieses Buchs entspricht 157 Taschenbuchseiten.
Der begabte Mediziner Dr. Manfred Bücken arbeitet als Assistenzarzt von Professor Winter in der Paul-Ehrlich-Klinik. Eine exzellente berufliche Zukunft scheint ihm sicher. Doch mit seinem Privatleben steht es nicht zum Besten: Seine Frau Marietta, eine selbstbezogene, oberflächliche Person, treib sich mit den falschen Leuten herum und wirft sein Geld zum Fenster raus, was zur Folge hat, dass sich das Ehepaar auseinanderlebt. Da lernt Bücken die attraktive Susanne Wilde kennen und lässt sich auf eine Affäre mit ihr ein. Als er bemerkt, dass seine Geliebte medikamentenabhängig ist, scheint es fast zu spät - sein Ruf als Arzt ist gefährdet ...
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Author
© dieser Ausgabe 2016 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
1
Ein gellender Schrei drang vom Ende des Ganges. Zwar durch eine Tür gedämpft, aber laut genug, um die Patientinnen der gynäkologischen Station aus dem Schlaf zu reißen.
Und zu laut für sechs Uhr früh.
Darum lief Schwester Ellen, kaum dass sie ihren Schrecken überwunden hatte, einen Schlag schneller zum Schwesternzimmer.
Dabei stellte sie wilde Überlegungen an.
Sie hatten hier auf der 3 b doch keine Wöchnerinnen. Die lagen drüben im anderen Flügel.
Gut, wenn blitzartige Wehen einsetzten, schrie eine werdende Mutter schon mal auf, dass es durch Türen und Wände zu hören war. Aber so doch nicht!
Auf dem Gang brannte noch die Nachtbeleuchtung.
Hinter den Türen der Krankenzimmer wurde es laut. Die Mehrzahl der Patientinnen war munter geworden. Da und dort wurde eine Tür geöffnet, und Lichtbalken fielen in den Bettenvorraum und auf den Flur.
Eine nörgelnde Frauenstimme verbat sich die rücksichtslose Ruhestörung.
Schwester Ellen rüttelte vergeblich an der Tür vom Schwesternzimmer.
Drinnen brannte die ganze Festbeleuchtung. Sie drückte sich die Nase an der Glaswand breit, um zu sehen, ob der Schlüssel von innen auf dem Schloss steckte.
Das war nicht der Fall.
Die Tür vom Giftschränkchen war zu. Aus dem Steckkasten über dem Schreibtisch fehlte der Pieper.
Schwester Ellen verrenkte sich noch etwas den Hals, um einen Blick in die Kaffee-Ecke ganz hinten werfen zu können.
Da war Schwester Ingrid auch nicht. Die hatte Nachtdienst.
Wird wohl bei der Patientin sein, dachte die Stationsschwester. Da haben sie uns aber einen Neuzugang verpasst!
Wieder schrie die Frau gellend. Es kam einwandfrei hinten aus dem letzten Zimmer.
Seufzend wandte sich Schwester Ellen ab, um ihrem Zimmer zuzustreben und sich für den Dienst einzukleiden.
Sie hörte eine Tür aufgehen und einen Mann etwas unwirsch sagen: „Etwas Morphium kann ich noch verantworten, Schwester. Alles andere muss der Chef entscheiden.“
Die Stimme kannte sie. Sie gehörte Doktor Bücken, einem der Assistenzärzte, die im Rotationsverfahren alle Abteilungen der Klinik durchliefen.
Er hatte Nachtbereitschaft gehabt. Und er hatte sie noch. Bis acht Uhr jedenfalls.
„Was nehmen wir?“, fragte Schwester Ingrid korrekt.
„Etwas Morphium“, war eine zu vage Angabe.
„Dilaudid stark, einen Milliliter. Ziehen Sie es auf eine Tuberkulin-Spritze, ich muss es sehr langsam geben.“
Schwester Ingrid kam den Flur entlang und fischte den Schlüssel zum Schwesternzimmer aus der Kitteltasche. Am Aufschlag hatte sie den Pieper angeklemmt.
Sie sah ihre Stationsschwester.
„Guten Morgen, Schwester Ellen. Gut, dass Sie da sind. Ich habe vielleicht eine Nacht hinter mir!“
Die Stationsschwester sah es ihr an. Ingrid wirkte sonst auch nach einer Nachtwache wie das blühende Leben. Jetzt war ihr Gesicht grau, die Augen waren gerötet, aus jeder Hautpore guckte die Müdigkeit.
„Machen Sie erst die Injektion fertig, Ingrid. Ich gehe Ihnen gleich zur Hand.“
In Windeseile zog sich Schwester Ellen um und ging ins Dienstzimmer. Ein wimmernder Schrei aus dem letzten Zimmer begleitete sie. Er war nicht mehr so laut.
„Wen haben wir da bekommen, Ingrid?“
Die schwarzhaarige junge Schwester hatte die Spritze vorbereitet und auf ein Tablett gelegt, die Kanüle in die Ampulle geschoben, damit Dr. Bücken eine letzte Kontrolle vornehmen konnte, bevor er die Injektion machte.
„Eine Frau Strube. Sie wurde gegen Mitternacht eingeliefert, Doktor Bücken wurde zur Aufnahme runtergerufen und hat sie mitgebracht, weil die Intensivstation bis auf die letzte Box besetzt ist.“
Das letzte Zimmer war die 18. Schwester Else griff sich die Patientenkurve Strube heraus und las.
„Oh Gott!“, murmelte sie.
Die Patientin Gerda Strube war erst sechsundzwanzig. Aus dem Einweisungsbrief ihres behandelnden Arztes ging hervor, dass er sie ein Jahr lang wegen fortschreitender Auszehrung, der Anorexia mentalis, behandelt und zwei Klinikeinweisungen veranlasst hatte. Ohne Erfolg. Sie war immer hinfälliger geworden, Folge einer schweren Hormonstörung, die auf einer Gehirnerkrankung beruhte.
Dann waren die Wundliegeerscheinungen dazugekommen, eine schwere Infektion hatte sich aufgepflanzt. Der acht Wochen alte gesicherte Befund lautete auf Rückenmarkstumoren mit Lähmung der unteren Extremitäten.
Dazu Lymphknotenkrebs, weiträumig metastasiert, im letzten Stadium.
Die Patientin war zum Sterben in die Klinik gekommen.
„Die Kurve, bitte!“, sagte Schwester Ingrid. „Doktor Bücken hat drei Stunden bei ihr gewacht. Er hat ihr noch in der Aufnahme Dolantin gegeben, aber die Wirkung hält nicht mehr vor, Sie hören es ja.“
„Da, nehmen Sie.“ Schwester Ellen gab ihr die Kurve und ließ sie gehen.
Durch die offene Tür hörte sie Ingrid mit dem Arzt reden. Die Schritte der beiden verloren sich.
Schwester Ellen bereitete die Frühschicht vor und schrieb die Zettel für die Nüchternpatienten und für die Frauen, die zum Eingriff rasiert werden mussten.
Von den Aufzügen näherten sich Stimmen. Die Schwestern und Schülerinnen des Frühdienstes trafen ein.
Nachdenklich starrte Schwester Ellen auf die Glaswand, an die sie die Zettel geklebt hatte.
Die Patientin Strube auf achtzehn gehörte auf die Innere, wenn auf der Intensivstation im Moment kein Platz war. Was bewog denn den Bücken, sich so zu engagieren?
Das hatte sie seit einem halben Jahr nicht mehr gehört, dass ein Arzt der Nachtbereitschaft drei Stunden bei einer Patientin gewacht hatte.
Es gefiel ihr dennoch. Sie brummte anerkennend. Früher hatte das der Chef auch fertiggebracht. Das rechnete sie ihm heute noch hoch an.
Das Pflegepersonal trat ein, laute Geschäftigkeit erfüllte das Schwesternzimmer.
„Etwas mehr Beeilung, meine Damen!“, trieb Schwester Ellen das Team an. „Fünf Patientinnen müssen gewaschen werden.“ Sie teilte die Waschkommandos ein.
Fünf Minuten später kehrte Schwester Ingrid zurück. Dr. Bücken kam mit, um den Schein für die Betäubungsmittelinjektion zu unterschreiben. Die Bürokratie hatte ihre eigenen unerbittlichen Gesetze. Auch in einem solchen Falle.
Er füllte das Formular aus und zeichnete den Eintrag in der Kurve ab. Müde wischte er sich über die Augen. Die Bewegung drückte Resignation aus.
Dann erst nahm er die Stationsschwester wahr.
„Guten Morgen, Schwester Ellen. Ich mache Ihrer Station Ungelegenheiten.“
Sie wäre ihm böse gewesen, wenn er sich dafür entschuldigt hätte. Sie war froh, dass er es nicht tat.
„Es ist auch Ihre Station. Für das nächste halbe Jahr. Und Sie werden schon Ihre Gründe gehabt haben.“
Er nickte und rieb über das Kinn. In der Nacht war sein Bart gewachsen, die Stoppeln knisterten.
„Massives Weißbluten, als sie gebracht wurde. Ich konnte doch nicht dabeistehen, ein paar verlogene Worte sagen und die Achseln zucken. Eine Bekannte habe ich so grausam sterben sehen. Sie war meine erste Patientin als Praktikant.“
Schwester Ellen nickte. Sie verstand.
„Sie brauchen mir nichts zu erklären. Trinken Sie eine Tasse Kaffee mit? Sie sehen aus, als könnten Sie auch zwei vertragen.“ Seine Zustimmung wartete sie gar nicht ab.
Sie stellte eine Schwesternschülerin zum Kaffeekochen ab und zog sich einen Rollhocker heran.
Irgendwie hatte sie das Gefühl, dass Dr. Bücken ein Gespräch suchte. Der hoffnungslose Fall der Patientin Strube bedrückte ihn.
„Reden Sie frisch von der Leber weg, Herr Doktor“, ermunterte sie ihn.
In seinen grauen Augen blitzte scheuer Humor auf. Diese hübsche Schwester Ellen hatte Humor. Schade, dachte er, dass sie mit dem Kollegen Erlen verheiratet ist ...
„So hochoffiziell soll es nicht werden, Schwester, und mit meinen spärlichen Sünden komme ich vorerst noch alleine zurecht. Aber ich frage Sie, ob man hier schon mal eine Schmerzausschaltung vorgenommen hat. Ich informiere mich vorher lieber bei Ihnen, als beim Professor ins Fettnäpfchen zu treten.“
„Treten Sie ruhig mal rein, das hat er gern. Zeugt von Persönlichkeit und Individualismus, sagt er. Was verstehen Sie unter Schmerzausschaltung?“
„Das Anspritzen bestimmter Nervenbahnen mit Alkohol. Das würde ihr die bestialischen Schmerzen nehmen, sie würde es befreit und vielleicht sogar glücklich hinter sich bringen.“
Das Leben, ja, dachte Schwester Ellen. Es ist doch gar kein Leben mehr! Das Ende wäre eine Erlösung für sie!
Sie zögerte lange. Endlich nickte sie. „Es ist schon einige Jahre her, aber es wurde schon gemacht. Sprechen Sie mit dem Professor. Gleich nachher.“
„Die Spritze wirkt bestenfalls vier Stunden“, sagte Dr. Bücken mehr zu sich selbst. „Die Frau wiegt gerade noch achtundzwanzig Kilo. Vielleicht geht es noch ein paar Stunden, vielleicht auch zwei Tage.“
Diese ehrliche Betroffenheit, die aus seinen Worten sprach, machte ihn mit einem Male so menschlich.
Sie erfasste sein Problem. Sie kannte es zur Genüge, denn es stellte sich in jeder Klinik immer wieder neu.
Die Ärzte durften kein Leben verkürzen.
Aber nirgendwo stand geschrieben, dass sie einen Menschen auch quälen mussten, wenn sie schon mit allen ärztlichen Mitteln sein Leben verlängern sollten.
Die Schwesternschülerin brachte zwei Tassen Kaffee an den Schreibtisch.
„Ohne Milch und Zucker, danke!“, wehrte Dr. Bücken ab, als sie ihm einen Löffel Zucker in die schwarze Brühe hineinzittern wollte und ein Milchdöschen aufriss.
„Gießen Sie mir das Produkt einer glücklichen Kuh in die Tasse, Birgit“, meinte Schwester Ellen trocken. Sie fixierte den Arzt. „Schwarz aus Überzeugung oder wollen Sie der schönste Mann der Klinik werden?“
„Gewohnheit, Schwester Ellen. Wenn ich morgens aus dem Haus gehe, habe ich es gerade geschafft, so einen Pott voll schwarzer Brühe zu brauen. Bis ich den Rest zusammengesucht hätte, wäre der halbe Vormittag um.“
„Ich denke, Sie sind verheiratet?“
Schwester Ellen hielt erschrocken den Mund. Aber es war zu spät, die Worte waren gesagt. Bücken wurde also morgens nicht von seiner Frau versorgt.
„Bin ich“, antwortete der Arzt. Die Art, wie er es sagte, gab Schwester Ellen den Gedanken ein, dass er wünschte, es nicht zu sein.
Sie enthielt sich einer Meinung. Private Dinge mussten draußen vor der Klinik bleiben.
Sie trank genießerisch ihren Kaffee und ermahnte Dr. Bücken: „Vergessen Sie nicht, sich zu renovieren. Stoppelbärte kann der Chef auf den Tod nicht ausstehen, aber sonst fast alles.“
2
Professor Dr. Florian Winter war schon durch jenes, geheimnisvolle Informationssystem vorgewarnt, das in jeder Klinik der Welt anzutreffen ist.
„Aha, Sie also waren letzte Nacht der Samariter vom Dienst, Herr Kollege“, empfing er Dr. Bücken. „Sie wissen sich zu helfen, das freut mich.“
„Hoffentlich denken Sie gleich auch noch so, Herr Professor“, sagte Bücken. „Die Prognose ist aussichtslos, die Aussicht erstreckt sich auf maximal acht bis achtundvierzig Stunden. Ich schlage eine konsularische Visite unter Hinzuziehung der Neurologen vor.“
Florian Winter betrachtete seinen Assistenzarzt. Bücken hatte eine Nachtbereitschaft hinter sich und einen vollen Tagesdienst vor sich. Selbst sanftmütige Naturen waren da leicht gereizt.
Nicht so Bücken. Er sah müde aus, aber er trug seinen Vorschlag sicher, klar und überzeugend vor.
„Keine Einwände, Herr Bücken“, sagte er. „Und was schwebt Ihnen als letzte Therapie vor?“
„Nervenparalyse durch lokale Alkoholinjektion, Herr Professor.“
„So? Und haben Sie das schon einmal gemacht?“
„Nein, nur zugesehen. Da war ich Praktikant. Ich werde es nie vergessen, und wenn ich tausend Jahre alt würde. Das Verfahren hat mich überzeugt.“
Florian Winter wog das Für und Wider ab. Bücken war von der Chirurgie und der Inneren, wo er zuvor gewesen war, überaus gut beurteilt worden. Ein Mann, der mitdachte und nicht andere für sich denken ließ.
Ihm imponierte, wie er für seine Auffassung eintrat. Und dass er nicht lange herumgackerte.
„Schön, dann wollen wir die Herren Kollegen von der Neurologie um ihre geschätzte Meinung fragen“, entschied Florian Winter und griff zum Telefon.
Er beraumte ein gynäkologisch-internistisch-neurologisches Konsilium für neun Uhr an.
Als er den Hörer auflegte, dankte Bücken mit einem knappen Kopfneigen und wollte das Chefzimmer verlassen.
Der Professor rief ihn zurück.
„Sie können mir gleich assistieren, Herr Bücken. Ich muss eine Blasenhebung vorziehen, bin in Termindruck und benötige den zweiten Operateur. Der sind Sie. Kommen Sie mit.“
Manfred Bücken wäre es lieber gewesen, wenn es langsamer angegangen wäre. Aber dem Chef einen Korb zu geben, getraute er sich nicht.
Und so eine Offerte, das wusste er, bekam er auch nicht alle Tage gemacht. Vom Chef den zweiten Operateur angeboten zu bekommen, war eine Auszeichnung.
3
Um Viertel vor neun Uhr war die Blasenhebung gemacht.
Sie schafften es gerade, am Konsilium teilzunehmen.
Die ärztlichen Meinungen waren selten so einhellig wie im Falle dieser Patientin.
Dr. Bücken erhielt die Erlaubnis, die unwiderrufliche Nervenparalysierung vorzunehmen. Im Beisein der zugezogenen Kollegen der anderen medizinischen Disziplinen.
Er ließ sich von Schwester Ellen medizinisch reinen Alkohol und Injektionsmaterial bringen.
Die Patientin lag völlig apathisch und bot ein erbarmungswürdiges Bild der Hinfälligkeit.
Dieses Bündel Mensch bestand nur noch aus Haut und Knochen, aus einem wie durch ein Wunder noch etwas funktionierenden Stoffwechsel und aus großen, teilnahmslos blickenden Augen.
Die Austrocknung war so weit fortgeschritten, dass auch ein Lallen nicht mehr möglich war. Bei der Einweisung hatte die junge Frau noch deliriert. Es war aber schon abzusehen gewesen, dass sie in den komatösen Endzustand verfallen und nie mehr daraus auftauchen würde.
Die Heftigkeit, mit der sich diese dramatische Verschlechterung eingestellt hatte, war nur zur Hälfte der Grund gewesen, der Manfred Bücken drei Stunden lang am Schmerzenslager der Frau hatte ausharren lassen.
Zur anderen Hälfte war es einfach das Bedürfnis gewesen, diesem wegdämmernden Leben Hinwendung zu geben.
Man wusste außerdem ja nie, inwieweit solche Patienten noch aufnahmefähig waren. Man konnte aber getrost davon ausgehen, dass sie registrierten, ob jemand bei ihnen war oder nicht.
Und sicher war es für viele eine letzte große Erleichterung zu merken, dass man sie nicht allein ließ.
Schwester Ellen brachte den Alkohol und die Spritze.
Dr. Bücken half mit, die Patientin auf der Seite zu lagern. Er bestimmte die Injektionsorte.
Beim Anblick des Zustandes des Rückens der Frau wurde einer der Neurologen schwach. Geistesgegenwärtig schob jemand dem Arzt einen Stuhl unter.
Manfred Bücken zögerte. Feine Schweißbläschen erschienen auf seiner Oberlippe. Die Stirn wurde ihm feucht.
Jetzt war ihm mit einem Mal angst und bange. Die Verantwortung drückte wie ein Gebirge auf ihn.
Er zögerte. Noch tat die Morphiumgabe ihre Wirkung. Aber wenn sie nachließ, würde das arme Wesen erneut die Hölle erleiden.
Die Kollegen spürten, was in ihm vorging.
Spannung, die kaum noch zu ertragen war, breitete sich im Krankenzimmer aus.
Dr. Bücken verkürzte das Leben der Patientin nicht, wenn er die Injektionen machte, er verlängerte es auch nicht. Er machte es nur schmerz- und weitgehend empfindungsfrei.
Aus der Sicht der ärztlichen Ethik war das Vorhaben gerechtfertigt.
Dennoch zögerte Bücken.
Die Patientin bewegte sich schwach; sie war ohne Saft und Kraft, ein Bild des Jammers.
Professor Florian Winter sah, wie Bücken litt. Er litt mit ihm. Aber er konnte nichts für ihn tun. Bücken hatte allein die allerletzte Entscheidung zu treffen.
Mit eingezogenem Kopf kam der Assistenzarzt um das Bett herum. Jedermann hatte den Eindruck, dass er die Spritze zurücklegen würde.
Die großen, tief eingesunkenen und schmerzdunklen Augen der Patientin schienen sich zu beleben. Ein veränderter Ausdruck lag auf dem grauhäutigen Gesicht.
Die Augen bettelten.
Ein tiefer Seufzer entrang sich Dr. Bückens Brust. Er starrte vor sich hin - bald eine halbe Minute lang.
Dann gab er sich einen Ruck.
Er kehrte auf die andere Seite des Krankenlagers zurück und machte die Injektionen.
Als er die leere Spritze auf das Tablett zurücklegte, zitterten seine Hände so sehr, dass Schwester Ellen in Versuchung war, sie ihm festzuhalten.
Die Patientin wurde wieder in Rückenlage gebracht.
Der reine Alkohol hatte eine blitzschnelle Wirkung in den Nervenbahnen gezeitigt. Was auch immer jetzt noch auf Gerda Strube zukommen sollte, sie spürte nichts mehr davon.
Wie ein fernes, unendlich zufriedenes Seufzen klang es plötzlich aus dem Mund des Menschenbündels.
Die versammelten Ärzte gewannen den Eindruck, dass die Augen dankbar lächelten.
Florian Winter hätte es sogar beschwören können.
Dr. Bücken verließ sichtlich erschüttert das Zimmer und verschwand im Ärzteraum. Man ließ ihn ziehen. Er musste mit sich selber ins reine kommen..
Professor Winter ließ ihn erst zur Spätvormittagsvisite holen. Aber dann spannte er ihn ordentlich ein. Ein anderer Assistenzarzt, Dr. Steiner, ein abschreckendes Beispiel für Unzuverlässigkeit, hatte durch seine Haushälterin telefonisch ausrichten lassen, dass er krankheitshalber nicht zum Spätdienst erscheinen könnte. Leider.
Der Chef hatte es zähneknirschend zur Kenntnis genommen.
Und erst während der Visite ging ihm auf, dass an der Sache doch etwas nicht stimmen konnte. Seit wann hatte Steiner, der junge Spund, eine Haushälterin?
Schön, vermögensmäßig war es denkbar, er stammte aus einem wohlhabenden Stall. Aber ein Arzt, gerade um die dreißig, hielt sich bestimmt keine Haushälterin.
Florian Winter war überzeugt, dass die Dame eine ganz andere Aufgabe bei Steiner erfüllte, als ihm die Wirtschaft zu führen und die Wäsche zur Wäscherei zu schaffen und ihm, wenn er vom Klinikdienst nach Hause kam, ein Süppchen zu kochen.
So ging das nicht. Der Steiner brachte ja alleine mehr Fehltage zusammen, als die ärztlichen Mitarbeiter der Station Urlaubstage im Jahr zu beanspruchen hatten.
Das musste abgestellt werden.
Er musste Steiner mal das alte Sprichwort vom Krug und vom Brunnen in den Sinn bringen. Wenn Steiner auf der anderen Seite nicht bloß so ein hoffnungsvolles Talent gewesen wäre, hätte er längst dem Treiben ein Ende bereitet.
Professor Winters Laune litt etwas. Er bemühte sich indes redlich, seinen Groll auf Steiner nicht die anderen Mitarbeiter entgelten zu lassen.
Am Nachmittag gab es zwei Geburten und eine Neuaufnahme.
Winter stellte Bücken dafür ab, die Untersuchung der neuen Patientin vorzunehmen.
Minuten vor Feierabend, der für die Mehrzahl der Ärzte diesmal pünktlich zu beginnen schien, trat Dr. Inge Stoll ins Ärztezimmer. Ihr Gesicht war ernst, ihre Stimme gefasst.
„Das arme Würmchen auf achtzehn ist gerade eingeschlafen.“
Manfred Bücken warf den Kopf hoch.
Aber da war niemand, der ihm einen tadelnden Blick zugeworfen hätte. Er hatte alles für die Patientin getan. Er brauchte sich keinen Vorwurf zu machen.
Es war eben nur ein ungemein erniedrigendes Empfinden zu wissen, dass man wieder einmal verloren hatte.
4
Als er an diesem Tag nach Hause kam, hätte er dringend jemand haben müssen, mit dem er sich aussprechen konnte. Der ihm zuhörte. Und der ihm gescheite Fragen stellte oder ihm widersprach.
Zu seiner dumpfen Resignation gesellte sich ein Gefühl von Bitterkeit.
Natürlich war Marietta nicht da. Sie war nie da, wenn er sie brauchte.
Wann war sie denn überhaupt da?
Nachts, ja. Wenn er Glück hatte und sie nicht auf einer Einladung innerhalb ihres sehr umfangreichen Bekanntenkreises herumtanzte.
Dann war sie da. Körperlich jedenfalls. Aber launisch und in jedem Falle müde und kaum ansprechbar, schon gar nicht auf das Thema, das einem Ehepaar mehr Vergnügen als angenehme Pflicht sein sollte.
Ihre Ehe ging nicht gut.
Sie wussten es beide. Sie waren zu unterschiedlich. Jeder ging seiner eigenen Wege. Marietta hatte damit begonnen.
Sie betrügt mich, dachte Manfred Bücken, aber ändere ich es, wenn ich einen häuslichen Aufstand inszeniere oder ein Drama in fünf Akten aufführe?
Ich amüsiere sie höchstens. Mein Gott, und das war meine große Liebe gewesen! Und ich der glücklichste Mensch unter der Sonne!
Sie hatten sich in ganz wenigen Ehejahren auseinandergelebt, weil Wünsche und Wirklichkeit nicht in Einklang zu bringen gewesen waren.
Marietta hatte ihm immer wieder zu verstehen gegeben, dass sie schon als kleines Mädchen davon geträumt hätte, eines Tages einen Arzt zum Mann zu haben.
Später war dann herausgekommen, dass sie einen berühmten Arzt gemeint hatte.
Sie hatte immer sehr unrealistische Vorstellungen vom wirklichen Leben gehabt. Vielleicht deshalb auch, weil ihre Eltern ihr als einzigem Kind alle Wünsche erfüllt und alle Neigungen nachgesehen hatten.
Wenn Marietta etwas haben wollte, hatte sie es selbstverständlich bekommen. Was denn sonst auch?
Sein Pech in ihren Augen, dass er es nicht mit einem Schlag zum berühmten Mediziner gebracht hatte. Vom mühsamen Weg auf der Erfolgsleiter hatte sie überhaupt keine rechte Vorstellung gehabt.
Als er ihr es erklären wollte, hatte sie ihm nicht einmal zugehört.
Aber einen Schmalspurmediziner hatte sie ihn genannt. Es war ihr ernst damit gewesen. Einen beknackten Kliniker, der sich ein Leben lang damit abmühen wollte, den Leuten die kleinen Wehwehchen wegzukurieren.
Sie hatte geglaubt, an seiner Seite ein Leben in Saus und Braus und immer in erlesener Gesellschaft führen zu können. Und sie mittendrin als glänzender Mittelpunkt.
Dass dafür Reichtum erforderlich war, hatte sie erbittert und störrisch gemacht. So hatte sie sich die Ehe mit einem Arzt nicht vorgestellt. Das rieb sie ihm immer wieder unter die Nase.
Vollends uneinsichtig war sie in dem Punkt, dass Geld, das man zum Inszenieren von Festen und Gesellschaften brauchte, erst einmal durch harte Arbeit verdient werden musste.
Harte Arbeit hieß zermürbender Klinikdienst, hieß Nachtbereitschaft und Wochenenddienst.
Ernüchtert vom Sturz aus ihrem unrealistischen Traumhimmel mit den rosaroten Wolken hatte sie ihm eines Tages sogar geraten, doch einfach eine epochemachende Entdeckung fertigzubringen.
Durchs Mikroskop zu gucken und dem Geheimnis des Krebses auf die Spur zu kommen. Und schon seien sie gemachte Leute und überall mittendrin.
In dem Punkt war ihre Naivität nicht mehr zu überbieten.
Er hatte geduldig versucht, ihr auseinanderzusetzen, was Krebs überhaupt ist.
Seine Erklärungen hatte sie als faule Ausreden abgetan.
Es hatte ihn tief betroffen gemacht, und immer klarer begriff er, dass sie ein oberflächliches, wenn auch sündhaft schönes Geschöpf war und eine riesengroße Enttäuschung.
Danach hatte sie begonnen, ihr eigenes Leben zu leben und es nach ihrem Geschmack aufzuziehen. Er war bloß der Mann, der es finanzierte. In letzter Zeit hatte er häufig an eine Trennung gedacht. Sogar an die Scheidung.
Marietta hatte in dieser Richtung noch keine eigene Meinung zu erkennen gegeben.
Vielleicht kam er ihren Wünschen sogar entgegen, wenn er die Trennung begehrte. Rannte offene Türen ein.
Andererseits war er nicht knickerig und ermöglichte ihr ein auskömmliches Leben. Maulend kam er auch für ihre Extravaganzen auf, aber letztendlich zählte doch nur, dass er bezahlte und Marietta zufrieden war.
Schon möglich, dass sie in die Scheidung darum nicht einwilligte. Was sie hatte, wusste sie. Das war ihr sicher. Was kam, war vom höchst launenhaften Glück abhängig.
Die Stille des gemieteten Hauses bedrückte ihn.
Überall schwebte ein Hauch von Marietta.
Er schloss die Augen und schnupperte.
Blödsinn, sagte er sich, es ist ihr teures Parfüm. Eines von ihren teueren. Sie hat sich wieder in Schale geworfen und in Duftwolken gehüllt und ist ausgeflogen!
Auf dem runden Tischchen im Durchgang vom Esszimmer zum Wohnraum sah er ihre Brieftasche liegen. Die hatte sie vergessen.
Ein gelinder Schrecken durchfuhr ihn, als er ihre Wagenpapiere herausschauen sah.
Er klappte ohne Arg die Brieftasche auf. Natürlich, sie war ohne Papiere, sogar ohne Führerschein unterwegs.
Vor dem Haus und in der Garage hatte der kleine sportliche Zweitwagen, den er ihr gekauft hatte, nicht gestanden. Mit dem war sie unterwegs.
Und voraussichtlich würde es wieder sehr, sehr spät werden, bis sie nach Hause kam. Morgen früh würde sie sich gähnend auf die andere Seite drehen, wenn er aufstehen musste, und halb im Schlaf murmeln, er möge rücksichtsvoller gegen sie sein, nicht solchen Lärm machen und die Haustür richtig zuziehen, wenn er ging.
Lieber Himmel, wenn wir auch noch Kinder hätten, das wäre was!, dachte er. Die müsste ich auch noch fertigmachen, sonst kämen sie nicht einen Tag pünktlich zur Schule!
Kinder wünschte er sich so sehr. Die Hoffnung darauf hatte er indes schon so halb aufgegeben.
Marietta wollte keine Kinder. Jetzt noch nicht, hatte sie gesagt. Das war schon zwei Jahre her. Vorsorglich hatte sie die Pille genommen, und er hatte es als Misstrauensbeweis gegen sich verstanden.
Er hatte sich einverstanden damit erklärt, jetzt noch keine Kinder zu haben.
Sie hatte ihm das nicht abgenommen. Er sei ja schließlich Arzt, und ihm würde bestimmt ein Trick einfallen, hatte sie gesagt.
In der Erinnerung daran stieg ihm die Zornesröte ins Gesicht.
Ein Trick!
Er war sich wie ein Gauner vorgekommen, der darauf hinarbeitet, den Partner hereinzulegen.
Denn das konnte Marietta, einem anderen Schuldgefühle einimpfen.
Fast hätte sie es bei ihm auch geschafft. Aber nur fast.
Ihr Misstrauen hatte aber nicht ihm allein gegolten, sondern auch der Pille. Sie nahm sie fleißig, aber sie traute ihr nicht. Sie verweigerte sich ihm.
Alles gütliche Zureden nützte nichts. Und für Aussprachen war sie nicht zu haben.
Sie nannte das den listigen Versuch, einen Gesprächspartner, den man nicht mit guten Argumenten überzeugen konnte, mit vielen Worten totzureden. Das sei ja wohl zu seiner Zeit an den Universitäten üblich gewesen. Sie hätten den Professoren die Zeit gestohlen mit blödsinnigen Demonstrationen und endlosen Diskussionen. Bei ihr brauche er damit gar nicht anzufangen.
Er hatte sich oft gefragt, was er falsch gemacht hatte.
Es war immer nur eine Antwort herausgekommen, Marietta hatte es stets zu gut gehabt. Das hatte ihren Egoismus krankhaft gesteigert.
Erst kam sie. Dann lange nichts. Und dann kamen die anderen - aber nur vielleicht.
Und zugegeben, er war nicht der Mensch, der seine Lebensaufgabe darin sah, den Partner zu formen und zu biegen und sich zu erziehen, bis er dem Wunschgeschöpf entsprach.
Ein solches Vorhaben ging in aller Regel schief. Er hatte es bei Freunden von der Uni gesehen.
Gerade als er die Wagenpapiere in die Brieftasche zurücklegen wollte, fiel sein Blick auf eine Fotografie.
Sie zeigte einen gutaussehenden, etwas südländisch wirkenden Mann.
Mit spitzen Fingern griff Manfred Bücken das Bild heraus und drehte es um.
Kein Name, keine Adresse, keine Widmung.
Er betrachtete wieder das Abbild.
Der Mann war mindestens fünfzehn Jahre älter als er und zwanzig älter als Marietta.
Er schien ihr etwas zu bedeuten. Einen anderen plausiblen Grund fand er nicht für den Umstand, dass sein Foto in Mariettas Brieftasche geraten war.
Natürlich war er neugierig. Und wütend. Gelegentlich erzählte seine Frau schon, wie und wo sie ihre Nachmittage, Abende und halben Nächte verbracht hatte. Auf Feten und Festen und Partys und Empfängen.
Ein bestimmter Mann war in den schwärmerischen Erzählungen jedoch nie vorgekommen. Möglich auch, dass er nicht so genau hingehört hatte.
Sie ging ja ihren Vergnügungen nach, das kannte er schon. Neuigkeiten waren das nicht. Und wenn er müde und abgearbeitet von der Klinik heimkam, stand ihm der Kopf wahrhaftig nicht nach Tratsch und wildem Klatsch. Da wollte er ganz gern auch schon mal einfach nichts sehen und nichts hören.
Bei so einer seltenen Gelegenheit, dass nämlich Marietta an einem Abend daheim war, konnte schon eine bedeutsame Kleinigkeit an seinen Ohren vorbeigeschwirrt sein.
Es war durchaus möglich, dass er so einen Hinweis auf diesen Mann verpasst hatte.
Er kämpfte mit der Versuchung, die Brieftasche zu durchwühlen.
In einem plötzlichen Entschluss legte er das Foto zurück, klappte die Brieftasche zu und legte sie auf das runde Tischchen zurück, wie er sie vorgefunden hatte.
Er wandte sich der Küche zu und inspizierte den Kühlschrank auf verwertbaren Inhalt.
Marietta hatte eingekauft. Aber alles Dinge, die zu ihren Schönheits- und Diätkuren notwendig waren. Gurken, Joghurt und ein Bündel Pflanzen, aus denen sie mittels Abkochen ein Gesichtswasser herstellte.
In einer sarkastischen Anwandlung knurrte er: „Wenigstens duften die grünen Zweige ganz angenehm.“
Er nahm nur eine Flasche Bier heraus und setzte sich ins Wohnzimmer.
Wie sah das eigentlich bei seinen Kollegen von der Klinik aus? Stimmte es bei dem einen oder anderen in der Ehe auch nicht? Was fing der Betreffende mit so einem Abend an?
Und wo trieben sich die unverheirateten Kollegen herum?
Sehnsucht nach der ungebundenen und ungezwungenen Studentenzeit überkam ihn. Damals hatten sie ihre Stammkneipe gehabt, und wenigstens zweimal in der Woche traf man sich dort. Das war wie eine zweite Familie.
Und jetzt?
Er saß allein in einem Haus, haderte mit dem Schicksal und war auf dem besten Wege, trübsinnig zu werden.
An einem kalten Abendbrot mit Schnitten und Wurst hatte er kein Interesse.
Zum Kochen hatte er nicht viel Talent. Außerdem war nichts da. Und er fürchtete, dass Joghurtsuppe mit Gurkenscheiben eine eigenwillige und wenig schmackhafte Komposition blieb.
Da ging er doch lieber aus und aß etwas in einem Restaurant.
Er stellte die halb geleerte Bierflasche in die Küche, bevor er es sich anders überlegte, duschte, zog sich leger an und fuhr in die Stadt hinein.
Die Leuchtreklamen ausländischer Lokale lockten. Er spürte fremdländische Gerichte förmlich auf der Zunge.
Warum ging zum Beispiel Marietta nicht mal mit ihm aus?
Sie hatte für so etwas nie Zeit. Ständig war sie in Hetze, um zu ihren Nachmittagstees und Damenkränzchen und Ausstellungseröffnungen und weiß der Teufel was noch zurechtzukommen. Ihre Meinung war, dass ohne sie nichts lief.
Manfred Bücken entschied sich für ein China-Restaurant.
Das Glück war ihm gesonnen, denn er konnte ganz in der Nähe einen Parkplatz ergattern.
Dunkel war es zwar längst, aber für den Abendbetrieb beim Chinesen noch zu früh. Es waren nur wenige Tische besetzt.
Er steuerte auf einen kleinen Tisch im Hintergrund zu und setzte sich. Dann schickte er seine interessierten Blicke durchs Lokal.
Er kannte es nicht, aber es gefiel ihm. Es hatte Atmosphäre, und es war dezent dekoriert nach der alten Weisheit, dass etwas weniger immer etwas mehr ist.
Ein Chinese von kleiner Gestalt mit rundem freundlichem Gesicht tauchte auf und griff eine Speisekarte vom Stapel herunter.
Manfred Bücken schaute ihm entgegen.
Zufällig ging sein Blick etwas zur Seite, wo an einem Tisch eine mittlere Gesellschaft munter schmauste.
Die Mehrzahl der Teilnehmer kehrte ihm den Rücken zu. Auf der Gegenseite saß nur eine Frau. Aber was für eine!
Das aufregendste Weib, das er außer Marietta je sah.
Sie spürte, dass sie fixiert wurde.
Sogar die Richtung merkte sie.
Denn als sie den Kopf hob, schaute sie genau zu ihm herüber.
Ein Ruck ging durch ihn.
Wenn es Sympathie auf den ersten Blick gab, dann erlebte Manfred Bücken sie in diesem Moment.
Es war eine Sympathie auf Gegenseitigkeit.
Diese Frau hatte etwas in den Augen, das ihn auf Gedanken kommen ließ, über die man besser nicht spricht.
Er merkte, dass er etwas verlegen wurde. Sie nicht. Das ärgerte ihn.
Und es schien die Frau zu amüsieren, denn sie merkte auch das.
Er riss sich zusammen, lächelte höflich und grüßte verhalten hinüber. Sie dankte mit einem knappen Neigen des Kopfes. Ihre Miene drückte Neugierde aus.
Und das, wusste er, war in diesem Falle eine gute Eigenschaft.
Er musste sie kennenlernen. Um jeden Preis.
5
Natürlich stellte er es ziemlich ungeschickt an.
Bei dem kleinen Chinesen mit dem freundlichen runden Gesicht, der seine Bestellung aufnahm, versuchte er Erkundigungen einzuholen.
Aber der dienstbare Geist schien nur das Vokabular zu beherrschen, das in der Speisekarte enthalten war.
Alle Fragen nach der Gesellschaft nebenan und insbesondere nach der schwarzhaarigen Dame beantwortete der gute Mensch mit Verbeugungen und einem Grinsen, das ihn zu nichts verpflichtete.
Manfred Bücken begann etwas umständlicher und lauter zu forschen.
Noch immer wurde er nicht verstanden. Dafür schien der Nebentisch von seinen Bemühungen etwas mitgekriegt zu haben, denn etliche Köpfe wandten sich, mäßig interessierte Blicke musterten ihn.
Dann sagte ein Mann etwas, und allgemeine Heiterkeit herrschte.
Natürlich lachten sie über ihn.
Manfred Bücken klopfte sich eine Zigarette aus der Packung und zündete sie an. Eine kleine Beschäftigung half am ehesten über die Peinlichkeit einer solchen Situation hinweg.
Unter der abziehenden Rauchwolke her schoss er einen raschen Blick hinüber.
Das schwarzhaarige Rasseweib lachte nicht mit, die intime Heiterkeit ihrer Gesellschaft missfiel ihr.
Wieder trafen sich ihre Blicke.
Ein unsichtbarer Bogen spannte sich zwischen ihnen, Strömungen und Empfindungen pendelten auf geheimnisvolle Weise hin und her.
Die Frau wurde angesprochen, sie wandte sich ihrem Gegenüber am Tisch zu.
Manfred Bücken bedauerte es.
Denn wenn ihn nicht alles trog, hatte die Frau eben einen Augenflirt mit ihm begonnen.
Sein Herz tat ein paar Schläge mehr.
Rettungspuls, dachte er. Manfred, komm wieder zu Verstand, dein Herz schafft es ja auch! Eine Frau von ihrer Klasse ist in festen Händen! So was läuft doch niemals frei herum!
Er war dem kleinen Chinesen dankbar, dass er das bestellte Pils brachte. Gut eingeschenkt und mit einer haltbaren Blume drauf.
Immer mehr kam er sich wie ein heftig verschossener Pennäler vor, der seine Angebetete aus der Entfernung anhimmelte, aber nicht den Mut aufbrächte, das Wort an sie zu richten.
Zumindest war man damals noch so zurückhaltend, als er auf die Penne ging.
Dem Vernehmen und etlicher Klagelieder verheirateter Kollegen nach herrschten heute andere und wesentlich zwanglosere Sitten an den höheren Lehranstalten. Und nicht nur dort.
Er drehte sein Glas auf dem Bierfilz.
Drüben war man mit dem Essen fertig. Es wurden warmer Reisschnaps und duftender Zimtwein gereicht.
Der Chinese stellte sich mit einem Block in Positur und begann zu addieren. Die Gesellschaft wollte also aufbrechen.
Manfred Bücken passte haarscharf auf als er mitbekam, dass keine Gesamtrechnung drüben gemacht wurde.
Fast jeder Gast bezahlte für sich.
Sie auch.
Aus gewissen Zeichen und Gesten schloss Manfred Bücken, dass die Gäste mit dem Lokal sehr vertraut waren.
Und wirklich erschienen zur Verabschiedung auch zwei Frauen und ein Mann, alles Chinesen. Hände wurden geschüttelt, Scherzworte flogen hin und her. Es ging sehr familiär zu.
Das bestärkte ihn in der Ansicht, dass die Besucher hier sehr bekannt waren.
Das Rasseweib wandte sich im Eingang um und warf ihm einen langen, fast verzehrenden Blick zu. Vielleicht war bei ihm in diesem Punkt auch mehr der Wunsch der Vater des Gedankens.
Er erhob sich und machte eine Verbeugung.
In ihren Augen las er Überraschung.
Sie sagte etwas zu dem Chinesen, offensichtlich dem Inhaber des Lokals. Und der blickte her.
Im nächsten Augenblick drängte die Gesellschaft hinaus.
Er hatte es sich angewöhnt, die Leute etwas zu taxieren. Nach ihrem Auftreten, nach ihrer Art und nach ihrer Kleidung. „Menschenstudien“ nannte er das.
Und gelegentlich hatte er die Möglichkeit, das Ergebnis seiner Vermutungen und Taxierkünste mit der Realität zu vergleichen.
Mitunter lag er weit daneben.
Aber das fasste er als Herausforderung auf.
An der Uni hatte er vier Semester lang einen steinalten Professor gehabt, einen unleidlichen, ungerechten und ewig nörgelnden Mann, der zudem noch ein schwieriger Dozent war.
Milchbock hatten sie ihn genannt. Weil er sich zu jeder Vorlesung in der Thermoskanne Milch mitbrachte und diese ungeniert verkonsumierte. Und weil er einen Knebelbart trug, der ihn wie einen widerwärtigen Ziegenbock ausschauen ließ.
Der Mann hatte sich um die Medizin verdient gemacht. Diese Verdienste lagen indes in grauer Vorzeit, und nachfolgende Forschungen waren über seine Entdeckungen hinweggegangen. Er hatte jedoch die Bahn bereitet und die Richtung gezeigt.
Und dieser Milchbock war, so ungenießbar er sonst auch war, ein exzellenter Diagnostiker. Dazu benötigte er nicht mehr als seine Finger zum Perkutieren und sein Stethoskop zum Abhorchen.
Seine Befunde waren atemberaubend sicher.
Ein Semester lang hatte das Auditorium geglaubt, hier ginge es nicht mit rechten Dingen zu oder der Milchbock hätte die Patienten, die er vorstellte, zuvor schon auf Herz und Nieren untersucht.
Bis er ihnen sein Geheimnis verriet.
Ansehen. Anhören. Begreifen.
Den Patienten nämlich.
Und er hatte ihnen die Worte von Samuel Hahnemann um die Ohren gehauen, einem der großen Wegbereiter der Homöopathie. „Macht’s nach, aber macht’s genau nach!“
Der selige Hahnemann sollte diesen Ausspruch zwar in einem ganz anderen Zusammenhang gebraucht haben, als er nämlich über die Schulärzte herzog. Der Milchbock kannte jedoch keine Skrupel und baute die markanten Worte in seine Vorlesung ein.
Und da erst hatten sie begriffen, dass er kein Hexenmeister war, sondern nur den unbestechlichen und sicheren Blick hatte.
Dieses Erlebnis hatte Manfred Bücken fasziniert.
Ab der Zeit hatte er seine persönlichen Experimente gemacht, wie er das Einschätzen, Taxieren und Einstufen wildfremder Menschen nannte.
Auf die schöne schwarzhaarige Unbekannte angewandt kam er zu dem vorläufigen Ergebnis, dass sie sehr selbstsicher war, gute Umgangsformen besaß, gewandt war, sich aber noch beeindrucken ließ.
Durch sein Aufstehen.
Na ja, und wie ein hässlicher Kinderschreck sah er ja schließlich auch nicht gerade aus.
Er beschäftigte sich so sehr mit der Frau, dass er kaum richtig wahrnahm, was er verzehrte. Jedenfalls mundete es ihm, und das war mehr, als er anfangs von diesem Abend erwartet hatte, daheim im leeren Haus.
Als er ging, trat der chinesische Besitzer in Erscheinung und bedankte sich wortreich und mit starkem Akzent für den Besuch.
„Es gefällt mir hier“, versicherte Manfred Bücken, „ich komme gerne wieder, ganz bestimmt sogar. Sagen Sie, die Gäste von dem Tisch dort, die vor einer Weile gegangen sind, kennen Sie die?“
Der Chinese bejahte freudig.
„Auch die schöne schwarzhaarige Dame?“
Das Lächeln des Chinesen wurde verschmitzt. „Ja. Hat gesagt, man geht in das Nachtlokal.“
Eine freudige Erregung überkam Manfred Bücken. Das hatte die Frau dem Lokalinhaber beim Abschied gesagt?
Da hatte sie aber wirklich genau gespürt, wie stark sie ihn beeindruckt hatte und wie sehr er wünschte, sie wiederzusehen und mit ihr bekannt zu werden.
Nachtlokal war allerdings eine verteufelt ungenaue Angabe. In der Stadt gab es viele. Er hatte nie eines besucht.
„Welches Nachtlokal, bitte?“
Der Chinese stieß den Zeigefinger zweimal senkrecht nach oben. „Im Hause. Fünfte Etage.“
Jetzt entsann sich Manfred Bücken, unten neben dem Eingang einen Schaukasten mit dümmlichen Fotos gesehen zu haben, die nackte Tänzerinnen in sehr ungesunden Verrenkungen zeigten.
„Danke. Wissen Sie zufällig auch den Namen der Dame?“
Der Chinese war ein Universalgenie. Die Dame hieß Wilde. Ob allerdings Frau oder Fräulein, das entzog sich seiner Kenntnis.
Wie er es sagte, waren ihm solche feinen Unterschiede auch gleichgültig.
Gerne hätte Manfred Bücken noch mehr von ihm erfahren, aber nun wäre er sich selber lächerlich vorgekommen.
Eigentlich war er schon über seinen eigenen Schatten gesprungen, dass er sich derart für eine wildfremde Frau interessierte.
Er kannte sich kaum mehr wieder.
Aber heute war ein besonderer Tag, er spürte es.
Vielleicht brachte er eine Wende, die er insgeheim immer gewünscht und zugleich gefürchtet hatte.
Auch Trotz spielte mit hinein.
Gerade heute hätte er Marietta gebraucht. Als verständnisvollen Partner. Der war sie ihm jedoch nie gewesen.
Sei’s drum, dachte er. Ein Flirt kann ja nicht schaden, und Konkurrenz belebt das Geschäft. Abgesehen davon kann man sich ruhig draußen Appetit holen, wenn man anschließend nur zu Hause isst!
Dieser Vergleich schlug ihm auf den Magen.
Für ihn gab’s zu Hause nichts zu knabbern und zu nagen. In keiner Weise.
Er verließ mit einem kurzen Gruß den Chinesen.
Das Lokal lag im ersten Stockwerk.
Vor der Tür blieb er stehen, fast schon entschlossen, aber eben noch nicht ganz.
Ein Aufzug führte nach oben, und es gab ein Treppenhaus.
Nach Hause zog ihn nichts. Er konnte sofort heimfahren, und dann blieb die flüchtige Begegnung mit der Schönen eine bittersüße Romanze, in die er im Nachhinein all das hineindenken konnte, was hätte sein können, wenn ...
Der Abend wäre möglicherweise anders verlaufen, wenn nicht Stimmengewirr und Schuhgeklapper von oben nähergekommen wären.
Manfred Bücken zog sich zum Aufzug zurück und drückte ihn herbei. Er war natürlich irgendwo unterwegs.
Darüber kamen die Besucher heran, die so vergnügt und laut im Treppenhaus waren.
Es war ein Teil jener Gesellschaft im China-Restaurant, die über ihn gelacht und gespöttelt hatte.
Die Superfrau war nicht dabei.
Das Herz klopfte ihm bis zum Hals hinauf.
Der Mann, der am Tisch eine Bemerkung über ihn gemacht hatte, blieb stehen, hatte an jedem Arm ein Mädchen hängen und musterte Manfred Bücken mit einem schwer deutbaren Augenausdruck. Er empfand aber keineswegs freundliche Gefühle.
„Sie schon wieder?“, pflaumte er Manfred Bücken an. „Schnüffeln Sie uns nach, oder was sonst?“
Das Mädchen an seinem rechten Arm wollte ihn wegziehen. „Mach keinen Quatsch, Hans! Komm weiter.“
Manfred Bücken konnte eine Alkoholfahne riechen. Jetzt wurde ihm auch klar, weshalb dieser Hans zwei Mädchen bei sich hatte. Er brachte nicht sie hinunter, sondern sie ihn. Und sie schienen darin Erfahrung zu haben.
Im Restaurant hatte er einen nüchternen Eindruck gemacht. In knapp einer Stunde, seit er mit der Gesellschaft fort war, hatte er sich im Nachtlokal oben offensichtlich ganz schön einen hineingetan.
Manfred Bücken lächelte harmlos. Er zeigte auf die Aufzugtür, hinter der es immer noch dunkel war. „Ich warte hier auf die Straßenbahn.“
Einen entsetzlichen langen Moment sah es aus, als wollte sich der Mann Hans auf ihn stürzen. Plötzlich lachte er aus vollem Hals, schnappte sich die Mädchen und zog mit Lärm tiefer ins Treppenhaus hinab.
Der Aufzug war da. Manfred Bücken fuhr hinauf.
Ein jäher Argwohn erfasste ihn.
Tanzte das schwarzhaarige Superweib etwa in diesem Laden? Dass sie ein häufiger Gast unten beim Chinesen war, war ein gewichtiges Indiz.
Aber was war mit den Leuten gewesen, die auch am Tisch gesessen hatten? Na ja, dieser Hans wurde gerade aus dem Verkehr gezogen, und auch sonst war nicht anzunehmen, dass er als Darbietender in diesem Laden aufzutreten pflegte.
Manfred Bücken wollte es genau wissen. Außerdem wollte er nicht vergeblich heraufgefahren sein.
Er trat ein.
Man knöpfte ihm zwanzig Mark ab.
Das sollte ein sogenannter Clubbeitrag sein.
Dann wollte ihm ein spärlich bekleidetes Mädchen eine Tischkarte samt Tischdame besorgen. Für den vergleichsweise bescheidenen Beitrag von fünfzig Mark.
Und er hatte immer geglaubt, die Raubritter seien längst ausgestorben.
„Nein, nein, ich brauche weder eine Tischdame noch einen Tisch, noch möchte ich dieses Nachtlokal kaufen. Ich suche jemand.“
„Nicht zufällig mich?“ Die Kleine drehte sich kokett. Ihr Augenaufschlag ließ ihn jedoch an eine Kuh denken, die Koliken hatte.
„Zufällig nicht.“
Nachdem er sich als hartnäckig erwies und ihm kein weiteres Geld vor dem eigentlichen Eingang abzupressen war, ließ man ihn ziehen.