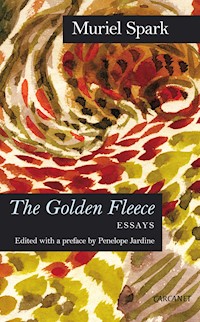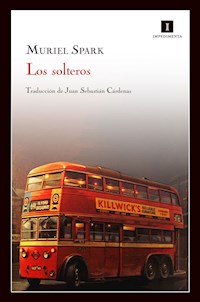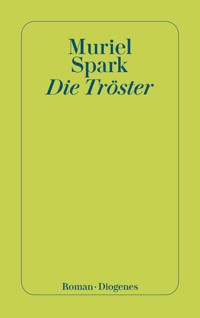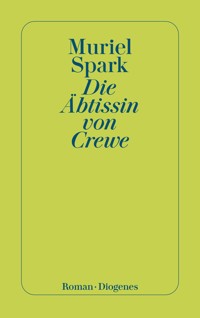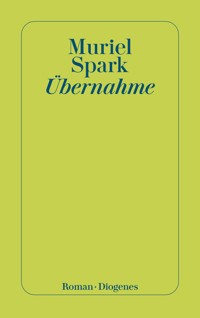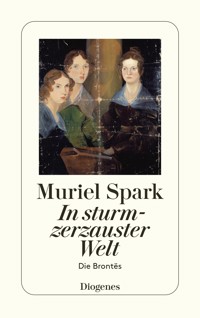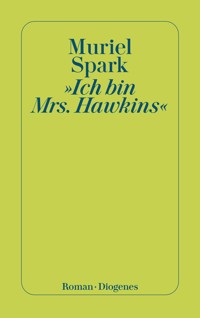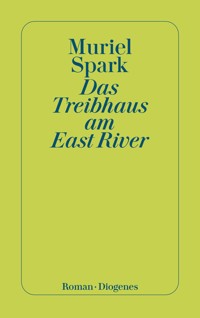8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Venedig tummeln sich allerlei seltsame Gestalten: ein junger Kunstgeschichtler aus Paris, der den Fängen eines reichen Kunsthändlers entflieht, eine junge Bulgarin auf der Suche nach dem Grab ihres Vaters, ein pensionierter Schulleiter mit seiner Geliebten, auch ein Detektiv und nicht zuletzt die zwei ältlichen Schwestern, die die »Pensione Sofia« leiten und ein ausgefallenes Geheimnis im Garten haben…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Muriel Spark
Hoheitsrechte
Roman
Aus dem Englischen von Mechtild Sandberg
Diogenes
Erstes Kapitel
Der Angestellte des Reisebüros telefonierte mit der Pensione Sofia, während Robert Leaver den Wasserverkehr an der Fähre beobachtete und die Nachsaisongäste, die in Venedig eintrafen. Es war ein sonniger Tag im Oktober. Nachdem der Angestellte mit dem Sofia gesprochen hatte, teilte er Robert mit, daß dort ein Zimmer frei sei. Robert nickte. »Urlaub?« fragte der Mann vom Reisebüro. »Forschungsarbeit. Kunstgeschichte«, erwiderte Robert und hob seine Aktentasche und seinen Koffer hoch.
Sein Weg zur Pensione Sofia führte über das sonnenbeschienene Wasser, in dem sich Paläste, Kuppeln und Fähren spiegelten. Es war sein erster Besuch in Venedig, und er war jung; aber er war nur halben Herzens bereit, sich verzaubern zu lassen, die andere Hälfte war noch von einem ungelösten persönlichen Problem in Paris gefangen, von wo er gerade gekommen war. Während er schon beim ersten Anblick den gebieterischen Ansprüchen Venedigs der Schönen ausgesetzt war, klang in seinen Ohren noch immer die ungeduldige Stimme des älteren Mannes: Leb wohl, leb wohl, leb wohl, leb wohl. Robert hatte mit seinen eigenen Abschiedsworten Mühe gehabt, hatte sie im Ton einer Rechtfertigung hervorgebracht, hatte zu häufig leb wohl gesagt. Den Koffer in der Hand, hatte er sich auf der Türschwelle umgedreht. »Ich melde mich … also nochmals leb wohl … auf Wiedersehen … also dann bis –«
»Leb wohl, leb wohl, leb wohl, leb wohl.«
Es war, als hätte der ältere Mann gesagt: »Du langweilst mich. Du kannst nicht einmal mit Stil fortgehen. Du hast nicht den geringsten Sinn für Trennungen. Du hast mich immer gelangweilt. Leb endlich wohl. Leb wohl.«
Diese ärgerliche Szene noch frisch im Gedächtnis, ließ Robert Venedig auf sich wirken und registrierte alles, was auf dem Weg zur Pensione an ihm vorbeizog, mit bloß fotografischem Auge.
Der muntere, stämmige junge Hausdiener erwartete ihn am Tor, um ihm sein Gepäck abzunehmen. Seinen Koffer gab Robert her, hielt jedoch nervös die Aktentasche fest. Der Hausdiener zeigte sich in keiner Weise davon berührt und ging den kurzen, mit Steinen ausgelegten Weg vom Straßeneingang hinauf zur hohen Glastür. Von den Außenmauern der Pensione blätterte der Anstrich ab, aber sie war ganz offensichtlich einmal eine ansehnliche Villa gewesen. Robert folgte dem Hausdiener in einen langen Empfangsraum. Die Villa war in ein kleines Privathotel umgewandelt worden. Einige Gäste saßen herum und warteten, zum Ausgehen fertig, darauf, daß ihre Freunde herunterkämen. Am entgegengesetzten Ende des Raums warteten ein großer dunkler Fernsehapparat und eine leere Sitzgruppe darauf, daß der Abend kam. Hinter dem Fernsehgerät befand sich eine breite Terrassentür, die Vorhänge waren zur Seite gezogen; jenseits davon, hinter dem Haus, zog sich ein langer Garten hin.
Zwei Frauen mittleren Alters erhoben sich gleichzeitig aus ihren Lehnstühlen. Die eine hatte gestrickt, die andere eine Zeitschrift gelesen. Man hätte sie für Gäste halten können, aber gemeinsam traten sie an den Empfangstisch, lächelnd, entgegenkommend und diensteifrig. Die beiden Köpfe, die sich über das große Buch beugten, um sein Zimmer ausfindig zu machen, sahen ganz gleich aus, gelblich grau, ordentlich und frisch frisiert. Der Zeigefinger der einen Frau glitt auf der Suche nach seinem Namen die Seite hinunter, der Zeigefinger der anderen fand ihn.
Eine der beiden ehrenwerten Damen hinter dem Empfangstisch fragte in angemessenem Hotelenglisch, wie lange er bleiben wolle.
Er öffnete den Mund und machte eine Pause, bevor er in französisch gefärbtem Italienisch antwortete: »Zwei oder drei Wochen. Vielleicht einen Monat.« Er schien die Entscheidung in eben diesem Augenblick getroffen zu haben; genausogut hätte er sagen können: »Zwei oder drei Tage. Vielleicht eine Woche.«
Die Finger fuhren in dem Buch umher. »Wir haben ein großes Zimmer mit zwei Fenstern und Dusche oder ein anderes Zimmer, kleiner, mit Bad.«
»Zwei Fenster?« fragte der junge Mann. »Das Zimmer mit Bad, hat das zwei Fenster?«
»Nein, nur eines«, antwortete Eufemia. »Ich zeige Ihnen beide Zimmer.« Sie griff nach den Schlüsseln.
Er folgte, über Gebühr aus der Fassung gebracht, zwischen den beiden Vorteilen wählen zu müssen. Ein Zimmer mit zwei Fenstern und nur Dusche, ein Zimmer mit einem Fenster, dafür ein Bad. Leb wohl, leb wohl. Er nahm das große Zimmer mit den zwei Fenstern und der Dusche.
»Vielen Dank, Signora«, sagte er, worauf sie ihn bat, sie Eufemia zu nennen, und hinzufügte, daß ihre Schwester Katerina heiße. Und selbst das beunruhigte Robert, da er fürchtete, in einem übermäßig intimen Hotel gelandet zu sein, wo seine Privatsphäre bedroht sein könnte.
»Sie haben Glück, daß Sie dieses Zimmer gefunden haben«, bemerkte Eufemia, während sie Seife und Handtücher prüfte und Schränke und Schubladen öffnete, um sich zu vergewissern, daß für den neuen Gast alles bereit war. Das Zimmer war groß und wahllos mit etwas wackeligen, dafür aber glänzend polierten Möbeln eingerichtet. Er bemerkte ein Telefon am Bett und einen Schreibtisch, was aus irgendeinem Grund seine Befürchtungen hinsichtlich seiner persönlichen Unabhängigkeit in der Pension beschwichtigte. »Sie würden sich wundern«, sagte Eufemia, »wie viele Touristen sogar in der Nachsaison noch täglich in Venedig eintreffen. Machen Sie Urlaub?«
»Forschungsarbeit«, antwortete er. »Kunstgeschichte.«
Eines der Fenster blickte auf einen Garten, an dessen Ende der Kanal lag, das andere auf einen großen Platz mit einer Kuppelkirche an dessen Ende.
»Kunstgeschichte? Gut, gut«, erklärte Eufemia, als wäre der einzigartigen Wunder kein Ende. »Nun, Sir, kann ich Ihren Paß für die Anmeldung haben?«
Von außen gesehen wirkt Santa Maria Formosa durch ihre Kuppel rund und anmutig. Hinter ihr plätschert einer der schmalen Pfade venezianischen Wassers, die Straßen mit Kirchen verbinden, Plätze mit Gassen. Die Kirche wirkt großzügig und friedlich in ihrer Behäbigkeit, als öffneten sich die Flügel ihres Portals, um den Platz davor im besten Licht zu zeigen; den Platz und alles, was ihn umgibt, die Apotheke, das Bestattungsinstitut mit seinen glänzenden, übereinandergestapelten und mit Enthusiasmus geschnitzten Särgen, die unregelmäßige Silhouette der Dächer, die Bar Dell’Orologio, wo jung und alt beisammenstehen und einander mustern, und, ganz links, das verschnörkelte alte Hauptquartier der Kommunistischen Partei mit seiner angemalten Fassade. Unter dem Kirchenportal stehend, kann man ein kurzes Stück den Seitenweg hinuntersehen, der vom gegenüberliegenden Ende des Platzes zum Straßentor und zum altmodischen Vorgarten der Pensione Sofia führt.
Über die kleine Brücke des Seitenkanals und den Fußweg, der in den großzügigen Platz mündet, war Robert hierhergekommen, sobald er ausgepackt hatte. Es war die Nachmittagsstunde, zu der die Läden nach der Mittagsruhe wieder öffneten. Robert war um den Platz herumgewandert, um zu erkunden, was für Sehenswürdigkeiten es gab, die man sich für spätere Besuche aufheben konnte, und stand jetzt bei Kaffee und Kuchen in der Bar. Er trug Blue jeans und einen dicken Pullover. Er war vierundzwanzig, mager, ziemlich groß und hatte einen schönen Kopf mit hellbraunem, lockigem Haar und einen herabhängenden braunen Schnurrbart. Einige andere Studenten beiderlei Geschlechts standen in der Bar, kamen und gingen. Robert zeigte dem Wirt einen Zettel, auf dem eine Adresse stand, aber der Wirt erklärte nach einigem Kopfzerbrechen, er habe nie von ihr gehört. Dann erkundigte er sich, wo diese Adresse sein solle, eine Frage, die gar nicht so dumm war; die anderen Venezianer, die sich jetzt auch für Roberts Problem interessierten, erklärten ihm, daß ihnen zwar ihre Stadt auf Schritt und Tritt vertraut sei, daß sie jedoch die Straßen nicht dem Namen nach kannten. Wo etwa war diese Adresse zu suchen, in der Nähe welchen Denkmals, welcher Brücke, welchen Geschäfts, welcher Kirche? Oberhalb oder unterhalb der Rialtobrücke? Ein anderer Student, ein Kanadier, erkannte schließlich den Namen der Straße; das führte zu weiteren Diskussionen und endlich zu einer Markierung auf Roberts Stadtplan, eigentlich gar nicht weit von der Stelle entfernt, wo er sich befand.
Genau in dem Moment, als Robert aus der Bar trat, sah er in der Ferne einen Moment lang Lina Pancev, das Mädchen, nach dessen Wohnung er sich erkundigt hatte. Er erkannte sie eindeutig an ihrer Silhouette, denn sie kleidete sich nach Zigeunerart in bauschige Gewänder mit dichtgereihten Rökken und breiten Schals, ein Stil, der bei den jungen Leuten von Paris üblicher war als bei denen Venedigs; dazu ihr eigenartig wiegender Gang, der eher stolz als wirklich sexy wirkte. Ihr kleiner Kopf mit dem schwarzen Haar im Pagenschnitt war wie immer mit einer gewissen Starrheit geradeaus gerichtet. Sie überquerte das Ende einer schmalen Straße, die vom Campo di Santa Maria Formosa wegführte, dann waren ihr Kopf und ihre Silhouette verschwunden.
Robert beeilte sich, sie einzuholen, schlug Haken um die Mütter, Kinderwagen, Kinder auf wilden Rollbrettern, Studenten, alten Männer und Touristen, die in den letzten Stunden des Sonnenlichts den Platz bevölkerten. Als er das Ende der schmalen Straße erreichte, war Lina außer Sicht, aber er schlug den Weg zu ihrer Adresse ein und sah sie schließlich neben der Brücke in einer schmalen Spalte zwischen zwei hohen Palästen stehen. Sie blickte sich flüchtig um, doch nur in ihrer nächsten Umgebung, als wolle sie sich vergewissern, daß niemand sie tätlich an einer geplanten Handlung hindern könne; ähnlich einem Marktdieb, der Weintrauben stehlen will. Dann bückte sie sich, hob ihren voluminösen Rock bis zu den Knien und schüttelte eine leere Makrelendose, einen Milchbehälter, zerbrochene Eierschalen und ein paar Fetzen alten Salats darunter hervor. Mit dem Fuß stieß sie die Abfälle zur Seite und ging dann weiter ihrem Ziel entgegen. Genau das hatte sie auch an jenem Tag getan, als Robert sie in einer heruntergekommenen kleinen Seitenstraße in Paris zum erstenmal gesehen hatte. Damals hatte sie aufgeblickt, den jungen Mann entdeckt, der sie beobachtete, und trotz ihrer Verlegenheit gelacht. Robert hatte auf eine lockere, jungenhafte Art gesagt: »Was machen Sie denn da?«
Sie hatte erklärt, sie habe ihre Abfälle weggeworfen. Offenbar wohnte sie in einem billigen Zimmer, wo sie nicht kochen durfte. Aber sie konnte es sich nicht leisten, auswärts zu essen, also kochte sie trotzdem auf einem Spirituskocher, den sie mit sich herumschleppte. Sie komme ganz gut zurecht, erklärte sie, das einzige Problem sei, die Abfälle loszuwerden; und sie löse dieses Problem, indem sie die Abfälle unter ihre Kleider stopfe und sie in einer abgelegenen Gasse wegwerfe. Sie sagte: »Ich muß die weiten Altweiberunterhosen tragen, die bis zu den Knien reichen.« Sie sprach zuerst Französisch und wechselte dann zu Englisch, weil Robert, wie sie ihm später erklärte, auf englisch lache.
Diesmal lachte Robert nicht. Er blieb stehen, wo er war, den Blick starr auf das Geheimnis dieser exakten Wiederholung der Ereignisse in einer anderen Stadt gerichtet; es war einer Halluzination ähnlich und schließlich doch kein Geheimnis, denn Lina hatte sich offenbar hier ein ebenso armseliges Zimmer genommen und sich mit ihrem verbotenen Spirituskocher eingerichtet. Er kannte Lina jetzt seit sechs Wochen. Erst Paris und nun Venedig; leb wohl, leb wohl. Lina war jetzt außer Sicht, aber er ging ihr nach zu ihrer neuen Wohnung.
Offenbar ging es bei dem Ärger zwischen den beiden um das Herbstlaub.
Robert stand am Gartenfenster seines Zimmers und blickte auf die wohlfrisierten Köpfe der beiden Frauen hinunter.
Der Garten, der mit Rosenbeeten und bunten Blumen übersät war, wurde von einem etwa drei Fuß breiten Kiesweg geteilt. Den ganzen Weg hinunter war genau in der Mitte eine Reihe weißgestrichener Steine ausgelegt, ähnlich denen, die an Bergstraßen vor einem jähen Abgrund warnen. Jetzt standen sich die zwei Frauen zu beiden Seiten der Trennungslinie resolut gegenüber, wobei jede mit den Fußspitzen haargenau den Rand berührte. Neben einer der beiden Frauen lag ein Haufen leuchtend bunter Blätter; es war ein riesiger Haufen, der unten schon feucht wurde und offensichtlich für den Kompost gedacht war. Unter anderen Umständen hätte Robert sicher bemerkt, wie prächtig dieser im matten, dunstigen Licht des Nachmittags aussah.
Die beiden Eigentümerinnen des Hauses kreischten weiter, nicht in dem Italienisch, das sie den Gästen gegenüber gebrauchten, sondern in einem venezianischen Dialekt, bei dem der Beobachter am Fenster nur da und dort einige wenige Anzeichen einer vernünftigen Unterhaltung entdeckte. Angelpunkt des Streits war die Stelle, wo das heruntergefallene Laub aufgehäuft worden war. Die Blätter selbst schienen in den Verantwortungsbereich der Frau namens Katerina zu gehören. Einige davon waren versehentlich über die weiße Linie in jenen Teil des Gartens geflattert, wo Eufemia, die andere, stand. Nach einer Weile verklangen die heftigen Töne im Garten zu einem gedämpften Grollen und lösten sich dann in Nichts auf.
Das spielte sich zwei Tage nach Roberts Ankunft ab. Der Nachmittagshimmel hatte sich grau gefärbt. Robert hörte den Wasserverkehr von Venedig hinter den Büschen am unteren Ende des Gartenwegs. Auch auf dem Seitenkanal und auf der kleinen Brücke, die zum Fußweg und zum Flußtor der Pensione Sofia führte, war Leben. Nachdem die Stimmen der Frauen verstummt waren, sah Robert, der noch immer zum Fenster hinausblickte, Eufemia schweigend ihren Platz behaupten. Sie trug einen bequemen Rock, und einer ihrer Strümpfe saß etwas schief. Auf der anderen Seite der weißen Grenzlinie bückte sich die andere, Katerina, nachdem sie widerstrebend klein beigegeben hatte, und hob mit kleinen Handbewegungen die in die Irre geflatterten Blätter auf; sie warf sie auf den leuchtenden Haufen auf ihrer Seite, ohne auch nur ihren Fuß über die Grenze zu setzen. Einmal, als drei Laubzweige außerhalb Katerinas Reichweite waren, schob Eufemia sie mit ihrem Schuh näher.
Dann gingen sie ins Haus, die gemeinschaftlichen Eigentümerinnen, die doch offenbar die meiste Zeit einträchtig unten im großen Empfangsraum verbrachten, wo sie vor dem Fernsehapparat saßen, mit den Gästen schwatzten oder zum Empfangstisch eilten, um Neuankömmlinge einzutragen und ihnen ihre Zimmer zu zeigen. Manchmal erblickte Robert beim Hinein- und Hinausgehen Eufemia allein hinter dem Empfangstisch, wie sie Abrechnungen machte oder Anrufe entgegennahm; zu anderen Zeiten waren sie beide gemeinsam dort beschäftigt, und dann rückte die eine die Ansichtskarten auf dem Ständer gerade, während die andere einem Gast eine Briefmarke oder eine Reisebroschüre aushändigte. Bei diesen Gelegenheiten waren sie zu allen und zueinander so gleichermaßen liebenswürdig, daß sie miteinander austauschbar schienen. Nachdem die Frauen hineingegangen waren, betrachtete Robert noch eine Weile sinnend den leeren Garten, dann riß er sich aus seiner Untätigkeit und ging in sein Zimmer zurück.
Auf der letzten Etappe seiner Reise von Paris fuhr Mark Curran über den Straßendamm in Richtung Venedig. Das flache Wasser der Lagune dehnte sich zu beiden Seiten im schwindenden Licht. Mark Curran war gekommen, um mit Robert reinen Tisch zu machen; er war reich an Vermögen und an Erfahrung, ein Mann von zweiundsechzig, mit festgegründeten, kultivierten Neigungen und wenigen Zweifeln.
Er ließ sich lieber mit ›Curran‹ als mit seinem Vornamen anreden, und das aus Gründen, die schwer zu enträtseln waren – wie beispielsweise, daß er es haßte, wenn ihn jemand bemitleidete oder meinte, daß er Mitleid nötig habe. Als fürchtete er, Mitgefühl zu wecken, wenn man ihn Mark nannte.
Die Tatsache, daß er seinen Freunden als ›Curran‹ und flüchtigen Bekanntschaften als ›Mr. Curran‹ bekannt war, hatte eine merkwürdige Wirkung auf seine Beziehungen zu Frauen. Abgesehen von den Frauen, die sehr jung und frei waren oder aber abgebrüht wie jene älteren, die ihn anriefen und sagten: »Ach, sind Sie das, Curran?« (als wäre er der Butler), blieben die meisten bei ›Mr. Curran‹, und das hielt sie geziemend auf Distanz. Tatsächlich hatte Currans simple, in einer Mischung aus Spaß und Ernst hingeworfene Redensart: »Ich ziehe es vor, wenn meine Freunde mich einfach Curran nennen«, vielerlei seltsame Auswirkungen auf sein Leben. Sie zwang die Männer, mit denen er gesellschaftlich verkehrte, zu einem Stil ›von Mann zu Mann‹: »Mein lieber Curran, ich komme auf der Durchreise nach Paris …«, und er pflegte seine Briefe mit ›Dein Curran‹ zu unterzeichnen, was auch immer er dem lieben James, dem lieben Arthur oder dem lieben Robert schrieb.
Voll des Bewußtseins, Curran zu sein, fuhr er nach Venedig hinein. Er kannte Venedig gut, war es doch für den größten Teil seines Lebens sein Hoheitsgebiet gewesen, nämlich Ende der dreißiger Jahre und seit Kriegsende, als er endgültig seiner Heimat den Rücken gekehrt hatte. Einmal im Jahr kehrte er in die Vereinigten Staaten zurück, um einige alternde Mitglieder seiner Familie aufzusuchen und jene Dinge zu erledigen, die erledigt werden mußten. Paris war sein Hauptquartier, von wo aus er herumreiste, wenn eine Veränderung angezeigt war. Er war oft in London, oft in Südfrankreich, oft auf Capri, manchmal in Florenz und weniger häufig in letzter Zeit in Rom. Er reiste kaum je nach Deutschland, es sei denn, er wollte ein Bild kaufen, und die Schweiz ließ er links liegen. Venedig schien ihm als sein Hoheitsgebiet sehr gemäß; es veränderte sich weniger als andere Orte im Lauf der Jahre.
In Gedanken bei der Zeit und ihrem Lauf und wie immer voll des Curran-Gefühls ließ er seinen Wagen am Bahnhof stehen und nahm ein Wassertaxi zum Hotel Lord Byron.
Hinter dem Campo di Santa Maria Formosa erstreckte sich ein Netzwerk von Straßen und schmalen Abwasserkanälen, wo es bei Flut nach toten Fischen roch und bei Ebbe noch übler. Das verpestete Wasser schlug zu beiden Seiten leise an die unteren Türen der hohen Gebäude; doch diese Türen waren für immer geschlossen. Die Eingänge zu den Häusern befanden sich auf der anderen Seite, in einer schmalen Gasse zwischen den Wasserwegen.
Lina Pancev wohnte in einem Zimmer hoch oben in einem dieser schmalbrüstigen Häuser. Von der Straße her gesehen ragte das Zimmer wie ein großer Vogel hervor; ein gefährlich aussehendes Stück Maurerarbeit, doch nicht mehr so gefährlich, wenn man davon ausging, daß der Vogel fliegen konnte. Der Schnabel, der aus dem kleinen Fenster hervorsprang, war in diesem Moment frei von Wäsche, und im Gegensatz zu den Fenstern darunter, die tiefer in die Mauer eingelassen waren, war der kleine schwarze Mund geschlossen. Um die luftige Mansarde zu erreichen, mußte man zunächst fünf gewundene Treppen hinaufklettern, bei denen jede Stufe in der Mitte zu einer dünnwandigen Mulde ausgetreten war. Aus dem eisernen Geländer, das in den unteren Stockwerken in verschnörkelten Mustern gearbeitet war, wurde bald eine rostige verbogene Stange, zu wacklig und beschädigt, um noch verläßlich zu sein. Der Geruch und der Anblick von Ratten, Katzen und Möwen am Eingang machten beim Höhersteigen diversen anderen, scheußlicheren Gerüchen Platz. Hatte man die Treppe dann erklommen, kam die Mutprobe, die Herausforderung: Zwei Bretter, etwa drei Fuß lang, führten vom Treppenabsatz, der selbst eine Neigung von mehreren Grad hatte, hinüber zur Schwelle von Lina Pancevs Horst. Die Frage, was dagewesen war, bevor die Bretter gelegt wurden, hätte jedem Architekten Kopfzerbrechen bereitet; das Gebäude war wenigstens drei Jahrhunderte alt, und die Dielen selbst sahen aus, als hätten sie mindestens schon zehn Jahre dort gelegen, und wie das überhängende Zimmer, in dem Lina Pancev wohnte, dem Gesetz der Schwerkraft so weit widerstand, daß es seinem Zweck entsprechen konnte, hatten vielleicht nicht einmal die ursprünglichen Erbauer gewußt. Das Haus war schon seit vielen Jahren von den Behörden zum Abbruch freigegeben, aber noch voll bewohnt; seine düsteren und unreinlichen Toiletten auf jedem Treppenflur legten sichtbares Zeugnis von der Anwesenheit der Mieter ab.
Als Robert Leaver über die Bretter zu Linas Tür balancierte, konnte er der Versuchung nicht widerstehen, durch den Schlitz zwischen ihnen hinunterzublicken, wie er das bei seinem ersten Besuch getan hatte. Die Bretter federten; ein jäher langer Absturz auf die schmale Straße in der Tiefe. Er drückte auf die Glocke, die erstaunlicherweise nicht nur funktionierte, sondern sogar mit elektrischem Strom betrieben wurde.
»Wer ist da?« rief Lina auf italienisch.
»Ich bin’s«, antwortete Robert auf englisch.
Sie öffnete die Tür und ließ ihn in ihr Zimmer, in dem eine Lampe brannte.
»Hast du deine Taschenlampe mitgebracht?« fragte sie.
»Ach, die hab ich wieder vergessen!«
»Dann muß ich dich mit meiner runterbringen, wenn du gehst.« Es wurde schon Abend, und es gab keine Beleuchtung für die unwirtliche Treppe, außer hier und dort einen Fensterschlitz auf einem Treppenabsatz. »Ich muß mit dir runtergehen und dann den ganzen Weg wieder raufsteigen. Die Batterien sind teuer.«
Aber es schien ihr nicht aufzufallen, daß ihre Begrüßung für Robert eigentlich kein Willkommen war. Er akzeptierte es auf eine beiläufige, benommene Art, in Gedanken offensichtlich mit weit dringenderen Dingen beschäftigt. Drinnen im Zimmer mußte er bergab zu einem schweren Sessel mit vielen Baumwollkissen und zerborstenen Sprungfedern gehen, der mehr oder weniger am Hang verankert war. Robert saß schief wie ein Paralytiker und erzählte Lina, daß Curran in Venedig eingetroffen sei. »Er hat mich aus heiterem Himmel angerufen«, sagte Robert.
»Aus heiterem Himmel?« echote sie. Sie blickte auf ihren schlichten Arbeitstisch aus Holz: ein zugeklappter Malblock, Pinsel in einem mit grauem Wasser halb gefüllten Marmeladenglas.
»Unerwartet«, erklärte er mürrisch.
»Oh, aber du mußt ihm deine Nummer gegeben haben«, meinte Lina, »wie hätte er dich sonst finden können?«
»Das würde Curran nicht schwerfallen; in diesem Fall brauchte er ja nur den Portier seines Hotels bei den bekannten Pensionen anrufen zu lassen. Im übrigen ist Curran daran gewöhnt, Leute ausfindig zu machen.«
»Wenn das so ist, kann er womöglich meinen toten Vater ausfindig machen.«
»Das wäre möglich«, sagte Robert.
»Gut«, versetzte sie, ihn beim Wort nehmend.
»Du scheinst ja sehr erfreut darüber«, bemerkte er, »daß Curran hier ist.«
»Nun ja«, erwiderte sie, »ich rivalisiere niemals und mit niemandem. Das habe ich dir gesagt.«
»Du möchtest Curran benutzen«, stellte er fest.
»Warum nicht, wenn er nützlich sein könnte?«
»Curran malt übrigens auch«, sagte Robert. »Ich kann es nicht beurteilen, aber er verkauft seine Bilder, abstrakte Ölbilder. Er kriegt einen Haufen Geld dafür.«
»Von wem? Von seinen tollen Freunden?«
»Ausschließlich von seinen Freunden. Sonst geht kein Mensch zu seinen Ausstellungen.«
»In Bulgarien war es auch so«, sagte Lina. »Aber da hatte ich selbst eine Menge Freunde.« Sie war sehr gelassen, nicht im geringsten gegen Curran aufgebracht wie zwei andere Maler, die Robert in Paris kannte. Sie machte einen Teil des Tisches frei. »Meine Freunde waren arm, aber Currans Freunde sind reich.« Es klang wie eine Zeile aus einem Kindervers.
Sie setzte ihren Spirituskocher auf eine hölzerne Obstkiste. Aus einem großen altmodischen Krug goß sie Wasser in einen Kochtopf und stellte ihn auf den Kocher.
»Erzähl mir die ganze Geschichte«, schlug sie vor, warmen Trost in der Stimme.
»Kommt nicht in Frage«, versetzte er. »Sei nicht so neugierig.«
»Ich zahle keine Miete mehr«, erzählte sie ihm, ihrem eigenen Gedankengang folgend. »Freitag war Zahltag, aber ich zahle nicht mehr, weil meine Nachbarn mich gebeten haben, mit ihnen in Streik zu treten. Wir wohnen in einem Haus, das die Behörden für baufällig erklärt haben; folglich hat der Besitzer kein Recht, die Zimmer zu vermieten. Er ist wütend. Die Miete ist sehr niedrig, aber ich zeige Solidarität«, sie stellte die Flamme ein. »… mit meinen Nachbarn«, fügte sie hinzu, während sie die Spaghetti über den Topf hielt, bereit, sie hineinfallen zu lassen, sobald das Wasser kochte. »Und wenn ich will, kann ich hier auch kochen, weil alle anderen es auch machen. Von heute an schmuggle ich die Abfälle nicht mehr hinaus. Ich werfe sie in den Kanal wie die anderen, wenn kein Polizeiboot in der Nähe ist.«
Robert sah ihr zu, während sie kochte; ein kleiner Topf, Zwiebeln, geschälte Tomaten aus der Dose, ein wenig Öl, noch ein wenig. Ihr schwarzes Haar mit dem Pagenschnitt glänzte; sie hatte Haar, wie Friseure es lieben, und es sah nach einem teuren Schnitt aus, obwohl das unwahrscheinlich war. Sie hatte apfelrote Wangen und weiße Zähne und sah aus, als käme sie vom Balkan, wie eine der Trachtenpuppen in den Souvenirläden. Ihre skrupellose Geschichte über die Miete gefiel ihm; ja, in einer Beziehung stimmte er ihr hinsichtlich der Miete zu, sosehr er in anderer unterschiedlicher Auffassung war. Während seines Studiums hatte er Mädchen ohne materielle Skrupel gekannt, wie sie es formulierten. Seine Mutter hatte dagegen strenge Prinzipien: Mein ist mein, und dein ist dein.
Lina plapperte weiter. Nach einer Weile unterbrach er: »Was hast du eben gesagt, Lina?«
»Du hast nicht zugehört.«
»Doch, ich hab’s nur nicht mitgekriegt –«
»Wovon habe ich gesprochen?«
»Du hast ›Eier‹ gesagt. – Was ist mit den Eiern?«
Sie machte sich an ihrem Spirituskocher zu schaffen, schob die beiden Töpfe, den großen und den kleinen, abwechselnd über die Flamme. »Ich sagte, daß das alles ist, was ich dir bieten kann. Morgen gehe ich los und kaufe ein paar Eier.«
»Das ist sehr lieb von dir«, sagte er. »Und du bist eine bezaubernde Frau.«
»Ich bin müde«, erklärte sie. »Wann triffst du dich mit Curran?«
»Morgen, am Abend.«
Morgen, am Abend, wanderte Robert unter den klaren Sternen und über ihrem Widerschein im Wasser durch die Gassen und über die Brücken zu Harry’s Bar, setzte sich unten hin und wartete. Der ältere Mann wirkte, als er eintrat, wohlhabender als gewöhnlich, ganz wie der reiche ältere Freund eines netten, gutaussehenden und schlanken jungen Studenten.
»Tja«, sagte Curran, »schön, dich wiederzusehen, Robert. Ein glücklicher Zufall, daß ich dich in Venedig gefunden habe.«
»Es war wirklich ein glücklicher Zufall«, erwiderte der junge Mann munter.
»Hast du schon mal hier gegessen?« fragte Curran, obwohl er wußte, daß Harry’s Bar über Roberts Verhältnisse ging und daß dies sein erster Besuch in Venedig war.
»Ich habe ein preiswertes Restaurant gefunden«, erklärte Robert fest. »Und es gibt Imbißstuben.«
»Ach ja, natürlich. Wir können dafür heute abend opulent speisen, wenn du meinst, daß das eine Abwechslung wäre. Ich habe oben einen Tisch bestellt. Aber zunächst einmal, was möchtest du trinken?« Sie saßen an einem Tisch in der Nähe der Bar.
Um sie herum war das Summen und der ungedämpfte Lärm aus vielfältiger Tätigkeit zu hören, das Scharren von Stühlen und Füßen, Gespräche an der Bar und an den anderen Tischen, das Geräusch der Tür, die mit dem Eintritt neuer Gäste aufschwang, und das ständige Klirren von Flaschen und Gläsern an der Bar. Alles zusammen gab eine gute Kulisse für ihr Treffen ab. Robert war erleichtert, daß Curran ihn nicht an irgendeinen ruhigen Ort gebeten hatte, und als sie jetzt auf ihre Whiskys warteten, fiel ihm nicht ein, daß er ja überhaupt nicht hätte kommen müssen.
»Was führt dich nach Venedig?« fragte er Curran einladend.
»Die Macht des Willens«, antwortete Curran, als hätte es kein ›Leb wohl, leb wohl, leb wohl‹ gegeben und keine lautstarken Vorwürfe vorher. »Und was ist mit deinen Studien?«
»Kunstgeschichte kann ich hier genausogut betreiben wie in Paris. Vielleicht besser. Venezianische Architektur und Kunst. Ich kann umsteigen.«
»Wie?«
»Du kannst es für mich arrangieren«, sagte Robert. »Ich kann mein Stipendium wechseln und in Venedig eine Arbeit schreiben.«
Curran lachte. »Hast du damit gerechnet, daß ich kommen und alles für dich arrangieren würde?«
»Kann sein, ja, vielleicht.«
»Und welchen Aspekt von Venedig würdest du dir vornehmen? Ich könnte mich bestimmt nicht entscheiden, wenn ich an deiner Stelle wäre. Und du würdest dich wundern, wieviel ich über Venedig weiß. Ich war als junger Mann hier. Ich war am Ende des Krieges hier. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft, immer wieder … Und doch, wo anfangen?«
»Wenn du anfangen müßtest, würdest du auch anfangen.«
»Wahrscheinlich, allein mit bloßer Willenskraft. Ich habe einige meiner besten Bilder in Venedig gemacht, aber selbstverständlich ist das etwas anderes.«
»Also«, sagte Robert, »wenn man anfängt, sich mit einem Thema zu befassen, sammelt man so viele Details wie möglich, dann sucht man die Charakteristika heraus, die ihnen allen gemeinsam sind, und dann entwickelt man die allgemeinen Grundzüge.«
»Sehr aufschlußreich soweit«, erwiderte Curran. »Aber was du da geschildert hast, dürfte eine Lebensaufgabe sein, wenn du gründlich arbeiten willst, und du bist noch nicht einmal eine Woche hier. Möchtest du noch einen Drink, oder wollen wir hinaufgehen?«
Sie gingen nach oben zum Abendessen. Robert sagte: »Ich fange mit der Santa Maria Formosa an. Sie ist mit ihren vielen Rundungen ein höchst ungewöhnliches Bauwerk.«
»O ja, die kenne ich. Wie bist du auf sie gekommen?«
»Sie war das erste, was ich sah, als ich aus der Pension trat. Da kann ich genausogut mit ihr anfangen. Ich habe schon in der Bibliothek nachgeschlagen. Es gibt ein paar verschwommene Legenden über den Namen, aber meine These ist, daß der Name Santa Maria Formosa ursprünglich von dem ›formosa‹ aus dem Hohenlied Salomos kam. In der lateinischen Bibel heißt es: Nigra sum sed formosa – ›Ich bin schwarz, aber gar lieblich‹. Den frühen Theologen zufolge war das eine Vorankündigung der Madonna. Jetzt habe ich zufällig entdeckt, daß es in der hebräischen Urfassung heißen könnte: ›schwarz, aber lieblich‹ oder ›schön‹ oder ›wohlgestaltet‹, und es könnte ebenso heißen: ›schwarz und lieblich‹, oder aber es könnte heißen: ›schwarz, deshalb lieblich‹. Ich habe daher vor, eine Dissertation zu schreiben …«
Curran hob die Hand, um auf den Kellner hinzuweisen, der neben dem Tisch stand. »Wir sollten bestellen«, sagte er.
Und als sie bestellt hatten, meinte er: »Erzähl weiter.«
»Langweilt es dich?« fragte Robert.
»Deine Dissertation dürfte interessant werden.«
»Das schien mir auch so.«
»Ich muß sagen, du hast in ziemlich kurzer Zeit eine ganze Menge nachgedacht.«
»Ja, das habe ich«, bestätigte Robert.
»Es ist gut möglich, daß die Kirche auch nur nach ihrer eigenen Gestalt benannt wurde. Ganz einfach«, sagte Curran. »Und weil wir gerade von Gestalt sprechen: Du hast mir nichts von dem Mädchen erzählt.«
»Von welchem Mädchen?«
»Wie viele gibt es denn?«
»Nur eine, die zählt.«
»Sie ist gefährlich. Geh ihr aus dem Weg.«
»Bist du deshalb hergekommen? Um mir das zu sagen?«
»Ja. Lina Pancev, die Tochter von Victor Pancev, einem Bulgaren, den ich vor dem Krieg kannte. Er stand im Verdacht, an einem Komplott zur Vergiftung von König Boris beteiligt gewesen zu sein, der in der Tat an einer Vergiftung starb. Pancev entkam, aber 1945 erwischten ihn die bulgarischen Royalisten und töteten ihn. Das war der Vater deiner Freundin.«
»Nun, das ist lange her. Da war ich noch nicht mal geboren.«
»Die Tochter schon; sie ist nicht mehr so jung wie du.«
»Du auch nicht mehr wie sie.«
»Ich spiele dabei keine Rolle. Ich bin nur gekommen, um dir zu sagen, daß diese Frau gefährlich ist. Sie ist aus Bulgarien geflohen, und mir scheint, daß sie überwacht wird. Wie ist dein Steak?«
»Was?«
»Was du da ißt. Ist es in Ordnung?«
»Ja, es ist gut. Ich merke gar nicht, was ich esse.«
»Ihr jungen Leute tut das nie. Also, sie wird von irgendwelchen Agenten überwacht, wahrscheinlich vom Balkan. Die mögen es nicht, wenn Leute sich einfach davonschleichen.«
»Hör mal, für die ist sie doch nur ein kleiner Niemand –«
»Sie war letztes Jahr mit einer Gruppe bulgarischer Kunsterzieher in Paris, und sie trennte sich von der Gruppe. Sie sind hinter ihr her.«
»Die Pariser Polizei weiß über sie Bescheid. Sie hat Asyl erhalten«, erklärte Robert. »Es ist alles in Ordnung.«
»Woher weißt du das?«
»Was hat das überhaupt mit mir zu tun? Sie sucht hier in Venedig das Grab ihres Vaters, und ich helfe ihr.«
»Wir reden im Kreis. Du bist in Gefahr, wenn du mit ihr gesehen wirst.«
»Du meinst«, sagte Robert, »ich bin in Gefahr, deine Freundschaft zu verlieren, wenn ich mit ihr gesehen werde. Meinst du, ich habe Angst? Ich habe ein Recht darauf, ein Mädchen zu haben. Glaubst du vielleicht, ich sei unmännlich?«
»Schrei doch nicht so. Wir werden wahrscheinlich sowieso belauscht.«
»Du hältst mich für unmännlich. Ich habe dir schon gesagt, daß ich mich nicht etikettieren lasse«, erklärte Robert.
»Ich halte dich sogar für übermäßig männlich«, versetzte Curran.
Robert sah sich im Raum um. Die anderen Gäste saßen alle in Gruppen, eifrig damit beschäftigt, zu reden und zu essen, zu bestellen und zu trinken, zu lachen, zu lächeln. Sie wirkten so, als hätten sie nichts als ihr eigenes Leben im Kopf und als trügen sie an ihren gutgekleideten Körpern nicht einmal das besondere Merkmal einer Lauschvorrichtung. Andererseits, aufgepaßt: Jeder einzelne Gast konnte in der Lage sein, seinen augenblicklichen Aktionsradius zu vergrößern. Das Lokal konnte voller Spitzel sein, woher sollte man das wissen?
»Weißt du«, sagte Robert, »ich glaube nicht, daß sie überwacht wird. Das ist nur ein billiger Trick von dir.«
»Wozu?« entgegnete Curran. »Warum? Weshalb sollte ich mir deinetwegen Umstände machen?« Er blickte sich im Saal um. »Zufällig«, bemerkte er, »sind diese Leute, die dir und Lina Pancev ständig folgen, heute abend nicht hier. Ich hielt es allerdings auch für unwahrscheinlich, daß sie hier sein würden.«
»Die Art, wie du dich hier umschaust, macht mich fertig«, sagte Robert, »als gehöre dir der Laden.«
»Daß du immer nörgeln mußt!« sagte Curran. »Wie eine gutbürgerliche Ehefrau.«
»Was gibt’s denn am Bürgertum auszusetzen«, entgegnete Robert, »außer daß Leute wie du dazugehören?«
»Männer wie du«, versetzte Curran, »das gibt’s am Bürgertum auszusetzen. Früher brachten die englischen Internate Helden hervor, heute nur noch Hamletfiguren.«
»Wenn du Männer wie mich nicht magst«, fragte Robert tückisch, »was tust du dann in Venedig?«
Nach dem Essen durchquerten sie schnell die kühlen Gassen und Plätze, wo die Seitenkanäle schlecht beleuchtet waren und die Zukunft über die nächsten paar Schritte hinaus im Dunkeln lag. »Es wäre leicht …« bemerkte Curran, wie praktisch jeder Besucher Venedigs früher oder später, »kinderleicht – nicht wahr? –, jemandem ein Messer hineinzustoßen, ihn in den Kanal zu befördern und einfach weiterzugehen.« Worauf Robert Curran so bestürzt ansah, daß Curran lachte.
Man konnte ein Motorboot hören, das sich aus einem Seitenkanal vor ihnen näherte. »Das ist die Hafenpolizei«, sagte Curran. Das Brummen eines ruhig laufenden Motors folgte. »Das ist die Wasserpolizei«, ergänzte Curran.
»Du siehst gut aus«, stellte Curran fest.
»Geh zum Teufel.«
Robert hatte Curran im Empfangsraum der Pensione Sofia vorgefunden, wo er mit Katerina und Eufemia an einem Tisch saß. Es war später Vormittag. Robert war mit der englischen Zeitung in der Hand durch das Portal gekommen, und Curran saß dort und plauderte mit den Frauen, als habe er sie schon sein Leben lang gekannt.
Die Frauen zogen sich diskret zurück, als Curran aufstand, um Robert zu begrüßen. Und »Geh zum Teufel« sagte Robert, als Curran mit seinem »Du siehst gut aus« herausrückte.
»Aber gestern hast du schlechter ausgesehen«, erklärte Curran. »Da hat dich gewiß etwas bedrückt.« Gleichmütig, mit seinen Blicken alles umfassend, sah Curran sich um, als wäre er der Eigentümer des Hauses. »Bei Tag«, bemerkte er, »ist das Innere dieses Hauses immer bezaubernd gewesen. Die Treppe …« Er ließ seine Augen sinnend auf der Treppe ruhen.