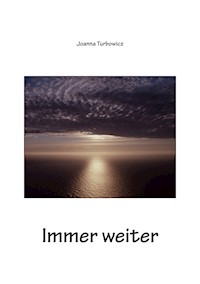
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Krebs. Diese Diagnose erschüttert jeden - auch die Autorin Joanna Turbowicz. Doch so leicht gibt sie nicht auf. Eine ihrer Waffen gegen die Krankheit ist dieses Buch: ein Tagebuch, in dem sie über den Verlauf ihrer Erkrankung berichtet. Ob Chemotherapie oder Bestrahlung, Perücke oder Operationsnarben - sie wird nie larmoyant und verliert nie ihren Humor. Schließlich gibt es ja auch noch andere Dinge, die wichtig sind: Der Sohn macht Abitur, die Katze bricht sich die Beine, die beste Freundin feiert einen runden Geburtstag. Das Leben will gelebt werden, findet Joanna Turbowicz und das tut sie auch - trotz allem. «Man stirbt erst, wenn man nicht mehr lachen kann», schreibt sie. Ihr Credo: Selbst in den schwarzen Phasen des Lebens gibt es Glücksmomente, man muss sie nur erkennen. Ihre Motivationstricks sind ebenso überraschend wie nachahmenswert, und was sie zum Thema Glück, Liebe, Heimat, Freundschaft oder Lebenspläne zu sagen hat, das hat Witz, Tempo und Esprit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
© 2022 Joanna Turbowicz
2. Auflage, Vorgängerausgabe 2005
ISBN Softcover: 978-3-347-76818-5
ISBN E-Book: 978-3-347-76819-2
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung „Impressumservice“, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Joanna Turbowicz
Immer weiter
„Denken ist nie unpersönlich. So abstrakt es auch werden kann, es beginnt immer als ein Versuch, ein persönliches Problem zu lösen.”
Connie Palmen
Für Julian
Montag, 29. April 2002
Nie hätte ich gedacht, dass es mich eines Tages trifft. Das klingt so banal, und doch steht dieser überraschende Tatbestand - denke ich - am Anfang jeder Überlegung. Jeder denkt das. Jeder ist erstaunt, wenn er zur Zielscheibe wird, welcher auch immer. Man muss da nolens volens durch, erst dann kann man den Gedanken zulassen und sich mit dem Geschehenen auseinandersetzen. Ich weiß, ich werde mit der Situation fertig, wenn ich mich mit ihr „anfreunde”. Na ja, das ist vielleicht zuviel. Sagen wir, ich akzeptiere sie.
Nun also: Krebs. Ich darf mich nicht beklagen. Es ist „nur” Hodgkin. Da sind die Heilungschancen gut. Das sagen zumindest alle. Die Leute, die jemanden kennen, der Hodgkin hatte, die anderen, die mal was darüber gelesen haben. Und auch die Ärzte. Die Genesungschancen stehen immerhin 90 zu 10. Ausnahmsweise also möchte ich mich denn doch lieber zur Masse bekennen und dazu gehören, während ich ja sonst arrogant auf meiner Individualität beharre. Oder auch darunter leide - wenn ich gerade wieder mal zwischen allen Stühlen sitze. Aber das ist ein anderes Thema.
Heute habe ich definitiv erfahren, dass ich krank bin. Geahnt habe ich es schon vorher. Seit Freitag, um es genau zu sagen. Ganz seltsam war das. Ich lag auf der roten Couch und las, als mich die Ahnung überfiel. Mein zweites Gesicht nenne ich das. Und auf das Wort „überfiel” lege ich viel Wert. Diese Ahnungen kommen tatsächlich ganz plötzlich und massiv und treffen mich wie ein Hammerschlag. Leider handelt es sich dann meistens um unangenehme Dinge. Ich habe den Tod meiner Mutter genauso geahnt wie die Untreue meiner großen Liebe. Oder die Gefahr, die Julian bei seiner Geburt bevorstand. Gott sei dank - in diesem Fall zumindest.
Ich werde nie vergessen, wie das war. Ich war damals Patientin bei Dr. Rexilius, dem berühmten Frauenarzt, der sanfte Geburt, damals noch ein Novum in Deutschland, propagierte. In seiner Klinik in Starnberg zu entbinden, war ein Privileg, um das mich Hunderte von anderen Schwangeren beneideten. Doch als ich einmal - ich war etwa im fünften Monat - das Krankenhau besichtigen wollte, überfiel mich (ja, auch damals) schon beim Eingang Panik. Es war mir unmöglich, das Haus überhaupt zu betreten. Es war wie Atemnot. Nur weg hier, war mein einziger Gedanke. Also bin ich geflüchtet, habe den Arzt gewechselt und landete in der Uniklinik in München. Hier, in diesen alten und leicht muffigen Räumen fühlte ich mich wohl. Und hier hat man auch Julian - und wahrscheinlich auch mir - das Leben gerettet. Wir wurden nämlich beide nach der (übrigens wunderbaren und trotz aller Umstände sanften) Geburt todkrank und landeten jeweils auf der Intensivstation. Ohne die Vorrichtung des fahrbaren Brutkastens, in dem Julian sofort künstlich beatmet werden konnte, hätte er es nicht überlebt. Oder er bliebe in seiner Entwicklung zurück, wie so viele, die bei der Geburt Sauerstoffmangel gehabt haben.
Doch zurück zu der roten Couch. Vielleicht waren meine Ahnungen diesmal nicht ganz so stürmisch. Immerhin zieht sich die Hodgkinstory schon seit mehreren Monaten.
Mit einem kleinen Knoten im Gesicht, rechts neben der Falte zwischen der Nase und dem Mund hat es angefangen. Harmlos, sagten die Röntgenologen nach der Computertomographie, zu der mich Didi, ein seit Jahren mit uns befreundeter Chirurg, geschickt hat. Klein und abgekapselt saß das kleine Ding, das auf den 3D-Fotos wie ein Kirschkern aussah, allerdings an einer sehr ungewöhnlichen Stelle. Wenn es wächst, erklärte mir Didi, kann es auf diesen Muskel drücken, dessen Namen ich mir nicht merken, der aber das Gesicht lähmen kann.
Raus also! Doch weil es im Gesicht war, und wohl auch an einer so komplizierten Stelle, schickte er mich zum Professor Mühlbauer. Der berühmteste Schönheitschirurg Münchens war sein Doktorvater. Ich weiß, dass er schon so manchen Star und so manche der Jet Set-Ladies operiert hat. Immerhin - so lernte auch ich ihn kennen. Ich war an diesem Nachmittag bestimmt die einzige „Dame”, die nicht nur aus kosmetischen Gründen bei ihm war. Und die nach der Visite nicht im Sekretariat das Portemonnaie zückte, um das Beratungshonorar sofort und cash zu zahlen. Immerhin: Ich fühlte mich als etwas Besonderes. Keine Masse. Damals zumindest noch nicht. Kurz und gut, der Kirschkern kam Anfang Februar heraus und alles war gut.
Dachte ich. Doch als ich wieder dort war, diesmal um die Nähte ziehen zu lassen, sagte der Professor, er hätte leider eine schlechte Nachricht. Wahrscheinlich hätte ich Hodgkin. Das sei nicht ganz tragisch, weil es dafür gute Heilungschancen gibt, aber dennoch… Doch er lässt meinen Kirschkern noch in Würzburg untersuchen, dem besten und bekanntesten Institut für solche histologischen Untersuchungen, um ganz sicher zu sein.
Hodgkin. Dieses Wort habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Die Faust in meinem Magen, die sich da aber plötzlich eingestellt hat und das Gesicht des Professors verhießen nichts Gutes. Zuhause setzte ich mich sofort an den Computer.
Google, meine Lieblingssuchmaschine wusste Bescheid. Und ich dann auch. Aber erstens war es ja noch gar nicht sicher. Zweitens sollte ich 10 Tage später mit meinen Freundinnen nach Südafrika und drittens - ich bin cool. Ich bin stark, zeige keine Schwächen und alle, die mich kennen, sagen, dass ich eine starke Frau bin. Ich bin stolz darauf, also zeige ich mich noch stärker als ich bin. Ich muss ja die Erwartungen erfüllen. Mehr noch vor mir als vor den anderen, obwohl ich selbst doch ganz genau weiß, wie schwach und verletzlich ich letztendlich bin.
Doch erst mal: Gelernt ist gelernt. Hodgkin ist ein Lymphdrüsen-Krebs. Im Gegensatz zu anderen Krebsarten, die punktuell eine bestimmte Körperstelle angreifen, ist das eine Systemerkrankung, ähnlich der Leukämie, dem Blutkrebs also. Symptome: Alkoholschmerzen, also Kater, Schweißausbrüche, Gewichtsabnahme und Knoten am Hals, in der Leiste oder unter den Armen. Die Gewichtsabnahme hätte ich noch am liebsten in Kauf genommen, gehöre ich doch zu den Verrückten, die ständig und erfolglos irgendeine obskure Diät probieren. Kater hatte ich nicht - das habe ich sofort ausprobiert, aber Knoten… ja… doch. Einen habe ich in der Leistengegend ertastet. Und noch einen, in der rechten Hand. Ich telefonierte mit Didi. In der Hand gibt es keine Lymphknoten, sagte er mir. Und das mit dem Hodgkin, das sollten wir erst in Ruhe abwarten. Ich sagte, ich würde sowieso erst nach Afrika fahren, egal, was wäre. Ich freute mich wahnsinnig auf diese Ferien, auf das Haus, das ich schon kannte, auf die Sonne und zwei Wochen Spaß mit meinen Freundinnen.
Ich fühlte mich gut. Eigentlich überhaupt nicht anders. Natürlich erzählte ich von meiner - vorerst noch vermuteten - Krankheit einigen Leuten. Ein paar Freunden. Und auch meinen Kolleginnen in der Literaturhandlung, wo ich gerade arbeitete. Meine „Krankheit”, die ich weder sah, noch spürte, gab mir eine Aura von Dramatik und ein Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Gerade, weil ich so nüchtern und leidenschaftslos damit umgehen konnte. Man bewunderte meine Haltung. Und ich gebe es unumwunden zu: Das schmeichelte mir. Ich war mir nicht ganz sicher, was mich so unerschütterlich machte. Die Eitelkeit, so stark zu sein? Mein Phlegma? Meine fatalistische Einstellung zum Leben? Oder einfach nur der Optimismus, dass sich die Vermutungen ohnehin als unwahr erweisen werden?
Noch in Afrika erreichte mich tatsächlich die Nachricht, der Verdacht auf Hodgkin wäre unbegründet. Ich sei gesund. Im fernen Deutschland machte Uli eine Flasche auf, und auch meine Freundinnen feierten diese Botschaft ganz ausgelassen und erleichtert. „Du meine Güte”, sagte eine von ihnen, „bin ich froh!” Ich war es nicht. Zumindest nicht ganz so. Da gab es ja noch den anderen Knoten, in der Leiste. Und den in der Hand. Nein, ich war auf der Hut und wollte nicht zuviel Fröhlichkeit zulassen, um spätere Enttäuschungen zu vermeiden.
Irgendwann im Mai kam dann der Leistenknoten weg, und Didi, der mich diesmal selbst operierte, wischte meine Bedenken fort. In dem ersten Knoten habe man zwar „antireaktionäre Zellen” gefunden, die den Hodgkinzellen ähnlich sind. Das könnte aber auch eine autoimmune Krankheit sein oder vielleicht sonst irgendetwas völlig Harmloses. Wenn wir das neue Ergebnis bekommen, werden wir uns auf die Suche machen. Er kenne auch einen sehr guten Immunologen, der dann weiter weiß. Ich war beruhigt. Bis zu eben diesem Abend auf der Couch. Nur drei Tage später wussten wir alle Bescheid.
Donnerstag, 2. Mai
Schwabinger Krankenhaus heißt nun meine zweite Adresse. Hier werden alle Untersuchungen gemacht, die nötig sind, um die Therapie zu bestimmen. Wieder Didi: Er hat uns Professor N., der diese Station leitet, empfohlen. Und noch bevor ich ihn kennen lerne, weiß ich, dass ich mich hier wohlfühlen werde. Dr. T., der Oberarzt, der mich aufnimmt, ist mir ausgesprochen sympathisch. Er ist langsam und bedächtig. Ich mag das bei Ärzten. Das gibt mir das Gefühl, dass sie wirklich für mich da sind. Außerdem liegt das Krankenhaus ganz in der Nähe von uns. Ich kann sogar zu Fuß gehen. Oder mit dem Rad fahren. Nicht ganz unwesentlich, wenn man bedenkt, dass ich hier in der nächsten Zukunft sehr oft sein werde. Es gibt noch mehr Bezugspunkte. Hier, in der Kinderabteilung, wurde Julians gebrochener Arm eingegipst. Hier ist meine Mutter gestorben. Und Ulis Vater. Doch für mich sind das längst keine unangenehmen Erinnerungen. Einfach Tatsachen. Und sie schaffen ein vertrautes Gefühl.
Gleich die erste Untersuchung mit dem Ultraschall bringt es an den Tag: Ich habe noch mehr Knoten. Der größte ist fast vier Zentimeter groß und liegt rechts in der Leiste, ganz in der Nähe von dem, der bereits rausoperiert wurde. Er liegt zu tief, um ihn als Knoten zu ertasten, und selbst jetzt, wo ich bescheid weiß, fühlt er sich ganz anders an, weil er so groß und so lang ist. Ich jammere ein bisschen, dass er nicht mit dem anderen gleich herausgeschnitten wurde. Doch die Ärzte sagen, dass es keine Rolle spielt. Es hätte ihn sehr gewundert, sagt Professor N., wenn ich keine Knoten mehr gehabt hätte. Doch die Therapie, sagt er, die sei so, wie Zimmer auswischen. Wenn man den Fußboden richtig sauber kriegt, ist es hinterher egal, wo und wie zerstreut die Fussel lagen. Ich liebe Metaphern, und ich finde, diese hat etwas Tröstliches. Ich denke, sie werden mich schon sauber kriegen. Oder?
Freitag, 3. Mai
Julian schreibt seine erste Abiturklausur - Erdkunde. Ausnahmsweise mag er frühstücken, und ich leiste ihm dabei Gesellschaft. Wir sitzen in der Küche an dem alten Holztisch und wie wahrscheinlich alle Mütter, neige auch ich in solchen Momenten zu Sentimentalitäten: Ob er noch weiß, wie oft wir in den früheren Jahren hier Tag für Tag beim Frühstück zusammensaßen? Später, in der Mittelstufe wollte er nur noch allein frühstücken. Und ab der Oberstufe frühstückte er überhaupt nicht mehr. Ich nehme an, das war cooler. Doch ich erinnere mich an alles. An seine Schultüte und die Brille, die er damals noch getragen hat. An alle guten und alle schlechten Noten. Und auch an die unzähligen Stunden mit den ungeliebten Lateinvokabeln, die ich ihn - auch hier an diesem Tisch - abgehört habe. Vor allem aber erinnere ich mich an unzählige ganz köstliche „Sprüche” von ihm: „Ich bin müde und durstig und essig.” Absolut logisch für einen Zweijährigen! Ebenso logisch: „Die Schere geht nicht mehr. Ist ausgeschnitten.” Oder: „Mami, erzähl mit bitte, wie die Welt auf die Welt gekommen ist.”
Mit drei, vier Jahren war mein heute so cooler Sohn ein sensibles, poetisches Kind mit viel Fantasie. Ein paar seiner Gedankensplitter, die zu meinen Lieblingsgeschichten gehören, sind folgende:
Ich liege am Strand mit einem Buch. Der Wind blättert die Seiten um. Darauf Julian: „Der Wind liest Dein Buch”.
Auf dem knallblauen Himmel ziehen Flugzeuge weiße Kondensstreifen. Julian: „Schau mal, das sind die Kreidestriche von den Engeln in der Himmelschule.”
Abends, vor dem Einschlafen, als ich ihm seine zwei kleinen Flaschen Milch bringe: „Immer, wenn ich Milch trinke, ist mir, als ob ich schwebe.”
Wir sind in Verona bei den Festspielen - zum ersten Mal mit Julian. „Nussknacker” steht auf dem Programm. Nach dem Ballett sagt Julian: „Wollen wir nicht runter gehen und dem Dirigenten Dankeschön sagen?” Und später im Auto, als wir darüber reden, ob wir Landstraße oder Autobahn fahren sollen: „Lieber langsam auf der Landstraße, sonst verweht mein Traum.”
Doch junge Männer hassen solche sentimentalen Erinnerungen. Echt ätzend. Zumal am ersten Abitag. Trotzdem bin ich froh und dankbar, dass ich über Nacht nicht im Krankenhaus bleiben musste. Vielleicht bedeutet es ihm wenig, dass wir hier heute zusammensitzen. Mir bedeutet es sehr viel.
Samstag, 4. Mai
Heute Nacht hatte ich einen Alptraum. Ich wurde von einem großen Hund überfallen. Hier, bei uns, in unserer Wohnung, auf dem Flur. Ich schrie „Uli, Uli”, doch mein Mann werkelte in der Küche herum und murmelte nur „gleich”. Ich wollte rufen, dass ich dringend seine Hilfe brauche, doch da saß der Hund schon auf mir, und ich kriegte keinen Ton mehr raus. Da wachte ich auf. Na klar. Jeder aufgeklärte Mensch kann diesen Traum deuten. Auch warum er ausgerechnet heute Nacht gekommen war, ist mir klar. Gestern im Krankenhaus hat der Arzt angedeutet, dass ich um „eine leichte” Chemotherapie wohl nicht herumkommen werde. Chemotherapie ist ein Alptraum. Wie ich wohl ohne Haare aussehen werde?
Eitel wie ich bin, schreckt mich das am meisten.
Meine Zimmernachbarin macht das wohl gerade mit. Als sie gestern kam, hatte sie eine Mütze auf. Später, im Bett sah ich, dass ihr Schädel ganz kahl war. Sie legte sich ein Kissen auf den Kopf und redete den ganzen Tag nicht. Nicht ein Wort. Unangenehm ist das. Wie eine Fessel. Ich traue mich nicht zu telefonieren, jeder Gang zur Toilette ist ein Spießrutenlauf. Und da schwöre ich mir: So nicht. So werde ich weder mit mir noch mit den anderen umgehen. Und wenn es mir noch so schlecht gehen sollte, ich will zumindest versuchen, einigermaßen liebenswürdig zu bleiben. Es ist unfair, andere für das eigene Unglück zu bestrafen.
Abends bin ich auf einem Fest. Ich tanze leidenschaftlich gern, und auch heute tanze ich ganz viel und ganz wild. Meine Freundin Gaby, mittlerweile gut angeheitert und ziemlich aufgelöst, tanzt zwischendurch mit mir. Wir wirbeln zusammen auf der Tanzfläche, lachen und schütteln unsere Haare. Da sagt sie plötzlich zu mir: „Ich liebe dich. Du bist eine wunderbare Frau”. Natürlich weiß sie Bescheid. Und ihre Anerkennung ist für mich ein kostbares Geschenk. Ich besitze seit Jahren ein virtuelles Schatzkästchen, in dem ich die edelsten und prächtigsten Erinnerungen aufbewahre. Da lege ich behutsam auch dieses Kompliment ab. Ich bin sicher, ich werde es noch brauchen.
Sonntag, 5. Mai
Ich schlafe schlecht. Zwischen vielen wirren und schnellen Träumen wache ich immer wieder auf. Vier, fünf Mal die Nacht. An die meisten Träume kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Nur einen habe ich festhalten können. Drei Frauen. Eine, ohne Beine, hockt auf einem kleinen Holzbrett mit Rädern. (Als ich ein Kind war, gab es in Warschau viele solche Bettler. Ich hatte ein unendliches Mitleid mit ihnen, gleichzeitig machten sie mir aber auch Angst.) Die zweite will ihr helfen, eine Treppe raufzukommen. Sie schiebt sie Stufe für Stufe rauf. Die Dritte bin ich. Ich stehe in der Mitte der Treppe, etwas abseits und schaue ihnen zu. Als die Helfende stolpert und wankt, ruft sie um Hilfe. Erst da erwache ich aus einer seltsam starren Lethargie und helfe den beiden. Wir erreichen eine sichere Stufe, halten uns zusätzlich an dem Geländer fest. Dann werde ich wieder wach. Von einem Psychologen hörte ich mal, dass die meisten Personen, die in einem Traum Vorkommen, man selbst ist. In diesem Fall ist es ganz klar. Die Hilflose, die Helfende und Ich, die kühle Beobachterin - das bin alles ich selbst.
Warum ich dieses Tagebuch schreibe? Das hat gleich mehrere Gründe. Zunächst einmal: Wer ein Tagebuch schreibt, ist nicht allein. Er hat - und zwar immer! - einen imaginären Gesprächspartner. Ich habe das zu schätzen gelernt als wir damals aus Polen weg sind. Ich war gerade 14 Jahre alt. In Deutschland kannte ich nicht nur niemanden - ich sprach auch kein Wort Deutsch. Das Tagebuch war die einzige Möglichkeit zu kommunizieren, und sei es mit mir selbst. Zum zweiten: Das Schreiben erzwingt es, die Gedanken zu disziplinieren. „Lesen macht einen Menschen vielseitig. Verhandlungen machen ihn geistesgegenwärtig. Schreiben genau.” Dieser Spruch von Francis Bacon klemmt an der Pinwand in meinem Büro. Ja, Schreiben ist eine gute Sache. Man kriegt nicht nur die Situation in den Griff, man lernt sich dabei auch ganz gut kennen. Und wer sich selbst kennt, kann mit Unbill besser fertig werden. Und dann… na ja… es gibt noch einen Grund. Die Kinder verstehen erst sehr spät, wer ihre Eltern wirklich waren. Und falls ich doch „elitär” zu den 10% gehören sollte, möchte ich, dass mein Sohn trotzdem die Gelegenheit bekommt, mich kennen zu lernen. Nicht als seine Mutter, die ständig etwas an ihm auszusetzen sondern als ein Mensch, von dem er bisher wenig Ahnung hat.
Montag, 6. Mai
Unter dem Gelände des Schwabinger Krankenhauses befindet sich ein unterirdisches Labyrinth mit unzähligen Gängen, die mich an die Kanalisationsfluchtwege aus zahlreichen Thrillern erinnern. Die hier sind allerdings bestimmt sauberer und vorbildlich mit Wegweisern ausgestattet. Diese, unter prachtvollen, grünen Baumalleen gut verdeckte Unterwelt entdeckt man, wenn man mitsamt dem Bett unterwegs ist. Vom Fahrdienst abgeholt - ich musste an den Centro- oder Blitz-Car denken, mit dem manchmal unsere Fotos und Texte transportiert werden - wurde also auch ich durch die Korridore gerollt. Mein „Chauffeur” kennt sich aus.
Er lässt brav einen Wagen mit großer Mülltonne vor, die von links kommt (bestimmt gibt es auch hier unten irgendwelche Verkehrsregeln), weicht geschickt einer Lore mit langer Leiter samt undefinierbarem Gerümpel aus und gelangt, vorbei am „Bettenbahnhof, unreine Seite”, sicher zum Ziel: Die Räume für die Knochenmarkuntersuchung. Das ist weniger lustig. Trotz Lokalanästhesie tut die „Beckenstanze”, so der ärztliche Fachjargon, scheußlich weh. Ich habe auf der OP-Liege recht gejammert und sogar laut geschrieen. Außerdem ist die Vorstellung, dass da sozusagen durch mich durch ein Loch gebohrt wird, ziemlich makaber. Kurz und gut: Mir geht es hinterher - vor allem psychisch - schlecht, und zum ersten Mal muss ich heute weinen.
Ich erfahre in diesen wenigen Tagen, die mich doch ziemlich aus der Bahn werfen, sehr viel Trost. Ich mag kein Mitleid, bin aber auf das Mitgefühl meiner Freunde sehr angewiesen. Es tut gut, über alles sprechen zu können und geduldige Zuhörer zu haben. Meine Freunde rufen tagtäglich an und hören sich geduldig alle meine Berichte an. Und Uli ist einfach unglaublich. Nicht nur, dass er versucht, mir jeden Wunsch von den Augen abzulesen, er weiß intuitiv, dass gutes Zureden keinen Sinn hat, also nimmt er mich einfach in den Arm und hält mich fest. Das ist wunderbar. Die Zuneigung, die ich von allen Seiten erfahre, macht mich stark und zuversichtlich.
Liebe zu geben ist schwierig genug. Noch schwieriger ist es aber, Liebe zu empfangen. Das ist so ähnlich wie mit Komplimenten: Was sagt meistens eine Frau, wenn man ihr Kleid lobt? „Ach, das ist doch nur ein alter Fetzen”. Ich ärgere mich immer darüber. Wenn ich jemandem etwas nettes sage, möchte ich ihm doch eine Freude machen. Warum macht er - oder sie - das also zunichte? Ich selbst sage stets einfach nur „Danke”, wenn man mir ein Kompliment macht.
Die Zuneigung unter Freunden offen zu zeigen hat meist etwas Peinliches. Wie und was sage ich, wenn ich jemanden mag? Und wie reagiere ich auf etwaige Liebesbezeugungen? Eine Krankheit löst dieses diffuse Gefühl auf. Offenbar lässt sich die Sympathie in schweren Zeiten wesentlich problemloser darstellen. Ich muss an den Buchtitel „Die Liebe in den Zeiten der Cholera” denken… Es ist zwar eine ganz andere Geschichte, doch der Titel selbst bekommt für mich eine ganz neue Bedeutung.
Mittwoch, 8. Mai
Soll ich die Haare an den Beinen wegmachen oder nicht? Den Sommer kann ich doch vergessen. Ich werde dieses Jahr bestimmt nicht an der See rumliegen. Auch an Wegfahren ist nicht zu denken. Ich bin unentschlossen. Dann erinnere ich mich aber an das Versprechen, das ich mir selbst gegeben habe: Es geht immer weiter. Also: Wachs drauf, Haare weg! Und dann fühle ich mich tatsächlich besser.
Ich fange an, mich mit der Chemotherapie zu beschäftigen. Gott sei Dank für Dr. T.! Er ist genau so, wie ich ihn gleich eingeschätzt habe. Er hat eine unendliche Geduld mit mir und meinen Fragen. Er erklärt alles dreimal, wenn es sein muss. Dabei sitzt er mir gegenüber an einem Tisch und schaut mir in die Augen. Es ist ein Segen, einen solchen Arzt gefunden zu haben.
Die Chemotherapie wird in Form einer Infusion verabreicht, die in ganz bestimmten Abständen wiederholt wird. Der 1. der 15. und der 28. Tag sind ein Zyklus. Wobei der letzte Tag gleichzeitig der Anfang des nächsten Zyklus ist. Drei bis vier solcher Zyklen werde ich vermutlich brauchen. Das sind genau drei Monate und eine Woche - ich rechne das später in einem Kalender genau nach. Danach drei Wochen Pause. Dann drei Wochen Bestrahlung - jeden Tag. Die Haare? Ja. Die fallen aus. Alle. Mein Gott, daran habe ich noch gar nicht gedacht! Auch die Brauen? Ja. Und die Wimpern? Auch. Gibt es nicht eine Chance, dass vielleicht, eventuell, doch, nicht…? Man hat ja schon irgendwie und irgendwo von Leuten gehört, die keine Haare verloren hätten, trotz Chemo? Das hängt von den Medikamenten ab, die in der Chemo drin sind, sagt Dr. T. Und bei Hodgkin ist der Alle- Haare-weg-Stoff drin.
Meine Zimmernachbarin - dieses Mal eine andere - kennt sich aus. Sie empfiehlt eine Perücke, die man jetzt schon, noch im Vollbesitz der eigenen Mähne und eventuell auch guter Laune, besorgen soll. Und die sollte man sich unbedingt vom Arzt verschreiben lassen, weil man dafür einen Zuschuss von der Krankenkasse bekommt.
Dieser Hinweis ist nicht unwichtig. Ich verdränge diesen Gedanken zwar noch, aber er schlummert natürlich seit Tagen in meinem Unterbewusstsein: Meine finanzielle Lage. Ich bin freiberuflich. Das bedeutet: Wenn ich nicht arbeite, verdiene ich kein Geld. Und wenn ich Kunden oder Redaktionen verprelle, werden die sich für diesen Auftrag eine andere Texterin suchen. Und ob sie dann wieder zu mir zurückkommen würden? Dazu darf ich es erst gar nicht kommen lassen. Das heißt, ich werde ganz bestimmt weiter arbeiten, egal, wie es mir geht. Und ich muss meine Chemotermine so koordinieren, dass ich Ende August in Hamburg sein kann, wo ich einen größeren Auftrag habe.
Im Schwabinger Krankenhaus gibt es einen Friseur, der auch Perücken hat. Aus Neugier gehe ich da mal vorbei. Was die so kosten? Ob ich wohl welche anprobieren darf? Ich darf. Das hätte ich aber lieber bleiben lassen. Ich sehe schrecklich aus! Wie eine „jiddische Mamme” aus Bnei Brak. Ich kenne Bnei Brak. Dort, in einem Vorort von Tel Aviv lebt Susi, eine wunderbare Freundin von mir, die orthodox ist. Dort laufen alle Frauen mit Hut oder Perücke - weil sich das nach der Eheschließung so gehört.
Fährt man mit dem Bus dorthin, erlebt man langsam, von Station zu Station die Reise in eine andere Welt. Am Anfang sitzen in dem Wagen noch Leute, die unkompliziert und einfach bequem sommerlich gekleidet sind. Man sieht viele ausgeschnittene Sommerkleider, Kurzarmhemden, Khakihosen, bunte T-Shirts und Shorts. Doch je weiter man sich von Tel Aviv entfernt, desto weniger Haut wird unter der Kleidung sichtbar. Es steigen immer mehr Männer ein, die lange schwarze Hosen, weiße Langarmhemden und eine Kippa, die traditionelle Kopfbekleidung, tragen. Und auch bei den Frauen werden bei jeder Haltestelle die Ärmel immer länger, ebenso wie die Rocksäume. Wenn man schließlich auch Hüte oder Perücken sieht, lange Kaftans und Pejse, die Schläfenlocken der orthodoxen Juden, dann weiß man - man ist in Bnei Brak angekommen.
Susi und ich kennen uns eine Ewigkeit. Es war irgendwann in den 70er Jahren, da rief mich ein Exfreund an und sagte, er habe eine neue Freundin, die sei genauso wie ich. Ob ich sie kennen lernen wollte? Natürlich wollte ich es. Es war Liebe auf den ersten Blick. Wir waren uns tatsächlich sehr ähnlich - und plötzlich ging mein größter Wunsch in Erfüllung: Ich hatte - zum ersten Mal in meinem Leben - eine „beste Freundin”. Doch Susi blieb nur noch ein Jahr in Deutschland. Dann wanderte sie mit ihren Eltern nach Israel aus und heiratete dort einen orthodoxen Mann. Keiner hat sie dazu gezwungen. Es war ihr eigener Entschluss. Sie wollte es so. Sie konnte es aber nur leben, wenn sie alle Brücken hinter sich abgebrochen hat. Ihr letzter Brief und das Foto von ihrer Hochzeit war alles, was übrig blieb…
Als ich vor drei Jahren für ein paar Tage nach Israel fuhr, beschloss ich, sie wieder zu finden. Mit ihrer letzten Adresse und ihrem Foto ausgestattet, bin ich von Tel Aviv mit dem Taxi zu dem Ort gefahren, wo sie damals lebte. Ich ging vom Haus zu Haus, zeigte das Foto rum und fragte nach ihr. Die Nachbarn redeten lange und stürmisch miteinander, telefonierten, redeten, telefonierten und plötzlich - plötzlich hatte ich Susi am Telefon, die einfach nur fragte: “Wo bist du?” Zehn Minuten später hielten wir uns in ihrem Treppenhaus im Arm und heulten Rotz und Wasser. Es gibt Freundschaften, die sich wie Nebel auflösen und verloren gehen, selbst, wenn man um die Ecke wohnt. Andere überleben wie dieses ägyptische Weizenkorn: In einer Grabkammer gefunden, ist es aufgegangen, als man es in die Erde steckte - nach 3000 Jahren!
Susi trägt auch eine Perücke. Mein Gott, sie hatte die schönsten langen Haare, die ich je gesehen habe! Aber jeder muss sein eigenes Leben leben, nicht wahr? Jeder, der eine eindeutige Identität hat, kann sich glücklich schätzen. Ich bin eine Jüdin, in Polen katholisch aufgewachsen und lebe mit einem deutschen Pass in Bayern. Auch die harmlose Frage nach meinem Beruf bringt mich aus dem Konzept. Ich habe mein Soziologiestudium abgebrochen, dann aber doch noch die Journalistenschule in München absolviert. Habe für Tageszeitungen und Zeitschriften gearbeitet. War sieben Jahre lang Reisereporterin, habe Modenschauen organisiert und später auch gestylt. Habe Pressetexte geschrieben und Pressekonferenzen veranstaltet. Habe nebenbei für Foodfotos gekocht und nach dem passenden Geschirr gesucht. Ich habe für die Ratgeberseiten einer Frauenillustrierten über Arbeitslosengeld, Pflanzenpflege, Beziehungskisten, Autos und Pelzaufbewahrung geschrieben. Ich habe eine außerordentlich umfassende Halbbildung. Und ich lebe ständig meine eigene Quizsendung: „Wer bin ich?”
Freitag, 10. Mai
Ich wache mitten in der Nacht plötzlich auf, mit dem Gedanken, ich hätte mir die Haare auf den Beinen gar nicht wegmachen brauchen: Sie fallen eh aus. Idiotisch, womit sich mein Unterbewusstsein beschäftigt…
Wahrscheinlich liegt etwas in der Luft. Ich habe lauter verrückte Ideen im Kopf. Ich will nächste Woche ein großes Essen machen, einen Weiberabend. Arbeitstitel: Das letzte Abendmahl - bevor ich im nächsten Jahr wie Phönix aus der Asche auferstehe. Und ich beschließe, meinen Zustand als so eine Art Schwangerschaft zu betrachten. Ich war eine glückliche, strahlende Schwangere. Das werde ich sicher nicht so ganz hinkriegen. Aber gewisse Parallelen gibt es schon: Auch Schwangeren wird es ab und zu schlecht. Manchmal müssen sie das Bett hüten. Sie sind in „anderen Umständen” und sehen „anders” aus. Sie sind - zumindest in den letzten Monaten - auf die Hilfe von lieben Mitmensehen angewiesen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt ist das Ende abzusehen (ich gehe doch lieber davon aus, dass ich zu den 90% gehöre, die das erleben). Und schließlich und endlich kommt ein neuer Mensch dabei heraus. In diesem Fall: Ich selbst.
Generalprobe: Ich stopfe alle meine Haare unter eine Baseballmütze und mache mich auf den Weg. Prompt treffe ich eine Bekannte, die laut ausruft: „Joanna! Fast hätte ich Dich nicht erkannt - ohne Deine schönen Haare”. Volltreffer! Plötzlich wird es mir bewusst: Meine Haare, Marke schwarzer Wuschelkopf, signifikant strubbelig und unbändig, sind nicht einfach nur ein äußerlicher Teil von mir. Sie gehören zu meiner Identität. Sie zu verlieren ist nicht nur eine Frage der Eitelkeit.
Samstag, 11. Mai
Die Frage meiner Identität beschäftigt mich zwar schon seit Jahren, zur Zeit aber ist dieses Problem ganz besonders akut.
Wie kann man das: Jude sein? Und gleichzeitig katholisch? Ganz einfach. Man wird als Jude geboren und nimmt - durch Zufall oder aus Überzeugung - eine andere Religion an. Immerhin ist der Bischoff von Paris, Monsignore Lustiger auch ein Jude. Früher, vor dem Zweiten





























