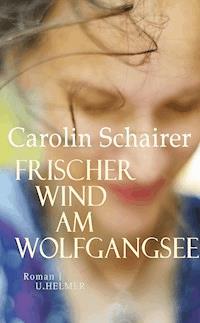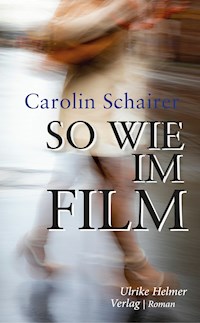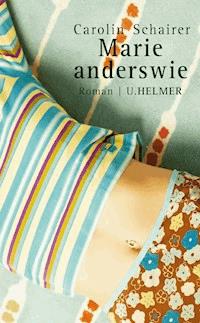12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ulrike Helmer Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Julie Schneebergs neuer Thriller ist noch nicht erschienen, schon wittern die Medien spannende Enthüllungen. Denn die gefeierte Krimiautorin greift darin das dunkelste Kapitel ihrer Vergangenheit auf: Eines Nachts wurde sie in der ei-genen Familie zur Zeugin einer blutigen Tragödie … Das schreckliche Erlebnis ließ die damals Siebzehnjährige zu einer Frau werden, die (von gelegentlichen lesbischen Affairen abgesehen) einsam und zurückgezogen lebt. Doch seit ihr Buch angekündigt ist, überschlagen sich die Ereignisse in Julie Schneebergs Leben … und auch auf ihre Mutter Dana, eine prominente Schauspielerin, wirft der Thriller tiefe Schatten voraus. Was geschah in jener Nacht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Carolin Schairer
In jener Nacht
Kriminalroman
Ulrike HELMER Verlag
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-89741-995-7
Originalausgabe in CRiMiNA.CRiMiNA ist ein Imprint des Ulrike Helmer Verlags, Sulzbach/Taunus© 2016 eBook nach der Originalausgabe© 2015 Copyright Ulrike Helmer Verlag, Sulzbach/TaunusAlle Rechte vorbehaltenCovergestaltung: Atelier KatarinaS / NLunter Verwendung des Fotos »white face«© Andrey Kiselev – Fotolia.com
Ulrike Helmer VerlagNeugartenstraße 36c, D-65843 Sulzbach/TaunusE-Mail: [email protected]
www.ulrike-helmer-verlag.de
Berlin, November 2014
»I keep going to the river to pray – Cause I need – Something that can wash all the pain …«
Ella Hendersons Song Ghost, der derzeitige Klingelton am Handy seiner Frau, riss ab, noch ehe Felix Rabenstein auch nur daran dachte, die Augen zu öffnen. Dana hatte den Anruf angenommen, obwohl es mitten in der Nacht war. Unruhig wälzte er sich im Bett auf die andere Seite.
»Du?!«, hörte er sie neben sich sagen.
Ihre Stimme klang so alarmiert, dass er sich trotz der bleiernen Müdigkeit, die ihm in den Knochen steckte, zum vollständigen Aufwachen zwang.
»Woher hast du diese Nummer?«
Felix richtete sich auf und betätigte dabei gleichzeitig den Schalter der Nachttischlampe.
»Was willst du?!« Danas Stimme klang ungewohnt scharf. Ihre Gesichtszüge wirkten angespannt.
Einen kurzen Moment lang spielte Felix Rabenstein mit dem Gedanken, ihr das Handy aus der Hand zu reißen und den nächtlichen Anrufer schonungslos niederzubrüllen. Die Annahme, dass es womöglich doch ein Journalist sein konnte, einer, den Dana gut kannte, ließ ihn davon absehen. Sosehr er die Presse auch hasste – sie brauchten sie. Die Medienberichte über Dana, eine der bekanntesten Schauspielerinnen im deutschen Sprachraum, und ihn, Moderator bei einem größeren privaten Radiosender, waren für ihre Karrieren äußerst förderlich. Seit sie vor eineinhalb Jahren ihre Beziehung in der größten Boulevard-Zeitung Deutschlands mit einem rührseligen Interview öffentlich gemacht hatten, war es für sie beide nur weiter bergauf gegangen. Dana bekam trotz ihres Alters plötzlich wieder große Rollen in Spielfilmen und er moderierte inzwischen die Morgensendung, bei der die Einschaltquoten am höchsten waren.
»Das wirst du sicherlich nicht tun!«
In Danas Tonfall hatte sich ein schriller Unterton eingeschlichen. Sogar im fahlen Licht der Nachttischlampe bemerkte Felix, dass ihr sämtliche Farbe aus dem Gesicht gewichen war.
Nun hörte er auch die Stimme am anderen Ende der Leitung: die ruhige, beherrscht wirkende Sprechweise einer Frau. Eine dumpfe Vorahnung beschlich ihn.
»Ich habe dazu nichts zu sagen, verdammt!« Dana schrie jetzt ins Telefon. Ihre Nasenflügel bebten. »Es ist alles gesagt worden, was es zu sagen gibt! Die einzigen Ungereimtheiten existieren in deinem kranken Kopf!«
Mit wutverzerrtem Gesicht drückte sie auf die rote Taste. Als sie das Handy zur Seite legte, zitterten ihre Hände.
»Wer war das, um Himmels Willen?«
Felix rutschte zu der Frau an seiner Seite und legte ihr fürsorglich den Arm um die schmalen Schultern. Erschöpft vergrub sie ihren Kopf in seiner Halsbeuge. Ihre rötlichen Haarsträhnen kitzelten seinen Nacken.
»Wer wird das schon gewesen sein, um kurz nach zwei Uhr nachts?« Danas Stimme klang heiser. »Sie – wer sonst!«
»Was will sie? Hat sie wieder einen ihrer depressiven Schübe?«
Zorn formierte sich in seinem Inneren. Er hatte Danas Tochter aus einer weit früheren Beziehung nur einmal erlebt: Während ihrer standesamtlichen Trauung hatte Julie mit steinerner Miene in einer Ecke des Trausaals gestanden. Als sie anschließend auf ihn zuging, rechnete er mit Glückwünschen, doch stattdessen bedachte sie ihn nur mit einem bedeutungsschweren Blick und sagte: »Ich hoffe, Sie wissen, auf was Sie sich hier einlassen.« Danach hatte sie sich ohne ein weiteres Wort umgedreht und war gegangen.
Die Szene hatten Pressefotografen festgehalten und in der Regenbogenpresse breitgetreten.
Letztendlich war es Danas Geschick im Umgang mit den Medienleuten zu verdanken, dass die Presse am Ende vollends für sie Partei ergriff. Es hatte sie große Überwindung gekostet, öffentlich über die psychische Erkrankung ihrer Tochter zu sprechen, das hatte er ihr deutlich angesehen. Aber es war die einzige Möglichkeit gewesen, um Schlagzeilen wie WAS HAT DANA KARNEOL ZU VERBERGEN? zu vermeiden.
Wenn er im Nachhinein an Julies Auftritt zurückdachte, war er sich sicher: Sie hatte die Hochzeit ihrer Mutter lediglich als PR-Forum für sich selbst nutzen wollen. Julies Bücher standen zwar in den Bestsellerlisten, doch von der Frau, die sie verfasste, nahmen große Society-Medien allenfalls dann Notiz, wenn über ihre prominente Mutter Dana Karneol berichtet wurde.
»Ich weiß nicht, warum sie mir das antut.«
Er spürte Danas heiße Tränen auf seiner nackten Haut.
»Warum kann sie nicht endlich aufhören damit? Habe ich nicht genug durchgemacht?! – Es waren meine zwei Mädchen, nicht ihre …!«
Dana schluchzte bitterlich und er spürte ihren Kummer, als wäre es sein eigner.
Ja, sie hatte genug gelitten, da war sich auch die deutschsprachige Boulevardpresse einig. Statt über DANA KARNEOL: SCHWANGER MIT 50, KANN DAS GUT GEHEN? zu lästern, hatten sich die Medien auf ihre Seite geschlagen. DANA KARNEOL: SCHWANGER! ENDLICH KANN SIE WIEDER GLÜCKLICH SEIN!, war der Tenor jener Berichte, die erschienen, seit sie ihre Schwangerschaft vor rund drei Wochen öffentlich gemacht hatten.
»Liebste … psst … bleib ruhig, denk an unser Baby.«
Er legte ihr besänftigend die Hand auf den Bauch, der Ende des vierten Monats allenfalls eine unmerkliche Wölbung erkennen ließ. »Denk nicht mehr an diese hässliche Geschichte. Was auch immer deine Tochter gesagt hat, vergiss es. Du hast selbst richtig erkannt: Sie ist krank. Sie will Aufmerksamkeit. Nach allem, was du mir erzählt hast, wollte sie das schon ihr ganzes Leben lang. Eine graue Maus, die sich nach Farbe sehnt und der jedes Mittel recht ist.«
Was er sagte, entsprach allerdings nicht ganz seiner Wahrnehmung. Rein optisch war Julie das um knapp zwanzig Jahre jüngere Abbild von Dana: mittelgroß, schlank, mit den gleichen kupferroten Haaren, dazu Gesichtszüge, die denen seiner Frau sehr ähnlich waren und sich nur in der Augenpartie unterschieden. Danas ausdrucksvoller Blick strotzte vor Energie, Julie dagegen wirkte ernst und streng. In Felix’ Augen fehlte es ihr an jenem Quantum Charisma, das erforderlich war, um die Massen zu begeistern.
»Ich will nicht, dass alles wieder ausgegraben wird.« Sie sah ihn tränenüberströmt an. Tiefe Verzweiflung stand in ihren Augen.
»Was genau hat sie gesagt?«
Es dauerte, bis sich seine Frau so weit gesammelt hatte, dass sie ihm eine Antwort geben konnte.
»Dass sie endlich wissen will, was damals wirklich passiert ist.« Dana begann erneut zu schluchzen. »Herrgott, warum stochert sie in dieser Sache herum? Warum tut sie mir das nur an? – Ich meine, was gibt es schon viel dazu zu sagen? … Er war ein Schläger, ein Despot! Ihn zu verlassen, schien mir der einzige Weg! … Ich hatte solche Angst, Felix! … Angst, dass er den Kindern etwas antut … Ich konnte doch nicht wissen … konnte doch nicht ahnen, dass er vollkommen austickt … Und jetzt kommt sie und tut so, als wäre alles meine Schuld …«
Bitterlich weinend schmiegte sich die Frau, die er liebte wie keine andere zuvor, an seinen nackten Oberkörper.
Wut begann in ihm zu brodeln.
»Sie ist depressiv … und wer weiß, was sonst noch in ihr vorgeht«, sagte er mühsam beherrscht, während er Dana über den Rücken streichelte. »Du hast mir selbst erzählt, dass sie schon als Jugendliche psychisch nicht mit sich im Reinen war. Julie kann das Glück anderer nicht akzeptieren. Sie kann nicht ertragen, dass du wieder Mutter wirst, dass sie in den Medien Fotos von uns als Paar sieht, dass du wieder lachst und glücklich bist, während sie allein in einer Kammer sitzt und nichts anderes hat als ihre Romane. Und deshalb quält sie dich mit ihren Anrufen und mit dieser tragischen Geschichte – weil sie dich genauso unglücklich sehen will, wie sie selbst sich vermutlich fühlt.« Er legte seine Hand unter Danas Kinn und hob es sanft an. Sein Blick war entschlossen. »Lass dich von ihr nicht aus der Bahn werfen, Liebling. Sollte sie jemals wieder anrufen, leg einfach auf. Denk immer daran, dass sie nichts weiter ist als eine gefrustete, einsame, depressive Intellektuelle, die gerne Missgunst streut und Kummer sät.«
»Ich weiß«, flüsterte Dana.
Sein Kuss sollte Trost spenden, alle Ängste beseitigen, doch die erwiderte Leidenschaft ließ für Felix keine Zweifel offen, dass sie ihn auf andere Weise wollte als nur in der Rolle des sanften Zuhörers. Mehr als nur bereit, schob er ihr Nachthemd nach oben und berührte die wohlgeformte Brust. Aufreizendes Stöhnen entfachte seine ganze Leidenschaft.
Später, als er sich schwer atmend und befriedigt von ihrem zierlichen Körper rollte, war sein einziger Gedanke, dass er für diese Frau alles täte, um sie zu beschützen. Wirklich alles. Dana war die Liebe seines Lebens, und hatte bereits genug gelitten. Niemals würde er zulassen, dass ihr irgendein Leid zugefügt würde. Sie hatte im Leben tatsächlich schon genug gelitten.
Altenhain, Oktober 1998
»Verdammt noch mal, wie soll ich mir bei diesem Höllenlärm einen Text merken?«
Dana sprang auf und stieß dabei so heftig gegen den Esstisch, dass ein Glas Wasser, das nahe an der Kante gestanden hatte, mit lautem Krachen auf dem hölzernen Schiffbrettboden aufschlug. Wie durch ein Wunder überstand es den Aufprall, ohne zu zerbrechen.
Der kleinen Wasserpfütze, die sich am Boden bildete und in das blanke Holz sickerte, weiter keine Beachtung schenkend, riss sie die Türe zum Nebenzimmer auf.
»Hört sofort auf! Das kann ja kein Mensch ertragen!«
Die zwei kleinen Mädchen, die nebeneinander auf dem Klavierocker saßen und auf den Tasten herumklimperten, fuhren hoch und schauten sie aus großen, dunklen Augen erschrocken an.
Dana hasste diesen Blick – diese unerklärliche Furcht in den Augen der Kinder. So, als ob sie sie regelmäßig schlüge – obwohl sie nie in ihrem Leben die Hand gegen sie erhoben hatte. Noch vor Jahren hatte sie geglaubt, dieser Blick sei eine Eigenart ihrer älteren Tochter. Auch Julie sah sie hin und wieder an, als wäre sie ein Monster. In manchen Momenten fühlte sie sich tatsächlich schon so.
Dass ihre fünfjährigen Zwillinge sie jetzt ebenfalls mit diesem strafenden Blick bedachten, machte sie wütend. Kurz entschlossen schlug sie den Klavierdeckel zu.
Alena begann zu weinen. Alissa starrte sie nur an.
»Aber Mami, wir wollten …«, begann Alissa zaghaft, doch Dana fiel ihr ins Wort.
»Das interessiert mich jetzt nicht. – Die Mami hat am Montag ein ganz, ganz wichtiges Casting. Wenn ihr weiter Lärm macht, bekommt die Mami die Rolle nicht und wir haben kein Geld. Dann können wir nichts zu essen kaufen.«
Nun machte auch Alissa ein Gesicht, als würde sie gleich in Tränen ausbrechen.
Dana unterdrückte ein Seufzen. Warum wollten die beiden sie einfach nicht verstehen? Ihr Nervenkostüm war in diesen Tagen nicht das Beste, das wusste sie selbst. Aber war das ein Wunder angesichts der Umstände? – Sie hatte ihr Konto überzogen, der Bankberater machte allmählich Stress und Joe hatte schon seit drei Monaten keine Skulptur mehr verkauft.
Sie kniete sich auf den Boden, um mit den Zwillingen auf Augenhöhe zu sein, und zog beide in ihre Arme. Die Kinder schmiegten sich dankbar an sie.
»Wenn die Mami die Rolle bekommt, gehen wir ein richtig großes Eis essen, versprochen. Und einstweilen …« Sie löste die Umarmung und stand auf. »Kommt mit!«
Die Mädchen folgten ihr durch das Wohnzimmer zur Küche. Dana öffnete einen der Schränke und drückte beiden je einen Keksriegel in die Hand. Mit Erleichterung sah sie, wie die Kinderaugen aufleuchteten.
»Und jetzt geht nach oben in euer Zimmer zum Spielen. Aber leise, versprochen?!«
»Versprochen!«, kam es einstimmig zurück. Kurze Zeit später ertönten die Trippelschritte der Zwillinge auf der Treppe.
Als sie zurück ins Wohnzimmer kam, kniete Julie mitten im Zimmer, um mit einer Küchenrolle den nassen Fleck am Bretterboden zu trocknen.
»Es war nur Wasser«, kommentierte Dana, während sie sich wieder auf den Stuhl fallen ließ. Sie fühlte sich müde und abgekämpft. Trotzdem griff sie nach dem Text.
Bei meiner letzten Italienreise habe ich die beste Pasta meines Lebens gegessen. Zu Hause bekam ich das nie so hin. Dann hat mir meine Freundin PASTA E BASTA empfohlen. Und jetzt werden die Nudeln so richtig al dente. Wie in Italien.
Dana fühlte, dass Julie sie anstarrte, und hob den Kopf.
»Was siehst du mich so vorwurfsvoll an? Willst du mir wieder einmal ein schlechtes Gewissen einreden, dass ich keine gute Mutter bin, oder was ist es diesmal?«
»Ich … ich … ich finde, du solltest sie nicht so anschreien.« Julie senkte den Blick zum Boden. »Sie sind doch erst fünf.«
»Oh, da sieh einer an.« Dana schob die ausgedruckten Textseiten von sich. Ärger keimte in ihr auf. Sie hasste diese Diskussionen! »Weißt du schon wieder alles besser als ich? Diesmal, wie man Kinder erzieht?«
Julie schwieg.
Erst macht sie mir Vorwürfe, dann wird sie verstockt.
Dana seufzte.
»Warum gibst du mir ständig das Gefühl, auf ganzer Linie zu versagen? Macht dir das Spaß? Oder willst du damit vielleicht einfach deine eigenen Unzulänglichkeiten kaschieren?«
Das junge Mädchen presste die Lippen aufeinander.
Dana seufzte. Warum musste sich die Pubertät ausgerechnet bei ihrer Tochter dermaßen lange hinziehen?
»Ich habe immer so gehofft, dass wir einmal Freundinnen werden.« Dana schloss einen Moment lang die Augen. Sie fühlte sich hilflos. »Ich bräuchte so dringend eine Freundin, Julie, eine, die mich versteht und der ich vertrauen kann. Mein Leben ist im Moment wirklich nicht so, wie ich es mir erträumt habe, verstehst du? – Das mit Joe und mir …«, sie schüttelte den Kopf, seufzte. »Aber stattdessen signalisierst du mir ständig, wie schlecht und unfähig ich in allem bin! – Ich will doch nur euer Bestes. Ich bemühe mich so sehr um dich und deine Schwestern und stelle meine eigenen Bedürfnisse permanent hintenan. Glaubst du etwa, es erfüllt mich, auf diesem Kaff herumzusitzen und darum zu kämpfen, wenigstens eine Rolle in Werbespots zu ergattern? Ich war einmal ein Star, Julie! Aber ich habe alles für diese Familie geopfert, alles! Also wirf mir nicht permanent vor, dass ich keine gute Mutter sei!«
»Mama … das tue ich doch gar nicht.« In Julies Augen glitzerten Tränen.
Natürlich, die übliche Masche. Erst kritisiert sie mich, dann fängt sie an zu heulen.
Dana verabscheute Julies Strategie, in ihr Schuldgefühle zu erwecken.
»Ich habe doch nur gemeint, dass du …«
Dana richtete sich auf, straffte die Schultern.
»Ich will dir einmal etwas sagen, Miss Superschlau! Du magst in der Schule mit guten Noten glänzen, aber was deine sonstige Entwicklung angeht – da hast du die Kurve ja wohl eindeutig nicht bekommen. Mit siebzehn war ich schon beinahe Mutter, also erzähl mir um Himmels Willen nichts darüber, wie ich deine Schwestern zu erziehen habe!«
Die Worte verfehlten nicht ihre Wirkung. Julie schluckte. Dann drehte sie sich wortlos um und verließ das Zimmer.
Super. Jetzt ist es mit meiner Konzentration erst recht vorbei.
Dana gab auf. Sie ging zur Schrankwand, öffnete eine der Türen und griff nach der Flasche Whiskey. Sie brauchte jetzt dringend einen Drink.
Ihr Leben befand sich derzeit auf einem Tiefpunkt.
Während sie in kleinen Schlucken das Glas leerte, starrte sie hinaus in die Dämmerung. Die kahlen Laubbäume, die die Hofeinfahrt säumten, bogen sich im Wind. Der umgepflügte Acker lag dunkel und bedrohlich dahinter.
Verdammtes Kaff.
Wenn sie nicht bald etwas an ihrem Leben änderte, würde sie zu Grunde gehen.
*
Julie schloss die Tür ihres Zimmers hinter sich, setzte sich an ihren Schreibtisch und fuhr den Computer hoch. Es dauerte, bis das Gerät betriebsbereit war. Es war schon älter und gebraucht gekauft; das Geld dafür hatte sie sich vor rund einem Jahr durch einen Ferienjob im hiesigen Eissalon verdient.
Mechanisch rief sie das Textdokument auf, an dem sie auch schon am Vortag gearbeitet hatte. Doch geschliffene Worte wollten ihr diesmal nicht in den Sinn kommen. Immer wieder glitten ihre Gedanken ab. Das Wochenende, genauer gesagt: der bevorstehende Samstagabend, lag ihr wie ein Stein im Magen.
Sylvia, eine ihrer Mitschülerinnen, veranstaltete eine Party im elterlichen Keller. Das war nicht ungewöhnlich, wie Julie längst mitbekommen hatte. Neu war jedoch, dass auch sie dazu eingeladen war. Zuerst wollte sie die Sache übergehen, doch ihre Mutter hatte auf irgendeine Weise von der Einladung erfahren und ihr so lange ins Gewissen geredet, bis sie den Druck nicht mehr aushielt und hinzugehen versprach. Mittlerweile war sich Julie fast sicher, dass ihre Mutter das Ganze für sie initiiert und Sylvias Mutter zu einer Einladung bewegt hatte. Die beiden Frauen kannten sich vom Chorsingen.
Unsere Julie sitzt nur zu Hause herum, sie tut mir sooo leid. Sie ist einfach zu schüchtern. Vielleicht kann ihr deine Sylvia einmal unter die Arme greifen?
Julie brauchte nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, was ihre Mutter wohl gesagt haben könnte, um ihr Ziel zu erreichen. Oft genug war sie unfreiwillige Zeugin davon geworden, mit welchen Worten Dana sie vor anderen dargestellt hatte.
Julie geht mehr nach ihrem Vater. Der war auch so ein Introvertierter! Unsere Julie sitzt am liebsten zu Hause und lernt. Sie ist halt sehr ehrgeizig, unsere Julie, ein bisschen eine Streberin …
Julie stand bei diesen Gelegenheiten stets dabei und sagte nichts. Umso deutlicher aber spürte sie die teils mitleidigen, teils verwunderten Blicke der Leute im Ort, vor denen sich ihre Mutter für eine Tochter zu rechtfertigen versuchte, deren Außenseiterrolle von Jahr zu Jahr immer offensichtlicher wurde.
Etwas über sechs Jahre war es her, seit ihre Mutter sie nach dem Tod der Großmutter von Wien zu sich und ihrem neuen Lebensgefährten Joe nach Altenhain geholt hatte, jener knapp 3000-Seelen-Gemeinde im östlichen Teil des Mostviertels, nur eine Dreiviertelstunde Autofahrt von der Hauptstadt entfernt. Elf Jahre alt war sie damals, und allein der Schulwechsel von einem städtischen Stadtgymnasium mit musischer Ausrichtung auf die Höhere Katholische Mädchenschule im fünfzehn Kilometer entfernten St. Pölten war für sie eine Herausforderung gewesen. Schulbus fahren statt Straßenbahn. Provinzieller Kleingeist statt multikultureller Weltoffenheit.
Ihre Mutter hatte die Schule ausgewählt mit der Begründung, dass fast alle Mädchen des Ortes dort seien, sofern sie mit Matura abschließen wollten. Wie Julie inzwischen vermutete, war die mütterliche Wahl nicht unmaßgeblich davon beeinflusst worden, dass es sich bei der Höheren Katholischen Mädchenschule um die einzige Ganztagesschule der Region handelte.
Der Ärger ließ nicht lange auf sich warten. Gleich bei der ersten Fahrt mit dem Schulbus war sie von ihren Dialekt sprechenden Mitschülerinnen wegen ihrer Schriftsprache aufgezogen worden. Im Unterricht und den Pausen hatten sich die Hänseleien fortgesetzt, sobald sie auch nur den Mund öffnete – mit der Folge, dass sie inzwischen nur noch das Notwendigste von sich gab.
Und nun diese Party.
In diesem Augenblick war Julies sehnlichster Wunsch, sich den schrecklichsten Grippevirus aller Zeiten einzufangen. Alles war besser als die Aussicht, noch mehr Zeit mit ihren Mitschülerinnen verbringen zu müssen.
*
Die Musik dröhnte ohrenbetäubend laut, im ganzen Raum hing dichter Rauch. Auf der Tanzfläche verrenkte sich Sylvia mit ein paar Freundinnen zum Rhythmus der Musik die Glieder, begafft von drei Burschen, die mit Bierflaschen und Zigaretten in den Händen auf dem ausladenden Sofa neben der kleinen Bar lümmelten. Ein anderer knutschte hinter der Theke mit Melanie, Sylvias bester Freundin, während der fünfte der vorhandenen Jungs vor einer halben Stunde mit dem Ausruf »Scheiße, ist mir schlecht, Oida!« nach draußen gestürmt und seither nicht mehr gesehen worden war.
Julie war froh, dass die Burschen ebenso wenig Interesse an ihr zeigten wie sie an ihnen. Sie stand am hintersten Ende des Partykellers, rang mit dem Gefühl akuten Luftmangels und wartete darauf, dass die Zeit verstrich. Ungeduldig warf sie einen Blick auf ihre Armbanduhr. Erst kurz vor halb elf!
Joe hatte ihr angeboten, sie um Mitternacht mit dem Auto abzuholen, und sie hatte sein Angebot dankbar angenommen. Danas Einwurf Vielleicht will sie die Nacht ja gar nicht mehr zu Hause verbringen? hatten sie beide unkommentiert gelassen.
»Schön, dass du auch da bist.«
Julie hob den Kopf. Daniela Haslinger stand vor ihr und streckte ihr ein Glas Orangensaft entgegen.
»Für dich.«
Überrascht nahm Julie das Glas entgegen.
»Hier drin ist es so laut.« Daniela musste schreien, um die Musik zu übertönen. »Komm mit, gehen wir nach nebenan.«
Julie folgte ihr. Vor dem Partyraum gab es eine hölzerne Truhe und jene Treppe, die nach oben ins Erdgeschoß und zu den Wohnräumen von Sylvias Familie führte. Unschlüssig nahm Julie neben Daniela auf der Truhe Platz. Sie wusste nicht recht, was die Mitschülerin eigentlich von ihr wollte, war aber froh, dem Lärm und Rauch fürs Erste entkommen zu sein.
»Prost.« Daniela schnippte sich das dunkle Haar nach hinten und ließ die Gläser klingen. Julie nippte an ihrem Getränk. Orangensaft, dem eindeutig etwas Alkoholisches beigemischt war. Sie mochte den Geschmack nicht, wollte Daniela aber nicht beleidigen und schluckte die Flüssigkeit tapfer hinunter.
»Das ist das neueste Album von den Whitewater Boys. Geile Musik, oder?«
Julie nickte, obwohl sie die Band nicht kannte und die hämmernden Bässe nicht mochte. Aus den Augenwinkeln musterte sie Daniela, die jetzt munter von irgendeinem Festival erzählte, auf dem sie die Band bereits live gesehen hätte. Danielas Shirt wirkte auch ohne tiefen Ausschnitt ziemlich gewagt. Es schmiegte sich so eng an den Körper, dass sich ihre Brüste deutlich darunter abzeichneten. Der kurze Rock, den sie trug, gab den Blick auf lange, mit einer Netzstrumpfhose bekleidete Beine frei. Julie wurde zum ersten Mal bewusst, wie attraktiv Daniela war.
Sie ließ die Dunkelhaarige reden, während sie sich gleichzeitig fragte, warum sie hier überhaupt beisammen saßen. Bisher hatte Daniela nur dann das Wort an sie gerichtet, wenn es darum ging, die Mathe- oder Latein-Hausaufgaben von ihr abzuschreiben.
Nur allzu klar war sie sich ihres eigenen Erscheinungsbildes bewusst. In Danielas Augen war sie ein dürres Mädchen mit schnurgeradem halblangem rotem Haar und Pickeln auf der Stirn, in Jeans, die ihr zu weit waren, und einem schlichten grauen Sweatshirt. Mit einem Mal wünschte sie sich von Herzen, hübsch zu sein. Dieser Wunsch überraschte sie selbst. Bisher hatte sie nicht viel Wert auf ihr Äußeres gelegt.
»Was machst du eigentlich so außerhalb der Schule?«
Daniela sah Julie mit erwartungsvollen Augen an. Julie war über das plötzliche Interesse so verwundert, dass sie im ersten Augenblick nicht einmal wusste, was sie darauf erwidern sollte.
»Ich …«, begann sie, doch im selben Augenblick wurde die Türe des Partykellers aufgerissen und Sylvia streckte den Kopf heraus.
»Da bist du ja, Dani! Ich hab dich schon vermisst!« Sie bedachte Julie mit einem kurzen, skeptischen Blick. »Kommt wieder rein, meine Eltern mögen nicht, wenn meine Gäste im ganzen Haus herumhängen! Außerdem, wir spielen jetzt Flaschen drehen!«
»Oh Himmel …« Daniela verdrehte genervt die Augen. »Sind wir dafür nicht ein bisschen zu alt?«
»Quatsch! Kommt mit, das ist cool!«
Im Raum war die Musik nun deutlich leiser. Die Partygäste kauerten im Kreis auf dem Boden. Ein paar von ihnen waren bereits sichtlich beschwipst.
Julie zögerte. Wenn sie sich nicht noch mehr zur Außenseiterin abstempeln lassen wollte, blieb ihr wohl keine andere Wahl, als sich dazuzugesellen. Also kniete sie sich neben Daniela auf den kalten Fliesenboden.
»Auf wen die Flasche zeigt, der muss ein Glas Schnaps auf ex trinken!«
Beifälliges Grölen von den Burschen.
Der gläserne Zeiger begann sich zu drehen. Julie hoffte inständig, dass er nicht auf sie weisen würde. Nach einem Glas Schnaps würde sie sich bestimmt übergeben müssen.
Sie hatte Glück, der Flaschenhals zeigte auf einen der Burschen. Unter tosendem Beifall kippte er ohne mit der Wimper zu zucken den Schnaps herunter, ohne abzusetzen.
»Wer jetzt dran ist, muss seinem linken Sitznachbarn einen Zungenkuss geben!«
Gekicher von allen Seiten.
Links neben Julie saß der Bursche, der zuvor mit Melanie geknutscht hatte – ein athletisch gebauter, südländischer Typ in teuer aussehenden Markenklamotten. Er sah aus wie einer, dem die Mädchen in Scharen hinterher liefen. Julie wollte ihn trotzdem nicht küssen.
Erleichterung ergriff von ihr Besitz, als der Flaschenhals schließlich auf Sylvia wies, die sich sogleich mit Begeisterung auf den hageren Jüngling neben ihr stürzte, begleitet vom Gelächter und einigen provokanten Kommentaren ihrer Freunde.
Julie wandte den Blick ab. Sie mochte dieses ganze Spiel nicht. Mit einem verstohlenen Blick auf die Armbanduhr stellte sie fest, dass noch immer eine qualvolle halbe Stunde vor ihr lag, ehe Joe sie abholen würde.
Die Flasche drehte sich von neuem. Jetzt ging es darum, den rechten Sitznachbarn zu küssen. Julie fragte sich, was dieses Spiel eigentlich bringen sollte. Was war so lustig daran, anderen beim Küssen zuzuschauen? Warum küssten sich nicht einfach die, die sich küssen wollten, und ließen den Rest mit ihrer Geschichte in Ruhe?
»Julie! Du bist dran!«
Sie fuhr zusammen. Alle Augen waren auf sie gerichtet. Der Flaschenhals wies eindeutig in ihre Richtung. Sylvia lehnte sich zu ihrer Freundin Melanie und flüsterte ihr etwas ins Ohr, woraufhin Melanie breit grinste. Julie brauchte nicht viel Phantasie, um zu wissen, was die beiden erheiterte.
Die verklemmte Julie. Hihi. Ich wette, die hat noch nie jemanden geküsst! Na, sieh sie doch an, wer will die auch schon?
»Traust du dich nicht?«, rief ein Mädchen aus der Runde.
»Vielleicht kann sie gar nicht küssen«, kam es von Sylvia.
»Oder sie ist verklemmt«, warf Melanie ein.
Julie wollte weglaufen, einfach nur weg von dieser Feier. Doch den meisten musste sie am Montag in der Schule sowieso wieder gegenübertreten. Bis zum Matura als Feigling zu gelten, der vor einem Kuss davonlief, widerstrebte ihr.
»Hey, jetzt mach schon, wir wollen weiterspielen!«, sagte der hagere Jüngling, den Sylvia geküsst hatte.
Bring es hinter dich, Julie.
Erleichtert, dass es die hübsche Daniela war, die zu ihrer Rechten saß, und keiner der ihr völlig unbekannten Burschen, beugte sie sich rasch hinüber und drückte ihre Lippen auf die ihrer Sitznachbarin. Zu ihrem eigenen Erstaunen war es ein gutes Gefühl – allerdings eines, das nur Bruchteile von Sekunden dauerte, denn die Dunkelhaarige stieß sie so heftig von sich, dass sie das Gleichgewicht verlor und nach hinten kippte.
»Igitt!«, hörte sie Danielas Stimme. »Das gibt es doch nicht, die wollte mich wirklich küssen!«
Julie rappelte sich auf. Der Schock saß ihr tief in den Knochen.
»Aber … das Spiel«, brachte sie stotternd hervor. »D…du sitzt rechts von mir …«
»Wie blöd bist du eigentlich?« Daniela funkelte sie wütend an. »Ist doch klar, dass das Mädchen übersprungen wird und du den nächsten Burschen küsst!«
»Sag mal, was bist du, eine Lesbe?«, kam es auch prompt von Sylvia.
Und schon schrien alle in der Runde im Chor: »Les-be, Lesbe, Les-be!«
Da ihr Wunsch, auf der Stelle tot umzufallen, nicht in Erfüllung ging, sprang Julie auf und stürzte aus dem Zimmer, die Treppe nach oben in Richtung Ausgang. Sie riss ihren Mantel vom Garderobenständer, hastete nach draußen und rannte die lange Einfahrt entlang bis vor zur Straße. Erst als sie sicher war, dass ihr niemand folgte, hielt sie laut keuchend inne.
Ihre Lungen brannten. Ihr heißer Atem hinterließ kleine weiße Wölkchen in der kalten Herbstluft. Die Siedlungsstraße war menschenleer.
Langsam ging sie in die Richtung, aus der Joe kommen würde, um sie abzuholen. Stille Tränen liefen über ihre Wangen.
Von nun an würde für sie alles nur noch schlimmer werden!
Als Joe Minuten später mit seinem alten VW-Bus um die Ecke bog, wischte sie sich rasch die Tränen aus dem Gesicht.
»Keine gute Idee, nachts hier herumzumarschieren«, begrüßte er sie, während sie neben ihm auf den Beifahrersitz kletterte. »Ich hätte dich fast übersehen. Außerdem, du frierst ja in diesem dünnen Mantel!«
Er spielte auf das Zittern ihrer Hände an. Sie ließ ihn in dem Glauben, dass Kälte die Ursache dafür war.
Joe drehte an der Heizung herum, gab aber schon bald auf. Erbost schlug er mit der flachen Hand gegen das Armaturenbrett. Der Mann mit dem Dreitagebart, der sein Geld als freischaffender Künstler zu machen versuchte, kämpfte einen ständigen aussichtslosen Kampf gegen die Tücken seines Fahrzeugs.
»Alte Mistkarre! – ’tschuldige, aber die Heizung funktioniert mal wieder nicht. Egal. In zehn Minuten sind wir sowieso zu Hause.«
Julie nickte, ohne ihn anzusehen.
»Die Party war wohl nichts, oder?«, stellte er fest, während er den Wagen durch die nächtliche Ortschaft lenkte.
Julie schüttelte stumm den Kopf.
Joe brummte etwas vor sich hin, sagte dann: »Ich habe deiner Mutter gleich gesagt, dass es eine Schnapsidee ist, dich auf diese Party zu schicken, aber du kennst sie ja … Sie weiß alles besser.«
Auch das noch. Sie fühlte sich wirklich nicht in der Lage, zu Hause im Detail zu erzählen, was an diesem Abend alles passiert war, von ihrem stummen Herumhocken bis hin zu diesem unseligen Kuss.
Zum ersten Mal, seit sie ins Auto gestiegen war, sah sie den Lebensgefährten ihrer Mutter an.
»Sag Mama nichts davon, dass ich dir schon entgegengegangen bin. Bitte. Ich möchte sie in dem Glauben lassen, dass alles okay war.«
Joe hob die Schultern.
»Wie du willst. Mir soll es recht sein. Was du und deine Mutter miteinander abzieht, geht mich nichts an.«
Er parkte den Wagen direkt vor dem Haus und hatte den Griff der Autotür schon in der Hand, als sein Blick auf Julie fiel, die keine Anstalten machte, auszusteigen. Die Beine wollten ihr einfach nicht gehorchen.
Joe knuffte sie freundschaftlich in die Seite.
»Wenn du weiterhin so ein Gesicht machst, nimmt sie dir das mit der Party allerdings nie ab!«
»Ich weiß.«
»Weißt du was? Wir werden morgen mal wieder ein bisschen Auto fahren, wir beide«, sagte er unvermittelt. »Nur weil wir dir im Moment keine Fahrstunden zahlen können, heißt das ja nicht, dass du nicht trotzdem üben kannst. Oder?«
Sie rang sich ein Lächeln ab. Joe meinte es gut mit ihr, das wusste sie. Unter seiner Regie Auto fahren zu lernen, hatte die letzten Male sogar Spaß gemacht. Er hatte jedenfalls nie die Geduld mit ihr verloren.
»Okay«, sagte sie, ehe sie das Haus betraten: »Danke, Joe. Für das Abholen. Und so.«
Er klopfte ihr auf die Schulter.
»Kein Problem.«
Irgendwo, November 2014
Auf einer der letzten Seiten des Buches war ihr Foto abgedruckt. Versonnen betrachtete er es, den dicken Wälzer andächtig in seinen Händen haltend. Er hatte ihn erst vor einer Woche gekauft, aber schon mehrmals gelesen. Einige Passagen konnte er bereits auswendig. Die Bilder, die ihre Worte in seinem Kopf entstehen ließen, weckten in ihm Gefühle und Sehnsüchte, die von Monat zu Monat, von Tag zu Tag, von Nacht zu Nacht mehr Gestalt annahmen.
Doch im Zentrum seiner Gedanken stand immer sie, diese wunderschöne Frau mit dem strengen, ernsten Blick. Sein Interesse an ihr war sofort erwacht, seit er sie vor fünf Monaten das erste Mal bei einer Buchpräsentation auf der Buchmesse erlebt hatte. Sie hatte an einem Pult gestanden und mit klarer Stimme aus einem ihrer Thriller gelesen. In diesem Moment war ihm klar geworden: Diese Frau war seine Erfüllung und sein Untergang zugleich.
Seither teilte er seine Phantasien mit ihr, seine Wünsche und Träume. Es verging kein Tag, an dem er ihr nicht schrieb. Anfangs hatte sie ihm geantwortet. Nach ein paar Mails war von ihrer Seite nichts mehr gekommen, aber er hatte vollkommen verstanden, dass eine beschäftigte Autorin wie Julie Schneeberg nicht immer Zeit hatte, zurückzuschreiben. Das Wissen und Empfinden, dass sie auf einer Wellenlänge waren, war für ihn lange Zeit genug gewesen.
Jetzt wuchs die Sehnsucht. Er wollte ihr nahe sein – näher als damals auf der Messe. Er ahnte, dass auch sie an ihn dachte. Sie waren Seelenverwandte, das stand außer Frage.
Wann sie sich treffen würden, stand noch nicht fest. Doch er spürte, dass es noch in diesem Jahr sein würde.
Er drückte seine Lippen auf das schwarzweiße Abbild, schloss das Buch und stellte es zurück zu seinen Vorgängern. Sorgfältig schloss er den antiken Schrank ab. Die silberne Kette mit dem Schlüssel hängte er sich wieder um den Hals und ließ beides unter seinem dunklen Rollkragen-Pullover verschwinden. Er konnte nicht riskieren, dass seine Frau nach diesen Büchern griff, die ihm alles bedeuteten …
Altenhain, November 1998
Sie trafen sich jeden Donnerstag im Pfarrsaal: Rolf und Rita Wunderlein, ein pensioniertes Lehrerehepaar, Dagmar Stöger-Harrach, ihres Zeichens Professorengattin und freiberufliche Innenausstatterin, Thomas Steger, ein etwas übergewichtiger Mitvierziger, der in Wien in einer Spielwarenhandlung arbeitete und vor zwei Jahren ein Kinderbuch veröffentlicht hatte, Herta Niebauer, eine Rentnerin, die nebenbei Tiergeschichten für ein Lokalblatt schrieb, und Lydia.
Lydias wegen saß auch Julie seit einiger Zeit in diesen Treffen, die unter dem Namen Altenhainer Literaturzirkel liefen und bei denen neben aktuellen Publikationen aus dem Bereich der Belletristik auch eigene literarische Ergüsse diskutiert wurden.
Dr. Lydia Götz, um die vierzig Jahre alt und Direktorin an der Höheren Katholischen Mädchenschule in St. Pölten, unterrichtete Deutsch und Englisch. Nach einer der Unterrichtsstunden hatte Lydia ihre Schülerin unter vier Augen darauf angesprochen, ob sie nicht einmal bei einem der nächsten Treffen im Pfarrsaal vorbeischauen wollte, ganz unverbindlich.
Du magst doch Bücher, hatte sie gesagt – und ihr schließlich einen zerknüllten Zettel in die Hand gedrückt, den sie während des Unterrichts Sylvia und Daniela abgenommen hatte, ehe sie beiden einen Verweis erteilte. Die Mädchen hatten ihn sich über Julies Kopf hin- und hergeschossen und das offensichtlich eine Spur zu auffällig.
Hast du die Lateinaufgabe gemacht? – Nein, ich schreib es von Julie ab, die Streberin hat sie eh. – Willst du echt die Lesbe fragen? – Wäh! … Na ja, weiß nicht? – Pass auf, die gräbt dich nur wieder an …
Vielleicht solltest du das wissen, hatte Lydia den Nachrichtenaustausch kommentiert.
Julie war wortlos und so schnell wie möglich aus dem Klassenzimmer verschwunden. Seither lebte sie mit der Angst, Lydia könnte irgendwann mit ihrer Mutter über den Inhalt dieser Zettel-Konversation sprechen. Die beiden waren befreundet, nach Julies Ermessen aber nicht sehr eng. Dennoch. Lydia, die Mezzosopran sang, traf Julies Mutter regelmäßig bei den Chorproben des Altenhainer Gesangvereins, bei dem sich die Schauspielerin als Sopranistin und Solistin hervortat. Lydia war bereits ein paar Mal bei ihnen zu Hause gewesen und daher rührte auch die Tatsache, dass sich Julie außerhalb der Schule mit ihrer Lehrerin duzte und sie beim Vornamen nannte – wenngleich ihre Kommunikation über oberflächliche Begrüßungsfloskeln nie recht hinausgegangen war.
Das Angebot, am Literaturzirkel teilzunehmen, war für Julie daher überraschend gekommen. Sie hatte es nach langem Abwägen angenommen, weil sie einerseits hoffte, nochmals mit Lydia wegen dieses unseligen Zettels sprechen zu können, andererseits, weil es vielleicht besser war, im Pfarrhaus zu sitzen und über Bücher zu diskutieren, als zu Hause Zielscheibe der schlechten Laune zu werden, die ihre Mutter mit sich herumtrug, seitdem sie nach dem Casting für den Pasta & Basta-Werbespot eine Absage bekommen hatte.
Seit drei Wochen saß sie also als Jüngste in der literarischen Runde dabei und hörte zu. Julie las Bücher, wie andere Musik konsumierten – zu jeder freien Minute und vor allem schnell, und das, ohne dabei Seiten zu überspringen oder den Inhalt nicht zu verstehen. Sie kannte fast alle Romane, über die in der Runde gesprochen wurden – sofern sie in der Gemeindebibliothek oder im Schulleseraum verfügbar waren. Es handelte sich dabei vorwiegend um Bücher mit tiefgründigen philosophischen Tendenzen; Werke, die beispielsweise im Rahmen des Bachmann-Preises prämiert worden waren. Julie wunderte sich teilweise im Stillen, wie Menschen, die weit älter waren als sie selbst, oft so eine oberflächliche Zugangsweise zu dem hatten, was sie lasen.
Darüber schwieg sie allerdings. Sie schwieg überhaupt zu allem. War es inzwischen derart gewohnt, ihre Meinung für sich zu behalten, dass sie anfangs nur antwortete, wenn ihr direkt eine Frage gestellt wurde. Erst allmählich traute sie sich ihre Gedanken zu äußern und stellte verwundert fest, dass es hier tatsächlich ganz anders war als in der Schule: Keiner lachte über sie, keiner nannte sie eine Streberin, niemand spottete wegen ihrer Schriftsprache.
Beim mittlerweile vierten Treffen und nachdem Thomas einen Textausschnitt aus seinem neuesten Kinderbuch vorgelesen hatte, wagte sie einen für sie gewaltigen Schritt.
»Ich … ich würde auch … ich habe einen Text dabei.«
Überraschte Blicke von allen Seiten. Lydia, die sie mit einem aufmunternden Lächeln bedachte, das ihr Mut gab.
»Bitte, Julie.«
Es ging um eine Frau mittleren Alters, die auf einem Hochhaus stand und mit sich rang, ob sie ihrem Leben durch einen beherzten Sprung ein Ende setzen oder ihre bisherige Situation weiter ertragen sollte. Ihr Mann war Alkoholiker und neigte zu Gewaltexzessen, der Sohn war in die Drogenszene abgerutscht und zu ihrer erwachsenen Tochter gab es kaum mehr Kontakt. Julie hatte sich Mühe gegeben bei dem inneren Dialog, den die Frau mit sich führte. Ihre Wortwahl war schlicht und schnörkellos – wie die Denke der Frau, deren Schicksal am Ende der Geschichte offen blieb.
Als sie geendet hatte, waren die Augen aller auf sie gerichtet. Dies und das Schweigen, das schwer im Raum hing, ließen den Kloß in ihrer Kehle zu einem imaginären Ball anwachsen, der ihr fast den Atem raubte. Einen Moment lang fühlte sie sich so hilflos und verunsichert wie vor einigen Wochen auf Sylvias Party, nachdem sie Danielas Lippen berührt hatte.
Es war Lydia, die mit einem Räuspern die Stille durchbrach.
»Julie … das war eine sehr ergreifende Geschichte.«
»Was heißt ergreifend? – Das war brillant!« Thomas sprang von seinem Sessel auf. Sein beleibter Oberkörper wackelte heftig, als er die kurze Distanz zwischen ihnen überwand und Julie, die nicht darauf gefasst gewesen war, in seine wuchtigen Arme schloss. »Du bist ein Wahnsinn, Mädchen, nur dass du das weißt!«
Der unerwartete Körperkontakt missfiel ihr, sie ließ ihn aber über sich ergehen.
Das Ehepaar Wunderlein äußerte sich ebenso enthusiastisch. Herta Niebauer schlug sogleich vor, die Geschichte in einem der ihr bekannten Lokalblätter unterzubringen, aber Lydia wiegelte eilig ab.
»Ich denke nicht, dass diese Art von Geschichte dafür geeignet ist, beim Nachmittagskaffee konsumiert zu werden.«
Julie war ihr dankbar. Die Vorstellung, dass diese Geschichte irgendwo abgedruckt wurde, möglicherweise auch noch mit ihrem Namen darunter, bereitete ihr Missbehagen. Sie hatte den Text in dieser Runde vorgelesen, weil sie wusste, dass er nicht perfekt war. Konstruktive Kritik war das, was sie sich erhofft hatte – nicht blinder Beifall. Im selben Moment begriff sie, dass sie das, wonach sie sich sehnte, von diesen Leuten nicht bekommen würde. Sie sah sich einen Moment lang durch deren Augen: ein siebzehnjähriges Mädchen, dass besser formulieren konnte als alle im Raum zusammen, Thomas, den Kinderbuchautor, und Lydia, die Deutschlehrerin, eingeschlossen.
Ein wenig enttäuscht von dieser Erkenntnis, trat sie rund eine halbe Stunde später nach draußen auf den Parkplatz vor der Kirche. Es war 20 Uhr und stockdunkel; obendrein hatte es zu nieseln begonnen. Ihr Zuhause lag knapp fünfzehn Minuten Fußmarsch vom Pfarrsaal entfernt – hügelaufwärts. Julie zog die Kapuze ihres dünnen Anoraks über den Kopf und wollte gerade losmarschieren, als sie Lydia neben sich bemerkte.
»Willst du wirklich zu Fuß gehen? – Ich fahre dich nach Hause.«
Julie nahm das Angebot nur zu gerne an. Während der kurzen Autofahrt überlegte sie inständig, wie sie die Direktorin auf den Zettel ansprechen konnte, doch es fielen ihr keine passenden Worte ein. Das Thema war unangenehm genug.
Das alte Holzhaus lag dunkel vor ihnen, als Lydia den BMW in die schmale Zufahrtsstraße lenkte. Julie fragte sich, wo ihre Mutter und die Zwillinge geblieben waren. Sie hatte keinen Hausschlüssel mitgenommen, weil Dana den Abend zu Hause verbringen wollte. Joe war an diesem Abend nach Wien gefahren, um sich mit einem Galeristen zu treffen.
Die Haustüre fand sie erwartungsgemäß versperrt. Lediglich die Scheune, die Joe als Werkstatt und Atelier benutzte, war nicht verschlossen. Tastend schob Julie sich in den Raum. Drinnen war es eiskalt. Joe heizte nur, wenn er dort arbeitete.
»Julie, das ist lächerlich, hier in der Kälte wirst du sicher nicht darauf warten, bis deine Mutter irgendwann nach Hause kommt.« Lydia war ebenfalls ausgestiegen. Ihre hochhackigen Stiefel knirschten auf dem Kies. Julie hatte das kleine Scheunentor wieder geschlossen und stand ratlos und fröstelnd im Hof, während die Lehrerin ihr Handy zückte.
»Dana, hier ist Lydia. Wo bist du?« Pause. »Weil deine Tochter vor verschlossener Tür steht.« Pause. »Warten? Wie lange soll sie hier bei Temperaturen um den Nullpunkt warten? Bis sie anfriert? – Nein, bleib, wo du bist. Julie kommt einstweilen mit zu mir und ich bringe sie in zwei, drei Stunden vorbei. Vielleicht bist du ja dann zu Hause.«
In Lydias Stimme schwang tiefer Sarkasmus. Julie empfang eine leise Genugtuung, dass es jemanden gab, der ihrer Mutter gegenüber auf diese Weise seine Missbilligung kundtat.
»Steig wieder ein.« Lydia hielt ihr die Tür auf. »Deine Mutter ist mit den Zwillingen nach Wien ins Shoppingcenter gefahren. Sie sitzt jetzt mit ihnen beim Running Sushi. Ihr war zu Hause zu fad, sagt sie.«
Julie erwiderte nichts. Sie war Aktionen wie diese gewohnt. Lydia, in der sich die Pädagogin zeigte, anscheinend nicht.
»Die Zwillinge haben doch morgen Kindergarten, oder? Gehen die immer so spät schlafen?«
»Manchmal.«
Lydia und ihr Mann, Primararzt am Landesklinikum St. Pölten, wohnten auf einem ehemaligen Bauernhof, ähnlich jenem, den Joe von seinen Eltern geerbt hatte und in dem sie mit ihm lebten. Im Gegensatz zu Joes altem Haus mit den moosüberwucherten Dachziegeln und dem bröckelnden Putz am Gemäuer war das Gebäude des Ehepaares Götz perfekt saniert. Die Scheune war hier in eine Garage umfunktioniert worden, mit per Fernsteuerung bedienbarem Tor.
Während sie warteten, bis sich das Scheunentor weit genug geöffnet hatte, um es passieren zu können, fiel Julies Blick nach draußen. Am Nachbarhaus bemerkte sie eine Bewegung hinter dem hell erleuchteten Fenster.
»Das ist die alte Frau Mosbacher«, kommentierte Lydia nüchtern. »Schlimmer als ein Wachhund. Ihr entgeht nichts. – Nun ja, es hat auch seine Vorteile. Falls bei uns eingebrochen würde, könnte sie zumindest die Einbrecher haarklein beschreiben oder vielleicht schon vorher die Polizei verständigen …«
Fünf Minuten später standen sie im Hausflur.
Julie war noch nie bei Lydia zu Hause gewesen. Das Haus sah innen genauso makellos aus wie außen. Die Terrakotta-Fliesen im Eingangsbereich wirkten neu. Lydia nahm ihr den Anorak ab und hängte ihn in den wuchtigen antiken Spiegelschrank, der als Garderobe diente.
Während Julie sich ihrer klobigen Turnschuhe entledigte, fragte sie sich, was sie hier sollte.
Zumindest ist es warm.
Sie folgte Lydia in die Küche – ein Raum, in dem es an nichts fehlte, mit von einem von allen Seiten zugänglichen Herd in der Mitte, einem amerikanischen Kühlschrank und ganz in weinrot gehaltenen Küchenkästen.
Lydia stellte zwei Sektgläser auf die Küchentheke, öffnete mit souverän kontrolliertem Korkenknall eine Flasche und befüllte die Gläser. Champagner, las Julie auf dem Schriftzug und sie wunderte sich, was das werden würde, hier mit Lydia, die aller privaten Bekanntschaft zum Trotz immer noch die Direktorin ihrer Schule und zudem ihre Lehrerin war.
»Richard ist auf einem Kongress in Berlin.« Ein gefülltes Glas wurde angereicht. »Machen wir es uns also nett. – Zum Wohl!«
Als sie anstießen, fiel Julie zum ersten Mal auf, dass Lydia ohne ihre Absatzschuhe fast einen halben Kopf kleiner war als sie selbst. Trotzdem kam es ihr noch immer so vor, als würde die Lehrerin sie allein durch die Präsenz ihrer Persönlichkeit um Kopflängen überragen.
Der Champagner perlte auf Julies Zunge. Sein Geschmack war ungewohnt, aber interessant.
»Nun, was machen wir jetzt, Julie?« Lydia sah sie aus dunklen Augen voller Intensität an. Ein seltsames Gefühl keimte in Julies Unterleib. Befremdet über ihre eigenen Empfindungen, senkte sie rasch den Blick.
»Ich habe eine Idee. Ich bin sicher, sie wird dir gefallen!« Ein kleines Lächeln umspielte Lydias Lippen, während sie Julie an der Hand ergriff und mit sich zog. Das Glas in der rechten Hand und Lydias warme Finger in der linken, folgte ihr Julie die Kellertreppe hinab nach unten.
Weiße Marmorfliesen und Lampen an den gekachelten Wänden, die aussahen wie Fackeln. Es war hier noch deutlich wärmer als oben. Ein dezenter Duft nach Eukalyptus kitzelte in Julies Nase.
»Willkommen in unserer kleinen Wellness-Oase. Die Sauna ist vorgeheizt.«
Und ehe Julie einen klaren Gedanken fassen konnte, begann sich Lydia auch schon auszuziehen. Stocksteif stand ihre junge Besucherin da und starrte sie an, während sie das Champagnerglas umklammerte wie einen Rettungsanker. Lydia schien die Schockstarre, in die Julie gefallen war, gar nicht zu bemerken. Splitternackt ging sie an ihr vorbei zu einem kleinen Schrank, öffnete ihn und nahm zwei große Handtücher hervor.
»Hier, nimm. – Was ist? Du bist noch immer angezogen?« Ein amüsiertes Lächeln umspielte Lydias Lippen. »So schamhaft? Ich hatte immer den Eindruck, bei euch zu Hause gehe es recht freizügig zu!«
Julie wusste, auf was sie anspielte. Dass sich ihre Mutter im Sommer faserfrei im Garten sonnte, war in Altenhain Ortsgespräch.
Sie leerte ihr Glas, ohne abzusetzen, und stellte es zur Seite.
Nun gut.
Es war eine seltsame Situation, hier mit Lydia. Doch sie war nun einmal da und im Augenblick hatte Julie nicht den Eindruck, dass sie etwas daran ändern konnte – es im Grunde auch nicht wollte. Lydia mit ihrem vollen Busen und ihren weiblichen Rundungen war kein Anblick, der Abscheu erweckte. Ganz im Gegenteil. Während Julie sich nun flugs aus ihrer eigenen Kleidung schälte, musste sie sich zwingen, nicht ständig verstohlen hinüberzusehen.
Sie hielt kurz inne. Noch trug sie ihre Unterwäsche am Leib. Während sie nach dem BH-Verschluss tastete, wurde ihr bewusst, dass sie sich vor fünf Tagen das letzte Mal rasiert hatte, und es war ihr mit einem Mal peinlich, sich komplett auszuziehen. Dann sah sie das Grinsen bei Lydia, deren Blick an ihren übrigen Kleidungsstücken hängen geblieben war, und entschied, dass gegen einen dunkelgrünen Sport-BH und eine lila Baumwollunterhose, bedruckt mit pinken Katzen, eine Spur von Haarwuchs letztendlich das geringere Übel darstellte.
Das Handtuch rasch an Brust und Unterkörper pressend, folgte sie Lydia in die kleine Saunakabine, wo sich die Hausherrin rücklings ausgestreckt auf die linke Bank legte. Julie, noch immer darauf bedacht, möglichst viel Haut mit dem Handtuch zu bedecken, setzte sich auf die Bank gegenüber und lauschte dem Knistern des Saunaofens. Wärme drang in ihr Inneres, hüllte sie, unterstützt von der Wirkung des Sektes, in eine angenehme Wolke. Für ein paar Augenblicke fühlte sie sich frei und sorglos.
»Deine Geschichte heute war wirklich gut«, durchbrach Lydia unvermittelt die Stille. »Dein Vokabular und dein Stil sind für dein Alter bemerkenswert … Ich korrigiere, nicht nur für dein Alter. Ich bezweifle, dass irgendjemand aus dieser Runde das so hinbekommen würde. Allerdings finde ich, du solltest über Dinge schreiben, von denen du etwas verstehst – etwas, dass du selbst erlebt hast, selbst gefühlt hast. Oder etwas, was du beobachtest. Diese Frau, die du da beschrieben hast … in Ansätzen hast du dich in eine Weise in sie einfühlen können, wie es sonst wohl kaum eine Siebzehnjährige zustande bringt. Aber zwischen den Zeilen merkt man, dass du keine Ahnung hast, was du da zu Papier bringst.«
Da war sie also doch, jene Art von Kritik, die sie sich erhofft hatte. Julie wusste, sie sollte Lydia für ihre offenen Worte unter vier Augen dankbar sein, trotzdem fühlte sie sich in diesem Moment gekränkt. Sie hatte sich sehr wohl in diese Frau hineinversetzt …
»Was meinst du damit?!« Sogar in ihren eigenen Ohren hörten sich ihre Worte harsch an – unangemessen rüde in Anbetracht dessen, dass sie an ihre Lehrerin gerichtet waren.
»Oh, du hast ja so etwas wie Emotionen!« Lydia richtete sich auf. Sie schmunzelte. »Habe ich dich auf dem falschen Fuß erwischt?«
»Nein.« Julie drehte den Kopf zur Seite. Ihr Ausbruch war ihr unangenehm, zudem wollte sie nicht ständig auf Lydias Brüste starren.
»Ich sag dir sehr gerne, was ich meine«, ergriff Lydia nach einer längeren Pause das Wort. »Du hast noch nie jemanden geliebt. Du hast keine Ahnung, wie es dieser Frau geht, die vor vielen Jahren einen Mann geheiratet hat, der für sie alles bedeutete, aber jetzt aufgrund seiner Trunksucht ein völlig anderer Mensch ist. Diese Enttäuschung über das Scheitern ihres Lebens, über ihre missglückte Partnerwahl – das alles spiegelt sich in deiner Geschichte nicht wider. Diese Frau ist verbittert, weil der Mensch, dem sie einst völlig vertraute, sie hintergangen und sich als ein völlig anderer entpuppt hat. Und dann die Sache mit dem Sohn. Du kennst niemanden, der Drogen nimmt. Du weißt nicht, in welch ohnmächtiger Hilflosigkeit eine Mutter ihrem süchtigen Sohn gegenübersteht.«
Der Vortrag stachelte Julies Gegenwehr. Trotzig schüttelte sie den Kopf, dass ihre roten Haare flogen.
»Ich kenne mich aus mit Drogen. Mama und Joe rauchen gelegentlich Marihuana und ich weiß …«
»Julie, bitte! Du bist spießiger als meine eigene Mutter und das will etwas heißen!«
Die so Gerügte holte Luft, zog es dann aber vor, den Mund zu halten und schweigend vor sich hin zu schwitzen. Der Saunaofen knackte. Auf Lydias Haut hatten sich bereits kleine Schweißperlen gebildet. Fasziniert sah Julie zu, wie eine davon Lydias Brüste entlang über deren Bauchdecke in Richtung Nabel rollte.
»Gefällt dir, was du siehst?«
Julie zuckte zusammen. Feuerrot vor Scham, starrte sie auf die hellen Holzbänke und fühlte sich ähnlich hilflos wie auf Sylvias Party. Sie empfand dieselbe Scham, verbunden mit dem Drang, auf und davon zu stürzen. Trotzdem blieb sie sitzen, ohne selbst genau zu wissen, weshalb. Vielleicht, weil Lydia nicht über sie lachte, sondern sie stattdessen mit einer Eindringlichkeit ansah, die Julie trotz Sauna Gänsehaut verursachte.
Sie fuhr sich mit der Zunge über die trockenen Lippen, richtete sich auf. »Ja«, sagte sie dann, ohne recht zu wissen, woher sie den plötzlichen Mut für dieses Geständnis nahm.
Lydia lächelte sie mit halb geöffnetem Mund und glänzenden Augen an.
Als sie knapp zehn Minuten später die Sauna verließen, waren Julies Körper und Geist in Aufruhr geraten. Das Kribbeln in ihrem Unterleib hatte in ein sehnsuchtsvolles Ziehen zwischen ihren Beinen gemündet. Inzwischen sah sie in Lydia nicht länger nur die Lehrerin, sondern eine attraktive Frau mit brünetten, schulterlangen Locken und einem straffen Busen, von dem sie ihren Blick kaum hatte abwenden können.
Sie wusste nicht recht, was sie von der plötzlichen Wendung, die ihre Bekanntschaft genommen hatte, halten sollte. Lydia war kinderlos, aber verheiratet. Julie kannte ihren Mann vom Sehen – ein schlanker, hochgewachsener Mittfünfziger, der ihr beim Bäcker einmal die Türe aufgehalten hatte, als sie mit Brot und Brötchentüte beladen zum Ausgang gegangen war. Es schien ihr nicht fair, hier mit Lydia diese Art von Blicken auszutauschen, während Richard Götz beruflich unterwegs war.
Trotzdem – die Gefühle, die Lydia in ihr plötzlich auslöste, waren neu und aufregend. Es war unmöglich, diese Empfindungen einfach zu ignorieren.
Julie hielt den Kopf unter das kalte Wasser und ließ es über ihre glühend heiße Haut rinnen. Als sie aus der Dusche trat, waren das Haar nass und die Haut eiskalt, doch in ihrem Inneren loderte noch immer ein Feuer. Hastig trocknete sie sich ab. Was sollte sie jetzt tun? Lydia bitten, sie sofort nach Hause zu fahren? Bleiben und abwarten, was der Abend noch bringen würde?
Die Entscheidung wurde ihr abgenommen, indem Lydias Arme sich von hinten um ihre schmale Taille schlangen. Sie fühlte weiche Brüste an ihrem Rücken, und ein Blitz, heiß und elektrisierend, schoss zwischen ihre Beine. Julies Herz raste.
»Kommst du mit mir auf die Liege?«, hörte sie Lydia heiser an ihrem Ohr flüstern.
Ja. Ja, wollte sie sagen, doch die Stimme wollte ihr in diesem Moment nicht gehorchen. Aus Furcht, diese attraktive Frau könne ihr Schweigen als Ablehnung deuten, drehte sie sich um und legte ihre Lippen leicht auf die von Lydia. Sie schmeckten anders als Danielas, waren weich und voll – vor allem aber öffneten sie sich für sie, als sie den Kuss erst vorsichtig, dann etwas mutiger vertiefte und nahm, was sich ihr so willig darbot.
Wien, Dezember 2014
»Bei diesem Elendswetter über acht Stunden Einsatz, das geht wirklich an die Substanz.«
Bezirksinspektor Bernd Gerold strich sich über seinen grau melierten Bart, während er seine Gummistiefel im VW Passat Kombi verstaute und gegen solide Halbschuhe tauschte. Helene Winter setzte sich neben ihn auf den Rand des geöffneten Kofferraums, die Arme fröstelnd vor der Brust verschränkt. Trotz der gefütterten Wachsjacke war auch ihr die feuchte Novemberkälte unter die Haut gekrochen. Gewöhnlich war sie gerne an der frischen Luft, doch einen ganzen Tag lang wegen einer Krisenübung im Freien zu verbringen, war auch für sie etwas zu viel des Guten.
›Geiselnahme an der Trabrennbahn Krieau‹ war das Thema der Übung gewesen. Hunderte Kollegen, zwei Spezialeinheiten und mehrere Laienschauspieler, die auf überzeugende Weise die vor Angst zitternden und teilweise irrational handelnden Geiseln simulierten, hatten das Szenario realistisch aufbereitet. Zuletzt war der Geiselnehmer, ein ehemaliger Kollege, der nach fünf Dienstjahren als Schauspieler an die Josefstadt gewechselt war und damit nun seiner wahren Passion nachging, wunschgemäß überwältigt worden – nach stundenlangen zähen Verhandlungen, die kein Ergebnis gebracht hatten.
Helene Winter, ihres Zeichens Polizeipsychologin, hatte gemeinsam mit den aktiven Kollegen die ganze Zeit in der Kälte gestanden, ohne wirklich zum Einsatz zu kommen. Anders als für die beiden Polizeipsychologen, die im Bereich der Opferbetreuung tätig waren, gab es für sie bei dieser simulierten Geiselnahme so gut wie nichts zu tun. Ihr Job war es, sich nach schweren Einsätzen um traumatisierte Polizisten zu kümmern. Die Kollegen probten jedoch selten einen psychischen Zustand, der ihren Einsatz erforderlich machte.
»Bist du mit dem Auto da?«
»Ist in der Werkstatt. Ich bin mit den Öffentlichen gekommen.«
»Dann bringe ich dich nach Hause.« Bernd Gerold hielt ihr die Tür zur Beifahrerseite auf, eine Geste, die sie zu schätzen wusste. Trotzdem zögerte sie.
»Du wohnst immer noch in Währing, Bernd, und ich immer noch in der Margaretenstraße. Das liegt nicht gerade auf der Strecke.«
Er machte eine abwehrende Geste.
»Egal. Ich fahr dich.«
Sie kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass sein Angebot nicht auf Selbstlosigkeit basierte. Vor knapp zehn Jahren waren sie in eine Affäre miteinander geraten, die sich über einige Jahre erstreckt hatte und schließlich endete, weil ihr die Rahmenumstände allmählich an die Substanz gegangen waren. Dennoch nutzte er weiterhin jede der eher seltenen Gelegenheiten, Zeit mit ihr alleine zu verbringen, und sei es auch nur für die Dauer einer Autofahrt quer durch die Stadt.
»Wie geht es dir?«, fragte er, während er das Auto vom Parkplatz auf die Hauptallee lenkte.
»Gut, im Großen und Ganzen.«
»Du siehst toll aus. Die kurzen Haare stehen dir.«
»In erster Linie sind sie praktisch.«
»Und in zweiter machen sie dich noch attraktiver.«
Sie lächelte flüchtig. Trotz aller Vorbehalte war sie für seine Komplimente empfänglich.
»Trotz der Tatsache, dass mein Haar inzwischen grau ist?«
Er sah sie von der Seite an und lächelte.
»Gerade deshalb.«
Eine Weile fuhren sie schweigend durch die bereits weihnachtlich beleuchtete Stadt. Im stockenden Feierabendverkehr kamen sie nur langsam voran. Bernd hatte die Autoheizung auf Höchststufe gedreht, dennoch sehnte sie sich fröstelnd nach einer heißen Badewanne und einem Glas Rotwein.