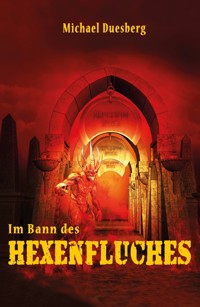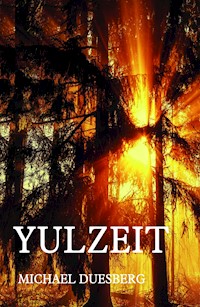8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Als das Waisenkind Ceana in einem Stadtteil Stuttgarts von der Polizei aufgegriffen wird, ahnt niemand von den Brennans, was das bedeutet. Doch die Kleine kommt zu ihnen in die Familie und nimmt die Stelle der dritten Tochter einer dritten Tochter ein. Damit werden in der Anderswelt Ereignisse in Gang gesetzt, die dramatische Folgen haben: Wesen aus dem finstersten Gefolge Angra Mainyus und seiner Verbündeten Ištar versuchen mit allen Mitteln, die verhasste Familie auszulöschen. Die Töchter der Brennans bemühen sich mithilfe der Elfen darum, die Bereiche von Leben, Seele und Geist als reale Größen ins Bewusstsein ihrer Schulkameraden und in die Kultur ihrer Zeit zu rücken. Darauf reagieren jedoch führende Regierungskreise mit Verboten und Strafen, gegen welche wiederum Teile der Bevölkerung protestieren und drastische Gegenmaßnahmen ergreifen. Es kommt zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen, an deren Ende die Gedankenfreiheit einstweilen siegt. Der Autor zeichnet mit Ironie und Wortwitz Situationen und Zustände, die gar nicht so weit von unserer Realität entfernt liegen. Neben allem Humor, der die Lachmuskeln reizt, bleibt der tiefe Ernst der Geschichte nicht verborgen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Michael Duesberg
Kinder der Unsterblichen
Impressum:
© 2020 Michael Duesberg
Umschlaggestaltung: Angelika Fleckenstein; Spotsrock
Umschlagbild: Artie Navarre pixabay.com
Korrektorat und Satz: Angelika Fleckenstein; Spotsrock
Druck und Verlag:
tredition GmbH
Halenreie 40–44
22359 Hamburg
ISBN:
978-3-347-01623-1 (Paperback)
978-3-347-01624-8 (Hardcover)
978-3-347-01625-5 (e-Book)
Die in der Geschichte verwendeten Namen u. Orte sind frei erfunden; Ähnlichkeiten zu lebenden oder bereits verstorbenen Personen sind daher rein zufällig und keineswegs beabsichtigt.
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http: //dnb.d-nb.de abrufbar.
Michael Duesberg
KINDER DER UNSTERBLICHEN
1
„Ich heißeAronwin,bin unterwegs nach Ait, wo meine Kusine Novaïkte wohnt; sie hat mich zum Lábreiteeingeladen“, sagte das Mädchen, als es bei der Polizei in Gegenwart einer Psychologin befragt wurde. Es war der einzige Satz, den es sprach und es tat dies mit einer merkwürdigen Betonung, die verriet, dass ihm die Sprache fremd war. Mehr sagte das Kind nicht.
Die Psychologin aber bekam große Augen.
„Na, das ist doch schon mal was“, meinte der leitende Polizei-Hauptkommissar Georg Hammer, als ihm Polizei-Hauptmeister Manfred Schlecker die Ergebnisse der Befragung vortrug. Die etwa Neunjährige war Passanten im Stadtteil Heslach aufgefallen, weil sie ohne erkennbares Zuhause zu sein schien, und das war für ein Mädchen ihres Alters untypisch. Aufmerksame Anwohner hatten das Sozialamt und die Polizei verständigt, und die Ordnungshüter sollten nun möglichst schnell die Eltern oder Verwandten des Kindes auftreiben. Das war aber nicht so einfach, weil das Kind mit Ausnahme des einstudierten Satzes die Sprache weder sprach noch verstand. Hauptmeister Manfred Schlecker hatte umsonst in alle verfügbaren Trickkisten, wie Gummibärchen, Lakritze und Karamellbonbons gegriffen, um etwas Brauchbares aus dem Mädchen herauszuholen.
Dann aber, während der zweiten Sitzung, gab es eine Überraschung. Als Hauptmeister Schlecker nämlich verlauten ließ, dass er die Begriffe „Aronwin“,„Ait“ und „Novaïcte“ international zur Suche ausschreiben lassen wolle, sagte die Psychologin, Frau Dr. Sadhbh Brennan, dass sie ihm von seinem Vorhaben abrate, weil ihr die angegebenen Wörter bekannt seien. Ja aber, warum sie das denn nicht gleich gesagt habe, hatte Hauptmeister Schlecker gefragt.
Nun ja, sie wäre sich anfangs der merkwürdigen Aussprache wegen nicht sicher gewesen, doch jetzt sei ihr klar, was das Mädchen gesagt hatte: „Ich heißeaon duine, bin unterwegs nacháit, wo meine Kusinedofheicthewohnt; sie hat mich zumlá breitheeingeladen“, was übertragen hieße: „Ich heiße „Niemand“, bin unterwegs nach „Nirgendwohin“, wo meine Kusine „Unsichtbar“ wohnt; sie hat mich zum Geburtstag eingeladen. “
Diese neue Entwicklung des Falls meldete Hauptmeister Schlecker dann seinem Chef.
„Also ein paar irisch-gälische Brocken, dazwischen ein bisschen unverstandener deutscher Brei und letztendlich null Ahnung“, fasste Hammer das Ergebnis der Befragung zusammen. Schlecker nickte und schwieg.
„Und diese Frau Doktor Brennan, die Psycho-Tante, was meinte die dazu?“, fragte Hammer.
„Die wusste dann auch nicht weiter. Aber sie nannte das Mädchen Ceana (Tschanna), und als ich sie nach dieser eigenmächtigen Namengebung fragte, meinte sie, das heiße bei ihnen in Irland „die Schöne“, sei ein Mädchenname und würde auf die hübsche Kleine ja wohl zutreffen.“
„Was für eine Sprache spricht denn das Mädchen?“, hakte Hammer weiter nach, „könnt ihr das nicht herausbringen? Fragt doch mal einen Spezialisten.“
„Wird noch gemacht“, antwortete Schlecker und verließ Hammers Büro.
Wieder vergingen ein paar Tage. Die Kleine war von Amts wegen einstweilen der Psychologin und ihrer Familie als Pflegekind zugesprochen worden. Das hatte Frau Dr. Brennan gleich nach der ersten Befragung beantragt, und da ihre Sozialkompetenz unbestritten war, freuten sich die Mitarbeiterinnen des Sozialamts über die unkomplizierte Lösung und beschleunigten sogar noch den Formalitätenkram.
„Frau Dr. Sadhbh Brennan übernimmt fortan die Verantwortung für das etwa neunjährige Findelkind Aronwin bis zum Auffinden von dessen Eltern oder anderen Verwandten“, so stand es in den Akten.
Frau Dr. Brennan wusste genau, was sie da tat. Sie hatte dem Mädchen gleich zu Beginn etwas angesehen, für das deutsche Augen blind waren, dass es nämlich kein gewöhnliches Menschenkind war; dass die Kleine möglicherweise keine Sprache der Welt sprach, es sei denn, sie lerne sie ganz neu, weil sie ein Kind der Anderswelt war. Doch ihre Abkunft war nach wie vor unklar. Dr. Brennan vermutete, dass vielleicht ein Elternteil Elf oder Elfe war, der andere möglicherweise Mensch. Eventuell auch ein Gott oder eine Göttin. Warum hatte dieses Geschöpf dann aber einen menschlichen Leib? Es blieben viele Fragen offen, und sie selbst und das Mädchen hatten Glück, dass sich beim Sozialamt ein Teil der Belegschaft derzeit im Urlaub befand, und das waren just die drei gefährlichsten Mitarbeiterinnen: Frau Sigrun Kreischer, Frau Asiram Steinherz und Frau Helene Quälinger. Schlimm, wenn eine von ihnen das Kind gleich zu Beginn in die Fänge bekommen hätte!
Als die Ermittlungen bezüglich der Nationalität des Findelkinds weiterhin stockten, wurde der Fall ad acta gelegt und Ceana, wie sie jetzt auch von Amts wegen hieß, lebte bei Sadhbh Brennan und ihrer Familie. Diese bestand aus ihrem Ehemann, Dr. Padraic Brennan, einem Arzt aus dem Team der Asklepios-Klinik im Zentrum der Stadt, und den zwei Töchtern Aili und Annag. Aili war 11 und Annag 9 Jahre alt, etwa so alt wie Ceana, der Findling. Die drei Mädchen hatten sich auf Anhieb gemocht, und das freute und beunruhigte die Psychologin gleichermaßen, doch was sie dabei umtrieb, darüber konnte sie mit niemandem sprechen, nicht einmal mit ihrem Mann.
Wie sie erwartet hatte, geschahen bald merkwürdige Dinge, die aber immer nur Sadhbh allein sah. Dazu gehörte, dass sie in den Ferien eines frühen Morgens ihre drei Kinder nebeneinander durch die tauigen Wiesen aufs Haus zukommen sah, wobei Aili und Annag zwei deutliche Spuren im Gras hinterließen, Ceana jedoch nicht die Andeutung einer solchen. Oder dass Tiere recht ungewöhnlich auf Ceana reagierten, denn alle Tiere schienen sie zu lieben und zeigten in ihrer Gegenwart überhaupt keine Scheu. So erzählten Aili und Annag ihrer Mutter ganz begeistert davon, dass Ceana im Wald ein Reh hinter den Ohren gekrault habe; oder wie geschickt sie auf Bäumen herumturnen und wie toll sie schwimmen konnte. Und in der Adventszeit, dass sie die Flammen der Kerzen gestreichelt habe.
Nach einem halben Jahr beantragte Familie Brennan die Adoption des Findlings; da fühlten sich die Mädchen schon lange wie Schwestern, und obwohl Ceana in der Familie anfangs die Rolle einer Drittgeborenen gespielt hatte, war ihr Einfluss auf die neuen Schwestern umfassender geworden. Sie führte die Spiele an, dachte sich immerzu neue lustige Tätigkeiten aus und beeinflusste bald die ganze Familie. Dieser Einfluss war in jeder Hinsicht ein Segen, denn sie alle fingen an, die Dinge umher aufmerksamer zu betrachten, sich liebevoller damit zu beschäftigen und ihre diversen Vorhaben tatkräftiger anzugehen. In dem Bestreben, der „neuen Schwester“ zu zeigen, wie man hierzulande lebt und was man tun musste, um alles gut und richtig zu machen, entwickelten die leiblichen Kinder des Paares große Hilfsbereitschaft, zuerst nur füreinander, bald aber auch für andere, sodass sich Frau Brennans Anfangsvermutung verdichtete, das Findelkind habe etwas mit der Anderswelt zu tun.
Als Ceana die neue Sprache weitgehend beherrschte, was sie schon in kürzester Zeit erreichte, holte Frau Brennan die alten Bücher über Elfenmärchen und Elfensagen vom Speicher und las abends beim Kerzenschein daraus vor, Geschichten, denen ihre leiblichen Kinder fast schon entwachsen waren.
„Warum machst du das?“, fragten Aili und Annag.
„Nun“, antwortete sie, „die Welt der sichtbaren Dinge und Wesen lernen wir alle ja schon von selbst und wie nebenbei kennen, doch die Welt der Unsichtbaren, von der muss ich euch immer wieder erzählen, die vergisst man allzu leicht; und wenn man sie zu lange vergessen hat, findet man sie bis ans Lebensende nicht wieder.“
Das leuchtete den Mädchen ein. So pflegte Sadhbh dieses Kapitel liebevoll über längere Zeit und niemand stellte es mehr in Frage.
Als sie bei einer ihrer Wanderungen in den Ferien frühmorgens sahen, wie der Dunst in Schleiern aus den Wiesen emporstieg, machte Sadhbh die Mädchen darauf aufmerksam, dass dort die Elfen, Nixen, Gnome und Feuergeister ihre Reigen tanzten, und als Aili und Annag fragten, wie sie sich darüber so sicher sein könne, antwortete sie: „Kommt einmal mit!“ und führte sie zu einem nahe gelegenen kleinen See. „Schaut jetzt alle drei nur zum Wasser hin, ja?“
Die Mädchen nickten und stellten sich nebeneinander ans Ufer. Sadhbh, die etwas hinter ihnen stand, nahm einen Stein vom Boden auf und warf ihn in weitem Bogen über die Kinder in den See. Als der Stein ins Wasser schlug, platschte und spritzte es, und von der Eintauchstelle ausgehend breiteten sich zentrifugal Kreise im Wasser und über den See hin aus, die bald auch das Ufer erreichten, wo die Mädchen standen.
„Was habt ihr gesehen?“, fragte Sadhbh.
Annag sagte: „Es hat geplatscht!“
„Hast du das gesehen?“, fragte ihre Mutter zurück.
„Nee, gehört.“
„Ich habe aber nach dem gefragt, was ihr gesehen habt. Was war da am Anfang, bevor der Gegenstand ins Wasser schlug?“
„Eine glatte, unberührte Wasserfläche“, antwortete Annag.
Die beiden anderen nickten.
„Gut“, sagte Sadhbh, „und dann?“
„Dann schlug der Stein ins Wasser“, antwortete Annag.
„Woher weißt du, dass es ein Stein war? Hast du ihn gesehen?“, fragte Sadhbh.
Annag überlegte kurz. „Nicht richtig, aber doch, ja, ein bisschen“, sagte sie dann.
„Also vermutest du, dass es ein Stein war“, half ihr Sadhbh.
„Ja“, bestätigte Annag, „der Stein – oder was es war – flog über das Wasser hin und schlug dann ein; da spritzte und platschte es und gab Kreise.“ „Und diese Kreise“, führte Aili den Gedanken fort, „wurden immer weiter und größer und kamen bis zum Ufer, wo wir standen.“
„Seid ihr mit dieser Beschreibung alle einverstanden?“, fragte ihre Mutter.
Die Mädchen überlegten kurz, dann nickten sie.
„Gut“, fuhr ihre Mutter fort, „genau so war das vorhin auch bei der Wiese: Die war zuvor wie diese glatte Seefläche, bevor der Gegenstand ins Wasser fiel. Heute habt ihr am See gesehen, wie sich sein Aussehen durch den Platsch verändert hat, nicht wahr?“
„Na, das warst doch du“, platzte Annag heraus.
„Dann hast du hinten Augen gehabt?“, fragte ihre Mutter, „was hast du denn wirklich gesehen, Herzchen?“
„Den Stein – oder das Ding halt – und dann den Plumpser und den Spritzer und die Kreise im Wasser.“
„Du hast also etwas fliegen sehen, das dann in den See platschte und Kreise machte, ja?“, fasste Sadhbh zusammen.
Alle nickten.
„So ist das auch bei der Wiese: Zuerst sieht man sie für sich allein. Dann macht jemand Unsichtbares etwas, und plötzlich verändert sich die Wiese. Beim See war es der Stein, der ins Wasser stürzte, der machte die Kreise. Bei der Wiese war es der Wasserdampf, der vom Boden aufstieg und die Wiese verschleierte. Stimmt das so weit?“
„Nein“, antwortete Aili, „der Stein flog ja nicht von sich aus.“
„Gut, der ist natürlich nicht von allein geflogen, aber der Wasserdampf ist eben auch nicht von allein aufgestiegen. Den Stein habe ich geworfen, doch das konntet ihr nicht sehen. Der Wasserdampf stieg aber auch nicht von allein und auch da konntet ihr diejenigen nicht sehen, die es bewirkten. Diese unsichtbaren „Nebelschieber“, das sind die Elementarwesen, also die Undinen, Sylphen, Gnome und Salamander.“
„Moment einmal, Mama“, wandte Aili ein, „ich habe doch in der Schule gelernt, dass der Luftdruck sich tagsüber zweimal verändert, dass er morgens zwischen 6 und 8 Uhr ein Minimum und abends zwischen 18 und 20 Uhr ein Maximum erreicht, weshalb die Erde morgens aus- und abends einatmet.“
„Und wer bewirkt diese Druckunterschiede?“, fragte Sadhbh.
„Das sind physikalische Kräfte“, erwiderte Aili.
„Und wer bewirkt diese physikalischen Kräfte?“, fragte Sadhbh weiter. „Andere physikalischen Kräfte?“
„Soweit du nur den Stein ins Auge gefasst hast, stimmen deine Antworten, ja. Doch hinter dem fliegenden Stein verbarg sich ja eine ganz bestimmte Person, oder nicht?“
Aili musste lachen. „Ja, die kenne ich, sogar schon seit einigen Jahren. Aber was willst du damit sagen?“
„Dass zwar aus Lebendigem Totes entstehen kann, nicht aber aus Totem Lebendiges. Die physikalischen Kräfte sind durchaus alle da, die können wir studieren und exakt messen, aber letztendlich findet ihr als Verursacher hinter allen physikalischen Kräften jene Wesen des Lebendigen, die sie bewirken, lenken und wieder verschwinden lassen, und die nennen wir „Elementarwesen“. Ihr seht sie genauso wenig, wie ihr am See mich gesehen habt, doch sie sind da. ‚Ohne Feuer kein Rauch’, heißt ein Sprichwort und das trifft auch hier zu: Ohne lebendige Wesen keine physikalischen Erscheinungen.“
Auf dem Rückweg waren die Mädchen nachdenklich, und einmal, als Sadhbh zufällig zur Seite schaute, sah ihr Ceana direkt in die Augen und sie merkte, dass das Adoptivkind sie unauffällig gemustert hatten. Sie lächelte das Mädchen an und Ceana lächelte zurück. Aber in diesem Blick lag auch etwas, das Sadhbh nicht deuten konnte. ‚Ob ich einen DNA-Test machen lassen sollte?‘, dachte sie bei sich. ‚Dieses Kind ist unserer verstorbenen Eilidh so unglaublich ähnlich.‘
2
Es war August, als die drei Mitarbeiterinnen des Sozialamts, Frau Sigrun Kreischer, Frau Asiram Steinherz und Frau Helene Quälinger, aus dem Urlaub zurückkehrten. Zunächst mussten sie alte Vorgänge aus der Zeit vor ihrem Urlaub aufarbeiten, und dann gab es ab September außergewöhnlich viele neue Fälle, die förmlich auf sie einprasselten, sodass sie für nichts anderes Zeit fanden. Es war, als würde jemand versuchen, sie mit aller Gewalt von bestimmten Vorgängen der Vergangenheit abzulenken. Der Sommer flog dahin, es wurde Herbst, dann Winter, Frühling und wieder Sommer, bis die drei Frauen die letzten Arbeiten, die ihre Kolleginnen während ihrer Abwesenheit bearbeitet hatten, noch einmal durchsehen konnten. Als sie von dem Findelkind aus Heslach lasen, wurden sie zwar aufmerksam, doch waren sie sich über dessen Bedeutung nicht im Klaren und konnten das Ereignis daher nicht abschließend bewerten. Auch war der Adoptionsantrag der Familie Brennan ja bereits durchgegangen und bestätigt worden.
Als die drei Amtfrauen sich im Oktober zu einer privaten Konferenz zusammensetzten, beschlossen sie, auch diesen alten Vorgang „Ceana Brennan“ im Auge zu behalten. Dazu mussten sie sich jedoch das Mädchen unter einem Vorwand noch einmal genau ansehen. So beschlossen sie, dass Sigrun Kreischer am nächsten Morgen bei der Familie des Findelkinds unangemeldet vorbeifahren und sich aus rein beruflichem Interesse nach Ceanas Befinden erkundigen sollte.
Also stieg Frau Kreischer am nächsten Morgen in ihren Wagen und fuhr zu den Brennans hinaus, die eine halbe Stunde entfernt am Rande von Botnang wohnten. Als sie um 9 Uhr dort ankam, klingelte sie an der Haustür und wartete. Eine junge Frau streckte den Kopf zum Fenster im Obergeschoss heraus und fragte die Besucherin nach ihren Wünschen.
„Guten Morgen! Ich bin vom Sozialamt, Sigrun Kreischer ist mein Name. Ich soll mich nach dem Befinden des Findelkinds erkundigen, das Familie Brennan kürzlich adoptiert hat. Kann ich kurz reinkommen?“
„Das geht leider nicht“, sagte die junge Frau, „Familie Brennan ist nicht da. Herr Dr. Brennan arbeitet seit 8 Uhr in der Asklepios-Klinik im Zentrum der Stadt, die drei Mädchen sind in der Schule und Frau Dr. Brennan ist ebenfalls beruflich unterwegs.“
„Kann ich trotzdem geschwind reinschauen?“, fragte Frau Kreischer betont freundlich.
„Nein“, antwortete die junge Frau, „ich bin nicht befugt, Fremde einzulassen.“
„Aber, aber, ich bin doch keine Fremde. Ich bin vom Sozialamt und kann notfalls auch einen Besuch bei ihnen erzwingen.“
„Dann tun Sie das. Ich muss jetzt weiter saubermachen.“
Damit schloss die junge Frau das Fenster und Frau Kreischer kochte vor Zorn.
„Diese saudumme Putzliese!“, zischte sie. „Was bildet die sich nur ein?“
Und weil sie sich gedemütigt, aber kraft ihres Amtes auch sehr mächtig fühlte, drückte sie abermals auf die Klingel und läutete Sturm.
Alsbald öffnete sich wieder das Fenster im Obergeschoss, die junge Frau schaute auf die Besucherin hinunter und sagte freundlich: „Noch einmal klingeln, und ich rufe die Polizei.“
Damit schloss sie das Fenster wieder, sodass Frau Kreischer ihr keine ihrer giftigen Bemerkungen entgegenschleudern konnte, sondern diese schlucken musste; und da dieselben ziemlich giftig waren, bekam sie unmittelbar darauf den Schluckauf. Sie verkniff sich einen Fluch, stieg in ihren Wagen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt ins Amt zurück.
„Na, etwas erreicht?“, fragte Helene Quälinger vom Schreibtisch aus, als Sigrun Kreischer an ihrem Büro vorbeikam.
„Nein, leider nicht“, antwortete die Gefragte, „die ganze Bande war ausgeflogen. Ich hätte doch besser vorher anrufen sollen.“
„Dann wären sie vorbereitet gewesen. War schon recht so.“
Frau Kreischer ging zu ihrem Büro weiter und schloss die Tür hinter sich.
Am Abend trafen sich die drei Frauen zu einer weiteren Besprechung.
„Erzähle, was du erlebt hast“, forderte Frau Asiram Steinherz ihre Kollegin auf und Frau Kreischer berichtete.
„Jetzt hast du die Putze vergrault; dabei hätten wir genau die als Hilfe gebrauchen können“, konstatierte Frau Steinherz.
„Konnte ja keiner wissen, dass die so reagiert“, nahm Frau Quälinger die Kollegin in Schutz.
„Das war keine Kritik“, versicherte Steinherz, „nur eine schlichte Feststellung. Das nächste Mal muss eine von uns beiden …“, und dabei wandte sie sich an Quälinger, „… zu der Familie hinfahren, du oder ich. Wir wollen Sigrun aus der Schusslinie nehmen. Ist das in eurem Sinne?“
Die beiden anderen stimmten zu. Dann machten sie aus, dass Frau Steinherz am folgenden Spätnachmittag einen weiteren unangemeldeten Besuch vornehmen sollte.
Um 16 Uhr schloss Frau Steinherz ihre Bürotür ab und verließ das Amt. Sie ging zu ihrem Wagen in der Tiefgarage, setzte sich hinter das Steuer und fuhr los. Wegen des frühen Berufsverkehrs war sie erst eine dreiviertel Stunde später in Botnang. Sie klingelte an der Tür der Brennans und wartete. Oben streckte Ceana den Kopf aus dem Fenster.
„Was möchten Sie, bitte?“, fragte sie.
„Guten Tag! Mein Name ist Asiram Steinherz, ich komme vom Sozialamt und möchte nur kurz hören, wie es dem kürzlich gefundenen Mädchen geht, das jetzt Ceana Brennan heißt.
„Geht ihm gut“, antwortete Ceana und, als die Frau nur schweigend zu ihr hochblickte, „gibt es sonst noch etwas?“
„Ja“, sagte Frau Steinherz, „kann ich dazu kurz reinkommen? Ich möchte es nicht von hier unten aus hochrufen müssen.“
„Mama und Papa sind gerade weg. Ich lasse keine Fremden rein, wenn sie nicht da sind.“
Während des kurzen Wortwechsels hatte Ceana das Gefühl, dass die Frau unten vor dem Haus irgendwie komisch war und nichts Gutes im Schilde führte. Als die Angst darüber in ihr hochstieg, sagte sie: „Entschuldigen Sie mich bitte, ich muss aufs Klo“, schloss das Fenster und blieb still im Zimmer stehen. Dort spürte sie die Bebenwellen, die der Wille der Fremden durchs ganze Haus jagte, und fing an zu weinen.
Die Fremde klingelte noch zweimal, dann hörte Ceana, wie die Autotür zuschlug und der Wagen wegfuhr. Zitternd setzte sie sich auf einen Stuhl.
Am folgenden Morgen berichtete Frau Asiram Steinherz ihren Kolleginnen, wie der Besuch verlaufen war.
„Jetzt musst du das nächste Mal hin“, wandte sie sich an Helene Quälinger, „kannst dich diesmal ruhig anmelden, die sind ohnehin gewarnt.“
„Vielleicht sind unsere Vorsichtsmaßnahmen ja auch ganz überflüssig“, meinte Frau Kreischer.
Dann ging jede wieder an ihren Schreibtisch und setzte die Arbeit vom Vortag fort.
Die Tarnung der drei Frauen als „Amtspersonen“ und langjährige Mitarbeiterinnen des Sozialamts mit viel Erfahrung, Kompetenz und Verantwortung war nahezu perfekt; doch die drei waren nicht nur Amtfrauen, sondern nahmen auch eine ungewöhnliche Art von Spionagetätigkeit wahr, die ihnen niemand ansehen konnte: Sie arbeiteten als Jüngerinnen eines schwarzmagischen Konvents für Angra Mainyu und dessen Scharen. Sie waren seit einigen Jahren auf erhöhte Vorsicht eingeschworen worden, warum, wussten sie selbst nicht so genau, aber es handelte sich dabei wohl um die Ankunft einer besonders hochgestellten weißmagischen Persönlichkeit, deren Kommen verhindert werden sollte und die notfalls sogar umzubringen sei.
Frau Helene Quälinger erhielt für das Wochenende einen offiziellen Besuchstermin bei den Brennans, und um 14 Uhr stand sie in Botnang vor der Haustür und läutete. Die Hausherrin öffnete und grüßte die Besucherin.
„Guten Tag“, flötete Frau Quälinger und lächelte die Psychologin an, „ich komme vom Sozialamt und mein Name ist Helene Quälinger. Zwei meiner Kolleginnen und ich waren zu der Zeit im Urlaub, als Ihre jetzige Adoptivtochter gefunden wurde und die Adoption erfolgte. Nun hätten wir, da wir ja auch die alten Fälle unseres Amtes im Auge behalten müssen, gern noch erfahren, ob bei Ihnen alles gut läuft, ob Sie irgendwelche Fragen haben und wie es dem Mädchen so geht. Kann ich sie kurz sehen?“
„Danke der Nachfrage“, antwortete Sadhbh, „ja, es geht uns allen gut.“ Sie verschwieg geflissentlich, dass sie von den unangemeldeten Besuchen der Amtfrauen wusste und verbarg ihr Misstrauen darüber. „Kommen Sie doch bitte herein. Mögen Sie einen Kaffee?“
„Das ist sehr nett von Ihnen. Ja, gern.“
Sadhbh führte Frau Quälinger ins Wohnzimmer, wo der Arzt und die drei Mädchen schon am Kaffeetisch saßen und Kuchen und Plätzchen naschten. Nach der gegenseitigen Vorstellung setzten sich alle wieder zu Tisch und plauderten scheinbar unbefangen weiter, während sie einander jedoch unauffällig musterten. Frau Quälinger strahlte in einem fort und betonte, wie toll sie die familiäre Atmosphäre finde und wie gut es das Mädchen getroffen habe, und dass sie ja so froh sei, dass die Adoption problemlos geklappt habe und … Vor lauter Schmeicheleien gerieten ihr dann ein paar Krümel ihres Brombeerkuchens in den Hals, sodass sie plötzlich heftig husten musste und mit hochrotem Gesicht nach Atem rang. Bald darauf verabschiedete sie sich, stieg wieder in ihren Wagen und fuhr davon.
Die drei Mädchen gingen hinauf ins Spielzimmer und machten sich wieder an ihre angefangenen Bastelarbeiten. Bis zum 1. Advent wollten sie für jedes Fenster im Haus zwei, drei oder vier Transparentsterne zum Anheften fertig haben. Beim Falten und Kleben unterhielten sie sich über „die blöde Frau“, die mit ihnen zusammen Kaffee getrunken hatte.
„Ich fand die nicht nett“, sagte Aili, während sie ihre gefalteten Sternzacken auf die Unterlage klebte, „die wollte irgendwas, sagte aber nicht, was.“ „Genau“, stimmte Annag zu, „die war doof.“
„Und“, fügte Ceana hinzu, „böse war sie auch; nur hat sie das nicht offen gezeigt. Uns hat sie ihr Lächel-Gesicht hingestreckt, aber innen hat sie die Zähne gefletscht wie ein Krokodil.“
Die beiden anderen mussten lachen. Dann klebten und falteten sie wieder eine Weile.
„Das mit den Kuchenkrümeln“, sagte Ceana wie nebenbei, „das habe ich bewirkt. Ich wollte, dass sie mit dem Lügen aufhört.“
„Wie hast du das gemacht?“, fragte Aili.
„Als sie nicht auf mich geachtet hat, bin ich in das Kuchenstück geschlüpft, das sie in den Mund steckte …“
„Ihh!“, rief Annag aus, „da hast du ja ihre Spucke abgekriegt!“
„Nein“, verteidigte sich Ceana, „ich bin dabei ganz trocken geblieben. Als sie einatmete, habe ich ihr nur die trockenen Krümel zum Hals hinter gepustet; den Rest hat sie dann selbst erledigt.“
„Das will ich auch können“, sagte Annag begeistert.
Aili bettelte: „Zeigst du uns, wie es geht, bitte, bitte?“
„Es ist ganz leicht“, sagte Ceana, „aber ich glaube, man darf es nur bei bösen Leuten machen.“
3
In dieser Nacht geschah etwas Außergewöhnliches: Als die Mädchen längst hätten schlafen sollen, tapste jemand vor das Schlafzimmer der Eltern, die Tür wurde leise geöffnet, und eines der Mädchen huschte zu Sadhbh ans Bett.
„Kannst du nicht schlafen, Herzchen?“, fragte Sadhbh.
„An oiread sin Sadhbh?“ (Tante Sadhbh?), hauchte Ceana.
Sadhbh fuhr vom Bett auf, nahm das Mädchen in die Arme und konnte ihr eigenes Schluchzen kaum unterdrücken.
„Ich dachte es mir, ich wusste es“, flüsterte sie der Kleinen ins Haar.
„Máthair“, flüsterte diese zurück, „ich fange an, mich wieder zu erinnern.“
„Was ist mit dir geschehen?“, fragte Sadhbh flüsternd.
„O máthair“, sagte das Mädchen, „ich weiß es nicht mehr. Ich sehe vor lauter Bildern nicht, was ich selbst erlebt und was ich erzählt bekommen habe!“ Und dann schüttelte es das Mädchen vor Schluchzen. Es umklammerte Sadhbh und drückte das Köpfchen so an Sadhbhs Brust, dass seine Tränen Sadhbhs Nachthemd vorn ganz nass machten.
Plötzlich ließ die Kleine ihre Adoptivmutter los und schob sie ein Stück weit von sich weg. „Erinnerst du dich noch an alles?“, fragte sie.
„Nein“, antwortete Sadhbh, „auch nicht mehr.“
„Dabei könnte ich dir aber helfen“, sagte Ceana plötzlich mit ganz anderer Stimme, „du weißt, woher ich stamme, oder?“
„Nicht genau; ich vermute ja so einiges, aber wissen tu ich es nicht.“
Ceana begann zu kichern. „Was vermutest du denn?“, fragte sie. „Dass mein Vater ein großer Frosch war, oder ein Maikäfer, oder …“
„Hallo, meine Kichererbsen“, kam es plötzlich schlaftrunken vom Nebenbett, „habt ihr eine nächtliche Krisensitzung anberaumt?“ Padraic knipste seine Nachttischlampe an und schaute erstaunt zu den beiden im Nachbarbett hinüber.
„Ja“, meinte Sadhbh, „so könnte man es nennen. Aber könntest du bitte das grelle Licht wieder abschalten, das tut in den Augen weh.“
„O, pardon! Na, dann noch eine gute Nacht.“ Damit knipste er das Licht wieder aus und drehte sich auf die andere Seite.
„Wie willst du mir denn dabei helfen?“, griff Sadhbh den Faden flüsternd wieder auf.
Ceana sagte: „Mein Vater ist einer der Unsterblichen, doch weiß ich nicht mehr, zu welchen Wesen er gehört.“
„Entschuldige bitte kurz“, unterbrach sie Sadhbh, „sag mir zuerst, bist du Vanoras oder Struanas Tochter?“
„Struanas“, antwortete Ceana spürbar beeindruckt, „schau, Tante, jetzt hast du mir sogar geholfen, denn Mutters Namen wusste ich auch nicht mehr; erst als du ihn ausgesprochen hast, erinnerte ich mich wieder, weißt du, durch den Klang.“
„Alle aus der Familie“, sagte Sadhbh, „hatten drei Töchter, schon unsere Großeltern und alle davor. Und später natürlich auch deine Großeltern, meine Eltern; sie hatten Vanora, Struana und mich.“
„Und warum ist dann euer drittes Kind nicht bei euch?“, fragte Ceana.
„Sie hieß Eilidh und ist schon wieder ins Land der Lebenden zurückgekehrt. Sie fiel einem Angriff unserer Feinde zum Opfer; die haben lange Arme und vergessen nichts. Aber jetzt bist du ja an Eilidhs statt gekommen. Wie hat deine Mutter dich genannt?“
„Ich glaube, Floraidh, aber ich weiß es nicht mehr so genau. Beim Weg durch das Wasser von meiner alten in die neue Welt habe ich fast alle Erinnerungen verloren. Doch der Name Ceana ist auch gut, ich mag ihn.“
Sadhbh kam noch einmal auf Ceanas Angebot zurück: „Du hast gesagt, du könnest mir helfen, mich wieder zu erinnern. Wie willst du das anstellen?“
„Nun“, antwortete Ceana, „so, wie alles bei uns gemacht wird: ich erinnere dich und dann erinnerst du mich.“ Damit legte sie beide Hände an Sadhbhs Schläfen und hielt Sadhbhs Kopf zwischen ihren Händen.
Kaum spürte Sadhbh die kühlen Hände der Neunjährigen, da brachen alle Dämme, welche ihre Seele als Schutzwall vor ihren Erinnerungen aufgebaut hatte, und eine Flut von Bildern, Lauten, Gerüchen, Gedanken und Gefühlen umwirbelte sie so heftig, dass sie benommen aufs Bett zurücksank.
Ceana schlüpfte wieder zu ihrer Adoptivmutter und kuschelte sich neben sie unter die Decke.
Am Morgen, als Sadhbh erwachte, spürte sie das Mädchen neben sich, das einen Arm unter ihren Kopf und eine Hand auf ihren Bauch gelegt hatte, und tief und fest schlief. Sie wollte Ceana nicht gleich wecken, darum blieb sie still liegen und gab sich den Erinnerungen hin, die sie jetzt überschwemmten, wie ein Fluss, der über seine Ufer tritt. Ein nicht enden wollender Strom an Ereignissen zog an ihrem inneren Auge vorbei, und immer neue Bilder türmten sich darin auf.
Das erste Bild, das sie zu fassen bekam, waren irgendwelche Worte ihrer Großmutter: „Wir sind Fremdlinge auf der Erde.“ Wie war Großmutters Name gewesen? Ach ja, Gavina O’Sullivan. Sie hatte Sadhbh als erste in die Geheimnisse der Familie eingeweiht; sie hatte ihr erzählt, woher sie stammten, und fürwahr, sie konnte sehr spannend erzählen. Schon Großmutters eigene Großeltern hatten „Elfenblut“, das war seit alters so bei ihnen, und von Zeit zu Zeit wurde es aufgefrischt, wenn neue Unsterbliche in die Familien einheirateten. Daher wussten bei ihnen alle Familienmitglieder von dem Geheimnis der Anderswelt.
Großmutter hatte ihr von jenem alten Zwist erzählt, der vor Urzeiten zwischen den Unsterblichen ausgebrochen war und sich zu einem Jahrtausende währenden Krieg ausgeweitet hatte. Sadhbhs Familie gehörte zwar nicht zu den Göttern, doch das Elfenblut in ihnen bewirkte, dass sie in jede Auseinandersetzung der Unsterblichen mit hineingezogen wurden, wer auch immer gegen wen kämpfte. Ein Teil der Elementarwesen und der höheren Geister hatte sich den beiden Verbündeten Ischtar und Angra Mainyu und den vom rechten Pfade abgefallenen Göttern angeschlossen; der Großteil jedoch stand weiterhin zu den guten Göttern, auf deren Seite auch Sadhbhs Familie stand. Diese wurde daher ebenso heftig bekämpft wie die Scharen der guten Götter und Naturwesen; weil sie aber Menschen waren, hatte sie den Kräften und Schlichen der Widersacher wenig entgegenzusetzen.
Sadhbh musste schon als Kind, gleich nach der ersten gemeinsamen Flucht mit Eltern und Geschwistern, den Tod ihrer Großeltern miterleben. Dann verlor sie ihre Eltern und erfuhr später auch von deren Tod. Sie alle starben in einem der Kriege in Nordirland, aber es waren nicht Protestanten oder Katholiken, die sie töteten.
Die ehemals große Familie wurde in alle Winde zerstreut und die Jüngsten landeten in Kinderheimen oder bei Adoptiveltern, wo sie von Fremden in einer fremden Sprache und Denkweise erzogen wurden. Als Sadhbh später dank eines Hochbegabten-Stipendiums studieren durfte, hatte sie immer wieder in allen europäischen Ländern nach ihren Schwestern und Kusinen gesucht. Doch das Unterfangen war zum Scheitern verurteilt gewesen, weil die Mädchen bei der Adoption außer den neuen Nachnamen auch neue Vornamen erhalten hatten, so wie es ihr selbst ergangen war. Mit Mühe und Not hatte sie sich später wieder an ihren alten Namen und an Bruchstücke ihrer Muttersprache erinnert.
Als sie Padraic kennenlernte und heiratete, erzählte sie ihm natürlich von den Verfolgungen und Nachstellungen, die ihre Familie hatte durchmachen müssen, und dass die Jagd auf sie noch lange nicht zu Ende war, aber über ihre Elfen- und Feen-Verwandtschaft konnte sie mit ihm nicht sprechen. Als er nach und nach immer mehr Episoden aus ihrem Leben erfuhr, war er immerhin einverstanden gewesen, mit ihr in ein anderes Land zu ziehen. Deshalb waren sie nach Deutschland ausgewandert und hatten sich eine neue Existenz aufgebaut.
In der Stadt S. waren sie sesshaft geworden, hatten eine bescheidene Karriere als Therapeuten gemacht und nach und nach ihre drei Töchter bekommen. Allmählich hatten sie sich mit ihrem neuen Leben und den Menschen darin angefreundet.
Doch eines Nachmittags wurde ihre jüngste Tochter, die dreijährige Eilidh, von einem streunenden Hund halb tot gebissen, und als das Kind in der Klinik Infusionen erhielt, waren diese mit HIV verseucht. Eilidh starb im folgenden Jahr. Das hätte ein tragischer Zufall sein können, doch dann erhielten sie jenen Brief:
„Die Feinde der Drei haben euch den Hund aus Angra Mainyus Reich gesandt und es gibt noch weitere von ihnen. Auch die Blutkonserven sind unser Werk. Behaltet es schön im Bewusstsein; wir finden euch, wo immer ihr seid.“
Bei der Erinnerung packte Sadhbh der Schmerz über Eilidhs Tod wieder von neuem und sie weinte im Bett neben Ceana still vor sich hin, bis diese sich allmählich zu rühren begann. Sie schlug die Augen auf, umarmte ihre Adoptivmutter und fragte: „Warum weinst du?“
„Ach Liebes, ich dachte an Eilidh, die du nicht mehr kennenlernen kannst.“
„Aber ich kenne sie doch!“, widersprach Ceana. „Sie war es, die mich zu euch geführt hat. Wie anders hätte ich euch sonst finden sollen? Ich wusste nicht, dass sie tot war.“
Sadhbh vermochte das Gehörte kaum zu fassen. „Du hast was? Du hattest Berührung mit Eilidh?“, stammelte sie.
„Was ist daran so verwunderlich?“, fragte Ceana erstaunt. „Hast du vergessen, dass wir die Familie mit dem Elfenblut sind?“
„Warum kann ich selbst dann die Verbindung zu meiner Tochter nicht mehr finden?“
„Das wird an den Erlebnissen liegen, die du hattest“, vermutete Ceana, „doch jetzt, wo du dich an immer mehr erinnern wirst, können sicher auch die Fäden in die Welt der Ewig-Lebenden wieder neu geknüpft werden. Frag Eilidh einfach selbst, oder frag deine Großmutter.“
„Woher weißt du von ihr?“, fragte Sadhbh.
„Du hast mir heute Morgen von ihr erzählt.“
„Aber ich schwöre dir, ich habe kein Wort gesagt“, versicherte Sadhbh.
„Du hast es mir trotzdem erzählt. Großmutter heißt Gavina, und sie sagte einmal zu dir: ‚ Wir sind Fremdlinge auf Erden’, das hast du selbst gesagt. Und weißt du, was?“
„Sprich.“
„Je mehr du mir erzählst, an desto mehr erinnere ich mich auch selbst wieder.“
Sadhbh wollte noch etwas fragen, aber da läutete Padraics Wecker auf dem Nachttisch nebenan, und Padraic, der ein ausgesprochener Morgenmensch war, schlug die Decke zurück und schwang sich aus dem Bett. Da erst sah er seine Frau und die Adoptivtochter im Nachbarbett liegen, die ihn vergnügt anblickten.
„Hoi hoi, da sind ja plötzlich zwei im Bett, wo gestern Abend nur eine einstieg; und sogar beide schon wach. Ist alles in Ordnung?“
„Alles gut“, antwortete Ceana, „gehen Sie ruhig Ihrer Morgentoilette nach, Sir.“
„Wo hast du denn diese vornehme Wortwahl her?“, fragte Padraic lachend.
„Oh“, antwortete Ceana, „man lernt viel, wenn man dafür ohne Schläge zum Frühstück gehen darf.“
Sadhbh nahm Ceana in den Arm und drückte sie an sich. „Hier bei uns bist du sicher vor so etwas“, versicherte sie dem Mädchen.
„So sicher wie Eilidh es war“, murmelte Ceana.
Dann standen sie alle auf und richteten sich für die Aufgaben und Pflichten dieses Tages.
4
Am Abend desselben Tages, an welchem es für Sadhbh zur Gewissheit wurde, dass Ceana ihre Nichte war, fragte Sadhbh sie beim Abendbrot, ob sie etwas über ihre Mutter Struana oder deren Schwester Vanora wisse.
„Seitdem du mich an immer mehr erinnerst, erinnere ich mich selbst auch an immer mehr.“
„Wie soll ich das verstehen“, lachte Sadhbh.
„Ja so“, versuchte es Ceana noch einmal, „als ich zu euch kam, bestand meine Erinnerung aus klitzekleinen Fitzelchen, die kein Bild ergaben, sondern eben nur Fitzelchen waren. Zum Glück gehören dein und mein Bild zusammen, weil wir Verwandte sind. Dadurch kommt es, dass alle Fitzelchen, die du mir von dir gibst, zugleich meine Fitzelchen vermehren und dadurch auch meine Fitzelchen zu einem Bild machen. Durch sie kann ich die leeren Zwischenräume in meiner Erinnerung immer besser füllen.“
„Und wie sieht es mit deinen Fitzelchen über Struana und Vanora aus?“
Ceana überlegte eine Weile, dann fragte sie zurück: „Du hast gesagt, dass Eilidh gestorben ist, gelt?“
„Ja.“
„Dann ist Tante Vanora auch gestorben, denn sie ist mir auf dieselbe Art begegnet wie Eilidh, als Eilidh mich zu euch führte.“
„Und Struana?“, fragte Sadhbh.
„Mama ist nicht gestorben“, versicherte Ceana, „und ich kann dir von ihr erzählen, aber das sind keine fröhlichen Geschichten.“
„Weißt du, was? Nach dem Abendessen setzen wir uns im Wohnzimmer zusammen, zünden eine Kerze an und du erzählst uns alles, was du noch über deine Mama weißt, nachdem sie von Vanora und mir getrennt wurde und ihren eigenen Weg gehen musste.“
Und so machten sie es. Am Abend versammelten sie sich im Wohnzimmer, Sadhbh zündete eine Kerze an und Ceana begann unter Stocken zu erzählen.
„Das Früheste, an das ich mich erinnere ist, wie Mama mir von sich und ihrer ersten Flucht erzählt hat. Sie lebte in einer glücklichen Familie mit ihren Eltern und ihren zwei Schwestern, dir und Vanora, irgendwo an der Küste eines Landes, ich glaube, es hieß Irland. Mama sagte, damals sei nach langen Jahren wieder einmal ein schwerer Schlag gegen unsere Familie geführt worden. Es fing damit an, dass wir in einem Teil des Landes lebten, der überwiegend katholisch war. Wir selbst waren nicht dieses Glaubens, aber wir waren auch nicht evangelisch. Dadurch hatten wir plötzlich vier Gegner, von deren Dasein wir oft nichts wussten: Die Katholiken, die Protestanten, die Scharen Ištars und die Scharen Angra Mainyus, also der abgefallenen Götter, die sich gegen die guten Götter auflehnten. Wir waren natürlich aufseiten der guten Götter, daher ging es uns wie Körnern zwischen den Mahlsteinen, alle vier Gegner feindeten uns an und am Ende beschlossen wir, zu fliehen.
Wir packten einige Sachen zusammen, beluden ein paar Leiterwagen und machten uns nach Einbruch der Dämmerung auf den Weg. Oma und Opa gingen voraus. Nach der halben Nacht gelangten wir an eine Barrikade, das war ein Drahtzaun mit verschlossenem Tor. Da wir wegen der Leiterwagen nicht von der Straße abweichen konnten, machten sich Oma und Opa am Zaun entlang auf den Weg, um einen Durchschlupf oder ein Ende des Zauns zu finden, Oma nach links, Opa nach rechts. Von dieser Erkundung kehrten sie nicht zurück. Stattdessen kam ein Trupp Bewaffneter und plünderte uns aus. „Das war die Maut“, sagten sie, „jetzt dürft ihr durch“ und öffneten das Tor. So konnten wir unsere Flucht fortsetzen.
Aber wir waren unserer Nahrungsmittel und aller Wertgegenstände beraubt worden und besaßen nur noch das Wenige, das wir am Leib trugen. Nach ein paar Tagen litten wir schon Hunger. Zwar konnten wir durch Betteln etwas Essen zusammenbekommen, aber so sollte es nicht weitergehen; wir Mädchen wollten uns als Mägde verdingen und fragten an jedem Hof nach Arbeit. Doch die Höfe gehörten den Gentleman-Farmern aus Großbritannien, und die nannten uns ‚Pack’ und trauten uns nicht über den Weg. Daher stellten sie uns auch nicht ein.
Wir kamen in eine Gegend, da waren alle Häuser verrammelt, das Vieh stand in den Ställen und die Leute trugen Waffen. „Wenn ihr die Straße da weitergeht, seid ihr tot“, sagten sie zu uns. Da wussten wir nicht, was wir tun sollten. Wir durften in einer der Scheunen übernachten, aber das war unser erster Fehler. Mitten in der Nacht vernahmen wir Schüsse und Geschrei. Und ab da kann ich mich nicht mehr an Mamas Bericht erinnern.“
„Damit du den Faden wiederfindest, kann ich ab hier ein Stück weitererzählen“, bot Sadhbh an.
„Zuerst wollten wir drei Schwestern in der Scheune versteckt bleiben“, fuhr sie fort, „doch dann rochen wir Rauch und hörten es spratzeln1. Durch eine Ritze sahen wir, dass etliche Gebäude ringsum brannten. Wir schlüpften an einer Stelle hinaus, wo am wenigsten Geschrei ertönte und wir die Scheunenwand durchbrechen konnten. Draußen war es taghell von den Bränden.
Da begingen wir den zweiten Fehler. Wir huschten geduckt Richtung Wald – und liefen den unbekannten Angreifern direkt in die Arme. Es gab ein lautes Hallo, und sie priesen den Fang, den sie mit uns gemacht hatten. Oder meinten, gemacht zu haben, denn wir waren dreckig, verwahrlost, hungrig und wild.
Struana, deine Mama, biss einen der Häscher in die Hand, dann wurden wir zusammengeschlagen, bis wir uns nicht mehr rührten. Einer der Angreifer richtete sein Gewehr auf uns und grinste.“
„Wie alt wart ihr da?“, fragte Aili ihre Mutter.
„Vielleicht 14 oder 15 Jahre“, antwortete Sadhbh. „Wir wussten nicht, was die Bewaffneten mit uns vorhatten, und wir trauten ihnen nur das Allerschlimmste zu. Übrigens: Von unseren Eltern hörten wir später nie wieder etwas. Da wir nicht zu sprechen wagten, unterhielten wir uns ohne Worte: Was ich dachte, ‚hörten’ meine Schwestern und umgekehrt.
Wir machten aus, dass wir im Morgengrauen fliehen wollten, falls sich eine Gelegenheit böte. Aber dann holten unsere Bewacher einige Hunde, die sie vor unserer Scheune frei streunen ließen. Jetzt wurde es schwieriger.
Vanora sagte, sie könne mit Tieren umgehen und sprach in Gedanken mit den Hunden, bis diese zu uns in die Scheune gekrochen kamen, um von Vanora gestreichelt zu werden. Das fiel zum Glück nicht weiter auf. Im ersten Zwielicht wollten wir uns davonmachen und warteten angespannt darauf, als etwas Merkwürdiges passierte.
Die Hunde wurden unruhig, liefen hin und her und fingen an, uns an den Kleidern zu packen und daran zu zerren. „Lasst sie ruhig machen“, flüsterte Vanora, „sie sagen uns nur, wir sollen schnell von hier weg.“
Daraufhin erhoben wir uns geräuschlos, huschten zum Ausgang, wo der Wachposten fest schlief und schlichen an ihm vorbei und davon, immer den Hunden hinterher.
Wieder landeten wir in einem Wald, und die Hunde führten uns weiß der Kuckuck wohin. Nach etwa zwei Stunden hörten wir eine fürchterliche Explosion, die selbst bei uns noch einen Ruck im Boden verursachte, und sahen am Himmel über den Bäumen des Waldes einen blutroten Schein, der lange blieb. Mit etwas Glück hätten wir immer weiter nach Süden ausweichen und über die Grenze ins Nachbarland fliehen können, aber wir hatten kein Glück und begingen unseren dritten Fehler, denn wir liefen einer bewaffneten Streife mit Hunden in die Arme, wurden abermals gefangengenommen, voneinander getrennt und in verschiedene Gefängnisse gesteckt. Ich glaube, sie verdächtigten uns, wir hätten etwas mit der Explosion zu tun. Ab hier verloren wir Schwestern uns aus den Augen.“
Ceana sagte, sie könne jetzt wieder weitererzählen und fuhr fort: „Für Mama war es schlimm, dass sie von ihren Schwestern getrennt wurde und allem Unbekannten nun allein ausgeliefert war. Und dann kamen die schlimmen Männer.“
„Was sind schlimme Männer?“, fragte Aili.
„Das waren Männer, die Mama quälten. Sie fragten sie immer wieder nach dieser Explosion und schlugen sie und legten Strom an sie. Tagsüber bekam Mama nur künstliches Essen und irgendwelche giftigen Stoffe – Mama nannte sie Drogen –, die ihre besonderen Fähigkeiten und ihre Erinnerungen zerstörten, was aber beabsichtigt war. Am Ende wirkte Mama hilflos wie ein Tier; sie erinnerte sich an nichts mehr, vergaß sogar, wer sie war, und sie wurde von den schlimmen Männern immer wieder missbraucht. Irgendwann wusste sie nicht mehr, wie lange sie in Gefangenschaft gelebt hatte und lebte nur noch von Tag zu Tag oder von Nacht zu Nacht. Sie wurde so schlimm krank, dass sie an die Grenze von Leben und Tod kam. Die schlimmen Männer legten sie eines Morgens quer über einen Karren und fuhren sie zum Wald. Dort kippten sie Mama einen Abhang hinab, wo sie bis ans Ufer eines Sees rollte. Dort, so erzählte Mama später, habe sie ein hoher Wassergeist gefunden und gesundgepflegt.
Als sie wieder gehen konnte, machte sie sich auf den Weg und wanderte immer weiter nach Süden. Irgendwann wurde sie von guten Menschen gefunden und in ein Hospital gebracht. Dann kam die Polizei und wollte Mama ausfragen, aber sie wusste ja nicht mal mehr, wer sie war. Die Polizei glaubte ihr, denn sie trug am ganzen Leib die Spuren schlimmer Misshandlungen. Irgendwann merkte sie dann, dass sie schwanger war. Das Kind musste wohl von dem Nereïden kommen, der sie am Seeufer gefunden und gepflegt hatte. Als es zur Welt kam, war es ein Mädchen. Sie nannte es Kyla, aber es starb schon nach wenigen Tagen.
Ein Jahr später war Mama wieder schwanger. Das Mädchen, das dann geboren wurde, nannte sie Diana; es war schwerbehindert und musste in ein Heim gegeben werden, wo es mit zwei Jahren ebenfalls verstarb.
Was Mama auch anstellte, sie blieb immer allein. Durch irgendeine Sache, die sie nicht mehr genau wusste, gelangte sie nach England. Dort wurde sie im schottischen Norden in einer großen Stadt in der Universitätsklinik untersucht. Die Ärzte interessierten sich für die Folgen ihrer Misshandlungen und wie man diese rückgängig machen könnte.
Wie es kam, wusste Mama nicht zu sagen, aber irgendwann war sie wieder schwanger. Sie lebte mittlerweile in halbwegs geordneten Verhältnissen in Glasgow. Ein Fond für die Opfer von Kriegsverbrechen finanzierte ihren Lebensunterhalt und ihre Behandlungen. An vier Tagen in der Woche erhielt sie Therapien und einmal pro Woche wurde sie untersucht. Das Kind, das zur Welt kam, war ich. Sie nannte mich Floraidh, sagte aber nur Flora zu mir. Ich lernte die Landessprache und fiel eigentlich nur dadurch auf, dass ich begabt war; daher bekam ich alle Unterrichte umsonst.“
„Und wie bist du dann zu uns gekommen?“, fragte Annag.
„Ja, das ist eine andere Geschichte“, antwortete Ceana, und ein Lächeln flog über ihr schönes Gesicht.
„Eines Tages machten Mama und ich und ihr Freund Phil, den ich nicht mochte, weil er mich schlug, einen Ausflug. Wir picknickten an einem Fluss namens Oich, und als die Erwachsenen nicht so auf mich achtgaben, ging ich zu einem Gebüsch am Ufer und versteckte mich darin. Ich spürte, dass Mama und ihr Freund mich nicht bei sich haben wollten und kroch zum Fluss hinab.
Da vernahm ich eine klare Stimme aus dem Fluss, die mich rief: Blümchen, komm her!’ Ich ließ mich ins Wasser gleiten, doch die Strömung war stark und zog mich zur Mitte. Plötzlich war die Gegend voller Leute, aber das waren wahrscheinlich gar keine Menschen, jedenfalls keine so wie ihr. Ein mächtiger Wassergeist legte mir den Arm um die Schultern und sagte, er sei mein Papa. Ich fragte ihn, was mich erwarten würde. Da sagte er: ‚Du wirst wieder auf Reisen gehen, diesmal jedoch weit, weit weg, wo die Leute eine fremde Sprache sprechen. Dort wirst du als dritte Schwester einer dritten Schwester den Platz im Leben einnehmen, den du dir vor deiner Geburt ausgesucht hast.’ ‚Und wie soll ich diesen Platz finden?’, fragte ich. Er winkte ein kleines Mädchen zu sich und sagte: ‚Eilidh, komm bitte zu uns!’
Eilidh stand neben einer Frau, deren Hand sie festhielt, während sich zwei andere Mädchen an die andere Hand und den Rockzipfel der Frau klammerten. Ich spürte, dass wir Verwandte waren, aber ich wusste nicht, in welcher Art. Und da gab es noch mehr solcher Verwandter, die ich alle ein bisschen kannte. Als Eilidh kam, sagte mein Vater, der Wassergeist: ‚Führe Floraidh zu deiner Mutter nach Deutschland.’
Eilidh nahm mich an der Hand und zog mich durch das Flussbett zum anderen Ufer hin. Dort stiegen wir an Land und glitten dann wie Vögel weiter über die Wiesen, Wälder und Felder hin, immer in goldenem Sonnenschein. Ich weiß, das klingt jetzt komisch; aber wir sind richtig geflogen und ich spüre noch immer, wie sich das anfühlt. Wir waren nicht einmal lange unterwegs, da standen wir schon in diesem fremden Land in einer großen Stadt, und die Leute um uns herum sprachen diese fremde Sprache.
Eilidh sagte mir, sie müsse jetzt dringend zurück, und dann verloren wir uns aus den Augen. Das Weitere kennt ihr.“
Sadhbh stand auf, umarmte Ceana und hielt sie lange an sich gedrückt.
1 fränkisch/bayrisch für knistern
5
Während die Mädchen im Spielzimmer bastelten und Sadhbh und Padraic sich über das eigenartige Verhalten der drei Amtfrauen unterhielten, fuhr Helene Quälinger nach S. zurück. Von unterwegs rief sie ihre beiden Kolleginnen an und sagte, sie könne die Situation bei den Brennans noch immer nicht richtig einschätzen. Sie habe bis etwa 16 Uhr dort gesessen, mit der ganzen Familie Kaffee getrunken und geplaudert und alles schien relativ normal zu sein; andrerseits warne sie ein Bauchgefühl, dass irgendetwas doch nicht stimme. Ob sie am Abend gemeinsam eine „Séance“ abhalten könnten? Die anderen sagten zu. Sie verabredeten sich für 23: 30 Uhr bei Asiram Steinherz zu Hause und jede wusste, was zu tun war und was sie zum Mitternachts-Treffen mitbringen musste.
Wie seine Frau, so hatte auch Padraic das Gefühl, dass mit den Amtfrauen etwas nicht stimme, „…, aber was genau wäre das?“, fragte er.
Sadhbh dachte kurz nach, dann sagte sie: „Erstens: Diese Frau Steinherz ist nicht ehrlich; sie gibt beim Besuch eine Absicht vor, die nicht wahr ist, und was sie wirklich will, wissen wir nicht. Zweitens: Mich warnt etwas davor, ihr zu vertrauen; sie trägt die Maske des Lächelns, aber dahinter lauert eine Hyäne mit gebleckten Zähnen. Drittens: Die drei Frauen selbst sind, glaube ich, nicht so ganz schlimm, wohl aber die Mächte, denen sie dienen; und diese letzteren lassen mich schaudern.“
„Wie hast du eigentlich herausgefunden, dass Ceana mit uns verwandt ist?“, wechselte Padraic das Thema. „Du hast es doch schon lange vor Ceanas Bericht gewusst oder doch irgendwie geahnt. Und wolltest du nicht sogar einen DNA-Test machen lassen?“
„Ja“, antwortete Sadhbh, „anfangs war es eher noch so eine vage Ahnung, aber sie wuchs, je besser Ceana und ich uns kennenlernten. In letzter Zeit spürte ich sogar wieder frühere Fähigkeiten in mir aufsteigen, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie einmal hatte. Seit unsere Familie durch Ceana wieder vollständig geworden ist, wächst zwar die Gefahr für uns alle, aber dabei wachsen auch unsere Kräfte.“
„Dennoch konnten wir unsere Jüngste nicht retten“, erinnerte Padraic seine Frau.
„Aber aus demselben Grund, nämlich meiner Machtlosigkeit wegen. Du hast gehört, was Struana in der Gefangenschaft alles hat durchmachen müssen. Mir selbst sind, glaube ich, die Vergewaltigungen erspart geblieben, aber geschlagen und mit Elektroschocks drangsaliert hat man mich auch. Außerdem haben sie mich mit diesen Drogen abgefüllt; das braucht Jahre, bis man wieder auf dem Stand von vor der Vergiftung ankommt. Doch es geht mir seit Ceanas Ankunft schon viel besser. Nicht mehr lange, und ich kann die geistigen Mächte wieder um Hilfe bitten.“
„Was sind das für Mächte?“, wollte Padraic wissen.
„Viele Wesen aus den unteren und höheren Reichen der Naturgeister, einige auch aus dem Reigen jener Wesen, die hier in Deutschland Feen genannt werden; und einige Wenige auch aus Bereichen der Seelenwelt.“ „Worunter ich mir nun gar nichts vorstellen kann“, meinte Padraic resigniert.
„Na, hör mal“, korrigierte ihn Sadhbh, „du weißt doch, wie Liebe, Freude, Hoffnung, Zorn – und wie sie alle heißen – sich anfühlen, oder nicht?“
„Das schon“, stimmte Padraic ihr zu, „aber von da zu irgendwelchen persönlichen Wesen ist es immerhin noch ein weiter Weg.“
In dieser Nacht, um halb zwölf Uhr, kamen ihre beiden Kolleginnen zu Frau Steinherz’ Haus, läuteten und wurden sogleich eingelassen. Beide trugen Tüten und Körbe, die bis oben hin gefüllt waren.
„Es ist an der Zeit; richten wir den Kreis“, sagte Frau Steinherz feierlich.
„Zum Heile des Konvents“, sagte Frau Kreischer.
„Für Angra Mainyu, jetzt und immerdar“, fügte Frau Quälinger hinzu.
Dann schob Frau Steinherz das Klavier beiseite, öffnete eine Tapetentür dahinter, und sie betraten über einen flurartigen Gang einen großen Raum, das ‚Schwarze Zimmer’. Es maß etwa 5 mal 6 Meter, sein Boden bestand aus schwarzen und grauen Kacheln und hatte einen Ablauf. Mit den Kacheln zusammen war ein Mosaik eingelegt, das magische Zeichen zeigte, die Wände waren schwarz gestrichen und an einer der kürzeren Querwände befand sich ein umgedrehtes silbernes Fünfeck, das die gesamte Wand füllte. Vor dieser Wand stand ein beweglicher Altar aus Holz, dessen Oberseite mit glasierten Tonfliesen beklebt war.