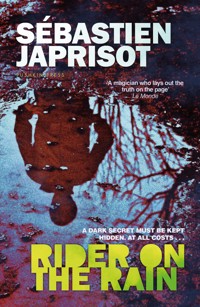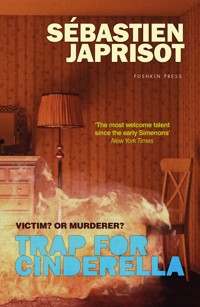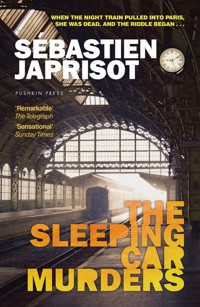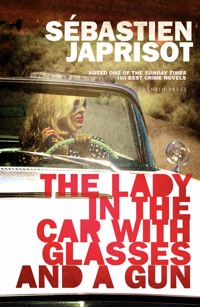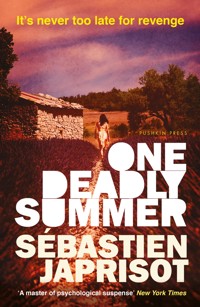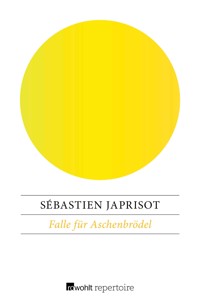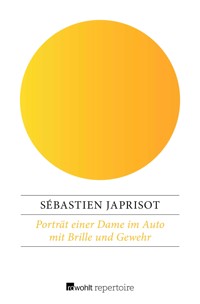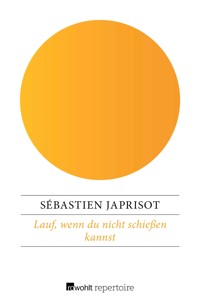
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist eine sonderbare Gemeinschaft, in die der dreißigjährige Tony Cardot so gewaltsam hineinversetzt worden ist. Vier Männer und zwei Mädchen, nicht unsympathisch, die sich in einem verlassenen Gasthaus an einem Nebenarm des St. Lorenz-Stroms eingerichtet haben. Sie haben Waffen, und sie planen etwas. Ein Verbrechen? Aber warum belasten sie sich dann mit einem Unbekannten? Wenn er nicht weiß, was er von den Fremden halten soll, so müssen sie sich ihrerseits bestimmt auch über ihn wundern, warum er seine Lage so klaglos hinnimmt. Woher sollen sie auch wissen, daß drei Männer ihn von Frankreich bis Kanada verfolgt haben, damit er die Schuld bezahlt, die er auf sich geladen hat? Und daß er gerade den tödlichen Schuß erwartete, als sie dazugekommen sind und ihn in ihr Auto gezerrt haben? Es war eine Entführung, die ihm – vorübergehend – das Leben gerettet hat. Ein paar Tage lang hofft Tony sogar gegen besseres Wissen, daß er seine Verfolger vielleicht endgültig abgeschüttelt hat. Und wenn das stimmt, wird er sich gewiß nicht an irgendeinem riskanten Unternehmen beteiligen. Aber dann klingt vom Fluß her die Melodie zu ihm herüber. Sie haben ihn eingeholt. Für einen Mann, dessen Tage gezählt sind, existieren die üblichen Bedenken nicht mehr. Ihn lockt auch nicht das versprochene Geld. Er macht mit, weil mitmachen besser ist, als untätig den Tod zu erwarten. Verfilmt unter dem Titel «Treibjagd».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Sébastien Japrisot
Lauf, wenn du nicht schießen kannst
Aus dem Französischen von Elisabeth Uebe
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Es ist eine sonderbare Gemeinschaft, in die der dreißigjährige Tony Cardot so gewaltsam hineinversetzt worden ist. Vier Männer und zwei Mädchen, nicht unsympathisch, die sich in einem verlassenen Gasthaus an einem Nebenarm des St. Lorenz-Stroms eingerichtet haben. Sie haben Waffen, und die planen etwas. Ein Verbrechen? Aber warum belasten sie sich dann mit einem Unbekannten?
Wenn er nicht weiß, was er von den Fremden halten soll, so müssen sie sich ihrerseits bestimmt auch über ihn wundern, warum er seine Lage so klaglos hinnimmt.
Woher sollen sie auch wissen, daß drei Männer ihn von Frankreich bis Kanada verfolgt haben, damit er die Schuld bezahlt, die er auf sich geladen hat? Und daß er gerade den tödlichen Schuß erwartete, als sie dazugekommen sind und ihn in ihr Auto gezerrt haben? Es war eine Entführung, die ihm – vorübergehend – das Leben gerettet hat. Ein paar Tage lang hofft Tony sogar gegen besseres Wissen, daß er seine Verfolger vielleicht endgültig abgeschüttelt hat. Und wenn das stimmt, wird er sich gewiß nicht an irgendeinem riskanten Unternehmen beteiligen.
Aber dann klingt vom Fluß her die Melodie zu ihm herüber.
Sie haben ihn eingeholt.
Für einen Mann, dessen Tage gezählt sind, existieren die üblichen Bedenken nicht mehr. Ihn lockt auch nicht das versprochene Geld. Er macht mit, weil mitmachen besser ist, als untätig den Tod zu erwarten.
Über Sébastien Japrisot
Sébastien Japrisot (1931–2003) war ein französischer Schriftsteller, Drehbuchautor, Regisseur und Übersetzer. Viele seiner Romane wurden verfilmt.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
TONY CARDOT
flieht vor einer Melodie
DIE ZIGEUNER
verfolgen eine Spur
CHARLEY
entführt eine Puppe
RIZZIO
schießt – und wenn es sein muß mit Billardkugeln
MATTONE
steigt über eine Feuerwehrleiter
PAUL
stirbt ehe er sterben durfte
SUGAR
backt Kuchen – aber es nützt nichts
PEPPER
hat ein Flugticket zuviel
MAC CARTHY
zahlt für etwas, das er nicht bekommt
DIE MAJORETTE
bringt Unglück
INSPECTOR BARNEY
hält das 18. Stockwerk eines Hochhauses für einbruchsicher
Vorwort
Zunächst sollte ich das Buch ‹Black Friday› von David Goodis für den Film adaptieren.
Doch dann konnte ich es nicht. Selbst meine eigenen Bücher habe ich nie adaptieren können. Ich stoße in alle möglichen Richtungen vor und erzähle schließlich eine ganz andere Geschichte. Das ist auch hier der Fall. Ermutigt – oder ich sollte besser sagen gedrängt – von meinem Produzenten, Serge Silberman, der trotz allem die Rechte auf meinen Wunsch hin gekauft hatte, habe ich das Buch ganz vergessen und erzählt, was mir das Herz bewegte, wie ich es auch gemacht hatte in ‹Adieu L’Ami› und ‹Le Passager de la Pluie›.
Bevor ich zu schreiben anfing, war ich mehrere Male in Kanada gewesen. Ich habe die rotgoldene Glut des kurzen indianischen Sommers erlebt, dem der Winter auf den Fersen folgt; ich habe das Labyrinth der Wasserarme des St. Lorenz-Stromes und auch diese Insel gesehen, auf die sich meine Personen flüchten sollten. Und einmal habe ich in Montreal lange Zeit am Ufer des Flusses gestanden, auf einer Wiese, und einer Parade von Majoretten zugeschaut.
Dort, glaube ich, hat ‹La Course du Lievre› wirklich begonnen. Monatelang quält man sich, weil man nicht weiß, was und wie man schreiben soll – und es scheint so, als könne man nie wieder etwas schreiben – und dann geht irgend etwas mit den Erinnerungen vor sich, und alles rückt an seinen Platz, die Geschichte, die Art, wie man sie erzählen wird, und auf einmal ist auch die Lust zum Schreiben da und das Wissen, daß man sich an die Arbeit machen wird.
Ich dachte an meine Schwester. Als wir noch Kinder waren – sie ist zwei Jahre jünger als ich –, verkleidete sie sich oft, wollte gern erwachsen sein. Sie sah sich immer nur als Ballett-Tänzerin. Und das wurde sie später auch. Aber da spielte sie nicht mehr die Erwachsene. Ich habe mich häufig gefragt, ob wirklich das Kind die Erwachsenen imitiert oder ob nicht ganz einfach die Wirklichkeit eine verzweifelte Kopie der kindlichen Träume ist. Als meine Schwester Ballerina wurde, war sie im Grunde schon lange ein Star gewesen.
In ‹La Course du Lievre› spielen in einer Straße von Marseille einige Kinder, sie seien in Amerika und überfielen dort einen Wolkenkratzer, während gleichzeitig in Amerika Erwachsene tatsächlich einen Angriff gegen einen Wolkenkratzer richten. Alle Elemente der Handlung, Beziehungen, Sprache, Haltungen und selbst auch die wichtigsten Requisiten gehören dabei durchaus einer kindlichen Welt an.
Die Schwierigkeit – oder auch das Spiel, wenn man so will – bestand darin, das Räderwerk der Handlungen gleichzeitig auf beide Geschichten anwendbar zu machen. Einmal vereint und ineinander verzahnt, konnten sie über die Tatsachen hinaus leicht eine dritte Geschichte erzählen, die noch geheimnisvoller und gleichzeitig noch verwirrender war.
Ich glaube eigentlich, daß ich mich dazu entschlossen habe, Kriminalgeschichten zu schreiben, weil sie ein bequemes Alibi darstellen für etwas, das ich mich sonst nur ganz leise auszusprechen getrauen würde. Die Ereignisse in einer solchen Geschichte sind derart laut, daß man dazu ruhig aus vollem Halse singen oder schreien kann. Es verstehen nur die, die sich ganz in der Nähe befinden.
Im Kino geht’s da ganz anders zu. Die Leinwand ist ein Verräter. Sie stellt dich total bloß, wenn du gerade schreist, und alle Welt zeigt mit dem Finger auf dich. Nur ein Zauberer bringt es fertig, einen Film so zu machen, daß deine kleine Melodie sich mit der seinen vereint, daß unter der lauten Musik der Parade die Stimmen sich antworten, ohne Angst, und daß die gezähmte Leinwand zu einem Spiegel wird, in dem die anderen sich sehen.
Aber ich habe einen Stern, der mich leitet. René Clément.
Paris, August 1972
Marseille. Der alte Hafen liegt im Licht eines sonnigen Spätnachmittags.
Es könnte ebensogut anderswo sein, in Barcelona, Neapel oder Hongkongfür jeden von uns wird es eine andere ganz bestimmte Stadt sein –, aber ich bin nun mal in Marseille geboren.
Nahe beim alten Hafen ist die Kathedrale, und in dem Wohnviertel dahinter steht in einer kleinen Straße ein Möbelwagen, aus dem zwei Männer gerade einen Spiegelschrank herausholen. Der Möbelwagen steht vor einer ehemaligen Buchhandlung, von der nichts weiter übriggeblieben ist als das Namensschild, dessen Farben schon arg verblichen sind. Auf einer der schmutzigen Scheiben klebt noch ein Plakat, das eine Katze auf einem Baum darstellt; die Katze zeigt in einem breiten Grinsen sämtliche Zähne.
Darunter steht ein kleiner Junge von zehn Jahren, der müßig-melancholisch dreinschaut.
Er ist sonntäglich gekleidet mit einer pflaumenblauen Samtjacke mit großen weißen Knöpfen. Er lehnt am Eingang der Buchhandlung neben seiner Mutter und seiner siebenjährigen Schwester. Die Mutter ist dreißig Jahre alt und sehr blond. Sie drückt ihre kleine Tochter fest an sich. Das Mädchen ist auch blond und hat ein hübsches weißes Kleid an.
Diese Frau, die mit ihren beiden Kindern allein ist, zieht in den Laden ein. Ihr Gesicht trägt die Spuren eines unglücklichen Lebens.
Jetzt weicht sie zur Seite, um die Möbelpacker mit dem Spiegelschrank vorbeizulassen und zieht den kleinen Jungen am Arm mit. Einen kurzen Augenblick spiegeln sich alle drei in dem Schrank.
Dann beugt sie sich zu dem Jungen hinunter.
DIE MUTTER: Geh jetzt spielen, Titou. Such dir einen Freund.
Der Junge gehorcht widerwillig. Mit der rechten Hand umklammert er ein Säckchen Murmeln. Während er über den Gehsteig trottet, hält er den Blick starr auf eine leere Streichholzschachtel gerichtet, die am Boden liegt. Er bückt sich, um sie aufzuheben.
Da erscheint plötzlich der Fuß eines anderen Jungen, der die Schachtel zertritt.
Titou richtet sich auf und sieht drei Jungen vor sich. Sie sind so alt wie er oder ein bißchen älter und schauen ihn feindselig an. Sie sind ärmlich gekleidet und haben eine sehr braune Haut. Der älteste von ihnen trägt einen vergoldeten Ring in einem Ohr.
Titou weicht zurück; er fühlt sich ihnen nicht gewachsen. Dann macht er kehrt und läuft davon. Er rennt die Treppen eines Gäßchens hinauf, sein Säckchen Murmeln fest in der Hand.
Doch er kommt nicht weit: andere Kinder, von einer anderen Bande, sitzen auf den obersten Stufen und versperren ihm den Weg.
Es sind vier Jungen und zwei Mädchen. Das eine Mädchen hält eine Puppe im Arm, das andere ißt ein Stück Kuchen. Einer der Jungen spielt mit einem kleinen Gummiball.
Alle bleiben regungslos sitzen und schauen den Neuankömmling in seinem pflaumenblauen Jackett an. Als Titou sich nähert, stehen die Jungen einer nach dem anderen auf, um ihm ins Gesicht zu sehen. Sie bewegen sich dabei seltsam langsam, gleichsam traumhaft – wie aus der Vergangenheit kommend.
Titou bleibt vor dem ältesten stehen, vor dem, der der Anführer zu sein scheint. Er versucht ein Lächeln. Der andere schaut ihn prüfend an, nicht sehr freundlich, aber auch nicht feindselig. Man spürt, daß er ein ruhiger Junge ist, gewöhnt, mit seinen Schwierigkeiten allein fertig zu werden und anderen den Ton anzugeben.
Um sich anzubiedern, um akzeptiert zu werden, reicht Titou ihm ganz naiv mit ausgestrecktem Arm das Säckchen hin.
Doch all die bunten Murmeln kullern heraus. Als sie neben seinen Füßen auf die Stufen aufschlagen und nach allen Seiten davonspringen, sind wir nicht mehr in Marseille.
Wir befinden uns auf einem Bahnhof, es ist ein Holzgebäude an der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada. Er liegt mitten im freien Land. Es ist früher Morgen, und die Sonne taucht wie eine rote Scheibe am Horizont auf.
Auf dem Bahnsteig stehen drei Männer, weit voneinander entfernt, regunglos.
Alles ist erschreckend regungslos.
Einer der Männer lehnt an einer Wand des Gebäudes und spielt auf einer Art Hirtenflöte. Er ist zwanzig Jahre alt. Ärmlich gekleidet. Lange Haare fallen ihm bis auf die Schultern. Sie werden von einem um die Stirn laufenden Lederband gehalten, das mit vergoldeten Nägeln verziert ist.
Seine zwei Gefährten stehen am Rande des hölzernen Bahnsteigs. Einer trägt einen schwarzen Hut mit rundem Kopf. Der andere, in verwaschenen Jeans, ist mit Schmuck behangen.
Alle drei haben kupferbraune Haut.
Sie sind das, was man in Europa Zigeuner nennt, und in Amerika gypsies.
Sie warten, wachsam wie Indianer.
Und dann kommt Bewegung in die Landschaft. Noch hört man nichts, noch zittern nur die Töne der Hirtenflöte in der Luft, aber am Ende des Schienenstrangs ist ein Zug aufgetaucht. Er kommt sehr schnell näher, metallisch glänzend, und plötzlich zerreißt sein Pfeifen die Melodie.
Es ist ein Zug der Canadian Pacific. Ein stählernes Ungetüm. Während er langsamer wird, in den Bahnhof einfährt und schließlich sacht am Bahnsteig stehenbleibt, haben sich die Zigeuner nicht gerührt. Sie halten nur auf der ganzen Länge des Zuges die Türen im Auge. Offensichtlich warten sie auf jemanden, der aussteigen muß. Aber es steigt niemand aus.
Jedenfalls nicht auf ihrer Seite.
Auf der anderen Seite öffnet sich eine Tür. Eine Hand wirft einen Koffer und ein Jackett auf den Schotter, und ein Mann erscheint. Er ist dreißig Jahre alt und sieht gehetzt aus. Es ist Tony Cardot.
In dem Augenblick, da er zu Boden springt und sich bückt, um sein Gepäck aufzunehmen, blitzt vor seinen Augen die Klinge eines Klappmessers auf.
Zwei weitere Zigeuner sind da. Der mit dem Messer ist am reichsten gekleidet: schwarze Samthose, gestickte Weste. Im Ohr trägt er einen goldenen Ring. Der zweite hält eine Hand in der Tasche seines verschlissenen Jacketts. Man errät, daß er durch den Stoff hindurch den Lauf eines Revolvers auf Tony gerichtet hält.
DER MANN MIT DEM MESSER: Antoine Cardot?
Tony schüttelt den Kopf, nicht sehr überzeugend.
Mit der Spitze des Messers fährt ihm der Zigeuner unter das Hemd: Tony trägt einen Verband über der Brust. Ein bißchen getrocknetes Blut klebt daran.
DER MANN MIT DEM MESSER: Unsere Brüder in New York waren ungeschickt. Aber deine lange Reise ist hier zu Ende, Tony.
TONY: Hört zu, es war ein Unfall. Das Gericht hat es selbst bestätigt.
DER MANN MIT DEM MESSER: Unsere Gesetze sind anders, Tony. Also, sei ein Mann.
Tony weicht einen Schritt zurück, aber der andere Zigeuner hält ihn fest. Die drei Männer, die auf dem Bahnsteig waren, sind nun ebenfalls auf dieser Seite des Zuges, vorn. Hinter ihnen, auf einem Erdwall, steht eine riesige Limousine, ein Luxusmodell aus den dreißiger Jahren. Eine gelbrote stilisierte Margerite ist auf die Tür gemalt.
DER MANN MIT DEM MESSER: Komm schon. Du wirst mich doch nicht zwingen, es hier zu tun.
Tony tut so, als wolle er seinen Koffer und sein Jackett aufnehmen.
DER MANN MIT DEM MESSER, indem er ihm einen Stoß gibt: Das brauchst du nicht mehr.
Tony geht vor zur Spitze des Zuges, gedrängt von den beiden Männern.
In diesem Augenblick setzt sich die Lokomotive wieder in Bewegung.
Tony sieht hinter den Wagenfenstern unbeteiligte Gesichter, Gesichter, die keine Ahnung haben, was hier vorgeht.
Die Tür, aus der er ausgestiegen ist, ist noch offen und kommt nun auf ihn zu. Da stößt er plötzlich die beiden Zigeuner zurück und springt in den Zug.
Er hastet über den Gang, öffnet die gegenüberliegende Tür und wirft sich in voller Fahrt aus dem Zug. Er rollt einen Abhang hinunter und steht im hohen Gras wieder auf. Felder und Wälder erstrecken sich, so weit das Auge reicht.
Tony nimmt sich nicht einmal die Zeit, sich umzusehen. Er rennt querfeldein. Er läuft und läuft, kommt völlig außer Atem, springt über eine Hecke, jagt eine abschüssige Wiese hinunter.
Er erreicht schon völlig erschöpft einen Waldrand und bahnt sich einen Weg durch das rötliche Laub.
Und dann läuft er am Rand einer Autostraße entlang, vierzig Kilometer von Montreal entfernt. Verzweifelt winkt er, um einen der vorbeirasenden Wagen anzuhalten. Ein schwerer Lastwagen endlich bremst und bleibt am Straßenrand stehen. Tony hat gerade Zeit, die Tür zu öffnen und sich hineinfallen zu lassen.
Der Koffer und Tonys Jackett werden heftig auf den Boden geschleudert, dem Mann mit dem Messer vor die Füße.
Er steht neben der altmodischen schweren Limousine in einiger Entfernung vom Bahnhof am Rande der verlassenen Schienen. Die anderen stehen um ihn herum.
Derjenige, der Tonys Sachen auf die Erde geworfen hat, ist der Zigeuner mit den Juwelen. Zornig spricht er in ihrer Sprache.
DER ZIGEUNER: Wir sind fünf! Und er ist uns entwischt!
DER MANN MIT DEM MESSER: Wir sind nicht fünf. Wir sind hundert, wir sind tausend, Tausende!
Er nimmt Tonys Koffer und reißt ihn auf. Den Inhalt verstreut er auf den Boden.
DER MANN MIT DEM MESSER: Na und, worauf wartet ihr?
Die anderen machen sich daran, die Sachen des Flüchtigen gewissenhaft zu zerstören.
DER MANN MIT DEM MESSER: Wohin er auch geht, wir werden dort sein! Er ist ein toter Mann.
Und um seine Worte zu unterstreichen, reißt er Tonys Jackett in einer einzigen heftigen Bewegung in zwei Teile.
Das Gitterbett
Trommeln und Trompeten.
Auf einem großen Rasenplatz, umgeben von roten viktorianischen Gebäuden, zieht inmitten bunter Fahnen die Parade junger Majoretten vorbei.
Die Anführerin trägt einen Degen in der rechten Hand. Sie ist sehr blond, ganz durchdrungen von ihrer Wichtigkeit. Ihre Uniform – Stiefel, Minirock und Tschako – ist weiß und mit goldenen Tressen besetzt.
Sie geht mit militärischem Schritt, zackig, und sie wirft den Kopf, daß ihr prächtiges Haar fliegt, aber kein Zug ihres Gesichts verrät irgendeine Bewegung. Sie achtet weder auf die hinter ihr Marschierenden noch auf die Gaffer am Wiesenrand. Sie schaut nur in sich selbst hinein.
Wir sind in Westmount, einem der eleganten Viertel von Montreal.
Tony Cardot befindet sich zur gleichen Zeit am anderen Ende der Riesenstadt. Der Lastwagen, der ihn mitgenommen hat, muß ihn wohl am Ufer des St. Lorenz-Stromes abgesetzt haben, denn die letzten Meilen, die ihn noch von der Stadt trennen, legt er zu Fuß zurück. Er ist erschöpft, sein weißes Hemd ist schmutzig, seine Krawatte verrutscht. So läuft er einsam über die riesige Jacques Cartier-Brücke, die den Fluß überspannt.
Durch das Stahlgerüst der Brücke hindurch sieht er in weiter Ferne vor sich die hohen Gebäude von Montreal. Unten auf der Insel Sainte-Hélène glänzt eine riesige gläserne Kugel in der Sonne: der Pavillon, den die Vereinigten Staaten für die Weltausstellung «Man and His World» errichtet haben.
Tony versucht nur noch ab und zu, einen der Fahrer aus dem endlosen, gleichgültig an ihm vorbeifließenden Autostrom anzuhalten, aber eigentlich hat er die Hoffnung schon aufgegeben.
Und jetzt, wo er schon gar nicht mehr daran glaubt, bleibt ein Auto neben ihm stehen – so plötzlich, daß die nachfolgenden Wagen mit den Stoßstangen aufeinander krachen.
Es ist die Limousine mit der Margerite.
Eine hintere Tür wird geöffnet, der Mann mit dem Messer wird sichtbar. Schon hat er den Arm erhoben, um seine Waffe zu schleudern. Tony hat gerade noch Zeit, sich zu bücken, um dem Angriff auszuweichen. Hals über Kopf wendet er sich in die entgegengesetzte Richtung und läuft zurück, Montreal und ein Hupkonzert hinter sich lassend.
Um ihn wieder einzuholen, bleibt den Zigeunern nur eine Möglichkeit: Sie müssen geradeaus weiterfahren und am anderen Ende der Brücke wenden.
Sie tun es. Als sie Tony wieder einholen – er ist inzwischen gelaufen und gelaufen, so schnell er nur konnte –, hat er gerade noch die Kraft, wieder kehrtzumachen und in die entgegengesetzte Richtung zu fliehen.
Die Zigeuner geben Gas, wenden mit quietschenden Reifen am Ende der Brücke und kommen abermals zurück.
Tony ist während dieser Zeit nur ein paar hundert Meter weit gekommen. Er kann nicht mehr. Er spürt die schwarze Limousine im Rücken und fühlt fast schon den kalten Stahl einer Klinge.
Von der Mitte der Brücke zweigt im weiten Bogen eine Straße ab zur Insel Sainte-Hélène. Diese Straße nimmt er jetzt. Seine Beine tragen ihn mit letzter Kraft zu der Kugel, deren ungezählte Facetten in der Sonne blitzen.
Hinter ihm hat der Wagen der Zigeuner ebenfalls gewendet und folgt ihm.
Eine grüne Böschung. Tony klettert hinauf. Ein metallenes Schutzgitter. Er klammert sich daran, zieht sich hoch, klettert darüber hinweg.
Die Limousine mit der Margerite kommt in dem Augenblick vor dem Schutzgitter an, als Tony durch eine geöffnete Tür wie durch ein Mauseloch in die riesige Kugel schlüpft.
Im Inneren herrscht die Stille einer gewaltigen Kathedrale der Zukunft, die verlassen und tot wirkt. Es sind mehrere Stockwerke da, ein paar stillstehende Rolltreppen, weiter nichts.
Tony hört nur das Geräusch seiner eigenen Schritte, geisterhaft verstärkt. Er steigt eine der Treppen hoch, schleppt sich im ersten Stockwerk an einer Rampe entlang. Er möchte noch laufen. Gott weiß wohin.
In diesem Augenblick bringt ihn ein Schuß abrupt zum Stehen.
Er hat ihn immer erwartet, diesen Schuß in den Rücken. Und er ist ganz überrascht, daß er nichts fühlt, daß er noch lebt. Nicht ihm hatte der Schuß gegolten.
Als er den Kopf wendet, sieht er über sich auf einer anderen Treppe einen Mann mit einem Revolver, der ins Erdgeschoß zielt. Dann schwankt der Mann unter Kugeln, die von eben dort kommen – Schüsse, die sich wie Donner anhören unter der riesigen Kuppel – und bricht auf den Stufen zusammen.
Wie eine Puppe purzelt der Mann die Treppe hinunter und bleibt vor Tonys Füßen liegen.
Und wieder herrscht Stille, eine beunruhigende Stille.
Der Unbekannte hat seine Waffe fallen lassen. Er stöhnt und öffnet die Augen. Nach einem Augenblick der Bestürzung kniet Tony neben ihm nieder.
DER UNBEKANNTE: Sind Sie Arzt?
TONY: Nein.
DER UNBEKANNTE: Dann gehen Sie.
Er will sich bewegen, aber er kann es nicht mehr. Er spricht mit schwacher, tonloser Stimme.
DER UNBEKANNTE: