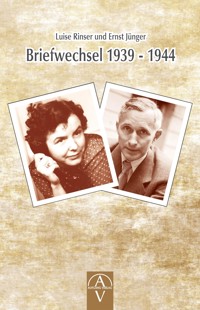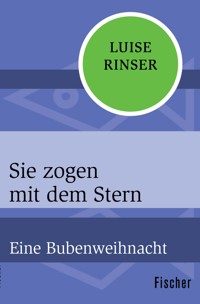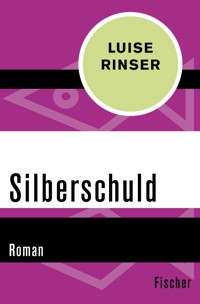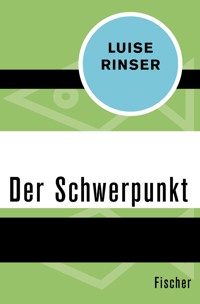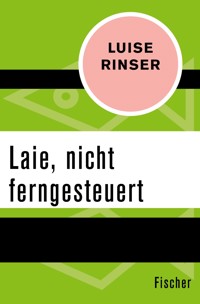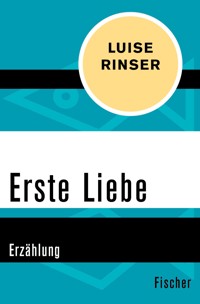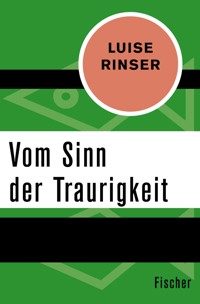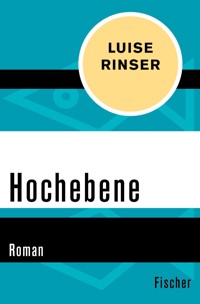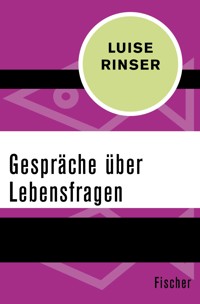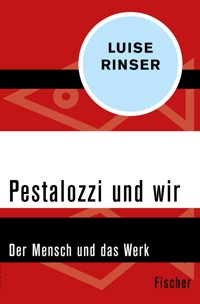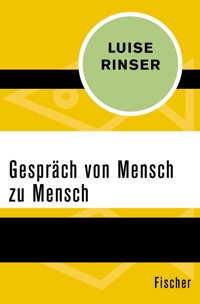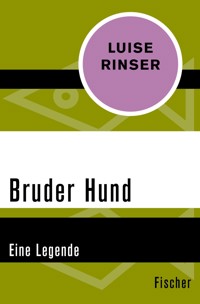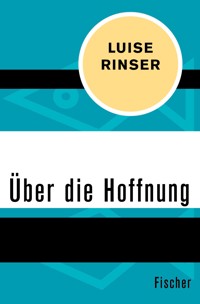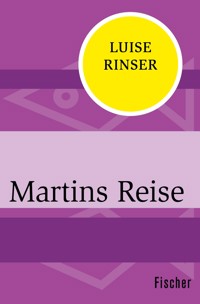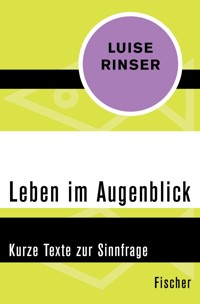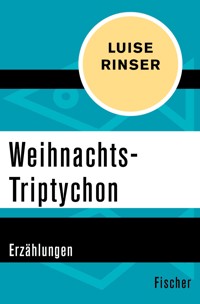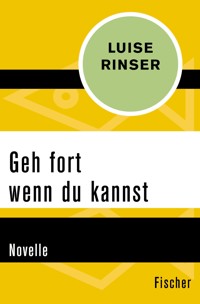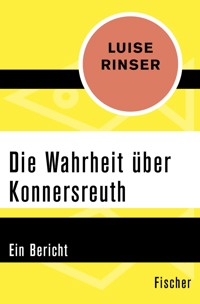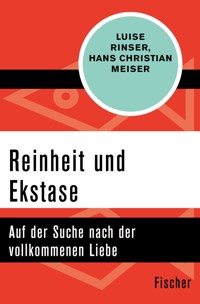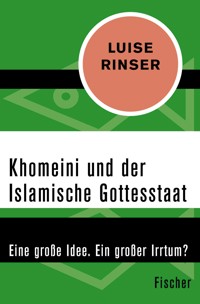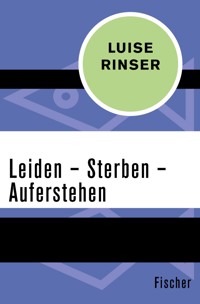
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Die Frage heißt nun nicht mehr: Warum leide ich, der ich doch meiner Meinung nach schuldlos bin, sondern: Warum leiden viele andere? Warum leiden Menschen überhaupt?« Am Beispiel des Hiob, der durch sein Leiden schließlich zu einer wichtigen Erkenntnis gelangt, diskutiert Luise Rinser in diesem erstmals 1975 erschienenen Essay Fragen nach menschlicher Schuld und nach dem Sinn des Leidens. Denn Leiden ist nicht gleich Not: »Wenn Not die Ursache der Zivilisation ist, so ist Leiden die der geistigen Kultur.« Leiden, Sterben, Auferstehen: Luise Rinser widmet sich hier drei großen und komplexen Themen und verhandelt diese wie gewohnt anschaulich und fundiert. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 73
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Luise Rinser
Leiden – Sterben – Auferstehen
Über dieses Buch
»Die Frage heißt nun nicht mehr: Warum leide ich, der ich doch meiner Meinung nach schuldlos bin, sondern: Warum leiden viele andere? Warum leiden Menschen überhaupt?« Am Beispiel des Hiob, der durch sein Leiden schließlich zu einer wichtigen Erkenntnis gelangt, diskutiert Luise Rinser in diesem erstmals 1975 erschienenen Essay Fragen nach menschlicher Schuld und nach dem Sinn des Leidens. Denn Leiden ist nicht gleich Not: »Wenn Not die Ursache der Zivilisation ist, so ist Leiden die der geistigen Kultur.« Leiden, Sterben, Auferstehen: Luise Rinser widmet sich hier drei großen und komplexen Themen und verhandelt diese wie gewohnt anschaulich und fundiert.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Erschienen bei FISCHER Digital
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Copyright © by Christoph Rinser
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Montasser Medienagentur, München
Covergestaltung: buxdesign, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-561211-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Für
Vom Sinn des Leidens
Sagen wir ja oder nein zum Sterben?
Ich glaube an die Auferstehung
Für
Paolo Brenni,
Pfarrer von St. Anton, Luzern,
der mich eingeladen hatte,
in seiner Kirche zu sprechen.
Vom Sinn des Leidens
Eines der Bücher des Alten Testaments ist das »Buch Hiob«. Wir nennen noch heute – nach zweitausend und mehr Jahren – einen Menschen, der über seine Kraft hinaus mit Leiden beladen ist, einen »wahren Hiob«. Aber nicht das Maß oder Übermaß der Leiden ist es, was diesen Hiob bemerkenswert macht, sondern seine Hartnäckigkeit des Fragens nach dem Sinn seiner Leiden.
Hören wir zunächst seine Klagen:
»Zum Ekel ist mir mein Leben geworden. So lasse ich meinem Jammer freien Lauf. Reden will ich in meiner Seele Bitternis.
Gutes erhoffte ich, aber gekommen ist Böses. Auf Licht wartete ich, die Finsternis kam.
Schrecknissse stürzten auf mich ein; nachts ängstigen mich Träume, und Wahnbilder verfolgen mich.
Meine Feinde zerstören mir den Weg, das Volk verlacht mich, aus der Gemeinschaft bin ich verjagt.
Ohne Hoffnung schwinden meine Tage dahin. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Möchte doch Gott seine Hand erheben und meinen Lebensfaden abschneiden.«
Was ist denn dem Hiob geschehen, daß er in so tiefe Verzweiflung stürzte?
Vordem war er ein reicher, angesehener, glücklicher Mann gewesen. Aber eines Tages wendete sich das Schicksalsblatt: Krieg brach aus, das fremde Heer raubte sein Vieh und erschlug die Landarbeiter, seine Schafherden verbrannten in einem Feuer, das »vom Himmel fiel«, ein Wüstensturm zerstörte das Haus, in dem eben seine Kinder zu einem Festmahl versammelt waren. Alle wurden getötet, und später befiel ihn selbst eine ekelhafte Krankheit. Zu alldem mußte er sich auch noch von seinen Freunden, den »geschwätzigen Tröstern«, sagen lassen, er sei natürlich selber schuld an seinem Unglück; denn Unglück sei immer Strafe, und wer also gestraft werde, müsse folglich ein großer Sünder sein.
Hiob aber ist sich keiner Schuld bewußt, für die Gott ihn bestrafen, so bestrafen müßte und dürfte. Hiobs Gott ist gerecht – er straft nur Sünder. Wenn er aber in Hiob einen Gerechten bestraft, so ist er nicht mehr gerecht. Oder er ist nicht gut. Oder er ist nicht allmächtig, er kann nicht, was er möchte. Wenn aber Gott nicht gerecht, nicht gut, nicht allmächtig ist, ist er dann Gott? Ist er dann überhaupt?
An diesem Punkt des Bemühens um Leidverständnis zerbricht für viele Menschen ihr Gottesbild und ihr Glaube, das heißt: ihr Vertrauen, ihre Hoffnung, und auch ihre Liebe.
Hiob aber hält an seinem Gottesbild, an seinem Gott fest. Er sagt sich: Wenn ich einen Widerspruch sehe und ihn nicht lösen kann, dann heißt das noch lange nicht, daß er nicht lösbar sei. Doch nur Gott selbst kann ihn lösen. Darum wendet sich Hiob mit seiner Frage an die oberste Instanz. Aber Gott schweigt. Gott erweist sich nicht als anwesend.
Wie sehr Gott anwesend ist, weiß Hiob nicht, denn er kennt den Beginn seiner Geschichte nicht – das Vorspiel im Himmel: eines Tages erscheint der Satansengel vor Gott. Er kommt, wie es heißt, »vom Herumschweifen auf der Erde«. Nicht er fängt nun an, von Hiob zu reden – er hat ihn gar nicht beachtet –, erst Gott macht den Satansengel auf ihn aufmerksam, indem er diesen Hiob über alle Maßen lobt. Warum tut er das? Er muß doch wissen, daß er damit den Satan provoziert. Und prompt reagiert dieser: Ja, dein Hiob, er ist gerecht, es geht ihm ja gut, und es ist leicht, gerecht und fromm zu sein, wenn es einem derart gut geht. Aber nimm einmal deine Hand von ihm und schau, ob er dir dann nicht ins Gesicht hinein flucht!
Und Gott erlaubt dem Satan, den Hiob zu schlagen; nicht er selbst also schlägt ihn, sondern er »läßt nur zu«.
Aber warum tut er das? Weiß er denn den Ausgang der Geschichte? Will er dem Satan zeigen, wessen Macht stärker ist: die Satans oder die des mit Gott verbundenen Menschen? Ist er sicher, in Hiob, im Menschen, das Spiel zu gewinnen? Ist die Geschichte auf die Endzeit gerichtet? Ist Hiobs Geschichte die der Menschheit, die am Ende gerettet ist?
Zunächst antwortet Hiob auf die Schicksalsschläge mit dem oft zitierten Wort: »Der Herr hat es gegeben, er hat es wieder genommen, sein Name sei gelobt.«
Ist diese Haltung das, was C.G. Jung, über Hiob reflektierend, eine (feige) Demutsgebärde nennt?
Noch ist nichts klar. Wie weit Hiobs Frömmigkeit reicht, ist noch nicht abzusehen.
Das Spiel geht weiter, das Leiden wird verstärkt. Bisher wurde Hiob nur in seinem Besitz getroffen, jetzt trifft es ihn an seinem Leib: er wird mit dem »Aussatz« geschlagen, mit einem juckenden, stinkenden Ekzem, das ihn seiner Frau und der ganzen Umgebung zum Ekel macht; er wird ein Ausgestoßener. Tiefer kann er nicht mehr fallen.
Und nun endlich beginnt er sich aufzulehnen. Da es für ihn keinen anderen Urheber des Schicksals gibt als Gott, schreit er zu diesem Gott.
Könnte es Hiob helfen, wenn man ihm mit jenem Satz käme, den billige Tröster leicht bei der Hand haben: Es ist ja nicht Gott, der dich schlägt, er läßt es nur geschehen? Macht es für den, den es trifft, einen Unterschied, ob Gott selber schlägt oder ob er es zuläßt, daß ein anderer schlägt? Es ist nur eine Verschiebung der Frage, keine Lösung.
Stellen wir uns Hiob vor, wie er finster und verlassen in der Asche hockt und seinen Aussatz – so steht es da – mit einer Scherbe kratzt.
Käme nun einer, der zu ihm sagt: Du hast ein falsches Gottesbild; Gott ist weder gerecht noch gut, noch barmherzig, das sind anthropomorphe Bilder, Gott ist anders, er ist ganz unbegreiflich, er schafft und zerstört gleichmütig, erinnere dich, wie er die Menschen in der Sintflut ersaufen ließ, weil es ihn reute – so steht es geschrieben –, daß er sie je erschaffen hat. Meinst du denn, du könntest mit Gott als einer statischen Größe rechnen? Meinst du, du könntest mit ihm abrechnen?
Oder es käme Buddha zu ihm und sagte: Dein Fragen, Hiob, ist unsinnig. Es gibt keinen Urheber der Leiden, denn es gibt kein Leiden, nur du selbst lebst in dem Wahn, es gebe Leiden. Alles ist »Wille und Vorstellung«. Leiden gehört zur Welt der Maya, die nicht existiert außer in deiner Einbildung. Du leidest nicht an Fakten, sondern an Vorstellungen. Oder es käme einer der altgriechischen Stoiker und sagte: Du leidest, gewiß, und es sind Tatsachen, an denen du leidest. Aber überlege einmal, ob es etwas gibt, woran zu leiden wert ist! Alles ist Asche, alles ist nur ein Hauch. Erachte alles Irdische für ein Nichts, und du bist leidfrei.