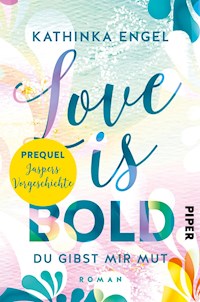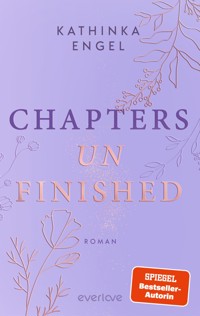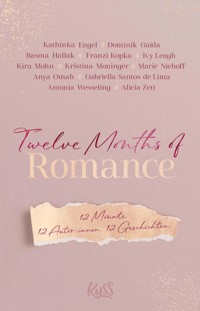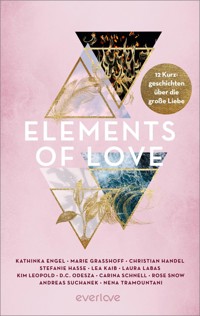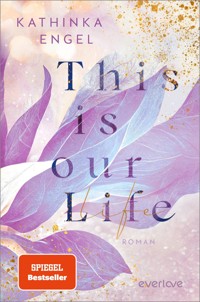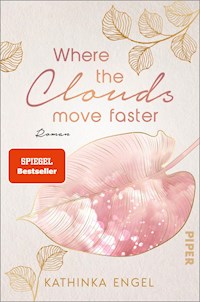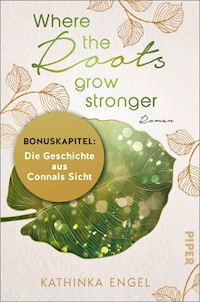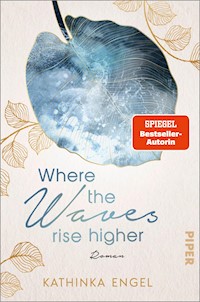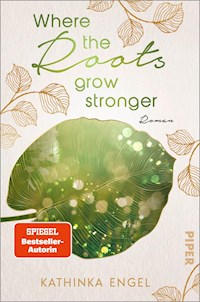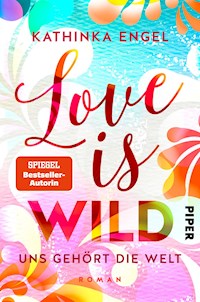9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebe und Musik im »Big Easy«: Die Love-is-Romanreihe von Bestsellerautorin Kathinka Engel New Orleans ist die Stadt der Musik, der Lebensfreude und der großen Gefühle. Kommt alles in einer Geschichte zusammen, entsteht wundervolle New Adult Romance mit absolutem Binge-Read-Potenzial. Zwischen alten Südstaaten und neuem Amerika ist New Orleans ein Schmelztiegel der Kulturen, Ideen und Träume. Im Takt einer eigenen Musik schwingt »The Big Easy« auf einer Wellenlänge, die jeden Neuankömmling mitten ins Herz trifft. So auch Franziska, die sich für ein freiwilliges soziales Jahr nach Louisiana begibt. Als sie den Musiker Link trifft, entführt er sie in ein New Orleans hinter den Postkartenansichten und stiehlt ihr Herz. Gibt es für Franziska ein Zurück ins alte Leben? Im ersten Band ihrer vielfältig-bunten New-Adult-Trilogie setzt Bestsellerautorin Kathinka Engel dem Sound von New Orleans ein rasantes Denkmal, das sofort die Sehnsucht nach einer Reise ins French Quarter weckt. »Love is Loud« ist lässig, cool und aufrichtig romantisch, ein Schnappschuss aus dem harten und aufregenden Leben einer jungen Band. Bühne frei für New Adult Romance der Extraklasse! Loslassen, treiben lassen, alles wagen: eine romantische Liebesgeschichte mit Soul Eine große, bunte Stadt und der Klang des Lebens – lass sdich mitreißen und entdecke auch »Love is Bold« und »Love is Wild«. Die Liebestrilogie von Kathinka Engel hat das Zeug zum neuen Herzensfavoriten! Für alle Leser:innen von Mona Kasten, Laura Kneidl und Tami Fischer Noch nicht genug von Kathinka Engel? Mit der »Finde-mich-« und der »Shetland-Love-Reihe« gibt es noch mehr von der deutschen Autorin zu lesen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Love is Loud – Ich höre nur dich« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Von Kathinka Engel liegen im Piper Verlag vor:
Finde-mich-Reihe:
Band 1: Finde mich. Jetzt
Band 2: Halte mich. Hier
Band 3: Liebe mich. Für immer
Love-is-Reihe:
Band 1: Love is Loud – Ich höre nur dich
Band 2: Love is Bold – Du gibst mir Mut
Band 3: Love is Wild – Uns gehört die Welt
© Piper Verlag GmbH, München 2020Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.Redaktion: Anita HirtreiterCovergestaltung: FAVORITBUERO, MünchenCovermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Cover & Impressum
1 Franzi
2 Lincoln
3 Franzi
4 Lincoln
5 Franzi
6 Lincoln
7 Franzi
8 Lincoln
9 Franzi
10 Lincoln
11 Franzi
12 Lincoln
13 Franzi
14 Lincoln
15 Franzi
16 Lincoln
17 Franzi
18 Lincoln
19 Franzi
20 Lincoln
21 Franzi
22 Lincoln
23 Franzi
24 Lincoln
25 Franzi
26 Lincoln
27 Franzi
28 Lincoln
29 Franzi
30 Lincoln
31 Franzi
32 Lincoln
33 Franzi
34 Lincoln
35 Franzi
36 Lincoln
37 Franzi
38 Lincoln
39 Franzi
40 Lincoln
41 Franzi
42 Lincoln
43 Franzi
44 Lincoln
45 Franzi
46 Lincoln
47 Franzi
48 Lincoln
49 Franzi
50 Lincoln
51 Franzi
52 Lincoln
53 Franzi
Danksagung
Zitat
Für all die Lauten. Für all die Leisen.Und für Maxi.
1
Franzi
Eins.Zwei.Drei.Vier.Fünf.Sechs.Sieben.Acht.Neun.Zehn.
Das »Nichts zu verzollen«-Schild am Louis-Armstrong-Flughafen in New Orleans blickt mich an wie eine stille Ermahnung. Wir sehen alles, sagt es. Du wirkst verdächtig. Ich starre zurück und zähle erst einmal langsam im Kopf bis zehn, obwohl ich weiß, dass keiner der Gegenstände in meinem Gepäck verzollt werden muss. Aber so hat es mir meine Mutter beigebracht. Wenn man bei zehn immer noch von seiner Entscheidung überzeugt ist, kann nichts mehr schiefgehen. Denn während dieser Sekunden erlangt man Gewissheit, dass eine Entscheidung rational ist und man sich nicht nur von seinen Gefühlen leiten lässt. Mit meinen vor lauter Nervosität schwitzigen Händen umfasse ich den Griff meines Rollkoffers und mache mich auf den Weg zum Ausgang – und in mein Abenteuer.
In der letzten Zeit fand ich mich viel zu oft in Situationen wieder, in denen ich im Kopf bis zehn zählen musste. Bevor ich meine Bewerbung an das Programm »Care for a Living« rausschickte, habe ich gezählt. Bevor ich meiner Mutter und meinem Bruder davon erzählte, dass ich angenommen wurde und wirklich ein Jahr in den USA verbringen würde, habe ich gezählt. Bevor ich auf den »Jetzt buchen«-Button der Flugsuche-Webseite klickte, habe ich gezählt.
Die amerikanischen Zollbeamten, an denen ich vorbeilaufe, unterhalten sich halbwegs angeregt und sind dennoch die ganze Zeit wachsam. Es ist jedes Mal das Gleiche mit mir. Ich weiß zwar, dass ich nichts Verbotenes tue, trotzdem werde ich leicht panisch, wenn ich Leute in Uniform sehe. Die Zollbeamten beäugen mich kritisch, und ich bin mir sicher, dass sie mir meine Nervosität ansehen können. Cool bleiben, weise ich mich selbst an. Tu einfach so, als wäre das hier ganz normal. Sogleich fällt mir auf, dass dies vermutlich genau das Mantra ist, das Schmuggler vor sich hin sagen, und ich fühle mich vollkommen grundlos noch verdächtiger.
Ich lasse die Beamten hinter mir und bemühe mich, meine Schritte nicht zu beschleunigen, damit sie mich nicht aus der Menge herausgreifen und wieder zurückrufen. Allerdings bin ich mir in diesem Moment nicht mehr sicher, wie hoch meine Schrittfrequenz war. Ich orientiere mich an der Dame vor mir, versuche jedoch zu vermeiden, in einen Gleichschritt zu verfallen, weil das sicher albern wirken würde. Dies ist eine meiner größten Schwächen, etwas, von dem ich glaube, dass es mich bislang in meinem Leben zurückgehalten hat. Die Tatsache, dass ich mir in den meisten Momenten meines Körpers, meiner selbst viel zu bewusst bin, hemmt mich. Beinahe kommt es mir vor, als würde ich die ganze Zeit neben mir schweben und mir bei meinem eigenen Leben zusehen und darüber urteilen. Es sieht komisch aus, wenn deine Hände so baumeln. Wenn du die Arme verschränkst, weiß doch jeder, dass du unsicher bist. Deine Tanzbewegungen sind viel zu steif. Warum ist es nur so schwer, in der Masse einfach unterzugehen?
Die Glasschiebetüren öffnen sich, und ich trete hinter der Dame vor mir hindurch. Im Gleichschritt natürlich, aber jetzt ist es ohnehin schon egal. Schnell taste ich in meinem Brustbeutel, den meine Mutter mir aufgeschwatzt hat, obwohl er der beste Beweis dafür ist, dass Funktionalität nicht über Schönheit gehen sollte, nach meinem Pass. Nur zur Sicherheit. Er liegt natürlich an Ort und Stelle, und ich blicke auf. Das hier ist mein erster Moment in New Orleans. Und ich hätte ihn fast verpasst, nur weil ich mal wieder alles richtig machen wollte und viel zu sehr damit beschäftigt war, mich auf mich selbst zu fokussieren.
Aus den Lautsprechern dringt leise Jazzmusik an mein Ohr, und ich lasse den Anblick der verschiedenen fremden Restaurantketten und Geschäfte kurz auf mich wirken. Es riecht nach Kaffee und Frittiertem. Auf großen Leuchtschildern werden Pretzels in allen möglichen Geschmacksvariationen angeboten. Hallende Durchsagen unterbrechen die Musik, aber ich kann mich nicht auf den Inhalt konzentrieren, dafür bin ich viel zu aufgeregt. Denn das hier ist der Start in mein Abenteuer. Mein eigenes grandioses Abenteuer – ein ganzes Jahr, bevor ich mich wieder auf meine Zukunft konzentriere und in irgendeinem Büro versauere. Ein Abenteuer ohne die großen Hemmungen, die ich zu Hause so oft verspürt habe. Ich schließe kurz die Augen, atme einmal tief ein.
Als ich sie wieder öffne, wird mein Blick auf die Wartenden gelenkt. Geschäftsmäßig aussehende Männer in Anzügen mit laminierten Schildern, Familien mit winkenden kleinen Kindern, Köpfe, die in die Luft gereckt werden, um besser sehen zu können.
In der zweiten Reihe erkenne ich sie von dem Foto, das sie mir per Mail geschickt hat: Faye, die Schwiegertochter von Hugo, um den ich mich im kommenden Jahr kümmern werde und dafür Kost, Logis und etwas Taschengeld erhalte.
»Hi, Franziska«, ruft sie und winkt. Fayes blonde, wellige Haare fallen über ihre linke Schulter und werden von einer Sonnenbrille gekrönt, die sie auf den Kopf geschoben hat. Sie trägt ein figurbetontes, ärmelloses Kleid, und um die Schultern hat sie einen Cardigan geschlungen. Die schlanken Beine stecken in schwarzen Pumps. Sie ist – man kann es nicht anders sagen – wunderschön. In meinen Leggins und meinem schlabbrigen Pullover fühle ich mich im Vergleich zwar ein bisschen schäbig, aber ihr offenes Lächeln nimmt mir sogleich meine aufkeimende Unsicherheit, und ich merke, wie etwas von meiner Hemmung abbröckelt.
Sie bedeutet mir, um die Absperrung herumzugehen, und läuft mir parallel auf der anderen Seite entgegen. Als wir endlich einander gegenüberstehen, breitet sie ihre Arme aus und zieht mich in eine Umarmung.
»Schön, dass du da bist! Hattest du einen guten Flug?« Ihr Englisch klingt unerwartet weich. Sie zieht die Vokale in die Länge. Das muss der Südstaatenakzent sein.
»Ja, danke!«, bringe ich mit klopfendem Herzen hervor. Ich lächle sie an, und sie klatscht in die Hände.
»Gut. Sind das all deine Sachen? Kann ich dir etwas abnehmen? Wir parken draußen.« Sie macht eine Geste zur nächsten Glastür. Ihre Energie ist beinahe ansteckend, obwohl ich hundemüde bin. Für mich ist es ja eigentlich bereits Mitternacht.
»Nein, geht schon«, erwidere ich.
»Hugo?«, ruft sie und sagt leise an mich gewandt: »Er hat schlechte Laune. Vermutlich, weil er keinen Mittagsschlaf gehalten hat.«
»Ich brauche keinen Mittagsschlaf.« Eine barsche Stimme zu meiner Linken zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Ein alter Mann erhebt sich von einer Bank und kommt auf uns zu. Er blickt mürrisch drein. »Genauso wenig, wie ich eine Aufpasserin brauche.«
Den letzten Satz könnte ich auch missverstanden haben, denn er nuschelt ein wenig. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich mich nicht verhört habe, vor allem, weil Faye lacht und sagt: »Keine Sorge, ihr beide werdet euch bestimmt gut verstehen.«
»Das muss erst noch bewiesen werden«, sagt Hugo und setzt sich einen Strohhut auf den Kopf.
»Ich bin Franziska«, stelle ich mich vor, doch er ist bereits an uns vorbei Richtung Ausgang marschiert. Etwas perplex sehe ich zu Faye.
»Tut mir leid, dass er so mies drauf ist«, sagt sie. »Er kommt immer noch nicht so richtig damit klar, dass er nun bei uns wohnen muss, obwohl wir ihn schon vor einem Jahr bei uns aufgenommen haben. Aber anders hätte es nicht funktioniert. Ich bin jedenfalls froh, dass du jetzt da bist. Das wird ihm guttun.«
Ich nicke und versuche mich an einem weiteren Lächeln, mit dem ich vor allen Dingen mir selbst beweisen will, dass mich nichts aus der Ruhe bringen wird. Doch ich merke, in der Fremde sind Optimismus und Vorfreude ein zerbrechliches Gerüst, das trotz Vernunft leicht zu erschüttern ist. Und auf einmal kommt mir das Jahr, das vor mir liegt, wie eine Ewigkeit vor. Denn was, wenn ich mich mit Hugo nicht verstehe? Warum habe ich mir darüber vorher keine Gedanken gemacht? Wieso wollte ich nicht gleich einen Bürojob antreten? Ich sehe etwas unsicher zu Hugo, der konzentriert Löcher in die Luft starrt und alles daranzusetzen scheint, bloß keine Notiz von mir zu nehmen. Das kann ja heiter werden.
In dem Moment, da wir aus dem klimatisierten Flughafengebäude hinaustreten, ist es, als würden wir in eine Wand aus Feuchtigkeit und Wärme laufen. Ich komme gerade aus dem regnerischen deutschen März, dessen Temperaturen in den letzten Wochen nie über zehn Grad geklettert sind. Hier hat es, wie mein Handy mir vor dem Abflug gesagt hat, vierundzwanzig Grad, die sich aber aufgrund der Feuchtigkeit anfühlen wie mindestens dreißig und mehrere Zentner schwer. Und die hier fünfundsiebzig Grad Fahrenheit heißen.
Bei einem schwarzen SUV machen wir halt. Faye drückt auf ihrem Schlüssel herum, der Kofferraum öffnet sich automatisch, und ich wuchte mit ihrer Hilfe mein Gepäck hinein.
»Hugo, willst du mit deinem schlimmen Bein vorne sitzen?«, fragt sie dann an ihren Schwiegervater gewandt. Er antwortet nicht, blickt nur grimmig drein. »Okay, dann ist es entschieden. Franziska, du sitzt vorne.« Sie lächelt und zwinkert mir zu.
Ich bin unschlüssig. Schließlich will ich dem alten Mann nicht den bequemsten Platz wegnehmen – zumal, wenn er ein schlimmes Bein hat. Ich blicke zu ihm, um zu eruieren, ob das wirklich in Ordnung ist, doch da klettert er bereits auf die Rückbank. Er ist beweglicher, als man meinen könnte, wenn man sein faltiges Gesicht betrachtet.
»Die Klimaanlage hat den Wagen gleich runtergekühlt, keine Sorge«, sagt Faye. Dankbar steige ich ins Auto.
Wir fahren über Highways, die so breit sind wie drei deutsche Autobahnen nebeneinander. Alles scheint auf den ersten Blick größer als in Deutschland, nicht nur die Temperaturskala. Die Autos, die Straßen. Am Horizont erspähe ich hinter einem Dunstschleier ein paar Wolkenkratzer. Mein Bauch macht einen kurzen Satz der Vorfreude. Denn dieses Abenteuer habe ich mir schließlich aus gutem Grund ausgesucht. Ich wollte etwas von der Welt sehen. Etwas, das weiter weg ist als der Gardasee oder holländische Strandbäder. Den Büroalltag werde ich noch früh genug erleben – und jetzt bin ich wirklich hier.
Faye schaltet das Autoradio ein, und ein Song von James Blunt ertönt. Von hinten dringt ein Schnauben zu uns nach vorne.
»Was ist es diesmal, Hugo?«, fragt Faye, deren mädchenhafte Stimme ein bisschen von ihrem geduldigen Klang einbüßt.
»Dein Gedudel«, sagt er.
»Mein Auto, mein Gedudel«, erwidert Faye und lächelt mir entschuldigend zu.
»Verlogener Scheiß«, sagt Hugo von hinten.
»Und was, bitte, ist daran verlogen, wenn man über eine Frau singt, die so schön ist, dass sie aus der Masse heraussticht?«
»Es geht nicht darum, was er singt.« Hugo wirkt nicht, als hätte er Lust, zu erklären, was er meint, tut es aber trotzdem. »Sondern darum, wie er es singt. Das ganze Arrangement. Es drückt einem die Emotionen geradezu auf. Das ist billig.«
»Dann hör eben einfach weg«, sagt Faye.
Ich wage einen kleinen Vorstoß und frage nach hinten gewandt: »Wie sollte Musik denn sein?«
»Authentisch. Lebendig. Statt einfach nur nicht anzuecken, sollte sie das Leben feiern, in all seinen Facetten. Die traurigen Seiten, die fröhlichen Seiten. Und dabei dem Zuhörer Raum lassen, um zu entscheiden, wie er sich dabei fühlen will. Aber ihr beide habt offensichtlich keine Ahnung davon.« Er macht eine kurze Pause, legt seinen Kopf auf die Lehne und zieht seinen Hut übers Gesicht. »Vielleicht ist es doch an der Zeit für ein Nickerchen.« Aber es klingt nicht, als wäre das wirklich sein Bedürfnis, sondern eher wie ein vernichtendes Urteil über Fayes Musikgeschmack und meine Gesprächskompetenz. Meine Vorfreude wird langsam, aber sicher von etwas zur Seite gedrängt, das sich anfühlt wie Sorge. Sorge ist der Anfang jeder Hemmung. Und genau das wollte ich hinter mir lassen.
»Keine Angst«, sagt Faye. »Er braucht ein bisschen, bis er sich an neue Umstände gewöhnt.«
Ich nicke, aber die aufkeimende Euphorie, mit der ich meiner Ankunft in New Orleans eigentlich begegnen wollte, schafft es in diesem Moment nicht an die Oberfläche, und beinahe sehne ich mich nach einem ergonomischen Schreibtischstuhl.
Wir verlassen den Highway über einen labyrinthartigen Knotenpunkt. Wie Faye sich hier zurechtfindet, ist mir ein Rätsel, und ich beobachte sie heimlich aus dem Augenwinkel. Sie ist absolut ruhig und cool, während sie Spuren wechselt, als gäbe es kein Morgen. Ich bin schon in Deutschland nur dann Auto gefahren, wenn es unbedingt sein musste. Mir scheint der Verkehr unberechenbar, so als könnte jeden Moment jemand durchdrehen und kamikazemäßig andere Verkehrsteilnehmer ausschalten. Ein Grund, warum ich auf der Autobahn nie schneller als hundertzehn Kilometer pro Stunde fahre und warum mein Bruder mich für den größten Angsthasen der Welt hält.
Wir fahren unter einer Brücke durch und biegen an der darauffolgenden Kreuzung rechts ab.
»Wir kommen jetzt in den Garden District«, sagt Faye. »Das Viertel, in dem wir wohnen. Und wenn du mich fragst, die schönste Gegend in New Orleans.« Sie lächelt.
»Wenn man sie sich leisten kann«, grunzt Hugo von hinten, ohne den Strohhut von seinem Gesicht zu nehmen, sodass ich seine Mimik nicht lesen kann.
»Und, Hugo?«, fragt sie. »Musst du denn Miete zahlen?«
Ich verstehe, dass sie genervt ist. Schließlich teilt sie ihr Zuhause mit ihrem Schwiegervater, der ganz offensichtlich alles andere als dankbar dafür ist. Oder höflich. Oder nette Gesellschaft.
»Und, Faye?«, kontert Hugo. »Musst du denn Miete zahlen?«
Faye seufzt theatralisch, sagt aber nichts dazu. Wäre ich an ihrer Stelle, ich würde dem alten Griesgram solche Unverschämtheiten nicht durchgehen lassen.
»Da drüben ist ein sehr nettes Café. Vielleicht könntet ihr zwei dort in den nächsten Tagen mal frühstücken gehen.« Fayes Tonfall bleibt bewundernswerterweise die ganze Zeit über freundlich. »Die Boutiquen hier haben zwar keine so große Auswahl wie die im French Quarter, aber wenn du willst, können wir beide am Wochenende mal eine kleine Shoppingtour machen.«
»Sehr gerne«, sage ich. Immerhin könnte es mit Faye wirklich nett werden.
»Du musst dir keine Sorgen machen, Franziska«, sagt Hugo bissig. »Wenn du dich an Faye hältst, besteht überhaupt keine Gefahr, dass du mit zu viel Geld wieder nach Hause fährst.«
Faye lacht, doch es klingt etwas gezwungen. Anscheinend ist bei ihr auch irgendwann eine Grenze erreicht.
Ich blicke aus dem Fenster und konzentriere mich auf den Anblick der neuen Umgebung. Faye hat recht, das hier ist ein schönes Viertel. Und je weiter wir der Straße folgen, desto pittoresker wird es. Unter Arkaden reihen sich kleine, gemütliche Cafés, Bars und Restaurants dicht an dicht. Pflanzenkübel und gusseisernes Mobiliar, Kleiderstangen vor Vintageläden und bunt gestrichene Holzbänke verleihen der lebendig-urbanen Umgebung einen Zuckerguss-Charme.
Wir lassen die belebte Straße hinter uns und biegen in ein Wohngebiet ab. Knorrige Bäume säumen die Fußwege zu beiden Seiten und dahinter –
»Wow!«, entfährt es mir, und für einen kurzen Augenblick ist mein Ärger über Hugo und meine Sorge, wie ich ihn ein ganzes Jahr lang aushalten soll, vergessen.
»Schön, oder?« In Fayes Stimme schwingt ein Lächeln mit.
Ich bin beinahe sprachlos. Hinter hohen Hecken und glänzenden Eisenzäunen stehen die pompösesten Stadthäuser – ach, was sage ich, Villen! –, die ich je gesehen habe. Es kommt mir geradezu lachhaft vor, dass ich in diesem Moment an unseren Vorort mit den Doppelhaushälften und kleinen Gärten denken muss, denn er hält keinem Vergleich stand. Zweistöckige weiße Prachtbauten mit Veranda und aufwendig verzierten Balkons stehen mächtig in großen Gärten. Fusselige Flechten hängen von den Ästen exotisch aussehender Bäume herab. Genauso hatte ich mir die Südstaaten vorgestellt.
»Hier lässt es sich aushalten, oder?«, fragt Faye.
Ich nicke langsam, immer noch hypnotisiert von dem Anblick, der sich mir links und rechts bietet. Von hinten höre ich ein Schnauben, aber für den Moment will ich mich nicht von Hugos Laune irritieren lassen.
»Die Sklavenhalter haben es hier auch gut ausgehalten, nicht wahr, Faye?«, sagt Hugo.
»Ja, Hugo, ich weiß. Aber lass doch ein einziges Mal die Geschichte Geschichte sein, in Ordnung?«
»Ich meine ja nur, die Sklaven fanden es vermutlich nicht so prickelnd hier.«
»Und? Haben wir Sklaven?«, fragt Faye und blickt in den Rückspiegel.
Hugo lacht leise, doch es wirkt nicht wie der Ausdruck von Freude. Ich schlucke und male mir einen höhenverstellbaren Schreibtisch mit Familienfotos darauf aus. Vielleicht eine Bürotasse mit Motivationsspruch, eine kleine Grünpflanze.
Wir biegen noch ein paarmal ab, bis ich vollkommen die Orientierung verloren habe. Dann halten wir vor einem Haus.
Es ist ebenso prachtvoll wie die anderen Villen, die ich auf der Fahrt bewundert habe. Hinter einem verschnörkelten schwarzen Eisenzaun blicke ich auf ein hellgraues Herrenhaus, das mit weißen Ornamenten geschmückt ist. Im ersten Stock stützen weiße korinthische Säulen einen prächtigen Balkon. Die Fenster reichen vom Boden bis zur Decke und werden links und rechts flankiert von schwarzen Fensterläden. Und sogar die Fenster selbst sowie die Eingangstür sind mit weißen filigranen Giebeln verziert.
»Können wir reingehen?«, fragt Hugo kurz angebunden und wuchtet bereits mein Gepäck aus dem Kofferraum. »Einen Vorteil muss es ja haben, dass wir in diesem absurden Haus wohnen. Und der heißt Klimaanlage.«
Faye gibt einen Code ein, und Hugo öffnet das Eisentor. Ich nehme ihm mein Gepäck ab, was er nur allzu bereitwillig geschehen lässt, und folge den beiden über den gepflasterten Weg. Zu meiner Rechten plätschert ein wunderhübscher kleiner Springbrunnen. Dahinter ragt ein monströser Baum gen Himmel.
»Was ist das für ein Baum?«, frage ich an Faye gewandt. Auch von seinen Ästen hängt dieser gräulich grüne Fluff herab.
»Quercus virginiana«, sagt Hugo.
»Eine Virginia-Eiche«, übersetzt Faye. »Im Süden nennen wir sie auch Lebenseiche. Sie ist der Grund, warum dein Zimmer leider nicht viel Licht abbekommt. Und warum wir den Keller nicht ausbauen können. Die Wurzeln reichen zu tief in die Erde. Victor und ich würden sie gern fällen.«
»Nur über meine Leiche«, sagt Hugo. »Bevor das passiert, kette ich mich daran fest.«
Es ist das erste Mal, dass ich auf Hugos Seite bin. Denn es wäre eine Schande, wenn dieser prachtvolle Baum gefällt würde.
»Sei nicht so dramatisch«, sagt Faye. »Die Stadt stimmt dem mit Sicherheit ohnehin nicht zu. Bei so alten Bäumen liegt es nicht in der Hand der Hausbesitzer.« Sie zuckt mit den Schultern und sperrt die Haustür auf.
»Und was ist das, was von den Ästen herabhängt?«, frage ich, an Hugo gewandt. Vielleicht finden wir darüber eine gemeinsame Ebene.
»Tillandsia usneoides«, sagt er. Doch er scheint meinen fragenden Blick zu bemerken und fügt hinzu: »Man nennt es auch Louisianamoos. Oder Feenhaar.«
»Pass auf, jetzt erzählt er dir gleich die Legende dazu. Lass sie erst mal ankommen, Hugo. Auspacken, duschen, ihre Familie anrufen.«
Ich bin ein bisschen enttäuscht, denn ich hätte gern die Legende dazu gehört. Aber vielleicht ergibt es sich ein andermal. Und die Vorstellung, mir den Flugzeugmief abzuwaschen, ist tatsächlich äußerst verlockend.
»Keine Sorge«, sagt Hugo. »Ich habe nicht vor, irgendjemanden mit meinen Altherrengeschichten zu langweilen.«
Er marschiert an uns vorbei ins Haus. Mir fällt auf, dass er tatsächlich leicht humpelt. Im nächsten Moment ist er verschwunden.
2
Lincoln
Einmal pro Woche hole ich meine vierjährige Nichte Maya bei ihrer Tagesmutter Phoenix ab. Phoenix lebt in Tremé, meinem liebsten Stadtviertel von New Orleans, und ist eine Freundin der Familie. Sie passt auf die Kleine auf, seit mein Schwager Jasper sie bei ihren Drag-Auftritten in einem Burlesque-Schuppen auf dem Klavier begleitet hat.
Wie immer bin ich mit meinem klapprigen Fahrrad unterwegs, und wie immer freut sich Maya, mich zu sehen. Ich lasse sie auf meinem Fahrradsattel reiten unter der Bedingung, dass sie sich gut an mir festhält, während ich sie schiebe. Es ist unser Geheimnis.
Jasper lebt mit Maya und ihrem siebenjährigen Bruder Weston in einem kleinen kreolischen Cottage mitten in Tremé. Ich lehne mein klapperndes Fahrrad vorsichtig gegen die Veranda und hebe Maya vom Sattel.
»Hast du Hunger? Wir haben Zeit für ein Sandwich«, sage ich und schließe die Tür auf. Drinnen ist es angenehm kühl, und ich lasse meinen Gitarrenkasten von der Schulter auf eins der alten Ledersofas sinken.
Maya schüttelt den Kopf. Sie spricht nicht gern.
»Hat Phoenix euch was gemacht?«, frage ich.
Wieder schüttelt sie den Kopf.
»Aber du hast gegessen?«
Jetzt nickt sie.
»Pop-Tarts?«
Erneutes Nicken. Dann schleudert sie die Schuhe von den Füßen und läuft schnurstracks in ihr Zimmer.
»Mach es dir nicht zu gemütlich, in fünfzehn Minuten müssen wir zur Bandprobe«, rufe ich ihr hinterher, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie mich noch hört. Maya hat die Gabe, die Welt einfach auszublenden, wenn sie ihre Ruhe haben möchte. Wir proben in einer Musikschule in der Nähe. Wenn es nicht zu lange geht, sind Jaspers Kinder oft dabei.
Ich nehme den leicht ramponierten Seesack vom Gepäckträger meines Fahrrads, der meine gesamte Wäsche beinhaltet – abgesehen von den Klamotten, die ich an meinem Körper trage. Wenn ich Maya einmal pro Woche, wenn Jasper länger Klavierunterricht gibt, bei Phoenix abhole, darf ich die Waschmaschine benutzen. Ich könnte meine schmutzigen Klamotten mit Sicherheit auch hier waschen, würde ich Maya nicht abholen, aber so habe ich kein schlechtes Gewissen.
Ich kippe den Inhalt meines Seesacks und ein giftig aussehendes grünes Gel in die Maschine und schalte sie ein. Nach der Bandprobe werde ich Jasper und die Kinder zurückbegleiten und die Wäsche mitnehmen.
Wir haben noch zehn Minuten, und da ich weiß, dass Jasper nach einem Tag in der Musikschule inklusive Bandprobe fix und fertig ist, schnappe ich mir den überquellenden Wäschekorb und beginne in der engen Waschküche die sauberen Kleidungsstücke zusammenzulegen. Wenn man bedenkt, dass Jasper ganz allein für Westons und Mayas Erziehung verantwortlich ist, ist es umso beachtlicher, wie ordentlich und organisiert das Haus ist. Ich bewundere Jasper dafür, dass er das alles hinkriegt – die Musik, die Kinder, sich selbst. Er hat sich kein einziges Mal beschwert. Natürlich, anfangs war er traurig. Doch er war vor allem für die beiden da. Und ich für ihn. Nach und nach wuchsen sie wieder zu einer Familie zusammen, in der zwar ein fettes Loch klafft – eines, das einen regelrecht anschreit, wenn man weiß, wie es früher war –, aber eine Familie, die glücklich ist. Zumindest nach außen. Wie es in Jasper aussieht, weiß ich nicht, allerdings versuche ich, ihm der beste Schwager zu sein, der in mir steckt. Und der beste Onkel für die Kinder.
»Fünf Minuten«, rufe ich in Mayas Zimmer. Sie hat zwar noch kein Zeitgefühl, aber zumindest eine ungefähre Ahnung davon, dass fünf Minuten nicht allzu viel sind. »Nimmst du dein Malzeug mit?« Weston, der bereits in die zweite Klasse geht, hat meistens noch Hausaufgaben zu erledigen. Doch Maya muss sich selbst beschäftigen, damit sie sich nicht zu Tode langweilt.
Auf dem Klavier im Wohnzimmer liegen zwei Ohrenschützer, die ich in Mayas Rucksack stecke. Wenn die Kinder zur Bandprobe oder zu Gigs kommen, besteht Jasper darauf, dass sie sie aufsetzen. Daneben steht das Schwarz-Weiß-Foto von Blythe. Es ist das gleiche, das ich für die Trauerfeier ausgewählt habe, weil sich sonst keiner dazu imstande sah. Es stammt aus einer glücklichen Zeit. Sie blickt lächelnd über ihre Schulter in die Kamera und sieht wunderschön aus. Ihr dunkelblondes Haar weht im Wind, und Sonnenstrahlen streifen ihr Gesicht. Ich fahre mit dem Finger einmal über das Foto, um den Staub abzuwischen. Meine Schwester. Meine kluge, schöne Schwester.
Dieser ungeheure Schmerz, der einem die Luft zum Atmen nimmt und einem das Gefühl gibt, das Leben sei vorbei, nimmt zwar irgendwann ab – die Welt dreht sich weiter, und man lernt, aufs Neue zu lachen –, aber dennoch schnürt es mir jedes Mal die Kehle zu, ein Bild von ihr zu sehen. Ich lasse mich auf den Klavierhocker sinken und schlage mit der linken Hand einen Ton an. Er durchschneidet die Stille auf sanfte, heilsame Weise. Etwas, woran sich die Erinnerungen festhalten können. Deswegen spiele ich ihn wieder und wieder.
Jaspers Klavier muss dringend gestimmt werden. Das F, das durch den Raum hallt, hat einen seltsam verzerrten, beinahe metallischen Klang. Ich nehme mir fest vor, Geld für einen Klavierstimmer zusammenzukratzen. Auch wenn ich gerade nicht weiß, woher ich es nehmen soll. Doch es findet sich immer eine Lösung. Vielleicht bitte ich meine Eltern um Hilfe. Nicht, dass bei ihnen viel zu holen wäre, aber manchmal kann ich mir ein bisschen was leihen.
»Kommst du, Maya?«, rufe ich mit einem Blick auf die Wanduhr. »Wir müssen uns wirklich beeilen!« Ich verstehe gar nicht, wo die Zeit hin ist. Aber wie jede Woche sind wir auf einmal viel zu spät dran.
Beim zweiten Chorus haben wir unseren Sound wieder. Die ersten Takte waren ein bisschen steif, aber jetzt fliegen meine Finger über das Griffbrett der Gitarre, und meine Stimme ist auch wieder voll da. Ich orientiere mich an Jaspers Begleitung und spiele nur einzelne Akkorde dazu. Bonnies Kontrabass gibt einen schnalzenden Rhythmus vor, und Curtis’ Bewegungen am Schlagzeug sind eine faszinierende Mischung aus Dreschen und Streicheln.
»This is all that I want«, singe ich, und Bonnie stimmt mit ein. »All that I need. A little bit of melody, some groove and a beat.«
Es ist unser fetzigster Song, den wir uns meist bis zum Ende eines Abends aufheben.
Nach dem zweiten Chorus spielt Sal eins seiner berühmten Trompetensoli, und obwohl das hier nur eine Probe ist, reißt es uns alle mit. Jasper und ich begleiten ihn mit vereinzelten Akkorden, und Curtis streicht sanft über seine Becken. Selbst Weston und Maya blicken auf. Maya klatscht – auf zwei und vier, wie ich es ihr beigebracht habe. Die Melodien, die Sal spielt, sind so pointiert, so durchdacht und – ich kann es nicht anders sagen – rund. Wüsste ich nicht, dass er in diesem Moment improvisiert, ich könnte schwören, es ist vorkomponiert.
Wir sind alle leidenschaftliche Musiker. Berufsmusiker, die sich mit anderen Jobs über Wasser halten, wenn es sein muss. Sal ist jedoch mit Abstand der Beste von uns. Eigentlich hätte er es schon längst über die Frenchmen Street hinaus schaffen und mit berühmten Bands oder Orchestern durch die Welt touren müssen. Aber Sal ist immer noch hier. Und obwohl wir keine Ahnung haben, warum er mit uns spielt, sind wir doch froh, dass er Teil der Band ist.
Wir sind im absoluten Flow. Jeder von uns spielt sich in eine Art Trance, die in der musikalischen Kommunikation ihren Ausdruck findet. Wir sind laut, wir sind glücklich, wir sind richtig gut. Der Klang von New Orleans vermischt sich in unserem Spiel mit Singer/Songwriter-Einflüssen, Funk und Blues. Es ist unser Sound, der uns zusammengebracht hat und zusammenhält. Ein Band, das dicker ist als alles, was ich kenne, als alles, was ich je erlebt habe. Es ist ein erhabenes Gefühl – man kann es kaum anders beschreiben als den Ausdruck von allem, was uns ausmacht. Pompös und wild. Schmerzhaft und schön. Arm und doch so reich. Wir haben so gut wie nichts, und doch haben wir in diesem Moment alles.
Am Abend sitzen wir zusammen im Garten hinter Jaspers Haus. Als Blythe sich noch um die Pflanzen kümmerte, war dieser Ort eine richtige Oase. Blüten überall. Jetzt ist er ziemlich überwuchert. Selbst der alte Wohnwagen in der hinteren Ecke, der schon seit Blythes und Jaspers Einzug hier steht, und von dem niemand so recht weiß, wohin damit, ist bereits zur Hälfte von irgendwelchen Ranken verdeckt.
»Glaubt ihr, Sal ist genervt, dass wir ihn jedes Mal wieder fragen, ob er mitkommen will, obwohl völlig klar ist, dass er ablehnt?«, fragt Bonnie in die Runde.
Wir wissen so gut wie nichts über unseren Trompeter. Er ist bei jeder Probe und bei jedem Gig dabei, danach verschwindet er allerdings Gott weiß wohin.
»Möglich«, sagt Jasper und zuckt mit den Schultern. »Aber ich fände es, ehrlich gesagt, noch komischer, wenn wir ihn nicht mehr fragen würden.«
»Er kann ja auch einfach Bescheid sagen, wenn wir ihm auf die Nerven gehen.« Curtis ist meistens der Pragmatischste von uns allen. Nur manchmal brennt bei ihm etwas durch. Doch seit einiger Zeit ist es besser geworden. Ungefähr seit er angefangen hat, mit seiner Mitbewohnerin zu schlafen. Aber diese Beobachtung teile ich nicht mit ihm.
»Meint ihr, er hat eine Familie?«, fragt Bonnie weiter. Es ist nicht das erste Mal, dass wir über Sals Privatleben spekulieren.
»Vielleicht eine, die nichts über ihn weiß. Und jedes Mal, wenn er zu Hause gefragt wird, ob er mitessen will, grunzt er und verschwindet«, schlage ich vor, und alle lachen. »Apropos zu Hause …« Ich stehe auf und strecke mich. Mein Rücken knackt. Das kommt von der unbequemen Position, in der ich den Großteil des Tages verbracht habe. Mit meiner Gitarre auf dem Schoß auf dem Steinboden vor Saint Mary’s im French Quarter. Aber es hat sich gelohnt. Die Touristensaison läuft gerade wieder an, und heute waren die Passanten ziemlich spendabel. Die Monate der Entbehrung scheinen endgültig vorbei zu sein.
»Vergiss deine Sachen nicht«, sagt Jasper und nickt mir zu.
»Danke, dass ich die Waschmaschine benutzen durfte«, setze ich an, aber er winkt ab.
»Jederzeit, Mann, das weißt du doch.«
Ich bin froh, dass Jasper sich nicht fragt, warum ich keine eigene Waschmaschine habe. Warum kein Geld für den Waschsalon. Er darf nichts von meiner Wohnsituation erfahren. Und vor allem darf er nicht herausfinden, dass ich keine Alternative habe. Dass ich mir nicht einfach irgendwo ein Zimmer mieten kann, weil mir das Geld fehlt. Denn dann müsste ich erklären, wieso. Und das könnte ziemlich in die Hose gehen. Ich werfe Jasper noch einen letzten Blick zu und verschwinde nach drinnen.
3
Franzi
Das also ist ein Jetlag. Ich bin vollkommen fasziniert. Es ist halb fünf Uhr morgens, und ich liege hellwach im Bett. Durch die Fensterläden dringt nicht der vorsichtigste, zaghafteste Lichtschein. Dieser Tag ist noch so weit davon entfernt, einer zu werden, dass ich regelrecht orientierungslos bin. So fühlt es sich an. Wenn man mit dem Wohnwagen nach Italien fährt, weiß man vielleicht im ersten Moment nicht, wo man ist, wenn man am nächsten Tag davon aufwacht, dass man den Ellenbogen des kleinen Bruders im Gesicht hat. Aber man weiß immerhin, dass es Tag ist.
Ich wälze mich auf die Seite. Vielleicht kann ich noch ein bisschen dösen? Aber nein, natürlich nicht. Mein Körper glaubt mir nicht, dass noch Schlafenszeit ist. Und mein Kopf ist sich, ehrlich gesagt, auch nicht ganz sicher, ob die Tage in New Orleans nicht vielleicht einfach in der Finsternis beginnen.
Es hat keinen Zweck. Ich gebe auf. Dann wird es eben ein langsames Annähern an den Rhythmus hier. Im Dunkeln taste ich nach meiner Nachttischlampe und knipse sie an. So richtig habe ich mein Zimmer gestern durch den Nebel dieser erschlagenden Müdigkeit und der Nervosität gar nicht wahrgenommen. Nachdem Faye mir alles gezeigt hatte, bin ich einfach nur in mein duftendes Bett gefallen. Es drangen noch leise Stimmen von unten zu mir herauf. Kurz glaubte ich, Faye und Hugo würden sich streiten, aber das kann auch ein Traum gewesen sein. Denn daran, dass Hugos Unfreundlichkeit mich bis in meinen Schlaf verfolgt hat, erinnere ich mich. Es war ein wirrer Traum. Jedes Mal, bevor ich ihm etwas entgegensetzen konnte, ermahnte meine Mutter mich, zu zählen. Und das tat ich. Doch immer, wenn ich bei zehn angekommen war, hatte Hugo sich schon wieder eine neue Gemeinheit ausgedacht, auf die ich nicht reagieren konnte, weil ich erst zählen musste.
Mein Zimmer ist nicht sonderlich groß, aber gemütlich und stilvoll eingerichtet. Mobiliar und Deko sind in Weiß, Türkis und Gold gehalten. Ein weißer Ziertisch mit geschwungenen, goldenen Beinen steht unter einem goldgerahmten Spiegel. Von dem antiken Holzschreibtisch mit goldenen Beschlägen blickt man bei Tageslicht durch die Krone der Lebenseiche auf die von Bäumen gesäumte Straße. Davor steht ein passender Holzstuhl, der mit türkisfarbener Seide bezogen ist. Links neben dem Bett führt eine Tür in einen begehbaren Kleiderschrank. Doch gestern war ich nicht mehr in der Lage, alles auszupacken, sodass mein Gepäck nach wie vor am Fußende des Bettes steht. Es ist ein weißes Metallgestell, das über und über mit türkisfarbenen Zierkissen belegt war.
Da ich nun einmal wach bin, beschließe ich, meine Mutter anzurufen. Gestern hatte ich nur noch Kapazitäten für eine kurze WhatsApp-Nachricht, die ich auch an meine beste Freundin Lara geschickt habe. Und so angle ich nach meinem Handy und betätige die Videocall-Funktion.
»Franziska!«, schallt es mir leicht blechern entgegen. »Wie geht’s dir? Wie ist die Familie? Und das Haus?«
»Hi«, sage ich als Erstes. Dann, als ihr Gesicht weniger pixelig wird: »Eins nach dem anderen. Ich bin gerade erst aufgewacht.«
»Wie viel Uhr ist es bei dir?«, fragt sie gleich weiter.
»Viertel vor fünf«, sage ich.
Sie keucht leise und schlägt sich die Hand vor den Mund. »Arme Maus«, sagt sie. »Ich hoffe, du gewöhnst dich bald an die Zeitverschiebung. Die USA sind eben einfach das andere Ende der Welt.« Sie klingt nicht unfreundlich, während sie das sagt, allerdings meine ich doch einen leisen Vorwurf herauszuhören. Du hättest eben nicht ans andere Ende der Welt gehen sollen, will sie eigentlich sagen.
Ich erinnere mich an die vielen Diskussionen, die ich mit ihr hatte. An die vielen Stellenangebote, die sie mir ausdruckte und hinlegte. Aber ich wollte das hier. Weit weg. Etwas von der Welt sehen, ehe die Zukunft beginnt, für die ich so hart gearbeitet habe.
»Hast du denn den alten Mann schon kennengelernt, um den du dich kümmern sollst?«
»Ja«, sage ich. »Er wirkt sehr nett. Und gar nicht so alt. Also schon alt, aber immer noch sehr selbstständig.« Ich will ihr nicht erzählen, dass unsere erste Begegnung nicht gerade rosig verlaufen ist. Ihr Ich hab’s dir ja gesagt-Gesicht brauche ich nicht gleich an meinem ersten Tag. »Und genießt du den Rest der Osterferien?«, frage ich, bevor sie merkt, dass ich geflunkert habe.
»Die Klassenarbeiten türmen sich auf meinem Schreibtisch«, sagt sie und seufzt. »Und hier ist dein Bruder«, fügt sie dann hinzu und dreht ihr Handy so, dass ich sehen kann, wie ein sehr verschlafen aussehender Adrian in die Küche kommt.
»Kaffee?«, fragt er heiser.
»Ich mach dir schnell welchen«, sagt meine Mutter und drückt ihm das Handy in die Hand. Als könnte er das nicht selbst! Aber so ist es schon immer gewesen. Die Ansprüche werden nur an mich gestellt. Ich weiß, dass meine Mutter es gut meint, aber manchmal koche ich innerlich.
»Hi, Bruderherz«, begrüße ich ihn, und er streicht sich durch die wuscheligen Haare. Adrian ist achtzehn und hat letzten Mai sein Abitur gemacht – obwohl er es auf den letzten Metern beinahe noch vermasselt hätte. Für ihn stand fest, dass er sich nach all der harten Arbeit ein Jahr entspannen müsse, um herauszufinden, was er mit seinem Leben anfangen will. Er ist das komplette Gegenteil von mir. Während ich immer mein Bestes gegeben habe, um nicht aufzufallen und ja keinen Ärger zu kriegen, mich angestrengt habe, etwas aus mir zu machen, lebt er in den Tag hinein. In Momenten, in denen ich mich von der Vernunft leiten lasse, fragt er nicht um Erlaubnis, sondern geht einfach Risiken ein, ohne nachzudenken. Manchmal läuft es schief, und er fällt auf die Schnauze. Aber meistens hat er Glück. Ab und zu habe ich mich dabei ertappt, wie ich mir wünschte, mehr zu sein wie er. Doch im nächsten Augenblick hatte ich stets die Stimme meiner Mutter im Ohr, die mir erklärte, wie wichtig es für eine junge Frau sei, unabhängig zu sein. Wie schwer es für sie war, als unser Vater uns sitzen ließ. Ich bewundere sie dafür, dass sie innerhalb weniger Jahre ein Lehramtsstudium durchzog, weil es etwas Sicheres war. Und ich möchte auf keinen Fall je in die Situation kommen, auf einmal vor dem Nichts zu stehen. Also lasse ich Adrian Adrian sein und gebe mir Mühe, vernünftig zu sein.
Meine Mutter setzt Adrian einen Becher mit dampfendem Kaffee vor die Nase und nimmt ihm das Handy wieder ab. Sie streicht ihm durch die Haare, und er duckt sich weg.
»Wie sieht dein erster Tag aus?«, fragt meine Mutter und hält das Smartphone jetzt so, dass ich sie beide sehen kann.
»Ich weiß es noch nicht genau, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich mache mich mit allem vertraut, und dann werde ich Hugo fragen, was er braucht.«
»Machst du Sightseeing?«, will Adrian wissen.
»Sie ist doch zum Arbeiten da, Schatz«, sagt meine Mutter.
»Mal sehen, ob ich mich heute schon in die Innenstadt wage«, sage ich. Denn erstens stimmt es, ich bin zum Arbeiten hier, und zweitens brauche ich vielleicht einen Moment, um mich zurechtzufinden. Das Café, das Faye mir empfohlen hat, wäre vielleicht ein schöner Kompromiss.
»Ich würde keine Zeit verschwenden«, nuschelt Adrian und schlürft aus seiner Tasse. Das glaube ich ihm sofort.
»Deine Schwester macht das schon«, sagt meine Mutter. »Sie weiß eben, was von ihr erwartet wird. Bring sie nicht auf dumme Gedanken.«
»Einer muss es ja tun«, mault er zurück, und innerlich – ich weiß auch nicht – muss ich ihm irgendwie recht geben.
»Na ja, ich will mich eben erst mal akklimatisieren.«
Adrian nickt. »Ich gehe mich unter der Dusche akklimatisieren.« Er winkt und steht auf.
»Ich glaube, ich mache mich mal daran, meine Sachen auszupacken«, sage ich, als nur noch meine Mutter vor mir sitzt.
»Gute Idee«, sagt sie und schickt mir einen Luftkuss. »Hab dich lieb, Maus.«
»Ich dich auch, Mama.«
»Und meld dich bald wieder, ja?«
»Mach ich.«
»Soll ich heute irgendwas Bestimmtes erledigen?«, frage ich Faye, die sich gerade Kaffee in einen To-go-Becher füllt und eine trockene Scheibe Toast im Mund hat. Sie balanciert parallel auf einem Fuß, während sie mit der freien Hand versucht, ihren zweiten Pumps anzuziehen. Die Absätze sind schwindelerregend, und ich frage mich, wie sie es darauf den ganzen Tag aushalten will.
»Komm erst einmal an«, sagt sie, nachdem sie den Deckel ihres Bechers zugeschraubt und den Toast aus dem Mund genommen hat. »Heute Mittag erwartet dich irgendwann eine Lebensmittellieferung vom Supermarkt. Vielleicht kannst du Hugo schon ein bisschen aus der Reserve locken. Lass dich von ihm nicht irritieren. Er braucht Gesellschaft. Egal, was er sagt.«
Ich nicke. Sie hat sicher recht, auch wenn es mir davor graut, mit dem alten Mann allein zu sein.
»Du kannst dich im Haus gern umsehen. Nur unser Schlafzimmer ist tabu. Und Victors Büro.«
Victor. Ich habe ihn noch nicht getroffen. Er hat das Haus verlassen, während ich im Badezimmer war. Laut Faye ist er kein Morgenmensch. Er joggt jeden Tag in die Arbeit, um dann dort zu duschen. Vorher ist er anscheinend nicht ansprechbar.
»Wir würden gern heute Abend mit dir und Hugo essen. Victor wartet schon ungeduldig darauf, dich endlich kennenzulernen.«
Ich habe das Gefühl, als könnte das ein kleines bisschen geflunkert sein, denn Faye weicht meinem Blick auf einmal aus. Aber wahrscheinlich interpretiere ich zu viel hinein.
»Victor hat vorgeschlagen, etwas vom Thailänder mitzubringen. In der Nähe seines Büros gibt es diesen tollen Laden …«
»Klingt gut«, sage ich.
»Oh, und wir haben eine neue SIM-Karte in Victors altes Handy gelegt. Das kannst du benutzen, solange du hier bist.« Sie zeigt auf ein Smartphone auf der Anrichte.
»Danke«, sage ich und bin erleichtert, dass ich mich nicht selbst darum kümmern muss.
»Hab einen schönen Tag. Und wenn etwas ist, ruf mich an.« Mit diesen Worten stöckelt sie zur Tür, nimmt sich ihren Autoschlüssel aus der Schale auf der schmalen Kommode neben dem Eingang und verlässt das Haus.
Auf einmal ist es ohrenbetäubend still. Es ist eine seltsame Vorstellung, aber ich bin ganz allein in einem fremden Haus in einem fremden Land auf einem fremden Kontinent. Nicht ganz allein, fällt mir im nächsten Moment auf. Irgendwo lauert ein schlecht gelaunter alter Mann.
Ich räuspere mich. Es klingt merkwürdig in dieser makellosen großen Küche, die so wirkt, als würde sie nie benutzt werden. Sie ist sehr modern gehalten, abgesehen von einer Vitrine, in der wertvoll aussehendes Silberbesteck und kunstvoll bemalte Teller stehen. Ich glaube nicht, dass jemals davon gegessen wird. Das dominante Material in diesem Raum ist der schwarze Marmor der Arbeitsplatten und der Kücheninsel, an der ich sitze. Wie auch der Rest des Hauses trifft minimalistische, kühle Moderne auf verspielte Antiquitäten. Es ist ein sehr geschmackvoller Mix, und ich wünschte mir, ich hätte auch so einen ausgesuchten Schönheitssinn wie Faye.
Ich blicke in den Garten. Der Rasen erstrahlt in sattem Grün. Bestimmt wird er regelmäßig gesprengt. Neben geordneten Beeten mit blühenden Blumen am Fuß der gefliesten Terrasse befindet sich an der gegenüberliegenden Grundstücksgrenze direkt neben einem Schuppen ein etwas wilderer Teil, der aber halb von einem knorrigen Baum verdeckt wird.
Da ich nicht so richtig weiß, was ich mit mir anfangen soll, beschließe ich, zwei Scheiben Toast mit in mein Zimmer zu nehmen. Hier zu sitzen und zu warten, bis Hugo kommt, ist mir unangenehm. Ebenso seltsam fühlt es sich an, durch das leere Haus zu wandern. Ich habe noch genug Gelegenheit dazu, alles kennenzulernen. Adrian hätte mit Sicherheit bereits jeden Raum erkundet. Er wäre bestimmt um halb fünf schon durchs ganze Haus geschlichen. Wobei er nicht einmal schleicht. Er geht. Selbstbewusst und laut. Ich hingegen schleiche selbst jetzt bei Tageslicht die Treppe hinauf in mein Zimmer.
Laute Musik lässt mich auf einmal aufschrecken. Habe ich geschlafen? Wie kann das sein? Ich blicke auf mein Handy. Es ist später Nachmittag. Dabei wollte ich mir doch nur einen Film auf meinem Laptop ansehen. Und dann – meine Augen ein bisschen ausruhen. Irgendwann muss ich wohl eingeschlafen sein. Dass der Jetlag meine Nächte verkürzt, okay. Aber jetzt auch noch meine Tage? Ich rapple mich schnell auf. Ich habe Hugo allein gelassen. Dabei braucht er doch Gesellschaft. Ich blicke in den Spiegel. Mein sonst so ordentlicher Haarknoten ist einigermaßen zerzaust, also löse ich die Strähnen und bürste mir die langen, glatten Haare. Ich sehe ein wenig ängstlich aus, fällt mir auf. So wie ich immer aussehe, wenn ich unsicher und gehemmt bin. Ich mag dieses Gesicht nicht. Und doch spiegelt es genau das Bild wider, das ich von mir selbst habe.
Mit geschickten Fingern habe ich meinen Dutt schnell wieder in Ordnung gebracht. Dabei achte ich darauf, dass meine Haare meine Ohren verstecken, die für meinen Geschmack viel zu sehr von meinem Kopf abstehen.
Ich öffne vorsichtig meine Zimmertür. Die Musik dringt augenblicklich noch lauter zu mir herauf. Bläser, Klavier. Ich habe noch nie etwas Vergleichbares gehört. Ein schneller Rhythmus, eine scheppernde, tiefe Stimme, vorsichtiges Schlagzeug. Die Melodie ist fröhlich, und gleichzeitig klingt sie seltsam wehmütig.
Ich laufe auf Zehenspitzen die Treppe hinunter, was vollkommen albern ist, denn bei dem Höllenlärm kann ohnehin niemand meine Schritte hören. Der Musik folgend, gehe ich ins Wohnzimmer, das auf der einen Seite von einer riesigen, beinahe einschüchternden Bücherwand eingenommen wird und auf der anderen Seite ganz im Einklang mit dem Rest des Hauses eine schicke Sitzecke beherbergt. Die Flügeltüren zur Terrasse stehen sperrangelweit offen, und ein Kabel führt von einer Steckdose neben einem alten Sekretär nach draußen. Zögerlich nähere ich mich der Terrasse. Und dort – ich traue meinen Augen kaum – steht ein Plattenspieler auf einem kleinen Tisch. Er ist die Quelle des Lärms, und ich bin kurz unschlüssig, was ich tun soll. Einerseits will ich Hugo nicht verärgern, der offensichtlich schwerhörig ist, so laut, wie er die Musik aufgedreht hat. Andererseits möchte ich nicht, dass die Nachbarn die Polizei rufen oder sich bei Faye und Victor beschweren. Langsam dämmert mir, warum sie mich brauchen. Entschlossen trete ich nach draußen und drehe die Musik leiser.
»Was zur Hölle?«, ruft es aus der hintersten Ecke des Gartens, und mir schießt Hitze ins Gesicht. Im nächsten Moment taucht Hugo hinter einem knorrigen Baum auf. Er hat wieder seinen Strohhut auf und trägt eine sehr altherrenhafte kurze Hose. Obenrum ist er nackt. »Was soll das?« Er kommt auf mich zu.
»Entschuldige«, sage ich. »Aber ich glaube, das war zu laut.«
»Zu laut?« Er hat schon fast den gesamten Garten durchquert. »Zu laut, glaubst du?«
»Ähm, ja. Die Nachbarn fühlen sich bestimmt gestört.«
Er lacht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es ein fröhliches Lachen ist. Ich lächle ihm zu, denn ich kann nicht riskieren, dass er denkt, ich wäre nicht auf seiner Seite. Doch es gibt einfach ein paar gesellschaftliche Regeln, an die man sich halten sollte, wenn man keinen Ärger kriegen will.
»Scheiß auf die Nachbarn«, sagt Hugo, der nun die Stufen zur Terrasse hochkommt und die Lautstärke wieder voll aufdreht. Dann wendet er sich um und tänzelt trotz seines schlimmen Beins die Stufen wieder hinunter.
Sein Benehmen ist absolut unvernünftig, und kurzerhand drehe ich die Musik wieder leiser. Sofort wirbelt er herum. Er blickt mich direkt an, und seine Augen funkeln vor Wut.
»Vorsicht«, sagt er, kommt zurück und dreht die Musik erneut auf.
»Aber …«, setze ich an und will die Lautstärke schon wieder runterdrehen. Doch Hugo hebt den Finger, was mich in meiner Bewegung innehalten lässt.
»Das ist verdammt noch mal Jelly Roll Morton«, ruft er mir über den Krach hinweg zu. »Und du bist verdammt noch mal in New Orleans.«
4
Lincoln
Um mich herum hat sich ein Pulk aus Touristen gebildet. Ich spiele eine Akustik-Version von Britney Spears’ Toxic und nicke dankend, sobald sich jemand aus der Menge löst und mir etwas in meinen Gitarrenkasten wirft. Coverversionen von Popsongs funktionieren am allerbesten, und so habe ich den Großteil des Tages damit verbracht, bekannte Songs auf meine Weise zu interpretieren. Ich würde lieber meine eigenen Sachen spielen, aber niemand bleibt für ein Lied stehen, das er nicht kennt. Nicht im Urlaub. Nicht, wenn man darauf aus ist, Videos an Freunde und Verwandte zu schicken, um ihnen zu zeigen, was sie verpassen. Oder, wenn ich Glück habe, Videos auf einem Travelblog hochzuladen. Zwei Mädchen, die seit ein paar Minuten in der ersten Reihe stehen, beginnen zu tanzen. Erst zaghaft, dann selbstbewusster. Ihre Freunde klatschen begeistert. Davon angestachelt treten sie in die Mitte des Kreises und reiben ihre Körper auf beinahe pornografische Weise aneinander. Es sieht echt scharf aus, aber ich versuche mich davon nicht ablenken zu lassen.
Als ich den Song beende, klatschen sie begeistert, und ich nuschle ein tiefes, inzwischen heiseres »Dankeschön« in mein Mikro. Eigentlich wollte ich nach Toxic zusammenpacken, mir in der Newsbar um die Ecke ein Glas Wasser holen und mich dann nach Hause begeben, um mich noch mal frisch zu machen, bevor wir heute Abend einen Gig im Cat’s Cradle haben. Aber eine so große Menschenmenge muss ich ausnutzen.
Ich räuspere mich und sage: »Dieser Song ist für die Ladys.«
Die Menge johlt. Ich streiche mir durch die Haare, hebe den Blick und lächle verschmitzt. Dann spiele ich die ersten Takte von Perfect, und mein Publikum rastet gänzlich aus. Erneut sehe ich nach oben. Dieser Blickkontakt, das Flirten, ehe ich anfange zu singen, sichert mir nach dem Song noch mal ein paar zusätzliche Dollars. Es ist wie Theaterspielen. Dies ist meine Rolle. Der verwegene Straßenmusiker mit der rauen Stimme. Und für einen kurzen Moment gestatte ich meinen Zuhörerinnen, sich ihrer Fantasie hinzugeben. Der Fantasie, mich und meine verlorene Seele zu retten. Manchmal, wenn ich Zeit habe, lasse ich mich eine Nacht lang retten. Dann ziehe ich mit einer Gruppe junger Frauen durch die Bars und genieße später den Luxus eines Hotelzimmers und die körperliche Nähe zu einer Fremden.
Nach zwei weiteren Songs merke ich, dass meine Stimme langsam schlappmacht. Der Gig heute Abend ist wichtig, und ich verkünde, dass ich nun zu meiner letzten Nummer kommen muss. Ich wähle Mr. Brightside und fordere alle auf, mitzusingen. Dies ist meine eigene kleine Bühne. Mein Madison Square Garden, meine Carnegie Hall. Die Straßen von New Orleans sind die Show, und die warme Steinstufe, auf der ich sitze, mein Stage-Dive. Es ist alles, was ich immer wollte, und noch viel mehr. Ich fantasiere nicht darüber, gerettet zu werden.
Endlich spiele ich den letzten Akkord und bedanke mich überschwänglich bei meinem Publikum. Jeder, der noch einen Schein in meinen Gitarrenkasten legt, bekommt ein persönliches Dankeschön. Jeder (und jedem), die eine Handynummer dazuflattern lässt, zwinkere ich zu und lasse sie einmal mehr von ihrem romantischen New-Orleans-Abenteuer träumen. Mache ich ihnen falsche Hoffnungen? Täusche ich sie? Nein. Denn wir wissen alle, dass das hier ein Spiel ist. Ein Geben und Nehmen. Ich gebe ihnen meine Stadt, meine Musik und einen Funken Sex, an den sie sich zurückerinnern können. Und ich bin nicht der Einzige. Denn jetzt, wo es wieder richtig warm ist, sind all die Leute auf der Straße zurück, die hier ihr Geld verdienen. Wenn sie nicht gerade Straßenmusik machen, malen sie verzerrte Karikaturen von Touristen, schreiben innerhalb einer Minute für einen Dollar einen Mehrzeiler oder legen Tarotkarten. Eine gespaltene Stadt, denke ich. Da gibt es diejenigen, die in ihr und von ihr leben, und dann die anderen. Die das Geld mitbringen. Geld, das mich, aber auch Jasper, Weston und Maya ernährt. Bonnie, Curtis und Sal.
»Und wenn ihr heute Abend noch nichts vorhabt«, rufe ich, während ich die Geldscheine in meine Hosentasche stopfe, »ich spiele mit meiner Band ab halb zehn im Cat’s Cradle in der Frenchmen Street.«
Kurze Zeit später hat sich die Menge verlaufen, und ich betrete die Newsbar, ein etwas schickeres Diner am Jackson Square. Ich habe Glück, denn Esmé steht hinter dem Tresen und poliert Gläser.
»Ich dachte schon, du kommst heute nicht«, sagt sie und lächelt mich an. Ihre dunklen Locken fallen ihr über die Schultern und rahmen das schmale Gesicht mit der eleganten Nase und den sexy Lippen ein.
»Kriege ich ein Glas Wasser? Am besten lauwarm?« Irgendwie muss ich es schaffen, meine Stimme wieder so weit hinzukriegen, dass ich heute Abend zwei Sets durchstehe.
»Du kriegst alles von mir«, erwidert sie.
Hinter der Bar ist die Wand verspiegelt, und ich betrachte mich darin. Meine Haare sind strähnig, und ich bin verschwitzt. Aber langsam kehrt die Bräune, die ich über den Winter verloren habe, wieder in mein Gesicht und auf meine Arme zurück.
Esmé dreht den Hahn auf. Als das Wasser die richtige Temperatur hat, hält sie ein Glas drunter und reicht es mir.
»Nimmst du mich heute Abend mit zu dir?«, fragt sie und zwinkert mir aufreizend zu.
Ich schüttle den Kopf. Wir haben schon so oft darüber gesprochen. Niemals würde ich Esmé mit zu mir nach Hause nehmen. Nicht, dass ich mich schämen würde, aber ich will keine Komplikationen. Ich habe keine Lust auf ihre Fragen. Auf Mitleid oder Unverständnis. Auf Lösungsvorschläge und gut gemeinten Quatsch wie »Du hast etwas Besseres verdient« oder »Zieh zu mir, bis du etwas Adäquates gefunden hast«. Ich kenne Esmé gut genug, um zu wissen, dass sie Dinge nicht einfach so hinnimmt. Auch sie würde mich am liebsten retten. Aber selbst wenn ich darauf Lust hätte, Esmé bedeutet Ärger.
»Du könntest auch zu mir kommen …« Sie lehnt sich über den Tresen und fährt mir mit ihrem Zeigefinger langsam über die Lippen und dann tiefer, meinen Hals und die Brust hinunter.
Sanft nehme ich ihre Hand und lege sie auf die Bar. Ich bin zu verschwitzt, um in Flirtlaune zu sein. »Heute geht es wirklich nicht«, entgegne ich. »Nimm’s mir nicht übel, aber ich brauche etwas mehr Schlaf, als du mir gestattest.«
Sie kichert und zuckt mit den Schultern. »Du überlegst es dir ohnehin noch mal anders.« Sie dreht mir den Rücken zu und geht lasziv in die Hocke, sodass ihr ohnehin schon kurzer Rock noch weiter nach oben rutscht.
Ihre Gewissheit, ich könne ihren Reizen nicht widerstehen, nervt mich ein bisschen. In Momenten wie diesen erinnere ich mich daran, warum man sich von Esmé fernhalten sollte. Warum Bonnie und all die anderen von unserer Liaison nicht gerade begeistert sind.
»Sei kein Spielverderber.« Esmé wendet sich wieder mir zu, schiebt die Unterlippe vor und klimpert mich mit ihren langen Wimpern an.
Ich mag es nicht, gedrängt zu werden. In letzter Zeit ist das immer häufiger der Fall. Sie setzt mich unter Druck, ist beleidigt, fordernd. Sie tut so, als könne sie frei über mich verfügen. Als wäre ich ihr Lustknabe, der sofort springt, wenn sie mit dem Finger schnippt. Dabei war von Anfang an klar, dass das zwischen uns nichts Ernstes ist. Nur für den Moment. Da es mir immer weniger Spaß macht, ist es vielleicht an der Zeit, es zu beenden. Aber nicht jetzt. Jetzt muss ich nach Hause, duschen und mich ein wenig ausruhen für die nächste Runde.
Zurzeit wohne ich am Rand der Central City in einer Gegend, die gerade von der Post-Katrina-Gentrifizierung entdeckt wird. Sie ist zu weit weg vom French Quarter, sodass sie lange Zeit nicht wirklich interessant war. Zu viele Lagerhallen, zu viele abgewrackte Bürogebäude. Doch in den letzten Monaten haben zwei hippe Cafés und ein Restaurant, das sich als Fujun (eine Mischung aus Cajun und Fusion) beschreibt, in Laufdistanz eröffnet, sodass es höchstens noch eine Frage von Monaten ist, bis auch dieser Teil der Stadt von Investoren aufgekauft und saniert wird. Solange genieße ich die zentrale Lage und meinen Lieblingsplatz am Ufer des Mississippi, der nur wenige Minuten von meinem Zuhause entfernt ist. Die warmen Steine, das leichte Plätschern des Wassers, die Schreie der Möwen, während ich meine Schwester besuche. Ein paar Meilen weiter unten haben wir nach ihrem Tod die Asche am Fluss verstreut. Ganz legal war es nicht, aber Blythe konnte man nie etwas abschlagen. Erst recht nicht ihren letzten Wunsch.
Oft komme ich erst in den frühen Morgenstunden nach Hause, wenn sich majestätisch die Sonne über dem gigantischen graubraunen Fluss erhebt. Das sind die Momente, in denen ich mich glücklich fühle. Stark. So stark, dass ich Schmerz zulassen kann, ohne daran zu zerbrechen. Die Momente, in denen ich mit Blythe spreche. Ihr erzähle, wie es Jasper und den Kindern geht. Manchmal denke ich, sie könnte die Sonne sein. Aber dann fällt mir auf, dass die auch vor dem Tod meiner Schwester jeden Morgen aufgegangen ist. Obwohl ich mir sicher bin, dass sie früher anders aussah.
Mein derzeitiges Zuhause ist spartanisch, aber mehr brauche ich nicht. Ich bin ohnehin meistens unterwegs und komme vor allem zum Schlafen hierher. Es ist zwar nicht unbedingt wohnlich, aber – gemessen an den Umständen – fühle ich mich hier so wohl wie sonst eigentlich nur bei Bonnie. Selbst bei meinen Eltern ist es, seitdem Blythe nicht mehr da ist, fremder geworden. Das ist nicht ihre Schuld, doch überall dort, wo sich Gedanken an die Vergangenheit unweigerlich anschleichen, um einen irgendwann von hinten anzuspringen, muss man mit Gefühlen vorsichtig sein. Und sei es nur das Gefühl von Zuhause. Ich schnappe mir saubere Boxershorts aus meinem Wäschesack und gehe duschen.
Das Wasser ist kalt, und ich keuche, als es auf meinen Körper trifft. Aber es ist erfrischend und belebend. Als würde die Müdigkeit des gesamten Tages von mir abgespült. Als wäre sie gar nicht in mir gewesen, sondern hätte nur außen an mir gehaftet.
Mit den frischen Klamotten fühle ich mich wie neu geboren, und beinahe bereue ich, dass ich Esmé vorhin habe abblitzen lassen. Gleichzeitig weiß ich, dass ich gut daran täte, nach dem Gig einfach ins Bett zu gehen. Und genau das wird passieren. Außerdem ist es mir doch ein großes Anliegen, dass sie mit ihrer Annahme über mich nicht recht behält. Meine Unabhängigkeit geht vor. Und wenn ich Esmé zurückweisen muss, um mir selbst zu beweisen, dass ich mich nicht erneut verletzlich mache, dann ist das ein notwendiges Übel, das ich gerne in Kauf nehme. Bonnie wäre stolz auf mich. Vielleicht sollte ich ihr nachher im Cat’s Cradle davon erzählen. Nicht nur, weil sie alles andere als Esmés größter Fan ist. Sie ist meine beste Freundin und war – neben der Musik – auch diejenige, die mich vor einem Jahr aus meinem Loch geholt hat. Mit guten Ratschlägen, mit schmerzhaften Wahrheiten, mit einem gepfefferten Arschtritt. Ich habe ihr zugehört. Jedes einzelne Wort, das sie an mich gerichtet hat, habe ich aufgesogen, auch wenn es manchmal nicht so schien. Einmal fühlte ich mich derart hilflos, dass ich ihr etwas an den Kopf warf, das ich mir bis heute nicht verziehen habe. Wir haben nie darüber gesprochen, und vielleicht hat sie es ja wieder vergessen. Hoffentlich.
5
Franzi
Als ich auf mein Handy blicke, erschrecke ich. Die Lebensmittellieferung! Ich habe die Klingel anscheinend nicht gehört und sie verpasst. Nicht nur war dieser Tag ein absoluter Reinfall in Bezug auf mein zukünftiges Verhältnis zu Hugo. Ich habe außerdem Faye hängen lassen. Dabei bin ich doch eigentlich die Vernünftige. Die Verlässliche. Und trotzdem habe ich das Gefühl, als würde alles falsch laufen. Mein großes Abenteuer droht schon am ersten Tag vollkommen nach hinten loszugehen. Und da ist sie wieder, die Sehnsucht nach einem höhenverstellbaren Schreibtisch und einer kleinen Grünpflanze. Vielleicht bin ich einfach keine Abenteurerin. Vielleicht sollte ich den spaßigen Teil des Lebens Adrian überlassen. Adrian. Ich vermisse ihn. Nicht, dass wir ein besonders enges Verhältnis hätten. Aber ein bekanntes Gesicht – und selbst wenn es nur spöttisch schaut – wäre schön. Meine Mutter. Ich reibe mit den Handballen über meine Augen, um die Tränen, die sich dahinter anstauen, am Herausfließen zu hindern. Es sind Tränen der Erschöpfung, Tränen der Wut. Wer lässt ein fremdes Mädchen um die halbe Welt fliegen und ist dann so unverschämt wie Hugo? Meine Stimmung kippt langsam, und ich habe gute Lust, einfach ihn für diesen Reinfall verantwortlich zu machen. Wäre er nicht so ein Griesgram, hätte ich mich gar nicht erst in meinem Zimmer verschanzt.
Ich atme einmal tief ein. Nein, so schnell gebe ich mich nicht geschlagen. Reiß dich zusammen, Franzi. Nach einem Tag kann man noch gar nicht sagen, ob das alles hier eine absolute Schnapsidee war. Bis zehn zu zählen bringt in diesem Fall nichts, aber ich könnte zehn Tage abzählen. Und dann meine Situation noch mal neu bewerten. Ja, das ist eine vernünftige Idee.
»Eins«, sage ich laut zu meinem Zimmer, stehe auf und gehe nach unten. Vielleicht gibt es in der Gegend einen Supermarkt, in dem ich die wichtigsten Lebensmittel einkaufen kann. Ich werde Hugo fragen, was er braucht. Ein Friedensangebot gewissermaßen. Und später werde ich Faye alles erklären. Sie wird es verstehen.
Als ich unten gerade ins Wohnzimmer abbiegen will, um draußen nach Hugo zu suchen, fällt mein Blick in die Küche. Auf der Kücheninsel steht eine Schale mit frischem Obst, die heute Morgen ziemlich sicher noch nicht dort war. Zögerlich trete ich über die Schwelle. Mein nackter Fuß berührt die schwarz-weißen Kacheln, die kühl sind und glatt und irgendwie beruhigend. Auf der Anrichte zu meiner Rechten stehen sauber aufgereiht eine Packung Reis, eine Packung Nudeln, abgepacktes Toastbrot und verschiedene Frühstücksflocken. In einem Hängeregal entdecke ich frisches Gemüse. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Habe ich die Lieferung schlafwandelnd entgegengenommen? Ich öffne die Kühlschranktür, und mir entfährt ein überraschter Schrei. Ein sehr leiser Schrei allerdings, denn ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Aber der Kühlschrank ist vollgestopft mit Lebensmitteln! Milch, Säfte und Wein stehen in der Tür. Verschiedene Käse und Schinken, Butter, Marmelade. Erdbeeren, eine seltsame Plastikflasche, die sich bei näherer Betrachtung als Pancake-Mischung herausstellt. Das kann ich nicht gewesen sein. Hat Hugo etwa …?
In diesem Moment wird die Eingangstür aufgeschlossen.
»Ich bin zu Hause«, ruft Faye. Ihre Stimme ist unverkennbar. Hoch und mädchenhaft, auf entzückende Art. »Hi, Franziska.«