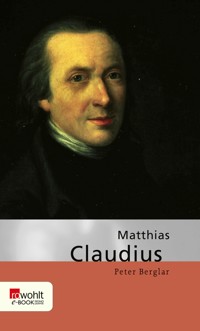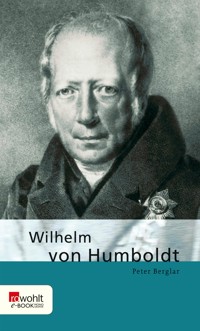9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Maria Theresia - Die Königin und Kaiserin, die eine Epoche prägte Maria Theresia (1717–1780) war eine der einflussreichsten Herrscherinnen ihrer Zeit. Als Königin und Kaiserin regierte sie vier Jahrzehnte lang das Habsburgerreich und führte es zu einer letzten Blütezeit. In dieser fesselnden Biografie zeichnet Peter Berglar das Leben dieser außergewöhnlichen Frau nach, die als "allgemeine und erste Mutter" ihres Landes in die Geschichtsbücher einging. Berglar beleuchtet nicht nur Maria Theresias politische Errungenschaften, sondern gibt auch Einblicke in ihr Privatleben und ihre Persönlichkeit. Er schildert ihre Rolle als Mutter von 16 Kindern, darunter die berühmte Marie Antoinette, und ihre Beziehung zu ihrem Ehemann Franz I. Stephan. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des 18. Jahrhunderts und erleben Sie hautnah mit, wie Maria Theresia das Habsburgerreich durch Reformen und geschickte Diplomatie während Krisen wie dem Siebenjährigen Krieg lenkte. Dieses E-Book ist ein Muss für alle, die sich für die Geschichte Österreichs und eine der bemerkenswertesten Herrscherinnen Europas interessieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Peter Berglar
Maria Theresia
Über dieses Buch
Maria Theresia (1717–1780) hat als Königin und Kaiserin eine Epoche geprägt. Sie regierte vier Jahrzehnte und brachte das Habsburgerreich noch einmal zum Erblühen. Am Ende ging sie als «allgemeine und erste Mutter» ihres Landes in die Geschichtsbücher ein.
Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Impressum
rowohlts monographien
begründet von Kurt Kusenberg
herausgegeben von Uwe Naumann
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Mai 2017
Copyright © 1980 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten
Redaktionsassistenz Katrin Finkemeier
Umschlaggestaltung any.way, Hamburg
Umschlagabbildung akg-images (Maria Theresia. Zeitgenössischer Kupferstich von Philipp Andreas Kilian nach einem um 1745 entstandenen Porträt von Martin van Meytens d.J.)
ISBN 978-3-644-40092-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Habsburgs Erbtochter
Sie brachte den fast verdorrten, in den dynastischen Überlegungen der europäischen Höfe und Kabinette kaum mehr zählenden Habsburgerstamm nochmals zu üppigem Erblühen und gelangte zu vierzigjähriger Herrschaft auf einen Thron, der, als sie am 13. Mai 1717 geboren worden war, keineswegs schon für sie bestimmt gewesen schien. Maria Theresia war der Glücksfall des Hauses Habsburg, die Überraschung Europas und die liebenswerte Verkörperung Österreichs. Das ist keine subjektive Behauptung, persönlicher Sympathie entspringend, sondern eine erwiesene Tatsache. Ergebnis der Geschichtsforschung, erklärbar und verstehbar.[1]
Wenn man das Wort «Habsburg» ausspricht, dann schwingen darin sieben Jahrhunderte deutscher und europäischer Geschichte mit. Aber nicht nur in einem allgemeinen Sinne, sondern mit sehr ausgeprägten Akzenten: Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das spanische Weltreich und die österreichisch-ungarische Donaumonarchie stehen vor unseren Augen; die Eroberung und Christianisierung Amerikas, die Glaubenskämpfe, die Türkenkriege, Katholizismus, Barock und Aufklärung und Nationalitätenprobleme, eine schwer beschreibbare Tradition von hausbackener Weltweite, von Trachtencharme auf internationaler Bühne, von zäher Lebenskraft in Nonchalance-Attitüde, von «Fünf-gerade-sein-Lassen» im unbeirrbaren Wissen, dass zweimal zwei vier bleibt, von Gamsjagd und Kaiserschmarrn und Walzer – ja, überhaupt von Musik, Musik der Töne, Formen, Farben. Habsburg: Das ist ein riesiger bilderreicher Gobelin unserer Historie, auf dem die Vorfahren Maria Theresias zu erkennen sind, manche schon sehr fern und verblichen, andere, wie etwa Karl V. und Philipp II., in deren Reichen «die Sonne nicht unterging», klar und scharf konturiert, oder, wie der versponnene Rudolf II. in seiner Prager Burg und die beiden Ferdinande des Dreißigjährigen Krieges, Stiefkinder der Geschichtswissenschaft, und aus dem auch die «mütterliche Majestät», wie der englische Historiker Edward Crankshaw sie genannt hat, uns entgegentritt.[2]
In den Anfängen des begabten, ehrgeizigen und fruchtbaren Adelsgeschlechts, das über Lehens-, Dienst-, Treueverhältnisse zu Stärkeren eine mittlere Machtposition erreichte, von der aus «der Sprung nach oben» gelang, lagen noch keine Besonderheiten. Diese erste Wegstrecke teilten die Habsburger mit fast allen Dynastien Europas. Doch unterschieden sie sich von den meisten durch eine Art von gemeinsamer Sippenbegabung, einer Kombination von Erwerbs- und Machtsinn, Vitalität und Glück, die man, auch wenn das etwas altmodisch klingt, als geschichtliche Berufung bezeichnen muss. Mit der Wahl des aus dem Aargau stammenden Grafen Rudolf von Habsburg zum deutschen König, 1273, begann ein Aufstieg, der trotz schwerer Rückschläge im 14. und 15. Jahrhundert schließlich aus der alemannischen Adelsfamilie das «Erhabene Erzhaus» werden ließ, eine Dynastie, die, gestützt auf ihre österreichisch-alpinen Erblande, von 1438 bis 1806 (mit einer Unterbrechung von drei Jahren [1742–45]), die deutsche Königs- und römische Kaiserkrone, von 1516 bis 1700 die Krone Spaniens, eines weltumspannenden Imperiums, von 1526 bis 1918 die Wenzelskrone Böhmens und die Stephanskrone Ungarns und von 1804 bis 1918 die Krone des Erbkaisertums Österreich trug.
Auch wenn man nur die österreichische Linie des Hauses ins Auge fasst, bleibt genug Imponierendes, ja Einmaliges. Die deutschen Habsburger haben keinen Nationalstaat geformt wie die Valois und Bourbon in Frankreich, die Romanows in Russland. Sie waren nicht wie die englischen Tudors oder die schottischen Stuarts und die niederländischen Oranier typische Inkarnationen ihrer Völker, und sie schweißten auch nicht verschiedenartige Territorien zum Einheitsstaat zusammen wie die Hohenzollern ihr Preußen. Sie vollbrachten weniger und zugleich mehr: durch Eheschließungen, Erbfälle, Verträge – seltener durch Kriege, die indes auch nicht fehlten – erwarben sie sich eine Ansammlung von Ländern und Kronen, die nicht durch Sprache, durch Volks- oder Geistesgemeinsamkeit zu einem «Reich» wurden, sondern einzig und allein durch die gemeinsame Dynastie. Den Kern bildeten die Alpen-Herzogtümer Österreich und Steiermark, in denen Habsburg seit dem Sieg König Rudolfs über Ottokar von Böhmen (1278 auf dem Marchfeld) unangefochten herrschte, und um den sich dann im Laufe der Jahrhunderte die Landesherrschaften und Königreiche gleichsam «anlagerten», um zu dem zu werden, was wir «das Habsburger Reich» nennen.
Obwohl es wiederholt zu «Bruderzwisten im Hause Habsburg»[3] und zu mannigfachen Linien-Verzweigungen kam, erwies sich das dynastische Zusammengehörigkeitsgefühl als außerordentlich stark. Die Familien-Kontinuität blieb stets gewahrt: und nicht nur in einer gewissen (angesichts der «gesamteuropäischen» Blutsmischung erstaunlichen) Gemeinsamkeit des Gesichtsschnitts, des Typus und des ganzen Persönlichkeitshabitus, sondern auch in politischer Hinsicht. Trotz Spannungen und Rivalitäten zwischen der deutschen und der spanischen Linie – diese Scheidung beruhte auf dem 1522 von Karl V. mit seinem Bruder Ferdinand geschlossenen Teilungsvertrag – gab es bis zum Erlöschen der Letzteren im Jahre 1700 so etwas wie eine «Achse Wien–Madrid»: zahlreiche inzucht-fördernde Heiraten, wechselseitiges Nachfolgerecht im Falle des Aussterbens eines der Zweige, kulturellen Austausch zumindest an den Höfen, niemals abreißende gegenseitige Konsultationen und, zeitweise, handfestes politisches und sogar militärisches Zusammengehen.
Der Ausgang des Spanischen Erbfolgekriegs (1700–13/14) setzte alldem ein Ende. Es gelang den österreichischen Habsburgern nicht, das iberische Erbe anzutreten. Als 1711 Kaiser Joseph I. nach nur sechsjähriger Regierung plötzlich starb und damit sein jüngerer Bruder Karl, der schon als «Karl III.» Aragon und Katalonien beherrscht, in Madrid gesessen und seinen bourbonischen Rivalen, Ludwigs XIV. Enkel Philipp V., fast besiegt hatte, alle Kronen und Länder der deutschen Linie erbte, dazu noch zum Römischen Kaiser gewählt wurde, schien die Universal-Konstellation Karls V. im Jahre 1519 wiedergekehrt zu sein. Die aber wünschte niemand in Europa, auch nicht Habsburgs Bundesgenossen. Der Bourbone auf dem spanischen Thron war jetzt die kleinere Gefahr, zumal die Vereinigung der französischen und der spanischen Krone für alle Zeiten ausgeschlossen bleiben sollte. Maria Theresias künftiger Vater kehrte also in sein Wien zurück, wo er als Kaiser Karl VI. bis 1740 regierte. Wenn auch das Kriegsziel nicht erreicht worden war, so fielen diesem letzten männlichen Habsburger im Friedensvertrag von Utrecht doch recht ansehnliche Gewinne zu: die sogenannten «spanischen Nebenländer» Neapel-Sizilien, Sardinien, Mailand und die spanischen Niederlande, das heutige Belgien. Manches davon verlor er sehr bald wieder: Sardinien 1720, Neapel-Sizilien 1735. Einiges aber kam auch hinzu, so das Großherzogtum Toskana mit Florenz (1737), das später eine wichtige Bedeutung für Wien erlangen sollte.
Karl VI. hinterließ seiner ältesten Tochter ein Reich, das zwar an «Masse», das heißt an Ausdehnung und an Potenzial, sehr beträchtlich, aber an innerer Kraft, wirtschaftlich und administrativ und militärisch, ziemlich heruntergekommen war; sein internationales Ansehen war gesunken, sein politisches Gewicht als Großmacht in Europa geschrumpft. In ihrem «politischen Testament»[4] von 1750/51, in dem Maria Theresia auf das erste Jahrzehnt ihrer Regierungszeit zurückblickt, das ein einziger Kampf um das Überleben des Habsburgerreichs gewesen war, beklagt sie neben vielem anderen das unter ihren Vorgängern mehr und mehr außer Kontrolle geratene Finanzgebaren und den Verfall der landesherrlichen Autorität: Hierbei werde was weniges von meinen Vorfahren melden. Diese haben aus großer Pietät viel und zwar die meisten Cameralgüter, (Güter der Krone), und Einkommen verschenket, welches zu selber Zeit zu Unterstützung der Religion und zu Aufnehmung der Geistlichkeit wohl hat geschehen können. Aber die Milde, Gnade und österreichische Munifizenz[5] hielt auch an, als die besonderen Umstände des Zeitalters der Konfessionskriege vorüber und eigentlich weder wirkliche Gründe noch genügender Reichtum für solche fürstliche Splendidität vorhanden waren. Kaiser Leopoldus, schreibt Maria Theresia über ihren Großvater, fände nicht mehr so viel zu verschenken, alleine die von ihme geführte schwere Kriege haben vermutlich verursachet, daß die noch übrigen Cameralgüter versetzt und verpfändet worden … dergestalten, daß die Vorgefundene Cameralerträgnüsse kaum 80000 Gulden erreichen …[6] Als schließlich die landesfürstlichen Dotationsmittel erschöpft waren, wandten sich die großen Herren und ministri an die Landstände in den einzelnen Kronländern, umb sich remunerieren zu lassen, und das führte dazu, daß sie in denen Ländern mehr geforchten und verehret worden als der Landesfürst selbsten, und dies wiederum bewirkte die große Praepotenz der Länder bzw. ihrer Stände.[7]
Die Schreiberin dieses «Testaments», das uns noch öfters beschäftigen wird, übte zwar keine direkte negative Kritik an ihren Vorgängern, aber die Schilderung des Zustandes der Monarchie, den sie 1740 vorfand und den sie für die anschließenden Unglücke und Verluste – nur mit knapper Mühe war sie der Katastrophe entgangen – verantwortlich machte, stellen selbst die denkbar herbste Kritik dar. In der Tat waren die Habsburger Herrscher seit Karl V. (1519–56) als Politiker oder Militärs nur Mittelmaß und bisweilen noch darunter gewesen, aber einzelne stehen doch als interessante, Dichter und Psychologen inspirierende Persönlichkeiten vor uns – so etwa der eigenartig düster-realitätsferne Rudolf II. (1576–1612) oder der oft als «Heuchler» verschriene, aber wahrscheinlich nur etwas pueril-verengt fromme Ferdinand II. (1619–37), Maria Theresias Ururgroßvater; und allen, bis zum Ende, eignete eine ungekünstelte, manchmal etwas müde-menschendurchschauende Würde, stets verbunden mit einem Bewusstsein der natürlichen Grenzen und des menschlichen wie göttlichen Maßes; Cäsarenwahn hat es im Hause Habsburg nie gegeben.
Das beliebte und manchmal auch reizvolle Spiel, Erbanlagen aus dem Stammbaum abzulesen, müssen wir uns im Falle Maria Theresias versagen; es würde ins Uferlose führen. Was allerdings auffällt: Sie war eine sehr «deutsche» Habsburgerin. Nicht allein beide Eltern, sondern auch die vier Großelternteile waren deutschstämmige, deutschsprachige Fürsten – ein Umstand, der, blickt man auf die Ahnentafel des Erzhauses, als ausgesprochen selten zu bezeichnen ist. Der Großvater, Kaiser Leopold I. (1658–1705), war als Sohn Kaiser Ferdinands III. (1637–57) und der spanischen Infantin Maria Anna, einer Tochter Philipps III. (1598–1621) von Spanien, auch äußerlich gleichsam das Fleisch gewordene Gesamt-Habsburg. Aus seiner dritten Ehe mit Eleonora von Pfalz-Neuburg, einer Wittelsbacherin, stammten die beiden Söhne, Joseph und Karl, die beide wiederum deutsche Prinzessinnen heirateten, Welfinnen. Joseph die Amalia Wilhelmine von Braunschweig-Lüneburg und Karl die Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel.
Und noch etwas ist bemerkenswert: Mit Maria Theresia gelangte in der dritten Generation ein Angehöriger des Hauses auf den Thron, der eigentlich nicht für ihn vorgesehen war. Sowohl Großvater Leopold als auch Vater Karl erhielten die Krone durch den Tod ihrer älteren Brüder. Leopold, für den geistlichen Stand bestimmt und entsprechend erzogen, rückte nach dem Tode seines Bruders Ferdinand an die erste Stelle der Thronfolge. Karl trat das Erbe seines Bruders, des Kaisers Joseph I. (1705–11) an, der im Alter von nur 33 Jahren plötzlich starb. Und Maria Theresia wurde sozusagen vom Schicksal, das Kaiser Karl VI. den Sohn versagte, zur Herrschaft bestimmt – und von der Pragmatischen Sanktion. Über diese später noch ein Wort. Weder Leopold I. noch Karl VI. waren «bedeutende» Herrscher, sie blieben oft politisch und militärisch glücklos. Das gefährliche und strapaziöse Dauer-Dilemma des Hauses Habsburg, auf das Adam Wandruszka hinweist[8], nämlich stets mit Aufgaben und Problemen im Westen und, sehr oft gleichzeitig, im Osten konfrontiert zu werden, vermochten beide nicht zu beheben; es blieb eine Grundkonstellation der Monarchie bis zu den Befreiungskriegen. Immerhin: Beide hatten ihren Prinzen Eugen, der seit 1683 in österreichischen Diensten stand, Ungarn von den Türken befreite, triumphale Siege im Spanischen Erbfolgekrieg errang, drei Kaisern mit Treue und Staatsklugheit diente und, obwohl selbst Savoyer, mehr als ein halbes Jahrhundert der gute Stern Österreichs war; jedoch vermochte auch er das, was am meisten notgetan hätte, nämlich aus dem komplizierten Länderbündel des Habsburgerreiches ein «Totum» zu machen und dieses von Grund auf zu reformieren, nicht zu erreichen. Die junge Erzherzogin hat den «edlen Ritter», den schon zu Lebzeiten legendären Kriegshelden, der ja zudem auch ein hochkultivierter Diplomat und Staatsmann in Friedenszeiten gewesen ist und in seinem Schloss Belvedere zu Wien wahrhaft fürstlich Hof hielt, noch kennengelernt. Mit seinem Tod im Jahre 1736 endete unwiderruflich Österreichs «Heldenzeit» (Max Braubach[9]); die nächsten zwölf Jahre standen ganz im Zeichen jener inneren und äußeren Staatskrise, die sich schon seit langem angebahnt hatte.
Sieht man einmal von der «angeborenen Majestät», von den Zügen der Zähigkeit, der Generosität und der mit Unduldsamkeit sich paarenden Glaubensfestigkeit Maria Theresias ab, die sie mit dem Vater und vielleicht noch stärker mit dem Großvater teilte, so scheint ihr Naturell mehr von den Anlagen der mütterlichen Linie, des Welfenhauses also, und der Großmutter väterlicherseits, der Pfalz-Neuburgerin, geprägt worden zu sein. Die Zeitgenossen stimmten darin überein, dass sie ihren bezaubernden Jugendreiz und die reife «junonische» Schönheit der Dreißigerin ihrer Mutter Elisabeth Christine zu verdanken habe, die ihrerseits in jungen Jahren eine hinreißende «Beauté» gewesen sein soll.
Wenn wir beider Damen Gemälde von Martijn van Mijtens ansehen und ihre Ähnlichkeit vergleichen, glauben wir es gerne. Doch auch so wichtige spezifische Charaktereigenschaften Maria Theresias wie ihr motorisches Temperament, ihre Arbeitsenergie, schlicht gesagt ihr Fleiß, ihre Stetigkeit, dazu die optimale Verbindung von Rationalität und Gemüt, und vor allem ihre niemals theoretisch verstiegene, immer an praktischen Erfordernissen orientierte Entscheidungsfähigkeit und -bereitschaft deuten in Richtung auf das mütterliche und großmütterliche Blutserbe. Im Übrigen ist kein Mensch eine bloße «genealogische Komposition»; zum Gewordensein tritt das Werden, zur Anlage die sie formende Umwelt und zu beidem, als ein dritter Faktor sui generis, der einmalige individuelle Freiheitsraum, wie immer man diesen auch interpretieren mag.
Wie war nun diese Umwelt, dieser Lebensraum beschaffen – ihr mehr persönlich-privater und ihr mehr historisch-politischer Aspekt –, darin das Mädchen, auf dem schließlich allein noch Habsburgs ganze Hoffnung stand, heranwuchs? Von der Kindheit der kleinen Erzherzogin wissen wir nicht viel mehr, als dass sie «ein gesundes, fröhliches und ungemein lebhaftes Kind war, das in der wienerisch gemütlichen Atmosphäre des kaiserlichen Familienlebens sorglos heranwuchs»[10]. Auch die Anekdoten aus dieser Zeit sind spärlich. Es wird erzählt, dass die Kleine einmal von einem Balkon aus der Fronleichnamsprozession zuschauen durfte, in der Kaiser Karl mitzog. Da sie den Vater so gut wie nie im pompösen Staatsgewand sah, hielt sie den im feierlichen Ornat dahinschreitenden Herrn für einen fremden Mann, bis sie plötzlich das Gesicht erkannte, vor Bewunderung und Vergnügen in die Hände klatschte und mit heller Kinderstimme zu dem ernst-gemessenen Zuge hinunterrief: «Komm her, Papa, und laß dich ein bisserl anschauen!» Durchaus glaubwürdig, wenn man daran denkt, dass sie auch zwanzig Jahre später noch, als Kaiserin und Königin, ihrem «Franzl», als er in Frankfurt zum Kaiser gekrönt wurde, vom Balkon des Hauses Zum Frauenstein aus applaudierte und zujubelte.[11]
Maria Theresia wurde gemeinsam mit ihrer nur eineinviertel Jahre jüngeren Schwester Maria Anna – eine weitere Schwester, Maria Amalie, starb 1730 sechsjährig – im üblichen Rahmen eines katholischen Fürstenhofs des 18. Jahrhunderts erzogen: Der Unterricht lag hauptsächlich in der Hand der Jesuiten, denen sie stets Zuneigung und Dankbarkeit bewahrte, auch nach der Aufhebung des Ordens durch Papst Klemens XIV. 1773. Ich gestehe, schreibt sie unter dem 13. September 1773 an ihren Sohn Erzherzog Ferdinand, daß ich darüber bekümmert bin, denn ich habe von ihrer Seite immer nur Erbauliches gesehen.[12] Obligatorische Fächer waren, außer natürlich Religion, Geschichte, Latein – damals die Staatssprache Ungarns –, Spanisch, Französisch, Italienisch, dazu Musik, die mit großer Sorgfalt, und Literatur, die oberflächlich, beides ganz italienisch ausgerichtet, gelehrt wurden. Maria Theresia sprach mit Mann und Kindern im «Privatleben» wienerisch, ansonsten, fließend, Französisch. Auch Italienisch beherrschte sie gut. Ihre Korrespondenz ist ganz Französisch abgefasst. Die deutsche Grammatik und Orthographie erlernte sie zeitlebens nicht. Als Siebenjährige wirkte sie in einer venezianischen Oper mit, die der Vater dirigierte, wie er ja auch bisweilen komponierte, wenn auch nicht so emsig und so begabt wie Leopold I. «Resl», wie die Wiener sie nannten, besaß eine hübsche Stimme und sang im kleinen Kreise italienische Arien zu eigener Spinettbegleitung, so noch 1753 beim Empfang des niederländischen Gesandten, Graf Bentinck, in Schönbrunn. Auf des Diplomaten enthusiastische Bemerkung, eine gute Fee habe ihr bei der Geburt offenbar «alle Gaben in die Wiege gelegt, durch die man die Menschen erfreuen könnte, erwiderte sie lachend: Es ist aber auch immer eine böse Fee dabei, die alles wieder verdirbt.»[13]
Vom elften Lebensjahr an wurde die Erziehung Maria Theresias von Gräfin Charlotte Fuchs, der «Aja», geleitet, einer klugen, geistvollen und herzenswarmen, pädagogisch begabten Frau, die sich die lebenslange zärtliche Anhänglichkeit ihres Zöglings erwarb; selbst in Briefen an Dritte pflegte Maria Theresia von ihr nur als «Mami» zu sprechen, und auch ihr Mann, Kaiser Franz I., hegte eine große Zuneigung zur «Fuchsin», der nach ihrem Tode eine einmalige Ehrung zuteil wurde: die Beisetzung in der Kapuzinergruft zu Wien, der Grabstätte des Hauses Habsburg, wo sie nun – als einziger Nicht-Habsburger – nahe dem Sarkophag des Kaiserpaares ruht.
Der Name «Franz» ist nun schon mehrmals gefallen: Franz Stephan, Herzog von Lothringen, später Großherzog von Toskana, seit 1745 römisch-deutscher Kaiser, vor allem aber Maria Theresias villgeliebter Bräutigamb[14] seit dem 31. Januar 1736 und mon cher Alter[15] nach der Trauung am 12. Februar. Über diese Heirat, diesen Gatten zu sprechen, heißt über ein Herzstück im Dasein Maria Theresias zu sprechen – das andere war ihre Lust am Regieren – aber zugleich auch über dynastische Sorgen, politisches Kalkül und internationale Verflechtungen. Es gilt etwas weiter auszuholen: Als Karl, der sich in Spanien Karl III. genannt hatte, 1711 nach Wien zurückkehrte, um als Karl VI. die Nachfolge seines verstorbenen, vermutlich begabteren Bruders Joseph I. anzutreten, ließ er in Barcelona für zwei Jahre seine junge Frau Elisabeth Christine zurück – als «Platzhalterin», weil er immer noch hoffte, den spanischen Thron behaupten zu können. Nachdem diese Hoffnung geschwunden und die Gattin ebenfalls nach Wien heimgekehrt war, dauerte es drei Jahre, ehe der erste Nachwuchs sich einstellte, ein Sohn Leopold, der nur wenige Monate alt wurde. Am 13. Mai 1717 kam dann Maria Theresia zur Welt, im darauffolgenden Jahr Maria Anna, die Marianne genannt wurde, Franz Stephans Bruder Karl heiratete und schon 1744 starb, und schließlich, 1724, Maria Amalie. Die ganzen folgenden sechzehn Jahre über hat Karl VI. immer noch auf einen Sohn gehofft, wobei er auch unbeschadet aller Liebe zu seiner Frau und seiner «Resl» die Möglichkeit nicht ausgeschlossen zu haben scheint, Witwer zu werden und in einer zweiten Ehe doch noch den ersehnten männlichen Erben zu zeugen. Daraus wurde bekanntlich nichts. Elisabeth Christine überlebte ihn um zehn Jahre. Die weibliche Erbfolge trat in Kraft.
Sie war mühsam und opferreich vorbereitet worden. Bereits zu Lebzeiten Kaiser Leopolds I., im Jahre 1703, als der Spanische Erbfolgekrieg sich günstig anzulassen schien, sodass mit einer habsburgischen Thronfolge in Madrid gerechnet werden konnte, hatte ein Familienpakt, das «Pactum Mutuae Successionis», die künftigen Erbansprüche zwischen den Linien geregelt. Er ging davon aus, dass in Spanien die Linie des zweiten Sohnes Karl, in Österreich und im «Reich» die des älteren Sohnes Joseph regieren werde. Zwischen beiden wurde die gegenseitige Erbfolge für den Fall des Erlöschens im Mannesstamm festgelegt; das war damals insofern theoretisch, als weder Joseph noch Karl Söhne hatten, doch bestand die Hoffnung, dies werde sich ändern. Im Frauenstamm, so bestimmte das «Pactum», sollten Josephs Töchter und ihre Nachkommen vor denen Karls rangieren. Was Spanien betraf, entfielen die Sorgen, denn dort kamen die Bourbonen auf den Thron. Und hinsichtlich der österreichischen Erbfolge ersetzte Karl VI. alsbald nach seiner Thronbesteigung das «Pactum Mutuae Successionis» durch die berühmte «Pragmatische Sanktion» von 1713. Sie legte fest, dass im Falle der Söhnelosigkeit Karls Töchter, und zwar in der Reihenfolge ihres Alters, thronfolgeberechtigt sein sollten vor den Töchtern Josephs und den weiblichen Nachkommen Leopolds I. Erst nach dem gänzlichen Aussterben des Karl’schen Stammes sollten die übrigen weiblichen Angehörigen des Hauses Habsburg, nach Erstgeburtsrecht, folgen können. Historisch-politisch aber noch wichtiger als diese Erbregelungen war die erneute und endgültige Bestimmung über die Untrennbarkeit und Unteilbarkeit des habsburgischen Gesamtbesitzes. Die «Pragmatische Sanktion» wurde so vor allem zur verfassungsrechtlichen Grundlage der Einheit des Habsburgerstaats. Als sie am 19. April 1713 vor der «Geheimen Konferenz» zu Wien verlesen und protokolliert wurde, erschien sie nur als eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil Karl keine Kinder hatte. Als er aber dann, elf Jahre später, immer noch bloß drei Töchter besaß, entschloss sich der Kaiser 1724, die «Pragmatische Sanktion» als Grundgesetz seines Hauses und Staates zu verkünden.
Man kann ohne Übertreibung sagen, dass sich Karl VI. von nun an bis zu seinem Tode von einem einzigen politischen Ziel leiten ließ: die Anerkennung der «Pragmatischen Sanktion» nicht allein durch die Stände in den habsburgischen Ländern, sondern auch, dies vor allem, durch die Mächte Europas zu erreichen. Bei den Ständen gelang ihm dies ziemlich reibungslos, wenngleich sie bei dieser Gelegenheit nicht vergaßen, auf ihre Privilegien und alten Rechte zu pochen. Die internationale Anerkennung dagegen gestaltete sich schwierig und langwierig. Bis 1732 war sie durch Russland, Spanien, Preußen, England-Hannover, die Generalstaaten (Holland) und das Reich erfolgt. Durch Frankreich geschah sie 1735, durch Bayern, dessen Kurfürst als Schwiegersohn des verstorbenen Kaisers Joseph ja ein unmittelbar nachteilig Betroffener war, erst 1745.
Das 18. Jahrhundert war das Jahrhundert der Erbfolgekriege, und in alle war Habsburg verwickelt – meist verlustreich. Im Spanischen Erbfolgekrieg (1701–13/14) konnte die Dynastie ihre Ziele, wie schon gesagt, nicht erreichen; der Polnische Erbfolgekrieg (1733–35) endete auch nicht gerade glorios für Wien; im Österreichischen Erbfolgekrieg (1740–48) konnte Maria Theresia mit Mühe und Not ihr Erbe wahren, und der Bayerische Erbfolgekrieg schließlich (1778/79) endete ebenfalls mit einem Misserfolg Wiens. Ausgenommen die spanische berührte jede dieser kriegerischen Erbauseinandersetzungen Maria Theresia existenziell, die polnische hatte sogar mit ihrem Glück als Frau, mit ihrer Eheschließung zu tun. Ein etwas komplizierter Zusammenhang. Im Jahre 1723 war ein fünfzehnjähriger Junge, Franz Stephan von Lothringen, aus Nancy, wo sein Vater, der durch seine habsburgische Mutter ein Vetter der beiden Kaiser Joseph und Karl und mit beiden eng befreundet war, als Herzog residierte, nach Wien gekommen; eigentlich kam er gleichsam als Ersatz für seinen verstorbenen Bruder Clemens, der eine Habsburg-Tochter hätte heiraten sollen. Er blieb sechs Jahre, und zwischen ihm und «Resl» gab es eine Kinderfreundschaft, übergehend wohl in erste Jugendschwärmerei von ihrer Seite; «Franzl» wurde in Wien wie ein Familienmitglied behandelt. Als 1729 der Vater starb, musste der Einundzwanzigjährige in Lothringen die Nachfolge antreten und das liebe Wien, den sympathischen Hof, die Jagden, Bälle, Amüsements und die kleine Erzherzogin, zwölf Jahre alt, verlassen. Ohne Verlobung, obwohl sich die herzoglichen Eltern natürlich immer sehr um eine solche Verbindung bemüht hatten und obgleich auch das Kaiserpaar, besonders Karl VI., «den schönen fröhlichen und dabei immer taktvollen bescheidenen Jüngling»[16] sehr gern mochte, ihn wie einen Sohn ansah und mit größter, gleichsam auf eine höhere Bestimmung zielender Sorgfalt erziehen ließ. Für eine «normale Erzherzogin» wäre der nette Lothringer-Herzog ja recht gewesen – aber für die größte Erbtochter Europas? Und das wurde Maria Theresia doch mit jedem weiteren Jahr mehr, das söhnelos verstrich. Zudem hatten 1726 die Höfe von Wien und Madrid zum Zeichen der politischen Wiederannäherung künftige Ehen zwischen zwei Töchtern Karls VI. und zwei nachgeborenen Söhnen seines alten Rivalen Philipp V. vereinbart. Das Projekt wurde nie realisiert, aber der Kaiser konnte sich auch zum Bunde Maria Theresias mit Franz Stephan nicht das Ja-Wort abringen. Als der junge Herzog, der seiner Mutter die Regentschaft in Lothringen übertragen hatte, nach einer längeren «Kavalierstour» 1732 wieder nach Wien kam, übertrug Karl ihm die Stadthalterschaft über Ungarn; ein ganz außergewöhnlicher Vertrauensbeweis. Aber von Verlobung war auch jetzt keine Rede.
Im Gegenteil: In dem Maße, in dem die Thronfolge Maria Theresias immer wahrscheinlicher und die politisch-militärische Lage des Kaisers immer fataler wurde, verschlechterten sich die Aussichten für die beiden Liebenden – denn das waren sie nun geworden, und mit jedem Tag mehr, die sechzehnjährige Erbin und der um neun Jahre ältere Herzog. Fast alles sprach dafür, diese Liebe den politischen Erfordernissen zu opfern. Damit sind wir wieder beim Polnischen Erbfolgekrieg: Er war entbrannt, als es darum ging, wer dem 1733 verstorbenen August II., «August dem Starken», Kurfürst von Sachsen und König von Polen, auf dem polnischen Thron folgen sollte. Polen war ein Wahlkönigreich, und seine Schwäche führte dazu, dass ihm die Thronprätendenten von auswärtigen Mächten serviert wurden. In diesem Falle also von Frankreich Stanislaus Leszcynski, Ludwigs XV. Schwiegervater, und gewählt durch die Mehrheit des polnischen Reichstags, von Russland und Österreich aber des verstorbenen August des Starken Sohn, der neue Kurfürst von Sachsen, August III. Auf des Stanislaus und Frankreichs Seite traten Spanien und Sardinien-Piemont; diesen ging es nicht um den Thron des fernen Polen, sondern sie nahmen die Gelegenheit wahr, Österreich die im Frieden von Utrecht zugefallenen, vormals spanischen Nebenländer in Italien wieder abzujagen. Deshalb war auch der Hauptkriegsschauplatz des Polnischen Erbfolgekriegs nicht Polen, sondern die Apeninnen-Halbinsel. Die Franzosen und Piemontesen eroberten Mailand; die Spanier Neapel-Sizilien. Österreich verlor seinen gesamten italienischen Besitz (außer Mantua); am Oberrhein kämpfte der alte Prinz Eugen glücklos gegen die Franzosen, welche auch ganz Lothringen besetzten. An allen Fronten besiegt, musste Karl VI. 1735 den Frieden von Wien schließen, der ein großes Karussell in Gang setzte: Stanislaus Leszcynski verzichtete auf die polnische Krone, die an den Sachsen fiel; er wurde entschädigt mit dem Herzogtum Lothringen, welches nach seinem Tode «für immer und ewig» an Frankreich fallen sollte, wie es denn auch 1766 geschah[17]; das Haus Lothringen musste auf sein Stammland verzichten und wurde mit dem Großherzogtum Toskana abgefunden, das allerdings noch nicht «frei» war, weil der letzte Medici noch lebte; das Königreich Neapel-Sizilien fiel an die spanischen Bourbonen. Der Kaiser konnte sich damit trösten, dass er das (durch Abtretungen an Piemont-Sardinien verkleinerte) Mailand behielt, die bescheidenen Herzogtümer Parma und Piacenza bekam und endlich auch die Anerkennung der Pragmatischen Sanktion durch Paris.
Es ist mehr als verständlich, dass nach diesem Ausgang die Berater und Minister Karl VI. drängten, seine Erbin mit einem mächtigen Fürsten, am besten einem deutschen, zu verheiraten; vor allem Prinz Eugen trat mit großem Nachdruck für die Ehe mit dem bayerischen Kurprinzen ein. Alle politische Vernunft sprach für diese Lösung: Der Bayern-Erbe hätte zum Römischen König gewählt werden und als Kaiser seinem Schwiegervater folgen können; eine Vereinigung der wittelsbachischen und habsburgischen Länder hätte einen Block entstehen lassen, der die Vormachtstellung des Hauses Österreich im Reich für immer begründet und gesichert hätte; das Problem der Pragmatischen Sanktion, die Bayern nicht anerkennen wollte, würde sich für München erledigt haben.[18] Jeder mag sich ausdenken, welch anderen Verlauf die deutsche Geschichte – und besonders auch die Geschichte des Habsburgerreichs – genommen hätte, wäre des Savoyers Plan verwirklicht worden.
Warum er es nicht wurde, bleibt ein Rätsel. Sollte des Kaisers Liebe zu seiner Tochter und zu Franz Stephan, sollte das Mitleid mit den jungen Leuten, ein Treue-, ein Loyalitätsgefühl oder auch schlechtes Gewissen gegen die lothringische Familie der Grund gewesen sein, so stellte das zwar seinem Herzen ein schönes, seinem realpolitischen Sinn aber ein schlechtes Zeugnis aus. Was übrigens das schlechte Gewissen betraf, so hätte man in Wien Ursache dazu gehabt. Über des Lothringers Land war beim Friedensschluss verfügt worden, ohne ihn auch nur zu fragen. Nun bestürmte die alte Regentin in Nancy ihren Sohn mit bald flehentlichen, bald drohenden Briefen, nicht zu verzichten, sein Herzogtum nicht den Franzosen preiszugeben, nicht zum «Kostgänger des Hauses Österreich» zu werden. Franz Stephan schwankte, konnte sich nicht entschließen. Wien, ungeduldig und verstimmt, das ganze Vertragswerk des so nötigen Friedensschlusses in Gefahr sehend, drängte und drückte mit allen Mitteln: auf Lothringen verzichten oder auf Maria Theresia; darauf lief es nun hinaus. Damals soll Bartenstein, der spätere vertraute Mitarbeiter der Kaiserin, zum Herzog das bekannt rüde Wort gesagt haben: «Keine Abtretung, keine Erzherzogin.»[19]