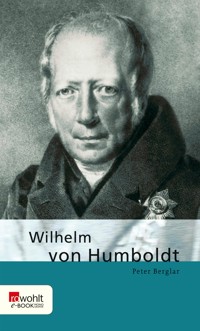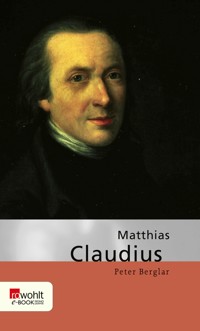
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Matthias Claudius (1740-1815) hat einige der schönsten Gedichte der deutschen Lyrik geschaffen. In seinen Texten fand er einen eigenen, Elemente von Kunst- und Volkslied vereinenden Ton – zum Beispiel in seinem wohl bekanntesten Gedicht «Der Mond ist aufgegangen» (1779). Aber auch seine teils satirisch-komischen Erzählungen und Betrachtungen fanden Beachtung, und als leitender Redakteur der Zeitung «Der Wandsbecker Bothe» (1771 – 75) schrieb er ein Stück Mediengeschichte. Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Peter Berglar
Matthias Claudius
Über dieses Buch
Matthias Claudius (1740–1815) hat einige der schönsten Gedichte der deutschen Lyrik geschaffen. In seinen Texten fand er einen eigenen, Elemente von Kunst- und Volkslied vereinenden Ton – zum Beispiel in seinem wohl bekanntesten Gedicht «Der Mond ist aufgegangen» (1779). Aber auch seine teils satirisch-komischen Erzählungen und Betrachtungen fanden Beachtung, und als leitender Redakteur der Zeitung «Der Wandsbecker Bothe» (1771–75) schrieb er ein Stück Mediengeschichte.
Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Vita
Peter Berglar, geboren 1919 in Kassel und aufgewachsen in Darmstadt, lebte seit 1950 in Köln. Mehr als zwanzig Jahre war er als Arzt (Internist) tätig, ehe er sich ab 1966 endgültig und ausschließlich den Geisteswissenschaften zuwandte. Er promovierte mit einer Monographie über Walther Rathenau zum Dr. phil. und habilitierte sich an der Universität zu Köln für das Fach Mittlere und Neuere Geschichte. Neben seiner dortigen Lehrtätigkeit wirkte er als Schriftsteller und Publizist weit über die Grenzen seines Fachs hinaus. Zahlreiche belletristische Werke, Essays und Aufsätze sowie Biographien, u. a. erschienen bei rowohlts monographien auch die Bände «Annette von Droste-Hülshoff» (1967) und «Maria Theresia» (1980). Er starb 1989.
Impressum
rowohlts monographien
begründet von Kurt Kusenberg
herausgegeben von Uwe Naumann
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2023
Copyright © 1972 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Stand der Bibliographie: 2003
Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten
Redaktionsassistenz Katrin Finkemeier
Covergestaltung any.way, Hamburg
Coverabbildung bpk (Matthias Claudius. Gemälde von Friederike Leisching, um 1785. Hamburg, Museum für Hamburgische Geschichte)
ISBN 978-3-644-01780-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Am Rand der Mitte
Matthias Claudius ist für die zünftige Literaturwissenschaft in gewisser Weise ein «enfant terrible». Zum Wesen dieser wie jeder Wissenschaft gehört nämlich die Charakterisierung, die Einordnung und Gruppierung der einzelnen individuellen, «originären» Phänomene, seien es Gestalten oder Werke, welche sonst, vereinzelt und massenhaft zugleich, dahin- und an uns vorbeiflössen, kurz: die Systematisierung der Lebensfülle und Bildervielfalt nach gemeinsamen Erkennungsmerkmalen. Ohne die jeweilige komplexe Individualität des jungen Goethe, Klingers oder Lenz’, des Novalis, Friedrich Schlegels oder Clemens Brentanos, Hermann Bahrs, Arthur Schnitzlers oder Hugo von Hofmannsthals im Geringsten zu vernachlässigen, bleibt für das Erfassen eines geistes-, literatur- und sprachgeschichtlichen Zusammenhangs doch die Subsumierung dieser Namen unter die Begriffe «Sturm und Drang», «Frühromantik», «Junges Wien» verbindlich. Die Ordnungsprinzipien sind zahlreich und variabel – die Notwendigkeit, überhaupt welche zu haben und immer wieder neue zu schaffen, bleibt unabdingbar.
Claudius nun will in die altbewährten Schubfächer der deutschen Literaturgeschichte nicht so recht passen. Zwar entrichtet er als junger Student in Jena dem Zeitgeschmack seinen Tribut wenn er im Erstling Tändeleien und Erzählungen (1763) reimt:
Itzt hob sich Chloens Busen,
Und Amor freute sich.
Er stieg mit Chloens Busen,
Und stieß, da traf er mich.[1]
Aber diese Mode fällt schnell von ihm ab, und niemand wird ihn unter die Rokokodichter und Anakreontiker nach Art eines Friedrich von Hagedorn oder «Vater» Gleim rechnen. Wie bei Rousseau und den vielen mehr oder minder direkt und stark von ihm beeinflussten Schriftstellern der sechziger und siebziger Jahre des 18. Jahrhunderts in ganz Europa spukt auch bei Claudius der «fromme Heide» und der seufzende Schwarze:
Weit von meinem Vaterlande
Muß ich hier verschmachten und vergehn,
Ohne Trost, in Müh’ und Schande;
Ohhh die weißen Männer!! klug und schön!
Und ich hab’ den Männern ohn’ Erbarmen
Nichts getan.
Du im Himmel! hilf mir armen
Schwarzen Mann![2]
Doch zählte er gewiss nie zu den «Empfindsamen», und wenn er an Herder von den Sprachgebärden und rohen Schrei’s der ersten Völker, von der Wunde in der Hüfte des Adonis und von Jupiters Schlafmütze schreibt[3] oder Voß und Hölty anbietet: Für eine Hütte für Euch Hirten will ich sorgen[4], dann drückt das eher lustige Ausgelassenheit als Schäferpoesie aus. Auch ein latenter oder gar offenkundiger Revolutionär lässt sich nicht aus ihm machen. Verse wie
Gut sein! Gut sein! ist viel getan,
Erobern ist nur wenig;
Der König sei der bess’re Mann,
Sonst sei der bess’re König![5]
enthalten kein politisches Programm, und ihnen stehen zahlreiche Huldigungsgedichte an das dänische Königshaus gegenüber.
Claudius hat einige der wunderbarsten Gebilde der deutschen Lyrik geschaffen, aber sie spotten der professionellen Klassifizierung – vielleicht vor allem deshalb, weil sie nicht von einem «Professional» der Dichtung stammen, nicht also Kunstwerke eines Dichters sind, der ganz bewusst mit allen seinen Kräften nach Selbst- und Weltdarstellung (und eines im andern) verlangt, sondern weil sie als Eingebungen und Zu-Fälle einer glücklichen schöpferischen Stunde aus jenem Urvorrat von Bildern, Stimmungen, Erkenntnissen aufsteigen, der einer geschichtlich gewachsenen Menschengruppe, sagen wir ohne Umschweife: einem Volke, eignet und den gerade das 18. Jahrhundert, Herder vor allem, entdeckte und bewußt machte. Kategorisierungen wie «klassisch», «romantisch», «naturalistisch» treffen da nicht. Eine Art von «natürlicher Urpoesie», etwas, das, wenn auch heute weithin verschüttet, ohne Zweifel existiert, gewinnt plötzlich unter einer günstigen Konstellation von verschiedenen Umständen des äußeren und inneren Lebens Stimme und tritt durch eine Individualität wie durch eine Membran hindurch, sie unter Umständen nur auf Zeit zum Poeten machend, an den Tag. Das vollendete Kunstwerk kann unter unsäglichen Mühen gemacht, erarbeitet werden, und seine Vollendetheit bezeugt sich gerade darin, dass diese Mühen nicht mehr erkennbar sind – doch es kann auch plötzlich und unerwartet da sein, ein freies Geschenk des Augenblicks. Goethe, die Droste, Rilke, Trakl bieten für beide Möglichkeiten viele Beispiele.
Claudius gehörte nicht zu den Bildhauern und Architekten der Sprache und der Stoffe; die harte Steinmetzarbeit war nicht seine Sache. In Prosa redete er, wie ihm der Schnabel gewachsen war, aber keineswegs unkontrolliert, konfus oder absichtslos. Im Gegenteil: Er besaß, darin Pestalozzi ähnlich, bei aller Kindlichkeit und Bescheidenheit den sicheren Instinkt für erzieherische Wirkung; ein Naturtalent der Pädagogik. Als Lyriker war er ein «Sterntaler-Kind», ihm fielen ein paar der glänzendsten Sterne buchstäblich in den Schoß: Das Abendlied, Das Kriegslied, Der Mensch, Der Tod und das Mädchen. Vieles, was er so reimte, ist freilich weniger karätig gewesen, und manche seiner Verseschmiedereien verunglückten ganz. Juwelen wie Alltagsware nahm und gab er gelassen. Über sich als Künstler, als Dichter, überhaupt als Gestalt des geistigen Lebens seinerzeit reflektierte er kaum.
Aber über die Welt und über den Menschen in ihr, über Gott und über das Heils-Werk Christi hat Matthias Claudius sehr viel nachgedacht, je älter er wurde, desto mehr und intensiver. Schließlich wurde der christliche Offenbarungsglaube das Generalthema seines letzten Lebensjahrzehnts; der siebte und achte (letzte) Teil der Sämmtlichen Werke (des Wandsbecker Bothen) standen ganz in seinem Zeichen. Doch auch hier bleibt Claudius Außenseiter. Überzeugter evangelisch-lutherischer Christ, aber doch kein Orthodoxer, allerdings auch kein «Vernünftler» im Sinne der Aufklärung. Durchaus streitlustig und ohne hinter dem Berge zu halten mit seinen Auffassungen von Religion und Staat, steigt er in die Arena der publizistischen Tageskämpfe, doch niemals vergisst er Toleranz und Generosität: Ob es nun darum geht, dem wegen seines Übertritts zur katholischen Kirche wüst beschimpften, von allen alten Freunden verlassenen Grafen Friedrich Leopold zu Stolberg die Treue zu halten oder dem toten Lessing, unbeschadet aller inneren und geistigen Gegensätze, bleibenden Respekt zu bezeigen. Claudius verwarf die Ideen von 1789. Die «Befreiung der Vernunft» als das helle Licht eines neuen Menschheitstages vermochte er nicht zu erkennen; Volksherrschaft, Republikanismus, Aufruhr und gewaltsame Veränderungen lehnte er ab. Er blieb ein Untertan aus der Überzeugung und dem Obrigkeitsverständnis Luthers heraus, und er hat das nicht nur schweigend geübt, sondern sehr beredt in seinen Schriften vertreten. Trotzdem vermochte die reaktionär-restaurative Gegenbewegung, die mit dem neuen Jahrhundert einsetzte, ihn nicht für sich zu reklamieren.
Wenn denn nun Bahn geworden, schreibt der 74-Jährige 1814, und das Himmelreich nahe herbeigekommen ist, so ist es Zeit, dem Himmelreich Gewalt zu tun und es für sich und andre zu sich zu reißen; so ist es Zeit, nicht bloß den alten Schaden zu bessern, sondern einen von Grund aus neuen Bau des Reichs Gottes zu gründen … Zuerst und vor allem können die Fürsten und Vorgesetzten der Völker dazu beitragen. Ihren Händen ist die Sorge für andre Menschen von Gott anvertraut … Der geringste ihrer Untertanen und Untergebenen ist ein Mensch wie sie und wird geachtet vor Gott.[6] Solche Sätze, denen sich viele andere zur Seite stellen lassen, prätendierten gewiss keine Heilige Allianz und keine kriegerische Interventionspolitik, wenn auch deren Initiatoren sie wohl, falls sie sie gekannt hätten, für sich in Anspruch genommen haben würden.
Mit der Unbefangenheit eines «geistlichen Naturburschen», der Claudius weit eher als ein Theologe und Philosoph war – unbeschadet seiner hohen Bildung und weitgespannten Gelehrtheit –, hat er sich in die Spinoza-Auseinandersetzung Friedrich Heinrich Jacobis mit Lessing und Mendelssohn eingeschaltet und sich nicht gescheut, Kants strikte Trennung der apriorischen Vernunft, die Erfahrung erst möglich macht, von der geoffenbarten Glaubenswelt anzugreifen; in langen Briefen an Freund Jacobi versuchte er Kants Lehre zu widerlegen. Das gelang freilich nicht, da war er in eine für ihn zu große, zu schwere Rüstung geschlüpft und führte Waffen, die über seine Kräfte gingen.
Nur mit Einschränkungen und Erläuterungen ist der Wandsbecker Bothe, ist Asmus Dichter, Philosoph, Theologe zu nennen. Manchmal erscheint er mehr als Journalist, als Volksschriftsteller, oder als das norddeutsche Pendant zu Johann Peter Hebel. An alldem ist etwas – aber ein Zögern bleibt, es ist doch nicht der ganze Claudius. Von Hebel unterscheidet ihn der größere religiöse Tiefgang; Volksschriftsteller ist er, bezogen auf das Gesamtwerk, nur in wenigen Stücken; der Journalist aber schöpfte aus Kräften und Vorräten, die vor und außer dem «jour», die «unter Tage» liegen, und was er dem Tag, seinem Tag, zu melden wusste, das reicht weit über den Tag, auch den unseren, hinaus.
Wohin also mit Claudius? Wie erfrischend, es mit einem Mann zu tun zu haben, der ein Original, ein ganzer Kerl und ein wirklicher Herr – Verteidiger der Schwachen und in die Ecke Manövrierten – gewesen ist und den man nicht einfach unter einem konventionellen Stichwort ablegen kann. Asmus nahm viele Rufe auf und gab viele Rufe weiter. Aber er hatte selbst keinen Beruf, denn die Altonaische Bankrevisor-Stelle, die er 1788 durch die Gunst des dänischen Kronprinzen erhielt, war eine Sinekure. An den Maßstäben bürgerlichen Nutzwertes und gesellschaftlicher Bedeutung gemessen stand Claudius am Rande der aufgeregten, ja hektischen Betriebsamkeit, die für die Intellektuellenschicht jener in mehr als einem Sinne revolutionären Epoche kennzeichnend ist. Obwohl er mit Klopstock, Lessing, Wieland, Herder, Hamann, Goethe in Kontakt stand, lebte und wirkte er dennoch an der Peripherie – dies auch schon rein äußerlich insofern, als Reinfeld, Wandsbeck (heute Wandsbek geschrieben), Altona, Claudius’ Heimat Holstein, der Nordsaum des Reiches, in Personalunion mit Dänemark verbunden war; der dänische König war als Holsteins Landesherr Reichsfürst. Die Einflüsse der benachbarten Freien Hansestadt Hamburg und die Ausrichtung auf das Zentrum Kopenhagen mochten sich zeitweise die Waage halten. Das Wesentliche ist, dass Claudius auch «kulturgeographisch» in einer Randposition stand: Die Zentren der großen geistigen Bewegungen Deutschlands in den Jahrzehnten zwischen 1775, als der 1. und 2. Teil des Asmus erschien, und 1815, als sein Autor starb, lagen in Berlin, in Weimar und Jena, in Heidelberg und Dresden. So hat der Wandsbecker Bothe zwar nur vom Rande der Mitte her gesprochen, aber seine Botschaft wurde gehört und hat sich bis heute erhalten.
Ein Boten-Leben
I. Werden
Der äußere Lebensablauf des Matthias Claudius weist keine dramatischen und sensationellen Geschehnisse auf. Da Claudius am Rande der «großen Welt» ein unauffälliges Dasein führte, wurde er auch nicht in die mannigfaltigen, erregenden, komplizierten Verhältnisse, in all die inneren und äußeren Wirren, die Ver- und Entwicklungsphasen hineingerissen, die das Leben der Großen, eines Goethe, Schiller, Kleist, Friedrich Schlegel oder Wilhelm von Humboldt, kennzeichnen. Das bedeutet indes nicht, dass sein Leben ohne Höhen und Tiefen, ohne Werde- und Reifungsstufen, dass es «langweilig» gewesen sei; so wenig wie das Leben Adalbert Stifters oder Gottfried Kellers «langweilig» gewesen ist. Nur: Es war nicht «aufregend», weil es nicht aufgeregt war, es empfing seine Prägung nicht aus Zwiespältigkeiten und Händeln, nicht aus Spannungen und Konflikten mit Welt und Menschen, sondern von den einfachen Dingen, von Ehe und Familie, von Alltagssorgen um das tägliche Brot, aus Nähe zur Natur und aus schlichtem Glauben. In der Bewältigung und Pflege dieser einfachen Dinge, die in Wirklichkeit so schwer sind, hat sich Claudius als Meister gezeigt.
Matthias Claudius wurde am 15. August 1740 zu Reinfeld in Holstein geboren. Der Vater, der ebenfalls Matthias hieß, war – wie auch schon der Großvater – Pfarrer. In Süderlügum 1703 zur Welt gekommen, erhielt er 1728 seine erste Pfarrstelle in Norburg auf Alsen; ein Jahr später finden wir ihn als Pastor in Reinfeld, wo er bis zu seinem Tode 1773 wirkte. Er war zweimal verheiratet. In erster Ehe (1730) mit Lucie Magdalene Hoe, die aus Flensburg stammte, 1737 starb und zwei Kinder hinterließ, Matthias’ Stiefbrüder Christian Carl (Kantor in Plön, 1731–1801) und Barthold Nicolaus (1732–58). Die zweite Ehe schloss der Reinfelder Pastor mit der Tochter des Flensburger Senators Jeß Lorenzen Lorck und seiner Frau Brigitta von Lutten, Maria Lorck. Sie wurde die Mutter von Matthias und dessen sieben Geschwistern. Die väterliche Abstammung reicht in altes Bildungsbürgertum zurück, im Mannesstamm der Claudius noch fünf Generationen über den Vater hinaus in Pfarrfamilien; mütterlicherseits sind es meist angesehene Kaufmanns- und Ratsfamilien in und um Flensburg.[7] So gehört Matthias Claudius zu dem Kreis bedeutender Gestalten unseres Landes, die aus dem evangelischen Pfarrhaus hervorgegangen sind.
Es ist schwer auszumachen, worin eigentlich das Geheimnis der fruchtbaren Wirkung des protestantischen Pfarrhauses lag: Vielleicht in der rechten Mischung von «Nestwärme», die nichts mit Zärtelei und Verwöhnung, sondern mit familiärer Geborgenheit zu tun hat, und strenger Zucht, von materieller Beschränkung und kultureller Aktivität, von verordneter unreflektierter Festigkeit im Glauben der christlichen Kirche und ermöglichten Bildungschancen, diese Festigkeit zu gefährden, diesen Glauben in Frage zu stellen; kurz: in den optimalen Bedingungen zur Entfaltung eigener Kräfte, sei es nun in tradierender Fortsetzung der elterlichen Linie, sei es im Aufstand gegen sie: Schließlich, und nicht durch Zufall, waren Lessing, die Brüder Schlegel – und Nietzsche Pfarrerssöhne. Solche Abkehr von den Vätern gab es bei Claudius freilich nicht. Am Glauben hielt er, ohne jemals zu schwanken und zu zweifeln, fest. An tätiger Verteidigung desselben, der seit der Aufklärung und bis zur Gegenwart im Kern herausgefordert und bedroht wird, hatte er mehr zu tun als seine Vorfahren, die Pfarrherren und Professoren, und hat er mehr getan. Vom Reinfelder Pastor und seinem Verhältnis zum Sohn wissen wir nicht viel, aber was uns dessen schlichte Verse am Grab des Vaters wissen lassen, genügt im Grunde:
Friede sei um diesen Grabstein her!
Sanfter Friede Gottes! Ach, sie haben
Einen guten Mann begraben,
Und mir war er mehr;
Träufte mir von Segen, dieser Mann,
Wie ein milder Stern aus bessern Welten!
Und ich kann’s ihm nicht vergelten,
Was er mir getan.[8]
Der Mutter, einer stillen, gütigen Frau, die sich stets unscheinbar und bescheiden im Hintergrund hielt, blieb der Sohn bis zu ihrem Tode (1780) verbunden; von ihren zehn Kindern, die beiden Stiefkinder mitgerechnet, lebten damals noch vier. Eine dominierende, das Maß des Natürlich-Üblichen übersteigende Rolle scheint sie in Matthias’ Leben nicht gespielt zu haben, wenn ihm auch die Übersiedlung nach Darmstadt nicht zuletzt wegen des Abschieds von ihr schwer und die Rückkehr nach Wandsbeck wegen des Wiedersehens mit ihr umso leichter fiel. Nach der Beerdigung meldet er seiner Frau Rebecca: Hier geht hulter polter, über und drüber; bringe aber keine großen Sachen mit, aber allerhand Kleinigkeiten für einige 60 M. Gesund sind wir gottlob alle und haben uns nicht gezankt. Das Begräbnis ist ehrbar und ordentlich vonstatten gegangen. Es war mir beim Hingehen, als wenn die Mutter wieder mit dem Vater vermählt werden sollte und wir sie zur Trauung führten.[9] Dass man sich, wie Claudius ausdrücklich erwähnt, bei der Erbteilung des sehr bescheidenen Nachlasses nicht «zankte», entsprach dem guten, freundschaftlichen Verhältnis, in dem Matthias zu seinen Brüdern stand. Die Verbindungen rissen, wenn auch nur lose gepflegt, nie ab; innerlich am nächsten ist ihm wohl – abgesehen von dem früh gestorbenen Josias – Christian Detlef (1750–1822), der jüngste der Geschwister, Arzt in Lütjenburg, gewesen.
Der eigentliche Gespiele, Kamerad und Freund seiner Kindheit und Jugend aber war Josias, nur ein Jahr älter als Matthias. Gemeinsam erhalten die beiden ihren ersten Unterricht in Lesen, Schreiben, Rechnen, aber auch in Latein und Religion beim Vater. Strenge Bibelgläubigkeit, beruhend auf genauer Bibelkenntnis, bildet das Fundament aller anderen Studien. Doch es ist keine kalte, rechthaberische Orthodoxie, die der Vater den Kindern vermittelt, sondern lebensvolle, warmherzige Frömmigkeit, die Gemüt und Phantasie zur Entfaltung bringt. In einer heute kaum mehr vorstellbaren Weise gehört Kindertod zum fast selbstverständlichen Schicksal jeder Familie. So sterben in dem einen Jahr 1751 kurz hintereinander die zweijährige Schwester Lucia Magdalena, der sechsjährige Bruder Lorenz und der achtjährige Friedrich Carl. Auch Matthias, obwohl er ja fast 75 Jahre alt wird, ist keineswegs von eiserner Gesundheit gewesen: «katarrhalische Störungen», wahrscheinlich tuberkulöser Natur – die «Pleuresie»[10] bleibt ein ständig wiederkehrender Begleiter –, machen ihm zeitlebens zu schaffen.
Wenn auch Pfarrerskinder auf dem Lande rechte Dorfkinder sind, die mit den Bauern leben, bei der Ernte helfen, mit dem Vieh umzugehen wissen, so fehlt doch nicht die Verbindung zu den hohen und höchsten Kreisen der Gesellschaft, zu dem Grafen Moltke in Niendorf und anderen adeligen Grundbesitzern der Umgegend, ja selbst zur fürstlichen Familie. Drei Geschwister von Matthias sind Patenkinder der Herrschaften; die Familie Claudius wird eingeladen, wenn Angehörige des regierenden Hauses im kleinen Reinfelder Schlösschen der Herzogin-Witwe weilen.
Matthias und Josias werden zum Theologiestudium bestimmt. Gemeinsam besuchen sie die «Öffentliche Evangelisch-Lutherische Lateinschule, auch Schreib- und Rechenschule» in Plön, das nur eine Tagesreise von Reinfeld entfernt liegt. Die nach dem Muster des berühmten Schulpforta gegründete Anstalt ist, wie Urban Roedl schreibt, «eine Hochburg weniger des wissenschaftlichen Geistes als der gelehrten Pedanterie. Sie besteht aus vier streng voneinander getrennten Klassen. Die Elementarklasse, die Quarta, leitet der Pädagogus, die Tertia untersteht dem ‹Schreib- und Rechenmeister›, die Sekunda dem Kantor, die Prima dem Rektor. Das ist der bekannte Schulmann Ernst Julius Alberti aus Hamburg, ein hochgelehrtes Haus und sonderlicher Kauz, unnachsichtlich streng und doch ein gemütlicher Patron, dem es nichts ausmacht, in Schlafmütze, Schlafrock und Pantoffeln Schule zu halten. Nicht sein lebendiger Witz, sondern nur die trockene Schulfuchserei des Rationalisten beherrscht die unteren Klassen.»[11] Das Hauptgewicht des Unterrichts liegt auch hier selbstverständlich auf der evangelischen Religionslehre. Dennoch: In die Philosophiestunden weht bereits ein neuer Geist hinein, der rationale Geist der Aufklärung.
Vier Jahre verbringen die Brüder Claudius in Plön, dann siedeln sie zum Theologiestudium nach Jena über, an die von den Holsteinern allgemein bevorzugte «Universitas pauperum», die damals, 1759, ihre großen Tage der Theologie und Jurisprudenz (16. Jahrhundert) schon hinter sich, die der Geschichte, Philosophie und Medizin (Schiller, Fichte, Hufeland) noch vor sich hat. Der Bruch, der durch die Theologie der Zeit geht und der dann seinen Ausdruck in der berühmten Kontroverse Lessings mit dem Hamburger Hauptpastor Johann Melchior Goeze finden wird, tritt auch in Jena zutage: Die jungen Theologiestudenten haben sich zwischen der orthodox-bibelgläubigen und der rational-philosophischen Richtung zu entscheiden.
Solche Wahl ist nicht Claudius’ Sache. So entschieden er auch in seinen späteren Jahren für die auf der Heiligen Schrift gründende Religion seiner evangelischen Vorfahren, für einen Christenglauben des warmen und demütigen Herzens eintritt, sosehr er geradezu missionarische Züge zeigt, wenn er einen Mystiker wie Saint Martin übersetzt, so kräftig ihm die Sprache des Predigers zu Gebote steht, wenn er etwa Vom Vaterunser oder Vom Gewissen handelt – der junge Mann, knapp zwanzig Jahre alt, meidet instinktiv ein Studium, das notwendigerweise ein Zerreden und Entzaubern der schamhaft im Innern verschlossenen Frömmigkeit bedeuten würde. Es gibt in diesen Dingen etwas wie seelische Keuschheit, und Claudius hat sie in hohem Maß besessen.
Während der Bruder bei der Theologie aushält, wendet sich Matthias weltlichen Fächern zu. Er verleibt sich in den Jahren 1759 bis 1762 jenes Sammelsurium von Jus, Philosophie, Kameralwissenschaften ein, das die zwar im Einzelnen nicht immer sehr tiefdringende, aber im Ganzen doch breitgefächerte und darum Freiheitsspielraum eröffnende Bildung jener Zeit ausmacht. Claudius hört Vorlesungen in Staats- und Völkerrecht, in Pandektenexegese, in Geschichte, vor allem aber in Philosophie, deren rational-spekulative Richtung im Sinn der Leibniz-Wolff’schen Schule J.G. Daries vertritt, während Schlettwein den Empirismus und Pragmatismus der Hobbes, Locke und Hume vorträgt.
Alles in allem ist der junge Holsteiner kein begeisterter Student. Die Professoren nennt er eine zänkische und stänkische Clique[12], die rohe, großsprecherische Bierseligkeit der Kommilitonen widert ihn ebenso an, wie wir es etwa von seinem späteren Darmstädter Kollegen Johann Heinrich Merck und auch manchen anderen Zeitgenossen wissen.[13] Dafür beginnt ihn nun die Literatur in ihren Bann zu ziehen. Wie an vielen Universitäten gibt es auch in Jena eine literarische, die sogenannte «Teutsche Gesellschaft», aus Professoren, Magistern und Studenten gebildet, die sich samstagnachmittags treffen, um Gedichte und Exkurse über moraltheologische oder philosophische Probleme vorzulesen und über Fragen der deutschen Grammatik, der Rechtschreibung, der Wortkunde zu disputieren. Es sind ja die Jahrzehnte, in denen nach Vorarbeiten Gottscheds von Männern wie Lessing, Bodmer, Herder die Germanistik als Wissenschaft fundiert wird, die dann die Brüder Grimm zu einem ersten Höhepunkt führen. Der allgemeine literarische Geschmack steht im Zeichen des Übergangs: Gleim und Hagedorn, Rokoko und Anakreontik haben noch ihre Stunde, aber Lessing und Klopstock eröffnen schon die große Epoche der deutschen Literatur: 1759 beginnen Lessings «Briefe, die neueste Literatur betreffend» zu erscheinen, 1760 liegt der erste Band des «Messias» von Klopstock vor.
Hier in der «Teutschen Gesellschaft» lernt Claudius den aus Tondern stammenden Landsmann Heinrich Wilhelm von Gerstenberg (1737–1823), der später zum guten Freund wird, kennen. Er ist ein paar Jahre älter und schon ein berühmter Dichter im anakreontischen Stil. Ihm, der die Universität verlassen hat, schreibt der schwärmerische Adept: Wollen Sie uns nicht bald wieder mit einigen süßen Tändeleien beschenken? Nein, liebster Freund, ob es gleich große Wollust ist, solche Tändeleien zu lesen, so haben doch die tragischen Empfindungen einen mächtigen Vorzug; schenken Sie uns lieber ein Trauerspiel oder sonst tragische Stücke, dabei man so recht weinen muß. Wie unaussprechlich süß ist jede Träne, die man beim Grabe oder überhaupt beim Unglück seines Freundes weint … O bester Gerstenberg, wenn Sie so recht betrübte und traurige Gemälde und Empfindungen liegen haben, gönnen Sie mir das Vergnügen, solche zu lesen, ich will Sie ewig lieben.[14] Dem merkwürdigen Hang Claudius’ zu Entspannung und Erhebung in Todesgedanken und Grabesvorstellungen werden wir später noch des Öfteren begegnen. Nur zum Teil lassen sie sich daraus erklären, dass der einzelne Mensch wie die Familie damals in ständiger enger «Tuchfühlung» mit dem Tode lebte: Man wurde im Hause geboren und starb inmitten der Seinen, man konnte selbst nur geringe Erwartung hegen, alt zu werden, und Kinder und Geschwister sah man wegsterben. Doch erscheint des Claudius Haltung dem Tod gegenüber, ähnlich wie bei der sonst so ganz anders gearteten Droste, von einer persönlichen Note, jener Mischung aus frommer Sehnsucht und wollüstigem Schauer, geprägt. Ich mag wohl Begraben mit ansehen, schreibt er, gleich zu Beginn des ersten Bändchens seiner Sämmtlichen Werke (1775), wenn so ein rotgeweintes Auge noch einmal in die Gruft hinabblickt, oder einer sich so kurz umwendet, und so bleich und starr sieht und nicht zum Weinen kommen kann. ’s pflegt mir denn wohl selbst nicht richtig in ’n Augen zu werden, aber eigentlich bin ich doch fröhlich. Und warum sollt ich auch nicht fröhlich sein; liegt er doch nun und hat Ruhe! Und ich bin darin ’n närrischer Kerl, wenn ich Weizen säen sehe, so denk ich schon an die Stoppeln und den Erntetanz. Die Leut’ fürchten sich so vor einem Toten, weiß nicht warum. Es ist ein rührender heiliger schöner Anblick, einer Leiche ins Gesicht zu sehen; aber sie muß ohne Flitterstaat sein. Die stille blasse Todesgestalt ist ihr Schmuck, und die Spuren der Verwesung ihr Halsgeschmeide und das erste Hahnengeschrei zur Auferstehung.[15]
Damals in Jena wurde der junge Claudius durch den Tod seines Bruders Josias tief erschüttert. Beide erkrankten nacheinander an Pocken, der neben der Tuberkulose verbreitetsten und verheerendsten Seuche der Zeit. Matthias genas und musste nun anschließend den geliebten Bruder trotz aller hingehenden Pflege nach langem Leiden sterben sehen. Der Nekrolog, den er vor der akademischen «verehrungswürdigen Trauerversammlung» mit dem «Magnificus Academiae Exrector» an der Spitze hielt, schloss mit den Worten: Nun ruhe, ruhe sanft, toter Bruder. Noch oft will ich in der Stunde der Mitternacht, bei blassem Mondschein zu Dein Grab hinschleichen und weinen. Dann lispele Dein Geist mir zu, daß Du mich noch liebst, so will ich zufrieden sein, daß ich mich Deiner süßen Umarmungen erinnere, und den künftigen froh entgegensehe.[16] Die Rede wurde gedruckt, Claudius’ erste Veröffentlichung.[17]
Im Jahre 1762 verließ ein Exstudent, der sich zwar mancherlei Kenntnisse angeeignet und die ersten literarischen Schritte getan, aber keinen Abschluss und keine auf einen bürgerlichen Brotberuf zielende Ausbildung erworben hatte, Jena, um in das elterliche Pfarrhaus zurückzukehren. Claudius war, was man heute einen «Spätentwickler» nennt: Der 22-Jährige, der da einkommens- und stellungslos wieder am väterlichen Tisch sitzt, weiß noch kaum etwas von den in ihm angelegten Kräften und Möglichkeiten. In sich gekehrt, ohne eigentlich ein Träumer zu sein, nachdenklich und verschlossen, ohne sich von der Umwelt abzukehren, voller Gedanken und Empfindungen, die sich aber weder in Worten noch Werken, noch «Affären» niederschlagen, so geht er durch das nächste Jahrzehnt, bis er seine Form findet, bis er der Wandsbecker Bothe und liebende Ehemann seines Bauermädchens Rebecca wird.
1763 erscheint sein erstes Buch – genauer Büchlein – Tändeleien und Erzählungen. So wie der Titel von Gerstenberg entliehen ist, so sind es auch die gekünstelten Reimereien, die seichten Fabeln, nur alles weit weniger gekonnt als bei Gerstenberg oder Hagedorn oder gar Gellert. Ich habe auch Tändeleien gemacht, kündigt er dem bewunderten Freund an, Tändeleien, denn ich wußte nicht, wie ich sie anders nennen sollte. Hier sind sie, sein Sie so gut und sagen mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt, ein wenig weitläuftig, wenn Sie Zeit und Lust haben.[18]
Das Werkchen erfuhr eine vernichtende Kritik, zuerst in den der «Teutschen Gesellschaft» nahestehenden «Kritischen und zuverlässigen Nachrichten von den neuesten Schriften für die Liebhaber der Philosophie und Schönen Wissenschaften», dann auch von Christian Felix Weiße (1726–1804) und Christoph Friedrich Nicolai (1733–1811), den Literaturpäpsten jener Jahre; trotzdem erlebte es erstaunlicherweise 1764 eine zweite Auflage. Den Reinfelder Pfarrer konnte das kaum beeindrucken, er drängte darauf, dass der Sohn nun endlich sein Brot verdienen müsse. Dieser, bei dem die poetischen Eingebungen keineswegs so reichlich flossen, dass sie ihn hätten ernähren können, gab das Drängen an Gerstenberg weiter: Stirbt in Kopenhagen nicht ein Sekretär oder braucht nicht ein junger Herr einen Hofmeister, mit ihm auf die Universität zu gehen? Wissen Sie, was mir neulich eingefallen ist, ich möchte wohl nach das Land Norwegen, wenn ich da nur was zu tun hätte, bei den Bergwerken oder sonst.[19] Ähnlich wirklichkeitsferne Wünsche, naiv vorgetragen, finden sich auch später bei Claudius noch, ob man nun seine Idee nimmt, mit Johann Heinrich Voß den fürstlichen Schlossgarten zu Lauenburg zu pachten, Gärtner, Schäfer und Bauer in einem, oder die Vorstellung, Vorsteher eines im Walde gelegenen Hospitals … Verwalter eines Jagdschlosses, Garteninspektor, Vogt eines Dorfes[20] im Darmstädtischen werden zu können, oder das phantastische Projekt, in eine «Dichterkolonie» auf der Südsee-Insel Tahiti zu ziehen.
Aus der Reise nach das Land Norwegen wird nichts, aber dem Onkel Josias Lorck, Pastor an der deutschen Friedenskirche zu Christianshaven, Kopenhagens Hafenviertel, gelingt es, Matthias als Sekretär bei dem Grafen Holstein in der dänischen Metropole unterzubringen. Die Umsiedlung zu Beginn des Jahres 1764 bedeutet Abschied von dem soeben erst gewonnenen Freund Schönborn und – trotz der nur kurzen Dauer – bleibende Berührung mit einer neuen größeren, weitergespannten Welt. Gottlob Friedrich Ernst Schönborn (1737–1817) war ein aus dem Harz stammender, von klein auf in Holstein lebender Pfarrerssohn, der nun nach Philosophie-, Mathematik- und sprachwissenschaftlichen Studien als Hauslehrer auf dem Gut Trenthorst bei Reinfeld wirkte, eine, wie Roedl es ausgedrückt hat, «von ewigen Zweifeln und unstillbarem Wissensdurst getriebene, niemals befriedigte, ungestüme Natur, vor keiner Maßlosigkeit der Spekulation zurückschreckend; dabei ein zur Freundschaft und Liebe geschaffenes Herz …»[21]