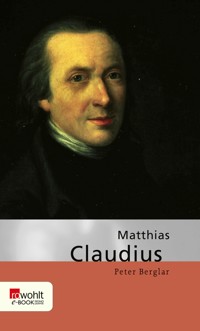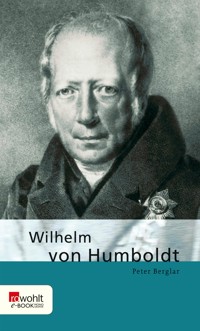
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Rowohlt E-Book Monographie Wilhelm von Humboldt (1767–1835) war Philosoph, Sprachforscher und preußischer Staatsmann. Er wirkte stets über enge Fachgrenzen hinaus und hat Maßstäbe gesetzt, die bis heute fortwirken. Der von ihm entworfene wissenschaftliche Universalismus ist noch immer hochgradig aktuell. In dieser kurzen Biographie werden das Leben und Wirken Wilhelm von Humboldts beschrieben und seine wichtigsten Leistungen gewürdigt. Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Peter Berglar
Wilhelm von Humboldt
Über dieses Buch
Rowohlt E-Book Monographie
Wilhelm von Humboldt (1767–1835) war Philosoph, Sprachforscher und preußischer Staatsmann. Er wirkte stets über enge Fachgrenzen hinaus und hat Maßstäbe gesetzt, die bis heute fortwirken. Der von ihm entworfene wissenschaftliche Universalismus ist noch immer hochgradig aktuell. In dieser kurzen Biographie werden das Leben und Wirken Wilhelm von Humboldts beschrieben und seine wichtigsten Leistungen gewürdigt.
Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Vita
Peter Berglar, geboren 1919 in Kassel und aufgewachsen in Darmstadt, lebte seit 1950 in Köln. Mehr als zwanzig Jahre war er als Arzt (Internist) tätig, ehe er sich, ab 1966, endgültig und ausschließlich den Geisteswissenschaften zuwandte. Er promovierte mit einer Monographie über Walther Rathenau zum Dr. phil. und habilitierte sich an der Universität zu Köln für das Fach Mittlere und Neuere Geschichte. Neben seiner dortigen Lehrtätigkeit wirkte er als Schriftsteller und Publizist weit über die Grenzen seines Fachs hinaus. Zahlreiche belletristische Werke, Essays und Aufsätze sowie Biographien, u. a. erschienen bei rowohlts monographien die Bände «Annette von Droste-Hülshoff» (1967), «Matthias Claudius» (1972) und «Maria Theresia» (1980). Er starb 1989.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2015
Copyright © 1970 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung any.way, Cathrin Günther
Coverabbildung akg-images, Berlin
ISBN 978-3-644-53301-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Wilhelm von Humboldt heute
Immer wieder unerwartet geschieht es, dass aus den Lagerhallen der Geschichte geistiger Sprengstoff zutage gefördert wird, der, lange fast vergessen, nun plötzlich allgemeines Aufsehen erregt und aktuelle Bedeutung findet. Eine bleiche, vornehme Denkmalsfigur nimmt wieder Fleisch und Blut an, steigt von ihrem Sockel, tritt unter uns, erhitzt die Gemüter und entflammt die Meinungen gegeneinander. So ist es mit Wilhelm von Humboldt und seinem Werk – genauer: seiner Hinterlassenschaft. Der Kampf um die Hochschulreform, der sich schon bald nach dem Zweiten Weltkrieg andeutete, aber im Für und Wider der Kommissionen, Ausschüsse, Pläne und unter dem Gewicht scheinbar dringenderer Sorgen zunächst versackte, ist seit knapp vier Jahren in voller Schärfe entbrannt. Er beginnt mehr und mehr sich von seinem ursprünglichen Gegenstände abzulösen; es geht nicht allein um die Neuordnung der deutschen Hochschule, es geht um Bildungsbegriff und Bildungssystem, um Wissenschaftstheorie und Wissenschaftspraxis, und es geht damit um Lebensgefühl und Lebenshaltung einer neuen Generation, einer neuen Epoche.
Mitten im Kampffeld ragt die Gestalt Wilhelm von Humboldts auf: Sein Werk ist in Frage gestellt, seine Auffassung von Bildung, von Wissenschaft, von Schule und Universität in ernste Zweifel gezogen, seine humanistische Weitsicht als überholte Illusion verdächtigt. Grund genug, uns mit ihm zu beschäftigen. Immerhin besuchen noch Millionen Kinder und junger Leute die höheren Schulen und Universitäten, die er, wenn man einmal so sagen darf, «erfunden» hat und die seitdem, seit mehr als eineinhalb Jahrhunderten also, im Prinzip, ihren von Humboldt gelegten Fundamenten nach, erhalten geblieben sind.
Es soll in dieser Monographie nichts «bewiesen» werden – weder dass Humboldt ein idealisches Leitbild abgebe, noch auch das Gegenteil, dass seine Idealität, wie Nietzsche meinte, nur falsch, affektiert, unecht sei[1]; weder dass seine reformerischen Leistungen zeitlose Gültigkeit zu beanspruchen hätten, noch dass sie von Anfang an verfehlt gewesen und heute völlig absurd seien. Eine Persönlichkeit von seinen Ausmaßen kann überhaupt nicht nach ihrer «Nützlichkeit» und «Brauchbarkeit» beurteilt werden. Wenn man sich Rechenschaft darüber zu geben sucht, ob und wie zwischen ihm und seiner Zeit und uns und unserer Zeit lebendige Verbindung bestehe, muss man sich vor Augen halten, dass dabei nicht platte Kausalität gemeint sein kann, sondern nur eine Begegnung, deren Wirkung ganz unbestimmt ist; sie trägt ihren Wert in sich, weil der, dem unser Fragen gilt und dem wir näherzutreten wünschen, ebenso wie seine Epoche ihren Wert, ihr Gewicht, ihre Bedeutung in sich tragen – selbst dann, wenn sich gar keine konkreten Bezüge zu uns mehr fänden. Historisch fragen, heißt nicht voraussetzungslos, aber es heißt selbstlos fragen. Und «selbstlos» meint: um höchstmögliche Gerechtigkeit, Objektgerechtigkeit, bemüht, nicht um die «Abstützung» vorgefasster Thesen durch manipulierte Vergangenheitsmaterialien.
Im Jahre 1967 brachte die Bundesbank ein Fünf-Mark-Stück mit dem Doppelbildnis der Brüder Humboldt heraus: Alexander, der jüngere, ist en face, Wilhelm im Profil dargestellt. Dies mag, unbewusst, ein Symbol sein: Alexander, der große Entdeckungsreisende, der Wissenschaftsheros Südamerikas, der bahnbrechende Geograph und Naturforscher, scheint unserer Zeit näherzustehen[2], scheint unkomplizierter, überschaubarer und «aktueller», während der Bruder, der «Minister des Geistes», der Diplomat, Sprachforscher und deutsche Klassiker «Numero drei» nach Goethe und Schiller, dahinter zurücktritt ins Grau einer kaum noch interessierenden geistigen Existenz, tatsächlich – wenn überhaupt – nur noch im Profil, nur noch halb sichtbar. Wie aber steht es wirklich damit?
Abgesehen davon, dass auch Alexander von Humboldt im Bewusstsein der Deutschen von heute nur einen sehr bescheidenen Platz einnimmt – es gibt keine und gab nie eine deutschsprachige Gesamtausgabe seines Riesenwerkes[3] –, so ist der Name Wilhelms tatsächlich zu nicht viel mehr als einem Gebildetenschlagwort abgesunken, zitiert, wo über humanistische Gymnasien, den Wert des Griechischen und das Selbstverständnis der Universität gestritten wird. Insofern ist er tatsächlich nichts weiter als ein schemenhaft verschwimmendes Profil, und es erscheint an der Zeit, ihn wieder einmal in die volle Ansicht zu rücken und von allen Seiten zu betrachten. Denn es fällt auf, wie sehr Wilhelm von Humboldt, der einen Bildungsbegriff prägte, selber zum bloßen Bildungsbegriff geworden ist, und wie sehr diesem alle Anschauung, Wärme, Lebendigkeit mangeln. Es fällt noch einiges andere auf: Humboldt, der Mann der Missverhältnisse im geistigen Haushalt der Nation, in dem er einen teils zu exponierten, teils zu geringen Platz einnimmt; der Mann der Diskrepanz zwischen Leistungen und Wirkungen, die einander nicht nur nicht entsprechen, sondern sogar verzerren, weil manche seiner aus einer bestimmten geschichtlichen Stunde geborenen Handlungen sich zu Dauerformen verfestigten und, umgekehrt, einige seiner guten, zeitlosen Hervorbringungen vergessen wurden; schließlich Humboldt, der Mann der vielfältigen Anlagen, die dauernd zur Verzettelung zu führen drohten, der universalen Ideen, die keinen rechten Ort innerhalb der engen preußisch-deutschen Realität seiner Tage fanden; der Mann, alles in allem, der Ansätze ohne Vollendung.
1790 trat der Dreiundzwanzigjährige nach Abschluss seiner Rechts- und klassischen Philologiestudien als Referendar in den preußischen Staatsdienst, aber ein Jahr später schon schied er wieder aus, um in aristokratischer Zurückgezogenheit mit seiner Frau Caroline nur der eigenen Bildung und «Glückseligkeit» zu leben. 1792 vollendete er die Schrift Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen. 1793 schrieb er die humanistisch-bildungsphilosophische Abhandlung Über das Studium des Altertums und des Griechischen insbesondre; ein paar Freunde bekamen das zu lesen, die Veröffentlichung aber erfolgte erst viele Jahre nach seinem Tode. Das gilt auch für die ebenfalls 1793 entstandene Schrift Theorie der Bildung des Menschen, ein Fragment, dem der bedeutende Erschließer Humboldts, Albert Leitzmann[4], zu Titel und später Publikation verhalf. Der aus dem freundschaftlichen Umgang mit Schiller und Goethe geborene Plan einer vergleichenden Anthropologie blieb – Plan. Dem ersten veröffentlichten selbständigen Werk des Zweiunddreißigjährigen: Ästhetische Versuche. Erster Teil. Über Goethes Hermann und Dorothea, wurde wenig Beachtung geschenkt und folgte nie ein zweiter Teil. Das große Vorhaben, die antike Kultur- und Staatenwelt umfassend darzustellen, erschöpfte sich in zwei schmalen Fragmenten Latium und Hellas (1806) und Geschichte des Verfalls und Unterganges der Griechischen Freistaaten (1807/08), und die Idee, das ganze 18. Jahrhundert im Zusammenhang vorzuführen, musste nach einer sehr extensiv geratenen Einleitung als unrealisierbar aufgegeben werden.
Der preußische Ministerresident beim Päpstlichen Stuhl, Wilhelm von Humboldt, machte in diesen Jahren 1802 bis 1808 zwar die entscheidende innere Entwicklung zu jener markanten und ingeniösen Persönlichkeit durch, als die er dann 1809, für alle Welt eigentlich unerwartet, die politische Bühne betrat, aber nüchtern betrachtet, im Sinne von Beruf und Laufbahn, stellte Rom nur eine drittklassige Mission dar. Dies Schicksal, als Staatsmann nicht in die vorderste Reihe zu gelangen, nie in die «erste Garnitur» aufzusteigen, hat Humboldt bis zum Schluss, bis zum Ausscheiden aus dem Staatsdienst, nicht wenden können. Der Versuch dazu brachte ihn 1819 endgültig zu Fall. Auch als «Geheimer Staatsrat und Direktor der Sektion des Kultus und öffentlichen Unterrichts im Ministerium des Innern», als der er das große preußische Schul- und Universitätsreformwerk einleitete, blieb er dem Minister unterstellt. Da ihm das menschlich und sachlich untragbar erschien, nahm er den Gesandtenposten in Wien an, 1810 bis 1814, wechselte damit aber nur den Vorgesetzten, der nun der Staatskanzler von Hardenberg war; ehrenvoll, wichtig und erfolgreich war seine diplomatische Mitwirkung bei den Verhandlungen zu Prag und Châtillon mit dem wankenden napoleonischen Regime, auf dem Wiener Kongress 1814/15, am Zweiten Pariser Frieden 1815, aber immer stand er im zweiten Glied, im Schatten Hardenbergs, der sich seiner als eines nützlichen Gehilfen bediente. Regierungsverantwortung blieb ihm versagt, mit seinen Verfassungsentwürfen und Verwaltungsreformplänen drang er nicht durch, politische Macht wurde ihm nie zuteil, nicht einmal ein wirklich eigenständiges Ministerium; als er es gegen Hardenberg erzwingen wollte, entließ ihn der König.
Humboldt heute – was ist geblieben, was lebt und wirkt noch? Für den Staatsmann Humboldt ist das schnell beantwortet: Von den rund achtzehn Jahren seiner amtlichen Tätigkeit sind es die sechzehn Monate als Sektionschef des preußischen Unterrichtswesens, die eine dauernde Prägung der deutschen Entwicklung hinterlassen haben und deshalb heute unser erneutes kritisches Interesse finden müssen. Viel schwerer fällt die Antwort für den Denker, Forscher und Schriftsteller Wilhelm von Humboldt. Hier muss der Begriff des «Lebendigen», «Wirkenden» selbst unter die Lupe genommen werden. Natürlich sind ein Gottsched, ein Bürger, ein Zacharias Werner heute nicht mehr «lebendig» in dem Sinne, dass man ihre Werke liest oder auch nur einen bewussten Zugang zu ihnen hat; freilich «wirken» heute ein Rechtsgelehrter wie Pufendorf oder ein Altertumsforscher wie Bachofen nicht mehr in dem Sinne, dass ihre Arbeitsergebnisse eine unmittelbare, spürbare Bedeutung für uns besäßen, aber sie alle, diese lange Reihe der Dichter, Künstler, Denker, Gelehrten aus drei Jahrtausenden, leben und wirken, indem sie als aktive Partikel in den Kulturhumus der Menschheit eingegangen sind, und als eben jede Epoche und jede Gesellschaft die Summe aller vorher gelebten Zustände aller ihrer Glieder darstellen.
Aus der gewaltigen Masse der Humboldt’schen Schriften, wie sie in der siebzehnbändigen Ausgabe der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften – schwer zugänglich – aufgehäuft liegt, ist dem Durchschnittsgebildeten nurmehr weniges gegenwärtig, obwohl sich darunter so geistes- und wissenschaftsgeschichtlich wichtige Arbeiten befinden wie die erwähnte staatsphilosophische Grundsatzschrift Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen, die man eigentlich als die Magna Charta des deutschen Liberalismus des 19. Jahrhunderts bezeichnen kann, oder die sprachphilosophische Altersschrift Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts, die die Sprache als das eigentliche wesenhafte Sein des Menschen, der nur in Sprache er selbst ist, erkannte. Es gibt für den geistig-schöpferischen Menschen eben noch eine andere Weise des Fortlebens und Fortwirkens, als in Lehrbüchern zu stehen oder den Zitatenschatz zu nähren; seine exemplarische Haltung in gewissen Fragen, seine vielleicht typischen Wandlungen, seine Grundsatzentscheidungen oder seine Methodik können derart sein, dass sie in späteren, veränderten, aber doch analogen Konstellationen die Bedeutung von Mustern gewinnen und von späteren, gewandelten, aber doch verwandten Generationen prinzipielle Antworten verlangen.
Gerade das gilt für Wilhelm von Humboldt. Er ist, wie wenige andere Deutsche, ein solcher Probierstein, an dem nicht nur deutsche, sondern europäische, ja allgemeinmenschliche Möglichkeiten geprüft werden können. Hierfür einige Beispiele: Seine Jugendschrift über die Machtgrenzen des Staates ist bis heute deshalb so «aktuell» geblieben, weil sie eine der beiden großen Eckpositionen – die andere hält nach wie vor Hegel – in der Frage nach dem Verhältnis zwischen Staat und Einzelmensch einnimmt. Wenn Humboldt schreibt: Das höchste Ideal des Zusammenexistierens menschlicher Wesen wäre mir dasjenige, in dem jedes nur aus sich selbst und um seiner selbst willen sich entwickelte[5], oder an anderer Stelle: Der Staat enthalte sich aller Sorgfalt für den persönlichen Wohlstand der Bürger und gehe keinen Schritt weiter, als zu ihrer Sicherstellung gegen sich selbst und gegen auswärtige Feinde notwendig ist; zu keinem anderen Endzwecke beschränke er die Freiheit[6], dann bezeichnet das eine der grundsätzlich möglichen weltanschaulich-gesellschaftspolitischen Haltungen, um die, wenn auch mit versetzten Akzenten und unter allerlei Tarnformen, immer wieder gerungen werden wird, und die deshalb auch immer wieder kritisch untersucht werden müssen.
Ein anderes Beispiel. 1809, aus Rom noch auf Initiative des Freiherrn vom Stein in die von Napoleon niedergeworfene Heimat zurückgerufen, um das gesamte Bildungswesen zu erneuern, verfasste Humboldt den berühmten «königsbergischen» und «litauischen» Schulplan. In letzterem, dessen eigentlicher Titel Unmaßgebliche Gedanken über den Plan zur Errichtung des litauischen Stadtschulwesens[7] lautet, heißt es: Alle Schulen aber, deren sich nicht ein einzelner Stand, sondern die ganze Nation oder der Staat für diese annimmt, müssen nur allgemeine Menschenbildung bezwecken. Was das Bedürfnis des Lebens oder eines einzelnen seiner Gewerbe erheischt, muß abgesondert und nach vollendetem allgemeinem Unterricht erworben werden. Wird beides vermischt, so wird die Bildung unrein, und man erhält weder vollständige Menschen noch vollständige Bürger einzelner Klassen. Denn beide Bildungen – die allgemeine und die spezielle – werden durch verschiedene Grundsätze geleitet. Durch die allgemeinen sollen die Kräfte, das heißt, der Mensch selbst gestärkt, geläutert und geregelt werden; durch die spezielle soll er nur Fertigkeiten zur Anwendung erhalten … Ein Hauptzweck der allgemeinen Bildung ist, so vorzubereiten, daß nur für wenige Gewerbe noch unverstandene und also nie auf den Menschen zurückwirkende Fertigkeit übrigbleibe.[8] Wieder hat Humboldt hier eine Stellung bezogen, deren klare Entschiedenheit das Kernproblem des europäischen Bildungs- und Erziehungsbegriffs trifft und die gerade heute heftig umstritten wird. Was ist überhaupt Bildung? Gibt es eine «allgemeine», was muss sie umfassen, ist sie noch möglich? Oder geht es nur um spezifische Ausbildung nach den praktischen Erfordernissen der Gesellschaft? Gibt es ein unveräußerliches geistig-sittliches Allgemeingut, das jedem Menschen zusteht – und wenn ja, ist es durch Schule zu vermitteln, und wie ist es mit der heute notwendigen Spezifizierung des Gesellschaftsglieder zu verbinden? Schwierige Fragen – auf sie antworten, heißt, für oder gegen Wilhelm von Humboldt und seine Prinzipien, auf denen weithin unsere Schuleinrichtungen noch gründen, sich auszusprechen, oder auch den «Weg der Mitte» zu suchen, der überzeitlich gültige Erkenntnisse des preußischen Reformers abtrennt von ihren einst zeitgebundenen, jetzt überalterten Formen in der Praxis.
Ein drittes Beispiel: Nach dem Scheitern im Kampf um die Organisation der preußischen Regierungsspitze und der Verabschiedung durch den König waren Wilhelm von Humboldt noch fünfzehn Lebensjahre vergönnt, in denen er, auf mannigfachen früheren Ansätzen wie etwa dem Schluss der Arbeit Latium und Hellas oder den Betrachtungen über das klassische Altertum (1806) oder der Schrift über die Vasken[9] im Jahre 1801 weiterbauend, sich zum bedeutenden Sprachforscher, einem der Begründer dieser jungen Wissenschaft, und zum großen Sprachphilosophen entwickelte. In der Abhandlung Über die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues, deren wichtigste Partien möglicherweise auch schon in die römische Zeit fallen, sagt Humboldt: Im Menschen aber ist das Denken wesentlich an gesellschaftliches Dasein gebunden, und der Mensch bedarf, abgesehen von allen körperlichen und Empfindungsbeziehungen, zum bloßen Denken eines dem Ich entsprechenden Du … Der Begriff erreicht seine Bestimmtheit und Klarheit erst durch das Zurückstrahlen aus einer fremden Denkkraft … Zwischen Denkkraft und Denkkraft aber ist die einzige Vermittlerin die Sprache, und so entsteht auch hier ihre Notwendigkeit zur Vollendung des Gedankens.[10] Eine solche Auffassung vom Wesen der Sprache, die sich ebenso gegen die vor Humboldt herrschende Meinung, Sprache sei bloß ein zweckgebundenes, zusätzliches Werkzeug des Menschen, wie gegen die nach Humboldt auftretenden Vorstellungen, Sprache sei technisches Instrument und also – etwa als Esperanto – konstruierbar, abgrenzt und die dann hundert Jahre später von ganz anderer Seite, nämlich von dem österreichischen Sprachphilosophen Ferdinand Ebner in seiner «Pneumatologie des Wortes»[11] zur Theologie der Sprache hin erweitert wird, bedarf immer wieder der neuen Konfrontierung mit der eigenen Spracherfahrung eines Zeitalters.
Wenn diese kleinen Proben vielleicht auch eine Ahnung davon geben, welche formende Bedeutung Humboldt für uns haben könnte, sofern wir uns sein Werk in handlichen Ausgaben und durch Beschäftigung an Schule und Universität wieder naherückten, so muss doch hinzugefügt werden, dass dieses Werk keinerlei Rezepte, sondern Einsichten – nämlich in Alternativpositionen – liefert und dass das eigentlich Wichtige, und sagen wir ruhig «Interessante» im Menschen Humboldt, in seinem so merkwürdig bewusst «gestalteten» Leben liegt.
Die Maximen, wie dieses Leben «glücklich» zu führen sei, hat sich Humboldt schon früh zurechtgelegt; teils entsprachen, teils widersprachen sie seiner Natur. Harmoniegesetze in sich zu entdecken und ihnen zu folgen, darin war er ein Meister, fast wie Goethe; aber er vermochte sie sich auch anzubefehlen und dem «Ideal» zu gehorchen wie ein Soldat, darin eher Kant nahe. An Schiller schrieb er unter dem 2. Februar 1796 aus Berlin: Es gibt nun ein doppeltes Leben für den Menschen, eins in bloßer und der höchsten Tätigkeit, mit der er strebt, etwas zu finden oder zu sein, was teils ihn selbst überleben, teils schon dadurch, daß es eine Zeitlang durch, ihn still mithandelt, auf den menschlichen Geist überhaupt erweiternd wirkt, ein anderes in bloß ruhiger Freude und heiterem Genuß, wo der Mensch sich begnügt, glücklich und schuldlos zu sein. In beidem ist ein gewisser Zweck und eine sichere Belohnung. Nur eine Art des Lebens, die dritte noch mögliche, ist fatal und doch … so häufig, diejenige, die, ohne wenigstens überwiegenden Genuß, bloß Arbeit gibt und wo die Arbeit nur dazu dient, das Bedürfnis zu befriedigen.[12] So spricht der Aristokrat. Ihn kümmerte nicht – ja, der Gedanke kam ihm gar nicht –, wie es denn mit «Genuß» und «Bedürfnis» bei den Armen, den Gedrückten, dem Bodensatz der Gesellschaft, auf deren Höhen er zeitlebens wandelte, sich verhalte. Mit provozierender Naivität fügte er hinzu: Daher ja auch im Privat- und politischen Leben alles darauf ankommt, die Gegenstände des Bedürfnisses zu vermindern und die des Genusses und der freien Tätigkeit zu vermehren.[13]
Humboldt ist diesen goldenen Regeln der Selbstliebe mit einer fast monomanen Egozentrik gefolgt – auch als Patriot und in den Krisen Preußens. Er ließ sich lange bitten, machte Schwierigkeiten, lehnte ab, wenn die vaterländische Tätigkeit nicht «genußreich» genug erschien – wobei natürlich «Genuß» nicht trivial, sondern als Befriedigung mehr oder minder sublimer Ich-Triebe verstanden werden muss. Sank der «Genuß-Pegel» unter einen gewissen Strich, dann warf er die Sache hin, so 1791, 1810, 1819 seine Staatsämter, so auch viele literarische und wissenschaftliche Arbeiten, die weniger aus Unvermögen als auch plötzlicher Unlust heraus Fragment blieben. In der Sprachforschung und der Sprachphilosophie leistete er das Abgeschlossenste, weil sie ihm am meisten Spaß machten.
Der Sechzigjährige sah zufrieden auf sein Leben und darum auch gelassen auf den Tod – oder er tat so. Auch ist das Leben ein Akt, schrieb er an Gentz (13. Juli 1827), der wohl geführt, aber auch wohl beschlossen sein will, und wer klug ist, geht also gern, wenn er am glücklichsten ist. Und glücklich bin ich sehr, so innerlich und äußerlich geschlossen, daß ich keinen Wunsch habe, den ich nicht durch mich erreichen könnte.[14] Unwillkürlich zuckt man bei einem solchen Satz zusammen – ist er Bescheidenheit oder Hochmut? Weisheit oder Vermessenheit? Er ist beides, und er ist eines vor allem: Willenskrampf, undenkbar aus Goethes Munde. In der Tat gibt es den «anderen» Humboldt, den verkrampften, den unzufriedenen, den negativistischen und erotisch fatalen. Er war keine Marmorbüste des deutschen Idealismus, wie ihn das spätere 19. Jahrhundert sah; er war ein Mensch aus Fleisch und Blut, mit Widersprüchen und Nachtseiten, geleitet allerdings von einem bewunderungswürdigen Willen, sich idealischer Vervollkommnung anzunähern, wie er sie als ein Mixtum compositum aus Winckelmann-Antike, Kantischer Ethik und Freundes-Vorbildern in Goethe und Schiller verstand. Er ist auf diesem Wege so weit gelangt, wie eine groß angelegte Persönlichkeit, der eine letzte, von Menschenliebe durchpulste Demut fehlt, gelangen kann. Sicherlich gehört zu den Siegen auf diesem Wege auch seine Ehe mit Caroline Friederike von Dacheröden, die ihm in seinen Vorzügen und Fehlern so ähnlich gewesen ist; eine Ehe, durchaus nicht ohne Spannungen, Krisen, ja Sperrzonen, im Ganzen aber eine Gemeinschaft, hoch über den Durchschnittsehen des folgenden Jahrhunderts stehend und Ibsens Freiheitsvorstellungen weit übersteigend.
Dieser Humboldt, der Gatte, der Briefschreiber (allein die Korrespondenz mit seiner Frau füllt sieben starke Bände), der Tagebuchverfasser, der heimliche Dichter, der mit pedantischer Regelmäßigkeit von Januar 1832 bis zu seinem Tode im April 1835 täglich, genauer nächtlich, ein Sonett verfertigte – 1183 im Ganzen –, bietet keine «Aktualität» im Sinne des für uns Übernehmbaren, aber die Tatsache, dass einer vor uns sein Leben bewusst und klar in die Hand genommen, es mit seinen Mitteln, in seinen Gegebenheiten und Grenzen, in den Zwängen und Chancen seiner Epoche zu einer sinnerfüllten, fruchtbaren Wirklichkeit zu machen versucht hat, wirkt doch, zeitlos, als Trost und Anreiz.
Ein junger Herr von Stande
Die Humboldts stammen aus Pommern; erst verhältnismäßig spät, vor Beginn des Dreißigjährigen Krieges, treten sie in das Blickfeld, eine tüchtige und strebsame, aber keineswegs auffallende Familie von Beamten und Offizieren im Dienste der Hohenzollern. Sie gehörten nicht zu den großen alt-adligen Sippen des deutschen Ostens, wenn sie auch über Sophie Dorothea von Schweder, die Großmutter Wilhelms und Alexanders, mit den Schlieffen, Podewils und Kleist verwandt wurden. Die Nobilitierung ist recht jungen Datums, aus dem Jahre 1738; damals wandte sich Großvater Johann Paul von Humboldt (1684–1740) in einem Immediatgesuch um Erneuerung, genauer, um Verleihung des Adels an Friedrich Wilhelm I., wobei er übrigens darauf hätte verweisen können, dass sein Vater Conrad (1650–1725) schon zwischen 1708 und 1720 städtische Urkunden mit dem Humboldt’schen Wappen siegelte, sich als Erster «von Humboldt» nannte, als solcher auch in der Trau- und Sterbeurkunde bezeichnet wurde, ja, dass das Adelsprädikat sich in der Bestallungsurkunde zum kurfürstlichen Rat vom 11. März 1682 findet. Vollkommen eindeutig war der Fall nicht; als geadelt gelten die Humboldts erst mit der «allerhöchsten Bewilligung» des Gesuchs durch den König im Jahre 1738. Ein Diplom wurde nicht ausgestellt.
Wie dem Großvater Johann Paul, der es zum «Kapitän» bei der Infanterie gebracht und in der Schlacht von Turin 1706 einen Fuß verloren hatte, so war auch der Vater der Brüder Humboldt, Alexander Georg (1720–79), preußischer Offizier; er nahm an den drei schlesischen Kriegen teil, zeichnete sich aus, zog sich durch einen Sturz vom Pferde eine schwere Brustverletzung zu und quittierte deshalb 1761 den Dienst als Major. Vier Jahre später ernannte Friedrich der Große ihn zum Kammerherrn bei der Gemahlin des Thronfolgers. Nach der Scheidung dieser Ehe im Jahre 1769 wurde zwar Alexander Georg von Humboldt wieder aus der Hofstellung entlassen, gehörte aber bis zu seinem Tode dem Freundeskreis um den späteren Friedrich Wilhelm II. an.
Der damals sechsundvierzigjährige, gerade neugebackene Kammerherr heiratete 1766 die um mehr als zwei Jahrzehnte jüngere Marie Elisabeth Colomb, die Mutter Wilhelms und Alexanders. Sie brachte nicht nur bedeutenden Besitz mit, so vor allem Schloss Tegel, sondern auch das weitgespannte europäische Bluts- und Kulturerbe, dessen Mischung mit dem pommerschen Schlag der Humboldts dann zu der verblüffenden Erscheinung dieser beiden genialen Brüder führen sollte, von denen Friedrich Schaffstein sagt: «Beide umfaßten zusammen fast das ganze wissenschaftliche Streben ihrer Zeit.»[15] Die Colombs waren einst nach Aufhebung des Edikts von Nantes (1695) durch Ludwig XIV. als Refugiés aus Südfrankreich (Languedoc, Nîmes) über Kopenhagen nach Brandenburg gekommen. In Neustadt an der Dosse hatte Johann Heinrich (Jean Henri) Colomb (1695–1759), der Großvater Wilhelms und Alexanders mütterlicherseits, eine Spiegelmanufaktur betrieben. Über seine Frau Justine Susanne Durhain (1716–62) verzweigen sich die mütterlichen Vorfahren der Brüder nach Schottland, Rheinland, Flandern und in die Pfalz. Es finden sich unter ihnen manche Gelehrte – Juristen, Mediziner – und schon im 16. wie im 17. Jahrhundert Rektoren der Universität Heidelberg.
Der Vater wird als ein liebenswürdiger, geschmackvoller Kavalier geschildert, der in Tegel ein gastliches Haus führte, wo ihn nicht nur gelegentlich der Kronprinz, sondern 1778 auch Karl August von Weimar und Goethe besuchten. Eine sehr scharf profilierte Persönlichkeit scheint er nicht gewesen zu sein. Frau von Humboldt überlebte ihren Gatten um fast achtzehn Jahre. Auf ihr lag die alleinige Verantwortung für die Erziehung der beiden Jungen und für die Verwaltung und Erhaltung des ausgedehnten Besitzes, von dem das Gut Falkenberg (bei Berlin-Malchow) ihrem Sohn aus erster Ehe, Rittmeister von Holwede, als väterliches Erbe gehörte. Massenbach zitiert einen Brief der Frau de la Motte-Fouqué, der sehr plastisch die Witwe von Humboldt und die Atmosphäre ihres Hauses zeichnet: «Alles ist bei den Humboldts, wie es war. In dem Hause ändert sich nichts, weder die Menschen noch die Art und Weise. Ihn werde ich zwar immer sehr vermissen. Seine leichte, muntere Unterhaltung machte einen charmanten Kontrast zu der leisen Ruhe und Gemessenheit seiner Frau. Diese … sieht heute so aus, wie sie gestern aussah und morgen aussehen wird. Der Kopfputz wie vor zehn Jahren und länger, immer glatt, fest, bescheiden. Dabei das blasse, feine Gesicht, auf dem nie die Spur irgendeines Affektes sichtbar wird. Die sanfte Stimme, die kalte gerade Begrüßung und die unerschütterliche Treue in all ihren Verbindungen … Man kann darauf schwören, wie man sie heute verläßt, so findet man nach Jahr und Tag die Familie im Innern und Äußeren wieder.»[16]
Als dieser Brief 1785 geschrieben wurde, begannen die Brüder gerade ihre ersten Schritte in das geistige und gesellschaftliche Leben Berlins zu tun; zwei für jene Zeit kurz vor Ausbruch der Revolution typische, zunächst gar nicht weiter auffällige junge Herren von Stande, die da trotz der zwei Jahre Altersunterschied – Wilhelm ist am 22. Juni 1767, Alexander am 14. September 1769 geboren – miteinander in die Kreise der Berliner Aufklärung um Nicolai (1733–1811), Mendelssohn (1729–86), Biester (1749–1816) und zugleich in deren Widerspiel, in den von Empfindsamkeit und Gefühlsemanzipation der sich ankündigenden Romantik geprägten Salon der Henriette Herz eingeführt wurden. Von dieser Zeit an hat Humboldt sein im Sinne eines «Kunstwerks» sorgsam gepflegtes Leben gerechnet. Die Kindheit und Jugendzeit erschienen ihm im Rückblick später «öde und freudlos dahinwelkend»[17]. Vielleicht war das ein wenig elegisch übertrieben, aber Kindheit und Jugend spielten im 18. Jahrhundert als eigenständige Begriffe keine Rolle, sie stellten nur Übergang zu einem Ziel, nämlich zum Erwachsensein dar, allein der Erwachsene zählte, und erwachsen im gesellschaftlichen Sinne war man wesentlich früher als heute, etwa mit sechzehn oder siebzehn. Bei jungen Adligen lag die Erziehung in den Händen der Hofmeister und Hauslehrer; die Eltern traten zurück und verharrten in oft beträchtlicher Distanz.
Den ersten Unterricht, bis 1777, erhielten die Brüder Humboldt durch den Hauslehrer ihres älteren Stiefbruders von Holwede, den von damals ganz «modernen», aufklärerisch-philanthropischen Ideen à la Rousseau erfüllten Pädagogen Joachim Heinrich Campe (1746–1818), einen der frühesten deutschen Demokraten, der unter anderem die sechzehnbändige pädagogische Enzyklopädie «Allgemeine Revision des gesamten Schul- und Erziehungswesens» (1785–92) herausgab. Wir treffen ihn 1789 wieder als den Begleiter Humboldts auf der Reise nach Paris. Nach seinem Weggang übernahm Gottlob Johann Christian Kunth (1757–1829) für mehr als zehn Jahre die Erziehung der beiden Brüder. Erst 1788 durfte sich Wilhelm bei dem Wechsel von der Universität Frankfurt an der Oder an die Universität Göttingen von ihm trennen, der mit Alexander auf der ersteren zurückblieb. Der ziemlich trockene und pedantische Mann, der es später zum preußischen Staatsrat und Mitarbeiter Steins brachte, vermochte sich Respekt, aber kaum echte Liebe seiner Schüler zu erwerben. Leben und Unterricht – und beides war in einem heute kaum vorstellbaren Maß identisch – spielte sich während des Winters in Berlin, während des Sommers in Tegel ab; in den achtziger Jahren blieb man auch den Sommer über in Berlin. Die Mutter wurde nur sonntags auf ihrem Landsitz besucht. Der Unterricht umfasste die Fächer Geschichte, Deutsch, Mathematik, Lateinisch, Griechisch, Französisch und wurde unter der Aufsicht Kunths von ausgesuchten Lehrern erteilt. Eine öffentliche Schule hat Wilhelm, der spätere Schulreformer, niemals besucht, wie er, der Begründer der neuen deutschen Universität, ja auch niemals an einem irgendwie gearteten gemeinschaftlichen Leben der Studenten teilgenommen hat. Seine Fachlehrer, die ihn von 1785 an auf den Universitätsbesuch vorbereiteten, waren ausgezeichnete Männer, die samt und sonders selbst zu angesehenen Stellungen im Staat aufstiegen: so Geheimrat Christian Wilhelm von Dohm (1751–1820), der den Brüdern Vorträge über Nationalökonomie und Statistik hielt; Ernst Ferdinand Klein (1743–1810), der sie Naturrecht lehrte, ein bedeutender Jurist, Kammergerichtsrat und Mitarbeiter am strafrechtlichen Teil des Allgemeinen Preußischen Landrechts; Johann Jakob Engel (1741–1802) schließlich, der sie in Philosophie und Geschichte der Philosophie unterwies, ein damals hoch in Gunst stehender Aufklärungsphilosoph, der auch den preußischen Kronprinzen, den späteren Friedrich Wilhelm III., unterrichtete. Allen Dreien hatte Humboldt vieles zu verdanken. Dohms und Kleins Einfluss ist besonders in der Schrift über die Grenzen des Staates nachzuweisen, und Engel machte ihn mit den antiken Denkern und mit Leibniz vertraut.
Das geistige und soziale Klima Berlins unterschied sich von dem im übrigen Reich. Während etwa in Baden, Württemberg und Thüringen die neuen Strömungen der Klassik und dann der frühen Romantik kräftig hervorzutreten begannen, blieb Berlin lange die Domäne Christoph Friedrich Nicolais und der Aufklärung verhaftet. Hier erschien die «Berlinische Monatsschrift», herausgegeben von dem populären Philosophen Johann Erich Biester und dem Direktor des Friedrichwerder Gymnasiums Friedrich Gedicke, um «nützliche Aufklärung zu verbreiten und verderbliche Irrtümer zu verbannen»; hier gab Nicolai die «Bibliothek der schönen Wissenschaften und freien Künste» und die renommierte «Allgemeine deutsche Bibliothek» heraus und machte sich über Goethes «Werther» lustig. Neben der Zentralfigur der Berliner Aufklärung, Moses Mendelssohn, dem Freunde Lessings, spielten die Bankiers Veitel Ephraim und Daniel Itzig, die Geldgeber des Siebenjährigen Krieges, David Friedländer, der Kaufmann und Vorkämpfer für die volle Judenemanzipation, und sein Freund, der angesehene Arzt Marcus Herz, eine hervorragende Rolle. Dessen Gattin Henriette, als Tochter des dem portugiesischen Judentum entstammenden Arztes de Lemos 1764 geboren, gründete in den achtziger Jahren den ersten der großen Berliner Salons, der später nur noch von dem der Rahel Levin übertroffen werden sollte.[18] Die geistes- und kulturgeschichtliche Bedeutung dieser Salons lag in der Verbreitung einer neuen Empfindsamkeit, einer neuen, der romantischen Gefühlswelt, in der Knüpfung eines gesellschaftlichen Netzes der Intellektuellen und Gebildeten, die sich seitdem als zusammengehörig (trotz allen Gegensätzen) empfanden und alle untereinander kannten, und in der Befreiung der Frau aus den Fesseln eines missverstandenen «Patriarchentums».