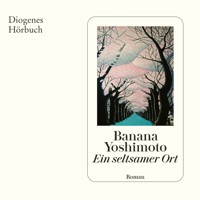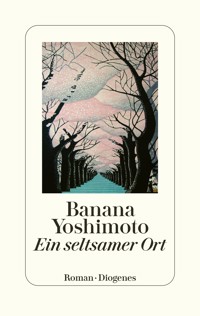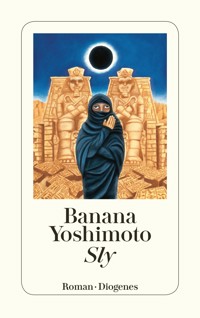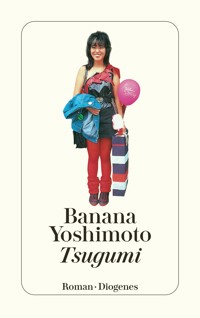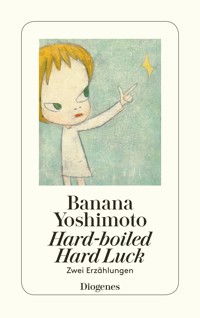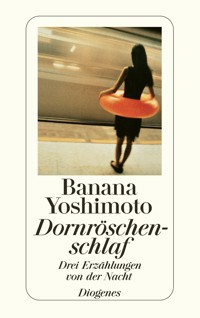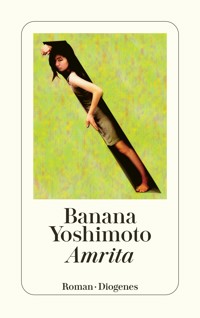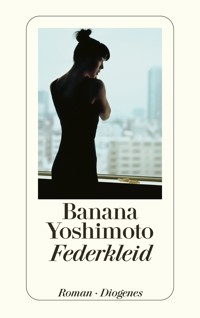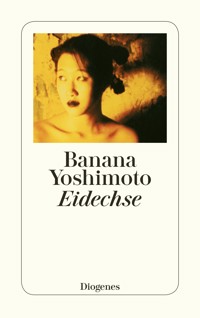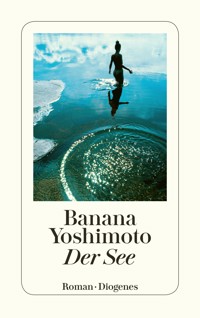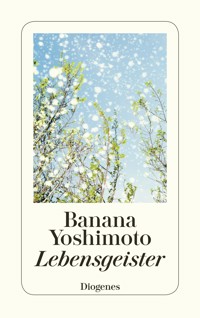7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der rote Faden dieser poetischen Geschichten, die alle mit seelischen Umbrüchen und Grenzsituationen zu tun haben: Manche Gewissheiten kann nur der Körper vermitteln, und er tut es heilsam und hellsichtig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Banana Yoshimoto
Mein Körper weiβ alles
Dreizehn Geschichten
Aus dem Japanischen von
Annelie Ortmanns
und Thomas Eggenberg
Titel der 2000 bei
Bungei Shunju Publishing Co., Ltd.,
erschienenen Originalausgabe:
›Karada Wa Zenbu Shitteiru‹
Copyright © 2000 by Banana Yoshimoto
Die deutsche Erstausgabe erschien
2010 im Diogenes Verlag
Die deutschen Übersetzungsrechte
mit der Genehmigung
von Bungei Shunju Publishing Co., Ltd.,
unter Vermittlung des Japan Foreign-Rights Centre
Die ersten sechs Geschichten
wurden von Annelie Ortmanns übersetzt,
die restlichen sieben von Thomas Eggenberg
Umschlagfoto (Ausschnitt) aus dem Bildband
›Tokyo Girls‹, erschienen in der
Edition Reuss, Copyright © Yasuji Watanabe
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2013
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24154 9 (1.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60310 1
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Inhalt
Der grüne Daumen [7]
Ruderboote [24]
Abendsonne [41]
Der schwarze Schwalbenschwanz [50]
Herr Tadokoro [62]
Mein kleiner Fisch [76]
Mumie [93]
Heiterer Abend [107]
Die Wahrheit des Herzens [118]
Blumen und Sturm [133]
Papas Spezialität [142]
The Sound of Silence [162]
Das rechte Maß
[7] Der grüne Daumen
Ich war in der Bahn eingenickt. Als ich die Durchsage der Station hörte und hastig ausstieg, fühlte ich mich noch halb im Traum. Der Bahnsteig wirkte wie eingefroren in der eisigen Winterluft. Ich wickelte mir den Schal fester um den Hals und trat durch die Sperre.
Draußen stieg ich in ein Taxi und nannte dem Fahrer die Pension, zu der ich wollte, aber er erwiderte, er wisse nicht, wo das sei. Mir fiel wieder ein, dass es sich um eine neue kleine Pension handelte, die offenbar kaum Werbung für sich machte, und bat ihn, mich irgendwo in der Nähe der Adresse aussteigen zu lassen.
Ich stand inmitten von Feldern, in der Ferne blickte ich auf eine sanfte Berglandschaft. Da entdeckte ich ein kleines Schild, das zur Pension wies, und folgte ihm einen schmalen Pfad hinauf.
An die Kälte hatte ich mich gewöhnt und freute mich über die reine, klare Luft. Inzwischen war ich vollkommen wach und begann sogar schon ein [8] wenig zu schwitzen, als ich vor mir plötzlich die Nähe eines alten Bekannten spürte.
Es war im vergangenen Winter, als wir uns Sorgen wegen der Aloe zu machen begannen, die allmählich auf die Straße hinauswucherte.
Mein Vater, meine Mutter und ich hatten die Pflanze ganz vergessen, die meine jüngere Schwester für dreihundert Yen gekauft und neben der Haustür eingepflanzt hatte, weil im Garten kein Platz mehr dafür war. »Aloe hier, Aloe da, du musst das Blattgel einnehmen oder auf den Pickel schmieren, Aloe ist für alles gut, ein wahres Wundermittel!«, hatte meine Schwester uns eine Zeitlang in den Ohren gelegen, aber selbst sie war schnell wieder aus ihrem Aloe-Fieber erwacht, mit dem sie sich in irgendeiner Zeitschrift oder sonstwo angesteckt hatte, und kümmerte sich bald nicht mehr um die Pflanze. Doch obwohl sie fast nie gegossen wurde und da, wo sie stand, kaum Sonne abbekam, wuchs die Aloe prächtig. Zu prächtig, denn ehe wir uns versahen, war sie baumgroß geworden, überwucherte den Weg und fing zu allem Überfluss auch noch an, widerlich geformte Trauben zu bilden, an denen blutrote Blüten aufgingen.
Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, an dem dieses Thema zur Sprache kam. Mein Vater, [9] meine jüngere Schwester und ich saßen um den kleinen Tisch in dem Haus, in dem ich geboren worden und aufgewachsen war. Es schien ein ganz normaler Abend zu werden.
Als meine Schwester und ich klein waren, haben wir zu Hause alles Mögliche an diesem Tisch gemacht: gegessen, gestritten, ferngesehen. Geld zusammengelegt, um Kuchen zu kaufen, den wir dann dort verspeist haben. Unsere Mutter hat ihre Einkäufe darauf abgestellt – die Kaufhaustüte mit ihrer neuen Unterwäsche auch mal neben den getrockneten Fisch fürs Abendessen. Unser Vater hat schon mit dem Gesicht auf der Tischplatte gelegen und seinen Rausch ausgeschlafen, und als meine Schwester in der Mittelschule ihren ersten Liebeskummer durchlitt, hat sie sich dort mit Wein volllaufen lassen, bis sie betrunken vom Stuhl gerutscht und mit dem Kopf auf den Boden geknallt ist. Dieses kleine Viereck war das Sinnbild für unsere Familie. Dort herrschte Körpertemperatur, dort roch es nach Leben – ein weiches, warmes, behagliches Plätzchen. Vor kurzem hat meine Schwester geheiratet und ist ausgezogen. Der Tisch steht zwar immer noch da, aber es kommt kaum noch vor, dass wir uns alle darum versammeln. Meistens sitzt meine Mutter dort allein vor laufendem Fernseher und strickt. So ändern sich die Zeiten.
[10] An jenem Abend meinte mein Vater plötzlich: »Diese Aloe wird langsam zu groß, bald kann der Nachbar kaum noch ein- und ausparken.« Da uns das Umpflanzen lästig war, taten meine Schwester und ich so, als hätten wir seine Bemerkung nicht gehört. »Wenn ihr sie nicht umpflanzt, reiß ich sie raus und schmeiß sie weg!«, drohte mein Vater. »Schon okay, mach nur«, meinten wir und blätterten weiter in unseren Zeitschriften.
So ging das hin und her, bis meine Mutter nach Hause kam, bepackt mit Tüten aus dem Supermarkt um die Ecke. »Hallo Mama«, begrüßten wir sie wie jeden Abend, ohne ihr ins Gesicht zu sehen. Erst als keine Antwort kam, hoben wir die Köpfe und merkten, wie blass sie war. »Was ist los?«, fragte meine Schwester.
»Die Oma! Sie ist doch ins Krankenhaus, weil sie dachte, sie hätte einen Hexenschuss, aber jetzt haben sie Gebärmutterkrebs in weit fortgeschrittenem Stadium bei ihr festgestellt! Sie muss enorme Schmerzen gehabt haben, aber die hat sie einfach ausgehalten, bis es nicht mehr ging. Jetzt ist es für eine Operation wohl zu spät!«
Meine Großmutter lebte allein in einer kleinen Wohnung in einem benachbarten Apartmenthaus. Erst vorgestern hatte sie uns mitgeteilt, sie hätte einen Hexenschuss, und meine Schwester [11] hatte sie mit dem Auto ins Krankenhaus gefahren.
Da meine Eltern beide Einzelkinder sind, haben wir keine große Verwandtschaft, deshalb halten wir im kleinen Kreis umso fester zusammen und besuchten Großmutter jeden Tag abwechselnd im Krankenhaus, mein Vater eingeschlossen. Auf einmal waren wir eine Familie mit anderen Sorgen als dem Wildwuchs einer Aloe-Pflanze. Großmutter kam zwar noch einmal nach Hause zurück, wurde dann aber bald wieder ins Krankenhaus eingeliefert.
Als ich ihr eines Tages ihre geliebten Pfannkuchen mit Anko-Füllung* [* Anko: Mus aus roten Bohnen mit Zucker. (A. d. Ü.)] vorbeibrachte, lag sie friedlich in ihrem Bett und schlief. Es schien ihr gutzugehen. Ich war erleichtert, denn nach Mutters Bericht war es ihr am Tag zuvor wohl erbärmlich gegangen. Sie hatte über solche Schmerzen im Bauch geklagt, dass sie Tränen vergossen hatte.
Sobald ich das Krankenhaus betrat, fühlte ich mich unwohl. Schon in der Eingangshalle wurde ich so kribbelig, dass ich am liebsten sofort kehrtgemacht hätte, aber nach einer Weile gewöhnte ich mich daran. Verließ ich es dann wieder, kam mir draußen alles viel zu intensiv vor. Die Massen von Autos, die über die Kreuzung rollten, die lauten [12] Stimmen der Leute, die meinten, sie würden ewig leben, die vielen Farben, die auf mich einstürmten – all das erschreckte mich. Ich brauchte fast den ganzen Heimweg, um mich wieder daran zu gewöhnen. Mir wurde klar, dass ich mich auf mysteriösem Terrain bewegte, wenn ich zwischen diesen Welten hin und her wanderte. Mir fiel die Geschichte von Orpheus ein, die ich als Kind einmal gelesen hatte. Er hatte es nicht geschafft, seine Frau, die im Reich der Toten wohnte, wieder mit zurückzubringen. Der Geruch ist anders. Der intensive Duft, den das Leben verströmt, wirkt in jener Welt nur noch wie ein aufdringlicher, giftig stechender Abklatsch. Den Geruch des Todes dagegen, der geschwächten Menschen anhaftet, verabscheuen die Leute. Draußen verliert sich dieser Geruch rasch wie Schnee, der in der Sonne schmilzt, aber die Menschen können ihn sofort ausmachen, wie Moschus, da mag er noch so weit weg und flüchtig sein. Sie fürchten ihre geschwächten Artgenossen, die sie an die Endlichkeit des eigenen Lebens erinnern, und wähnen sich dem Tode nah. Dabei muss man sich nur eingewöhnen, um zu erkennen, dass diese beiden Welten ein und dieselbe sind.
Als ich gerade dabei war, die Blumen in der Vase zu ordnen, machte Großmutter die Augen auf und sagte:
[13] »Wie geht es eigentlich meinen Topfpflanzen zu Hause? Gut?«
Großmutter liebte ihre Pflanzen über alles, deshalb ging ich jeden Tag in ihre Wohnung, um ihren Topfblumen Wasser zu geben. Es war nichts Wertvolles darunter, keine Bonsai oder so etwas, nur ganz gewöhnliche Zimmerpflanzen wie Jasmin, Palmenfarn, ein Sarcandra-glabra-Strauch, irgendein Bohnengewächs, das ich nicht zuordnen konnte, Mimosen, eine Pachira, ein Flammendes Käthchen… Und trotzdem meinte ich beim täglichen Gießen zu spüren, wie sehr sich die Pflanzen nach Großmutter sehnten. Mag sein, dass ich mir das einbildete, denn ich war ein ausgesprochenes »Omakind«: Ich war ja praktisch bei ihr aufgewachsen, da meine Eltern bis zur Geburt meiner Schwester beide berufstätig waren. Dass sie sterben würde, konnte ich kaum ertragen. Meine Oma, zu der ich ins Bett gekrochen war, wenn ich mich nachts einsam fühlte. Meine Oma, die jeden noch so kleinen Schatten auf meiner Seele spürte, noch ehe ich es selbst tat, und mir zum Trost meine Leibspeise, Tempura aus Süßkartoffeln, machte. Mit jedem neuen Tag schwand nun ihr Interesse an dieser Welt – und an mir – ein wenig mehr. Ich fühlte mich im Stich gelassen, genau wie die Topfpflanzen. Vielleicht konnte ich mich deshalb so gut in sie hinein[14] versetzen. Oder bildete mir das deshalb ein. »Für die Frau, die sich bisher immer zuallererst um euch oder um mich gekümmert hat, ist es nun an der Zeit, endlich einmal nur an sich zu denken«, versuchte ich mich beim Blumengießen selbst zu beschwichtigen.
Großmutter redete ein paar Worte und schlief sofort wieder ein. Wenn ein Mensch bettlägerig wird, verliert er rasend schnell an Kontur. Das mit anzusehen brach mir fast das Herz. Ein Prozess, den die Menschheit immer wieder durchleben musste, und nun nahm ich selbst daran teil. Und fühlte mich dabei merkwürdig weit weg, so als würde ich alles aus der Ferne beobachten.
Eines Nachmittags, als ich mich schon an dieses Leben zwischen den Welten gewöhnt hatte, kam ich mit gedünstetem Essen, das Mutter für sie gekocht hatte, ins Krankenzimmer, und Großmutter war ausnahmsweise einmal wach.
»Weißt du, früher, da habe ich Alpenveilchen wirklich gehasst!«, sagte sie.
»Ja, das hast du oft genug betont. Ich mag sie auch nicht besonders. Sie sind irgendwie so moorig feucht.«
»Du verstehst viel von Pflanzen, lass dir das von deiner alten Großmutter gesagt sein, wirklich, zu [15] dir würde ein Beruf, der mit Pflanzen zu tun hat, gut passen. Hör auf mit diesem Hostess-Kram.«
Meine Großmutter hatte schon immer etwas dagegen gehabt, dass ich im Rotlichtmilieu arbeitete. Dabei war ich gar keine »Hostess«, sondern Barkeeper in der Bar, die meinem Vater gehörte – aber das konnte ich ihr noch so oft erklären, für sie blieb es ein und dasselbe.
»Wenn du das sagst, werde ich es mir noch einmal überlegen. Aber wie kommst du auf Alpenveilchen?«
»Da vorne am Fenster steht eines, siehst du? Jetzt sind nur noch Blätter da. Aber bis vor kurzem hat es geblüht, was das Zeug hält. Frau Nakahara hat es mir mitgebracht. Am Anfang dachte ich, was für eine traurige Pflanze. Wir sind nie miteinander ausgekommen, ich konnte einfach nicht mit Alpenveilchen umgehen. Wenn man sie nämlich falsch gießt, hängen sie immer so schlaff herunter, und die dicken Stengel sehen wie Würmer aus – einfach ekelhaft. Aber seit ich hier bin und Zeit habe, hat sich meine Einstellung zu Alpenveilchen allmählich geändert. Diese Stengel sind dazu da, Wasser aufzusaugen. Nach dem Gießen strecken die Blüten fleißig und unermüdlich ihr Hälschen der Sonne entgegen, als wollten sie sie erreichen. Wie lebendig ihr seid, denke ich dann und werde nicht [16] müde, sie zu beobachten. Das ist das Schöne, wenn man mehr Zeit hat. Und da ich mich jetzt mit den Alpenveilchen angefreundet habe, traue ich mir sogar zu, sie auch drüben zu halten.«
»Sag doch so was nicht!«
Ob man denn erst lieben lernen muss, was man bislang gehasst hat, um für jenen Ort bereit zu sein?, dachte ich, und mir wurde schwer ums Herz.
Im Frühjahr war Großmutter nur noch selten bei Bewusstsein. Alle drei Tage etwa kam sie kurz zu sich, konnte aber kaum noch etwas sagen, außer vielleicht unsere Namen oder ein paar Worte wie »Oh, der liebe XY ist da«.
An jenem Abend hielt ich ihre Hand. Sie war kalt. Ich starrte auf die Stelle, die sich durch die Infusionsnadel blaugrau verfärbt hatte. In ihren Mundwinkeln stand weiß der angetrocknete Speichel, doch sogar dieser Anblick war mir lieb und teuer.
Da brachte sie plötzlich hervor: »Die Aloe, sie sagt: ›Bitte schneidet mich nicht ab!‹«
Ihre Stimme klang so dünn und brüchig, dass ich erst gar nicht richtig verstand, was sie gesagt hatte.
»Die Aloe, bei euch, neben dem Parkplatz. Sie sagt, es tut ihr weh, wenn das Auto drüberfährt.«
[17] Und: »Sie heilt Pickel, sie heilt Wunden, und sie blüht sogar, deshalb sollt ihr sie bitte leben lassen!«
Wie in Trance sagte sie das, immer nur wenige Worte hintereinander, als höre sie von irgendwoher eine Stimme. Mir lief es kalt den Rücken herunter. Warum war ich ausgerechnet jetzt allein mit ihr, fragte ich mich.
»Du hast einen Sinn dafür, davon bin ich überzeugt, du kannst ihre Gefühle nachempfinden, und dieses Gespür ist das Wichtigste beim Umgang mit Pflanzen. Wenn du dieser Aloe hilfst, werden dich in Zukunft alle Aloen lieben, wo auch immer du einer begegnest. Pflanzen halten zusammen, sie stehen für ihre Artgenossen ein.«
Nachdem sie das alles in einem Atemzug hervorgestoßen hatte, schlief sie sofort ein.
Bald darauf kamen meine Mutter und meine Schwester, um mich von der Krankenwache abzulösen, aber ich brachte es einfach nicht fertig, ihnen davon zu erzählen. Ich bekam kein Wort heraus, meine Kehle war wie zugeschnürt. Schließlich murmelte ich nur: »Tja, dann will ich mal«, und verließ das Krankenhaus. Der Himmel draußen war klar, der Mond war aufgegangen. Die Leute eilten mit unbeschwertem Gesicht heimwärts. Die Scheinwerfer der Autos erhellten den dunklen Asphalt wie in einer Traumlandschaft. Still ging ich zu [18] Großmutters Wohnung. »Entschuldigt, dass es so spät geworden ist!«, begrüßte ich die Pflanzen und gab ihnen Wasser. Als ich das Licht anmachte, offenbarte der blendend weiße Schein der Neonröhren Großmutters ganzes bescheidenes Leben, wie es sich im Zimmer verankert hatte: die luftig weichen Sitzkissen, die kleine Kristallvase. Pinsel und Tuschstein, ihre ordentlich gefaltete weiße Schürze. Die Glasvitrine voller Souvenirs, die sie von ihren Reisen mitgebracht hatte und die das Flair ferner Länder verströmten. Ihre Brille, die Taschenbücher, die kleine Golduhr. Großmutters Geruch, wie nach altem Papier. Mir wurde schwer ums Herz, und ich löschte das Licht. Da merkte ich, wie die Pflanzen vor den Fensterscheiben durchatmeten. Eingerahmt vom Mondlicht, das von draußen hereinfiel, strotzten sie vor sattem Grün. Es funkelten die Wassertropfen, die noch vom Gießen auf den Blättern standen. Ich blieb lange still auf dem dunklen Tatamiboden sitzen und betrachtete sie. Dabei wurde mir allmählich wieder leichter ums Herz. Langsam begriff ich, dass das, was ich hier sah, weder traurig noch schmerzlich, sondern im Gegenteil beglückend und gut war: die ganz gewöhnlichen Spuren des gelebten Lebens eines Menschen. Mir war, als hätten mich die Pflanzen gelehrt, besser nicht dem ersten Eindruck zu vertrauen, den ich mit [19] meinen von Traurigkeit getrübten Augen gewonnen hatte. Diese wundervollen Wesen, die zum Leben nur Sonne, Wasser und Liebe brauchen.
Als ich nach Hause zurückkam, ging ich nicht durch die Haustür hinein, schloss stattdessen das Gartentor auf, lief zum Schuppen und holte eine Schaufel und die Schubkarre heraus. Damit ging ich zur Haustür zurück und grub vorsichtig die Aloe aus. Sie war wirklich riesengroß geworden, vor allem, wenn man die Wurzeln mit berücksichtigte, und da ich mit bloßen Händen zugange war, pikten mich die Stacheln. Dennoch schaffte ich es irgendwie, sie in den Garten zu transportieren, wo ich sie an einer Stelle einpflanzte, die tagsüber lange in der Sonne lag. Mit Erde beschmiert, strotzte die Aloe im dunstigen Schein des großen Frühlingsmondes nur so vor Lebenskraft. Jetzt wäre eigentlich der Moment gewesen, sich in einen Menschen zu verwandeln und »Danke!« zu sagen, doch nichts dergleichen geschah: Sie lebte einfach nur weiter, mit aller Kraft, schob ihre Wurzeln in alle Richtungen vor und breitete die Blätter aus. Wieder einmal hatte ich das Gefühl, ermutigt worden zu sein.
Nachdem Großmutter gestorben und die Bestattungsfeier vorüber war, begann ich tagsüber eine Berufsschule zu besuchen, während ich abends [20] weiter in Vaters Bar arbeitete. Ich hatte beschlossen, einen Blumenladen zu eröffnen, und dazu musste ich mir das nötige Wissen aneignen. Für eine Gärtnerausbildung würde es wohl nicht ganz reichen, so hatte ich mich selbst eingeschätzt. Ich wollte ein ganz normales Blumengeschäft aufmachen, um Farbe in das Leben ganz normaler Leute zu bringen, die in ganz normalen Wohnungen lebten. Sich Blumen zu leisten sei keine Frage der Größe des Geldbeutels, sondern des Herzens, hatte Großmutter immer gesagt. Vater wollte mir seine Bar übergeben, wenn er sich zur Ruhe setzte, und da es Großmutters Letzter Wille war, hatte er mir erlaubt, aus dem Ladenlokal dann ein Blumengeschäft zu machen. Die Arbeit in der Bar würde ich aufgeben müssen, um bei einem Blumenhändler in die Lehre zu gehen, außerdem musste ich mir noch Floristik und die Kunst des Blumensteckens aneignen. Der plötzliche Berufswechsel würde sicher viele Probleme mit sich bringen, doch solange ich einen Grund hatte, für den sich die Anstrengung lohnte, würde ich es schon schaffen, dachte ich mir und beschloss, es anzupacken. Wenn ich jeden Tag einen Schritt weiterging, ohne zu verzagen, würde sich der Weg schon auftun. Jedenfalls blieb mir nichts anderes übrig, als es so zu machen wie damals bei der Ausbildung zum Barkeeper: [21] tagaus, tagein schön bescheiden bei der Stange bleiben. Großmutters letzte Worte hatte ich immer noch im Ohr. Ich mochte noch so oft zurückblicken auf die unbeschwerten Tage am Familientisch, auf die naive kleine Person, die ich einmal gewesen war, als ich es fertiggebracht hatte, fahrlässig mit dem Leben der Aloe zu spielen – ich konnte nicht mehr zurück. Wenn ich einmal starb, wollte ich auch so ein hübsches, sauberes Heim hinterlassen, selbst wenn ich allein wäre und die Wohnung noch so klein. Das Bild an jenem Abend von Großmutters Wohnung, in der ihre geliebten Topfpflanzen weiterlebten, ging mir nicht mehr aus dem Kopf.
Ich bekam nur selten ein paar Tage frei, und daher hatte ich, als der Mann meiner Schwester plötzlich Fieber bekam und sie nicht mitfahren konnte, beschlossen, die Reise allein zu unternehmen. Jetzt war ich also hier in den Bergen und meinte, die Nähe eines alten Bekannten zu spüren. Es war der erste Winter nach Großmutters Tod, aber mir kam es vor, als läge das alles schon Jahre zurück. Im schon fast spöttisch grellen Orange der winterlichen Abendsonne schaute ich mich mit zusammengekniffenen Augen um. Ich fühlte mich irgendwie sacht umhüllt, von gütigen Blicken, von etwas Heißem, Vertrautem.
[22] Ich rechnete schon damit, Großmutters Geist zu begegnen. Das erschreckte mich nicht, Hauptsache, ich könnte sie wiedersehen. Doch was meine Augen dann in dem kleinen Garten eines Bauernhauses erblickten, waren viele, viele, wirklich erschreckende Massen von Aloe-vera-Pflanzen – einen ganzen Dschungel davon.
Die Aloen standen in der Sonne und schienen mir etwas sagen zu wollen. Mit ihren stacheligen, fleischigen Blättern, die sie, kreuz und quer übereinandergeschoben, weit hinauf in den Winterhimmel reckten, und den unzähligen roten Blüten, die so merkwürdig zackig und plump aussahen, schienen sie mir ihre Freude am Leben vermitteln zu wollen. Eingehüllt in die Liebe der Aloen, fühlte ich mich auf einmal wie von Sonnenstrahlen erwärmt. Aha, so fügte sich also allmählich alles zusammen: Von nun an sollten für mich alle Aloen, wann und wo ich ihnen auch immer begegnete, mit Freundlichkeit und Wärme verbunden sein. Jede Aloe war die Freundin der Aloe, die ich in jener Nacht umgepflanzt hatte – und damit auch meine. Wir waren eine Gemeinschaft eingegangen, genau wie unter Menschen üblich, um uns gegenseitig zu beschützen, und es würden noch viele andere Pflanzenarten dazukommen. Großmutters Vermächtnis an mich war jene Kraft, die mir in Zukunft sicher [23] nützlich sein würde, auch wenn sie auf irrationalem Aberglauben beruhen sollte: der sprichwörtliche »grüne Daumen«. Mit diesem Talent würden die Pflanzen unter meinen Händen nach Herzenslust ihr Leben entfalten und gedeihen können. Und damit würde ich auch mit den Menschen verbunden sein, die einer solchen Arbeit nachgingen.
Ich zog meine Handschuhe aus und berührte sanft die stacheligen Blätter, die ich früher so abscheulich gefunden und so achtlos behandelt hatte, dass sie mir höchstens dann einfielen, wenn ich sie brauchen konnte: bei Sonnenbrand. Das junge Grün leuchtete wie Edelstein, und die Blätter fühlten sich glatt und kühl wie Seide an. Ermutigt und bestärkt, als hätte mir jemand die Hand gereicht, ging ich weiter den steilen Pfad hinauf.
[24] Ruderboote
Ja also, es gibt da eine rätselhafte Erinnerung, die mich einfach nicht loslässt: Jedes Mal wenn ich in einen Park gehe und Ruderboote sehe, die auf einem See in einer Reihe liegen, befällt mich dieses Gefühl, das kaum auszuhalten ist – aber ich kann mich eben nur noch bruchstückhaft an die Ereignisse von damals erinnern«, begann ich.
»Wenn du sagst, das Gefühl dabei sei kaum auszuhalten – heißt das, es liegt dir irgendetwas schwer auf der Seele oder ist mit schmerzhaften Empfindungen verbunden? Dann sollten wir die Sache nämlich nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern erst einmal nur darüber reden.«
»Nein, nein, im Gegenteil: Es ist eher ein schönes Gefühl, herzzerreißend schön. Deshalb möchte ich mich ja so gerne genauer daran erinnern, wenn es irgendwie möglich wäre. Ungefähr zusammenreimen kann ich es mir ja noch, nur die Einzelheiten sind mir nicht mehr gegenwärtig, aber mir scheint, als läge gerade in den Details das Wichtige für mich [25] verborgen. Es muss sich in der Zeit abgespielt haben, als man mich als kleines Kind von meiner Mama getrennt hat. Da sich aber in meinem Heimatort damals so gut wie alles in diesem Park mit See abgespielt hat, ist in meinem Gedächtnis alles Mögliche durcheinander abgespeichert, von Chronologie ganz zu schweigen, so dass ich nur noch Bruchstücke zusammenbekomme.«
»Gut, dann schließe die Augen. Atme ruhig ein und aus. Du wirst bei Bewusstsein bleiben und alles mitbekommen, ich werde dich nur Schritt für Schritt zurück durch deine Vergangenheit führen«, sagte die Therapeutin.