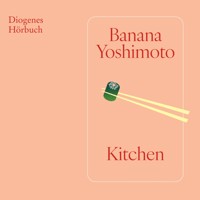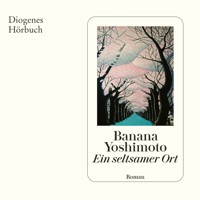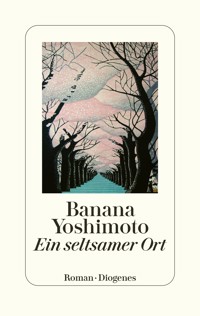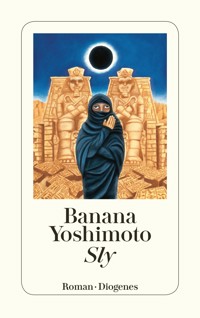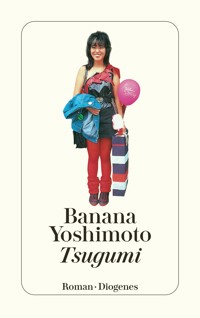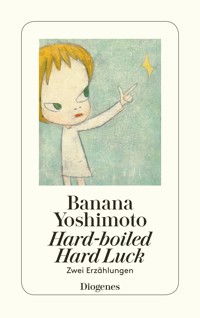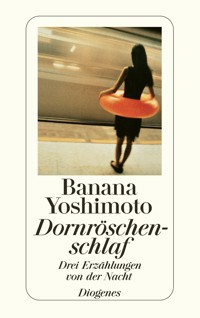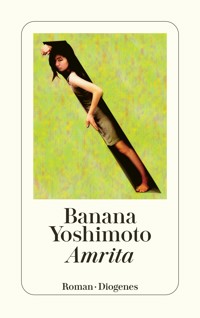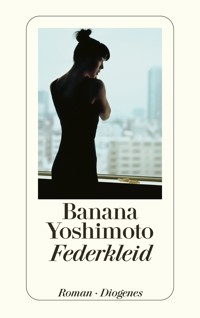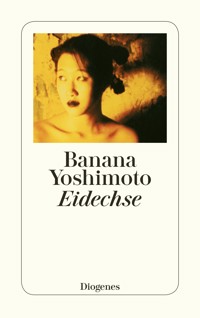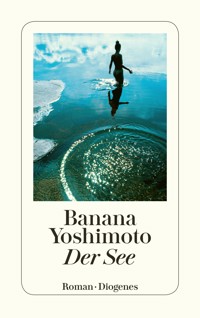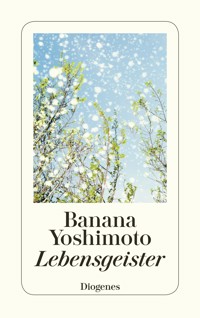9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die zwanzigjährige Yotchan steht vor dem Nichts, als ihr Vater, Leader einer Rockband, plötzlich zusammen mit einer wildfremden Frau Selbstmord begeht. Mit ihrer Mutter findet sie Zuflucht in einer ungewöhnlichen WG in Tokios Künstler- und Szeneviertel Shimokitazawa. Dort findet jede auf ihre Art zu neuer Lebensfreude zurück, getragen von dem authentischen Stadtviertel und seinen Bewohnern. Kochkunst, Essenslust und eine bewegte Reifungs- und Liebesgeschichte – eine asiatisch weise Verführung zum Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Banana Yoshimoto
Moshi Moshi
Roman
Aus dem Japanischen vonMatthias Pfeifer
Titel der 2010 bei The Mainichi Newspapers, Tokyo,
erschienenen Originalausgabe:
›Moshi-moshi Shimokitazawa‹
Copyright © 2010 by Banana Yoshimoto
Die deutsche Erstausgabe erschien 2015 im Diogenes Verlag
Die deutschen Übersetzungsrechte mit der Genehmigung von The Mainichi Newspapers, unter Vermittlung von Zipango, S. L.
Covermotiv: Foto von Ashley Dy (Ausschnitt)
Copyright © Ashley Dy
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2017
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24396 3
ISBN E-Book 978 3 257 60464 1
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5]Von dem schon verstorbenen Regisseur Jun Ichikawa, den ich sehr verehre, gibt es den Film Zawa zawa Shimokitazawa, »Summendes Shimokitazawa«.
Um mir für den Umzug nach Shimokitazawa Mut zu machen, habe ich diesen Film in einsamen Nächten unzählige Male gesehen. Damals lebte ich noch in der Wohnung meiner Eltern. Ich wollte Shimokitazawa wie ein Schwamm mit meinem ganzen Körper aufsaugen, um wirklich sicher zu sein, dass ich das Richtige tat.
In einer Szene des Films spricht die Pianistin Fujiko Hemming über diesen Stadtteil. Während sie zum Einkaufen über den Platz vor dem Bahnhof schlendert, setzt ihre Stimme aus dem Off ein:
»In dem kunterbunten Durcheinander dieses Viertels, dem man sich einfach so hingibt, ist bisweilen eine Anmut spürbar, die vergleichbar ist mit dem Schönen in dem eigentlich ungeordneten, ja hässlichen Wesen des Menschen. Man stelle sich Vögel vor, die an Blumen zupfen, oder Katzen, die [6]elegant aus einer Höhe herunterspringen. Etwas Neues beginnt immer als ein trübes Etwas, doch schon bald wird daraus ein klarer Bach, der in natürlicher Bewegung still dahinfließt.«
Als ich diese Passage zum ersten Mal gesehen hatte, stimmte ich ihr gleich aus vollem Herzen zu und merkte, wie mir dabei Tränen über die Wangen liefen. Seitdem hatte ich den Film so oft gesehen, dass ich ihn auswendig kannte und genügend Mut für einen Ortswechsel aufbrachte.
Wenn das, was man nur dunkel ahnt, von jemandem in so klare Worte gefasst wird, dann legt sich die Unruhe des Herzens, dachte ich damals.
Die unzähligen Schicksalsschläge, denen sich Fujiko in ihrem Leben ausgesetzt sah, verliehen ihren wunderbaren Worten und den Filmbildern eine besondere Bedeutung. Ihre Worte ergreifen die Herzen der Zuschauer, geben ihnen Zuversicht und das Gefühl, für das Leben gewappnet zu sein.
Auch ich wollte irgendwann, wie Fujiko, eine solch betörende Wirkung auf andere Menschen ausüben können.
Immer wenn ich mir nachts diese Gedanken machte, entstand ein Raum, in dem ich tief atmen konnte und der mich in die Lage versetzte, mein seelisches Gleichgewicht irgendwie aufrechtzuerhalten.
[7]Nachdem mein Vater gestorben war, fiel ich zwar nicht in ein tiefes Loch, fühlte mich aber wie jemand, dem ein Schlag nach dem anderen versetzt wurde, und ich sank allmählich immer tiefer, bis ich irgendwann wieder den Kopf heben konnte. Das wiederholte sich immer wieder.
In dieser Zeit entwickelte ich mich zu einer ausgesprochenen Rechthaberin, und ich fühlte mich, als wäre ich geschrumpft. Um mich zu schützen, versank ich immer tiefer in meine Gedankenwelt.
Blumen, Licht, Wünsche oder ausgelassenes Vergnügen, all das war auf einmal in weite Ferne gerückt. Ich war gefangen in einer tiefen Finsternis, in der nur noch die elementarsten Bedürfnisse herrschten, wo nur noch die aus meinem Bauch kommende Kraft zählte und alles Schöne und Leichte keinen Wert mehr besaß.
Inmitten dieser Finsternis tat ich nichts weiter als zu arbeiten, zu atmen und nur Augen für die Dinge zu haben, die in meinem unmittelbaren Blickfeld lagen.
Aber bald konnte ich wieder Licht sehen.
Nein, nicht eigentlich Licht.
Die Finsternis war weiterhin da, wild, ungezügelt, barbarisch.
Doch irgendwann gelang es mir, Abstand zu gewinnen und zu erkennen, dass beide Zustände ihre [8]Schönheiten, ihre zarten Schwingungen hatten, und erst da verstand ich den wahren Sinn von Fujiko-sans Worten.
Mein Leben in Shimokitazawa begann etwa ein Jahr nach dem Tod meines Vaters. Er hatte sich zusammen mit einer entfernten Verwandten, die meiner Mutter und mir völlig unbekannt war, in einem Wald der Präfektur Ibaraki das Leben genommen. Diese Frau hatte meinen Vater in einer Angelegenheit um Rat gebeten, und daraus hatte sich eine enge Beziehung entwickelt. Sie überredete meinen Vater – zuvor hatte sie ihm ein Schlafmittel in den Alkohol getan–, mit ihr zu einem Wald unweit einer spärlich bewohnten Siedlung zu fahren. Dort starb er an einer Kohlenmonoxydvergiftung, hervorgerufen durch die Kohlenbriketts, die sie mitgebracht hatte. Auch sie starb natürlich.
Die Ritzen an Türen und Scheiben waren sorgfältig von innen verklebt, so dass ein Verbrechen ausgeschlossen werden konnte.
Doch auch wenn alles nach einem gemeinsam geplanten Doppelselbstmord aussah: Für mich war Vater Opfer eines Mordes. Auf die Details zu Tatort und Tathergang und was meine Mutter und ich uns sonst noch alles ansehen und anhören mussten, möchte ich nicht weiter eingehen.
[9]Der Schock sitzt noch zu tief, als dass ich das Geschehene in mir ordnen könnte.
Auch sind meine Erinnerungen an damals nur bruchstückhaft, und vielleicht wird es mir niemals gelingen, dieses Ereignis ganz zu begreifen. Wenn man das Leben als einen Prozess bezeichnet, in dem die Mysterien eher zu- als abnehmen, dann bin ich allein mit diesem Ereignis den Rest meines Lebens bedient.
»In letzter Zeit ist er ganz schön auf Achse, übernachtet irgendwo oder kommt erst am Morgen nach Hause, findest du nicht? Ob er eine Freundin gefunden hat? Aber den Mut, uns zu verlassen, hat er bestimmt nicht. Und wenn doch, was machen wir dann? Na ja, dann leben wir halt so weiter wie bisher. Am besten, wir machen uns gar keine Gedanken darüber. Er würde sowieso wieder zu uns zurückkommen.«
So ähnlich haben Mutter und ich immer mehr im Scherz als ernsthaft geredet, bis dann eines Tages der Anruf der Polizei kam und wir von einem Schock in den anderen fielen.
Ich weinte, schrie, tobte, tat alles Erdenkliche, um meinem Schmerz Ausdruck zu verleihen. Wirklich alles. Allein oder mit meiner Mutter, wobei wir uns oft gegenseitig zu trösten versuchten.
Wir hatten uns immer eingeredet, dass Musiker [10]eben hin und wieder kleine Affären hätten und zu viel Kontrolle eher schlecht für die Familie sei. Nun machten wir uns Vorwürfe, dass wir Vater zu freie Hand gelassen hatten.
Wenn er nicht gerade auf einer längeren Tournee war, kam er nach jedem Konzert stets nach Hause, auch wenn es nach Mitternacht war. Jede noch so kleine Vereinbarung zwischen ihm und uns schrieb er entweder in sein Notizbüchlein oder auf seinen Handrücken, und er hielt sich daran. Er war so verlässlich, dass ich bei dem Gedanken, wie er sich Notizen macht, seine Hände vor mir sehe.
Von »Milch mitbringen« bis »Nächste Woche: Gyōza1« schrieb er alles auf und enttäuschte uns nie. Bevor er in einer Band spielte, war er ein Vater, wie man ihn sich nicht besser hätte wünschen können, und gerade deshalb waren wir wohl zu sorglos gewesen.
Nach der Beerdigung befanden Mutter und ich uns in einer Art Schockstarre, und es dauerte eine ganze Weile, bis wir begriffen, dass er nie wieder zurückkommen würde.
Wenn jemand tot ist, werden Vorwürfe sinnlos. Die Hinterbliebenen haben kaum die Möglichkeit, das Erlebte rational zu verarbeiten oder ihre [11]Gedanken auf etwas Konkretes zu richten, da der Tod das Ende von allem ist. Verwandte dieser Frau ausfindig zu machen und Schmerzensgeld zu verlangen würde nichts ändern. Ich verspürte im Übrigen auch gar keine Lust dazu. Ohnehin war diese Frau kurz nach ihrer Geburt zur Adoption freigegeben worden, hatte das Haus ihrer Adoptiveltern aber schon seit langem verlassen und war somit ohne Familie. All das erfuhren wir, obwohl wir es eigentlich nicht wissen wollten. Letztendlich taten wir nichts.
Ich hatte nur einen kurzen Blick auf ihren toten Körper geworfen, aber auf einem früheren Foto sah sie aus wie eine schöne weiße Füchsin oder wie eine Schlange, so dass es mir kalt den Rücken runterlief. Auch das versetzte mir einen Schock. Dass mein Vater sich von solch einer erotischen Ausstrahlung hatte betören lassen! Auch Mutter war bestimmt schwer getroffen vom Anblick dieser Frau.
Trotzdem ging der Alltag irgendwie weiter. Ich fand es seltsam, wie äußerlich normal ich beim Spazierengehen wirken musste, ich unterschied mich in nichts von den anderen Menschen, die mir unterwegs begegneten. Obwohl es in meinem Inneren brodelte, sah mein Spiegelbild in den Schaufensterscheiben aus wie immer.
[12]Etwa ein Jahr nach dem Tod meines Vaters schien sich Mutter wieder einigermaßen gefangen zu haben, und ich beschloss, ein neues Leben zu beginnen.
Gleich nach dem Junior College hatte ich in einer Fachhochschule kochen gelernt, meinen Abschluss gemacht und einer Freundin ab und zu in ihrem Café geholfen, während ich mich in aller Ruhe nach einer festen Stelle umsah. Doch das Ereignis mit meinem Vater warf alles über den Haufen. Ursprünglich wollte ich zusammen mit einer Kommilitonin aus der Fachhochschule ein Café aufmachen, aber das war nun nicht mehr möglich. Mein Leben fing praktisch wieder bei null an.
Ich zog aus dem Apartment meiner Eltern aus und mietete eine Wohnung im ersten Stock eines Hauses in der Chazawa-Straße, das der Mutter einer Freundin gehörte. Vorher hatte meine Freundin dort gewohnt, doch als sie heiratete und nach England zog, wurde die Wohnung frei, und ich packte die Gelegenheit beim Schopf. Das Haus lag sieben Minuten vom Bahnhof Shimokitazawa entfernt.
Ich begann, in einem kleinen Restaurant namens ›Les Liens‹ zu arbeiten. Es befand sich genau gegenüber meiner Wohnung, ich brauchte also nur eine Minute bis dorthin. Da es ein kleines Restaurant war, war ich sozusagen Mädchen für alles; ich half [13]in der Küche, schenkte die Getränke ein, bediente die Gäste und hatte so jeden Tag alle Hände voll zu tun.
Allein zu leben war etwas Besonderes für mich, und ich fand mich zum ersten Mal seit langer Zeit befreit von der bedrückenden Atmosphäre meiner elterlichen Wohnung. Endlich musste ich nicht dauernd an Vater denken und konnte wieder mein eigenes Leben führen.
Tee trinken, morgens aufstehen, all das machte mir nun wieder Freude. Ein Tapetenwechsel wirkt eben doch Wunder. Ich war froh, dass beim Aufwachen mein erster Gedanke nicht Vater galt.
In der Wohnung meiner Eltern war ich aufgewacht, und die Abwesenheit meines Vaters war nach und nach aus allen Ecken und Enden wie Geheimtinte auf einem Blatt Papier sichtbar geworden. Ich war ständig niedergedrückt.
Meine neue Wohnung nahm die ganze Etage des alten Hauses ein und war, wenn auch nicht übertrieben, geräumig. Sie war einfach und bestand lediglich aus zwei Tatamimattenzimmern, in die die gleißende Nachmittagssonne fiel, sowie einer etwas mehr als drei Quadratmeter großen Küche. Im Sommer brannte die Sonne so stark, dass selbst bei vollem Betrieb der Klimaanlage die Zimmer nicht richtig kühl wurden.
[14]Das Bad war abgenutzt, und die Wanne bestand vollständig aus Kacheln. Das Einzige, was hier glänzte, war die bei meinem Einzug eigens installierte Duschvorrichtung. Die ganze Wohnung müffelte entsprechend ihrem Alter, die Tatamimatten waren ausgeblichen und der Gasherd ein Uraltmodell. Immer wenn ich den kleinen Backofen benutzte, den ich mitgebracht hatte, sprang regelmäßig die Sicherung raus. Sogar beim Haareföhnen blieb mir nichts anderes übrig, als das Licht auszumachen und in einer stockdunklen Wohnung zu sitzen.
Hatte ich Freunde zu Besuch, meinten sie irgendwann mitleidig: »Dass es solche Wohnungen heutzutage noch gibt…«
Doch für mich war die Wohnung ideal: geräumig, billig (ich wollte Geld sparen) und in der Nähe meines Arbeitsplatzes. Die Hausbesitzerin wohnte nicht selbst dort, sondern verpachtete das Erdgeschoss für geschäftliche Zwecke. Neben einem Secondhandladen für Kleider gab es ein kleines, schickes Café, das praktisch nur aus einer Theke bestand. Der Kaffee dort schmeckte nicht, die Kekse waren nie ganz durchgebacken, und ich ließ mich nur selten da blicken. Doch die Bedienungen waren hübsche, junge Frauen mit einem Lächeln im Gesicht, und so saßen dort tagsüber stets Gäste, [15]was mir ein Gefühl von Sicherheit gab. Am Abend beschwerte sich keiner, wenn ich geräuschvoll durch die Wohnung schlurfte, Musik hörte oder Wäsche wusch. Die Wohnung hatte also ihre guten Seiten.
Dieses angenehme Leben war nur von kurzer Dauer. Denn eines Tages kreuzte plötzlich meine Mutter bei mir auf.
Das war zu einer Zeit, als sich der Würgegriff der drückenden Sommerhitze etwas lockerte und bei klarem Himmel ein angenehmer Wind wehte, genauer gesagt, an einem frühen Abend, als ein sanfter Regen den Herbst anzukündigen schien.
Ich war gerade dabei, mich nach der Nachmittagsschicht in meiner Wohnung etwas auszuruhen, als meine Mutter auf meinem Handy anrief, um mir mitzuteilen, dass sie gerade in Shimokitazawa sei.
Das war nicht ihr erster Besuch bei mir, und daher sagte ich nur: »Ich bin zu Hause. Wenn du willst, können wir hier eine Tasse Tee trinken.«
Als ich meiner Mutter die Tür aufmachte, stand sie mit einer großen Birkin-Tasche von Hermès vor mir, vollgepackte Papiertüten baumelten an ihren Händen, und sie sagte, als sei es das Selbstverständlichste von der Welt:
[16]»Du, Yotchan2, ich halte es in unserer Wohnung allein nicht mehr aus. Kann ich nicht für eine Weile bei dir bleiben?«
O nein, dachte ich, konnte es aber gerade noch vermeiden, eine verdrießliche Miene zu machen. Ich wusste, wie schwer es meine Mutter hatte, und ließ mir nichts anmerken. Noch immer befanden wir uns beide in einem labilen Zustand, für den wir nur schwer Worte finden konnten.
Trotzdem war ich wie vor den Kopf gestoßen. Meine Arbeit nahm mich so in Anspruch, dass ich praktisch nur zum Schlafen nach Hause kam. Auch konnte man meine Bude nicht mit dem hübschen und großräumigen Dreizimmer-Hochhausapartment meiner Eltern in Meguro vergleichen. Aber das schien meine Mutter nicht zu stören.
Ich hatte mich inzwischen an meine Arbeit gewöhnt und dachte sogar daran, mich mal wieder zu verlieben und meine Freunde öfter zu treffen, die ich schon eine ganze Weile vernachlässigt hatte, kurz gesagt: Ich wollte endlich die Freuden des Alleinlebens genießen. Und nun das! Ich bot meiner Mutter an, ihr eine Zeitlang in Meguro Gesellschaft zu leisten, doch sie sagte:
[17]»Ich habe nichts gegen Jiyūgaoka, aber die Wohnung dort, die ganze Gegend erinnert mich zu sehr an Vater. Shimokita ist genau richtig für mich. Hier möchte ich bleiben. In unserer Wohnung ersticke ich. Alles ist wie tot. Ich habe erst jetzt begriffen, wie wichtig deine Anwesenheit für mich war.«
Das Hochhausapartment in Meguro, das unweit von Jiyūgaoka lag, wurde uns nach meiner Geburt von der Großmutter meines Vaters überlassen. Miete fiel also nicht an, lediglich die Kosten für die Hausverwaltung, und solange man nicht für den turnusmäßigen Verwaltungsdienst eingeteilt wurde, gab es nur die monatliche Eigentümerversammlung. Eine zeitweilige Abwesenheit wäre daher kein Problem.
»Ein halbes Jahr möchte ich warten. Wenn sich mein Gefühl dann immer noch nicht geändert hat, verkaufe ich die Wohnung«, fuhr meine Mutter fort.
»Na gut, wenn wir ohnehin für eine Weile zusammenleben, dann aber in einer größeren Wohnung. Mit deinem Geld müsste das doch möglich sein«, wandte ich ein.
»Im Grunde ja, doch dann müsste man sich festlegen und obendrein einen Riesenaufwand betreiben. Dafür bin ich noch nicht bereit. Ich möchte lieber kleine Schritte machen, ohne viel Staub aufzuwirbeln. Mal kurz verschnaufen, zu mehr bin ich [18]zurzeit nicht in der Lage«, antwortete meine Mutter.
Das war eines ihrer Talente: in Situationen wie dieser Worte zu finden, denen man nur schwer widersprechen konnte.
»Hier fühle ich mich wohl. Ich weiß genau: Wenn ich von diesem Fenster aus auf die Chazawa-Straße runterblicke, dann finde ich wieder zu mir selbst. Ach, Yotchan, kannst du mich nicht einfach als deine Freundin betrachten? Tu doch einfach so, als wäre ich eine Freundin, die Liebeskummer hat und eine Weile bei dir bleiben möchte.«
Ich blickte auf Mutters grelles T-Shirt und war sprachlos. Das hatte sie bestimmt in dem Secondhandladen im Erdgeschoss gekauft, anprobiert und einfach angelassen. Sie sah bereits aus wie eine Bewohnerin von Shimokitazawa, und nichts erinnerte mehr an die Madame aus Meguro.
»Nein, Mutter, wirklich nicht. Was uns passiert ist, war ja wohl ein bisschen mehr als Liebeskummer. So einfach können wir es uns nicht machen«, widersprach ich.
»Na gut, von mir aus kannst du auch denken, dass ich noch nicht bereit bin, meine Tochter einfach so gehen zu lassen. Ich brauche dein Lachen, und solange nicht wieder alles irgendwie ins Lot gekommen ist, kann ich nicht zurück.«
[19]In meinem Kopf drehte sich alles. Ich hatte Mühe, mich zu überzeugen, dass ich nicht träumte. Es war mir ein Rätsel, warum meine Mutter in einer so heruntergekommenen Wohnung leben wollte, und mit ihr zusammen fühlte ich mich wie in einer billigen Absteige während einer gemeinsamen Reise. Ich hatte diese Wohnung einzig aus dem Grund gewählt, Geld zu sparen und keinen weiten Weg zu meinem Arbeitsplatz zu haben. Mutter als »Freundin« und Zimmergenossin stand nicht auf meinem Plan.
Sie bot an, sich an den Haushaltskosten zu beteiligen, was wohl bedeutete, dass sie mehr als die Hälfte der Miete bezahlen würde. Wahrscheinlich wollte sie auch noch die Wäsche waschen und staubsaugen. Wo blieb dann mein Traum von der Unabhängigkeit?
So schonend wie möglich versuchte ich, ihr meine Haltung deutlich zu machen. Doch ich redete gegen eine Wand.
»Was du sagst, klingt vernünftig, und ich verstehe dich natürlich.«
»Gut, dann sind wir uns also einig, ja?«, meinte ich.
Mutter schüttelte den Kopf.
»Ich möchte jetzt aber nicht vernünftig sein. Ich will mal für eine Weile aufhören, mich wie eine [20]Erwachsene zu verhalten. Verstehst du? Heiraten, ein gemeinsames Leben, das gilt als gesellschaftlich vernünftig. Jeder Tag verläuft ohne große Überraschungen. Gerade deshalb wollte Vater etwas tun, was nicht Routine, nicht vernünftig war. Und während er herumexperimentierte, wurde er in etwas hineingezogen und hat diesen schrecklichen Tod gefunden. Ich möchte jetzt auch etwas Unvernünftiges tun! Dadurch werde ich zwar nicht wieder jung, aber da du jetzt selbständig bist, kann ich dich wie eine Freundin behandeln und muss nicht mehr an alles denken. Ich will noch einmal ganz von vorne anfangen.«
Während ich meiner Mutter zuhörte, beschlich mich das seltsame Gefühl, dass sie recht hatte. Genauso dachte ich auch.
Mein Vater war ein recht populärer Band-Keyboarder. Manchmal wurde er auch von befreundeten Musikern gebeten, bei Studioaufnahmen mitzumachen, und er war eigentlich dauernd unterwegs. Über mangelnde Engagements konnte er nicht klagen, und er verdiente ganz gut.
Bisweilen hielt er Vorträge an Musikschulen, doch als einen festen Beruf konnte er sich diese Tätigkeit nicht vorstellen. Er mochte Live-Auftritte und richtete sein Leben danach aus. Ständig war er mit einer Band auf Tour, und wir bekamen ihn immer [21]seltener zur Gesicht. Als Familie bestanden wir nur noch auf dem Papier.
Familien durchleben verschiedene Phasen. Es gibt Zeiten, wo sich die Mitglieder auf sich selbst konzentrieren und die Distanz zu den anderen größer wird.
Und als ich gerade glaubte, es würde wieder werden wie früher, wurde Vater brutal aus unserer Mitte gerissen. So empfand ich es zumindest. Meiner Mutter, die wohlbehütet aufgewachsen war und eine entsprechende Erziehung genossen hatte, fehlte die nötige Skrupellosigkeit, um mit dieser Situation zurechtzukommen.
Im Grunde war mein Vater kein besonders energischer Mensch, er neigte zur Nervosität, und auch seine körperliche Konstitution war eher schwächlich. Doch ganz so schwach war er nicht, auch wenn er immer den Eindruck erweckte, gerade mal so sein Leben managen zu können.
In ihm floss wohl das Blut einer Mutter, die zwar aus wohlhabendem Hause stammte und ihr ganzes Leben keine finanziellen Probleme kannte, deswegen aber noch lange nicht glücklich war. Mein Großvater starb, als Vater noch ein Kind war, aber wegen einer anderen Frau war er ohnehin nur selten zu Hause. Davon erfuhr ich erst nach dem Tod meiner Großmutter.
[22]Der Gedanke, dass auch in mir dieses Blut floss, machte mir Angst. Vater vermittelte stets den Eindruck eines zurückhaltenden und ernsthaften Menschen, aber innerlich war er immer ein Student geblieben. Wenn wir zusammen ausgingen, musste ich mich immer bei ihm unterhaken, und eigentlich war er ein verwöhnter und fröhlicher Blender. Äußerlich wirkte er stets nachgiebig und feinfühlig, ein Eindruck, der durch seine Wortkargheit noch verstärkt wurde. Tatsächlich konnte ihn schon eine Kleinigkeit aus der Bahn werfen, doch er hoffte wohl, sein unbeschwertes Leben immer irgendwie weiterführen zu können. Seine Haltung war: Was auch passierte, es würde schon wieder werden. In gewisser Hinsicht war er wie ein Kind, und ich mochte ihn dafür.
»Mama, wenn du bei jemandem wohnen willst, warum nicht bei einer von deinen Freundinnen? Eigentlich wollte ich hier allein leben. Ich kann mich doch nicht ewig von dir verwöhnen lassen und möchte endlich auf eigenen Beinen stehen«, versuchte ich es noch einmal.
»Das verstehe ich, aber du bist die Einzige auf dieser Welt, mit der ich Vater teilen kann. Na ja, eigentlich müssten wir uns Vater mit dieser Frau teilen, doch deren Freundin könnte ich niemals werden, und leben tut sie ja auch nicht mehr. Bei [23]meinen Freundinnen kann ich mich nicht einfach gehenlassen. Die Einzige, die in Frage käme, hat geheiratet und lebt jetzt wegen der Versetzung ihres Mannes in San Francisco«, antwortete meine Mutter.
»Sie hat zwar ein großes Gästezimmer, und ich könnte zur Not bei ihr wohnen, aber das fände ich doch etwas übertrieben. Wenn es mit uns beiden hier nicht klappt, dann wäre ein Monat in San Francisco kein Problem. Aber egal, wie lange ich dort bleiben würde, mehr als ein Intermezzo wäre es nicht. Nur in Japan hängt alles, was man tut, früher oder später mit dem eigenen Leben zusammen. Was aus mir wird, weiß ich nicht, aber ich möchte mein Geld auch nicht zum Fenster rauswerfen. Die Miete für deine Wohnung ist keine Belastung für mich. Hier kann ich jederzeit wieder ausziehen. Lassen wir es doch dabei! Es bringt nichts, sich über alles Mögliche den Kopf zu zerbrechen. Wir sind hier unter uns, und wir müssen uns unser Geld schließlich einteilen. Ich habe ehrlich gesagt wenig Lust, jetzt schon alles gründlich zu durchdenken. Das ist mir einfach zu dumm, und ich habe Angst, am Ende als Verlierer dazustehen. Über morgen mache ich mir Gedanken, wenn es so weit ist.«
Das war eine beeindruckende Rede. Seit wann [24]war meine Mutter in der Lage, ihre Situation so präzise zu analysieren?
Während Vater ein leichtlebiger Mensch war, legte meine Mutter stets Wert auf Ordnung. Alles musste genau geplant sein, und es wäre ihr niemals in den Sinn gekommen, einfach mal ins Grüne zu fahren.
Ich erkannte sie kaum wieder.
Sie war ein Einzelkind, und ihre Eltern waren gestorben, als ich noch klein war. Das elterliche Gut mit all den Weiden und Feldern war da schon längst veräußert. Da es sich in einer nahezu menschenleeren Gegend befand, hielt sich der Verkaufswert in Grenzen. Meine Mutter, die zu der Zeit Hausfrau war, erbte dennoch ein kleines Vermögen, das sie niemals antastete. Ich konnte daher nachvollziehen, wenn sie aus finanziellen Erwägungen für eine Weile bei mir bleiben wollte. Auch ich konnte so ein bisschen mehr Geld sparen.
Ich machte mir keine Illusionen: Noch war ich nicht so selbständig, wie ich sein wollte. Ich brauchte einen Ort, an den ich zurückkehren konnte, und deshalb wollte ich Mutter in unserer alten Wohnung haben.
Ohne meinen Status als Kind aufzugeben, hatte ich mich spontan dazu entschlossen, auszuziehen und allein zu leben. Ich hatte mich, ohne zu [25]überlegen, was damit verbunden war, einfach nur auf das Alleinleben gefreut. Ich träumte von einem sorglosen Alltag, wo alles ganz nach meinem Willen lief.
Warum sollte ich meine eigenen vier Wände, in denen sich nur wenige Dinge von mir befanden, mit meiner Mutter teilen? Das war irgendwie unnatürlich. Ich hatte mir alles für meinen Liebsten in spe so schön ausgemalt. Nicht zusammenwohnen, sondern nur gelegentliche Übernachtungen; noch dazu wollte ich mich auf meine Arbeit konzentrieren und in meinem eigenen Rhythmus leben.
Eigentlich hätte ich, wenn es mir wirklich ernst mit meiner Selbständigkeit gewesen wäre, zornig werden müssen, ihr böse Worte an den Kopf werfen und sie aus meiner Wohnung jagen sollen. Wäre ich ihr Sohn gewesen, hätte ich das bestimmt gemacht.
In dem Moment stützte meine Mutter die Ellbogen auf den Tisch, legte ihren Kopf in die Hände und blickte wie ein kleines Mädchen versonnen auf die regenverhangene Chazawa-Straße.
Dieser Anblick gab mir einen Stich ins Herz.
Alle Argumente, die mir durch den Kopf tobten, waren auf einmal wie weggewischt. Keine Worte konnten deutlicher ihren Wunsch ausdrücken, bei mir zu bleiben, als diese Pose. Das war nicht die Haltung einer erwachsenen Frau. Um sie lag ein [26]Schleier, flüchtig wie ein Traum. Es war der Schleier, der eine besorgte junge Frau umgibt, ein Schleier aus Hoffnung und Einsamkeit.
»Was soll das heißen, ›als Verlierer dazustehen‹? Wem gegenüber? Etwa Vater?«, fragte ich.
»Unsinn! Ich meine, gegenüber dieser Lüge, ein ordentliches Leben führen zu müssen. Ich habe immer gedacht, ein ordentliches Leben würde mich vor Unheil bewahren, und ich habe alles getan, damit ich verschont bleibe. Und was hat es mir gebracht?
Am Ende wurden selbst meine schlimmsten Vorstellungen noch übertroffen. Ich muss geradezu dankbar sein, dass Vater gestorben ist, ohne einen Berg Schulden hinterlassen zu haben, und das macht mich traurig. Meine Ersparnisse sind bald aufgebraucht, und dann stehen wir mit leeren Händen da. Trotzdem war er ein guter Mensch, jemand, der bereit war zu sterben, bevor er uns in ein noch tieferes Unglück stürzen würde. Auf seine eigene, merkwürdige Art ist er sich treu geblieben.
Als ich mit dir schwanger war, gab es zwischen Vater und mir eine Zeit, wo es nicht gut lief und er eine Trennung vorschlug. Er meinte, er sei kein Familienmensch. Ich hätte damals in die Scheidung einwilligen sollen. Wir haben viel miteinander geredet und beschlossen, dich doch zu bekommen. [27]Danach haben wir das Thema Scheidung nie wieder erwähnt. Im Gegenteil: Vater hat nach deiner Geburt immer gemeint, wie gut es gewesen sei zu heiraten. Ich sage nicht, dass ich glaube, schuld an seinem Tod zu sein. Aber ich habe keine Lust mehr, diese wie in Stein gemeißelte Regel der Gesellschaft ›Lebe ordentlich, dann wird alles gut‹ zu befolgen.«
Ich konnte meiner Mutter nicht widersprechen, wusste aber auch nicht, wohin mit meinen Gefühlen, und murmelte vor mich hin:
»Na gut, was zählt, ist das Hier und Jetzt. Ich muss das mit anderen Augen sehen. Ich bin auf einer Reise, und meine Mutter ist zu Besuch gekommen. Das wird schon gutgehen!«
Und sogleich ging es mir besser. Ich wollte meine Mutter nicht verletzen und redete mir ein, dass es eben keine Alternative gebe. Irgendwann würden wir uns ohnehin auf die Nerven fallen. Dann könnte man immer noch eine Lösung finden.
Das Gespräch mit Mutter kostete mich so viel Kraft, dass ich an weiterreichende Pläne nicht denken konnte. Vor mir saß meine Mutter, die bei mir bleiben wollte. Mehr brauchte ich nicht zu wissen. Morgen würde sie vielleicht schon wieder in ihre Wohnung zurückwollen. Trotzdem regte ich mich innerlich auf und wollte mich durchsetzen. Wenn [28]man etwas will, entwickelt man eben ungeahnte Kräfte.
»Gut, einverstanden«, sagte ich schließlich.
»Wirklich? Danke!«, antwortete sie mit einer Stimme, die nicht danach klang, als sei ihr ein Stein vom Herzen gefallen. Sie kannte mich eben zu gut und hatte von Anfang an gewusst, dass ich nicht ablehnen würde. Wahrscheinlich war das ganze Gespräch für sie überflüssig gewesen, da sein Ausgang nie in Zweifel stand. Ein bisschen war ich beleidigt, wie leicht ich zu durchschauen war, aber ich gab mich geschlagen. Für eine weitere Auseinandersetzung fehlte mir die Energie.
Ich ging zum Fenster und setzte mich neben sie.
Es war bestimmt nicht einfach, in ihrem Alter noch mal von vorne zu beginnen. Ich war kein Kind mehr, um das sie sich kümmern konnte, und für ihren Lebensunterhalt arbeiten musste sie auch nicht. Dazu kam noch dieser Schatten der Vergangenheit, der an uns haftete.
Denn was wir auch taten, wie wir hier zusammenlebten, die Vergangenheit konnten wir nicht ungeschehen machen, wir mussten mit ihr leben. Es würde Zeiten geben, wo wir nicht daran denken würden, doch dieser Schatten im Hintergrund würde niemals verschwinden, würde immer wie ein Alpdruck auf uns lasten. Auch wenn ich [29]unzählige Male so geheult hatte, dass mir der Hals weh tat, wurde es nicht leichter. Ich tat nur so, als ob ich wieder in Ordnung wäre.
In der makellosen Wohnung meiner Eltern mit der vertrauten Anordnung der Zimmer und der festgelegten Rollenverteilung war es kaum möglich gewesen, frei miteinander zu sprechen.
»Du, Yotchan, war es bei uns wirklich so unerträglich?«
»Nein, als Musikerfamilie sind wir zwar etwas aus dem Rahmen gefallen, aber als bedrückend habe ich unser Leben nicht empfunden«, versicherte ich ihr.
Vater kehrte meist um Mitternacht heim, und dann lief im Haus Musik. Waren Freunde zu Besuch, ging es bis in die frühen Morgenstunden hoch her, oft mit leise gespielten Jam-Sessions.
Bei Konzerttouren durfte ich manchmal in der Schule fehlen, um Vater zu begleiten. Thailand, Shanghai, Boston, New York oder Paris. Auch in Südkorea und Taiwan waren wir schon. Auf diesen Reisen lebten wir praktisch von der Hand in den Mund, doch immer waren wir umgeben von Musik. Ab und zu durften wir im Konzerttruck mitfahren, und ich freundete mich mit den Kindern anderer Musiker an oder verliebte mich bis über beide Ohren. Es war eine aufregende [30]Kindheit, fast wie das Leben in einer Hippiefamilie.
»Lag es vielleicht an mir?«, fragte meine Mutter wieder.
»Ein bisschen vielleicht schon. Aber in einer Familie muss es jemanden geben, der Wert auf Ordnung legt, sonst geht alles drunter und drüber.«
Ich schluckte. Das Folgende wollte ich eigentlich nicht sagen, doch schon seit meiner Kindheit schleppte ich diesen Gedanken mit mir herum.
»Wenn Vater uns nicht gehabt hätte, wäre bestimmt etwas anderes passiert, und er wäre noch früher gestorben.«
Mutter sah mich mit großen Augen an, in denen deutlich die Worte »Also doch!« geschrieben standen.
»Danke, Yotchan«, sagte sie nur.
Auf der Chazawa-Straße herrschte nur wenig Verkehr. Die Autos fuhren gemächlich aneinander vorbei wie zwei sich begegnende Fußgänger. Gegenüber sah ich das Bistro Les Liens, meinen Arbeitsplatz. Im ersten Stock befand sich das Café Mikenekosha, durch dessen antike Fensterscheiben ein mattes Licht schimmerte. Eingehüllt vom Nieselregen wirkte das Gebäude, als würde es in der zunehmenden Dunkelheit verschwinden.
Ob Mutter nun jeden Tag zum Mittagessen zu [31]mir ins Bistro kommen würde? So hatte ich mir mein neues Leben nicht vorgestellt.
Nein! Ich werde nichts anders machen: Werde weder Handtücher noch Zahnputzbecher für sie kaufen, damit sie so richtig ihr Parasitendasein spürt. Und sie muss auch mit dem plattgedrückten Gästefuton vorliebnehmen, auf dem sie sich bestimmt nicht so wohl fühlt wie auf ihrer teuren Tempur-Matratze zu Hause (die Federbettdecke hatte allerdings einiges gekostet).
Meine schlechte Laune wäre vorprogrammiert, wenn ich abends von der Arbeit nach Hause käme und meine Mutter vorfände. Warum auch nicht? Auch ich habe ein Recht auf schlechte Laune.
»Außerdem spukt Vater in der Wohnung, wenn ich da bin«, sagte meine Mutter auf einmal.
»Du spinnst!«, rief ich aus.
»Wenn ich’s doch sage! Ich wache morgens auf und sehe ihn wie immer auf der anderen Bettseite schlafen oder auf dem Sofa sitzen«, fuhr meine Mutter in ganz normalem Ton fort.
»Bist du aus Trauer jetzt übergeschnappt?«, fragte ich. »Gerade du hast doch nie an so etwas geglaubt. Immer wenn ich mich bei diesen Gespenstergeschichten im Fernsehen gefürchtet habe, hast du dich über mich lustig gemacht.«
»Ein Grund mehr, mir zu glauben. Aber du hast [32]recht. Ich habe ja selbst allmählich den Eindruck, ich verliere den Verstand. Deshalb bin ich hier. Oder denkst du etwa, es macht mir Spaß, bei meiner Tochter zur Untermiete in einer heruntergekommenen Wohnung zu wohnen?«, ereiferte sich meine Mutter. Dann, etwas ruhiger:
»Du, Yoshie, hast du keine Lust auf eine Tasse Tee? Ich würde gerne welchen trinken.«
»Was für einen möchtest du denn?«
»Schwarzen Tee. Eine Tasse Tee am Fenster gibt mir das Gefühl, im Café zu sitzen. Was hältst du davon, wenn ich einen Teetisch kaufe? Es gibt hier ein Geschäft, das antike Möbel renoviert. Das habe ich gestern beim Spaziergang durch die Onogashira-Straße entdeckt. Ich war so begeistert, dass ich eine ganze Weile dort verbracht habe. Es macht Spaß, jungen muskelbepackten Männern in kurzärmeligen Hemden beim Schleifen und Lackieren zuzusehen. Echt heiß, sage ich dir!«
»Ah ja, ich weiß, welchen Laden du meinst. Stimmt, der ist ziemlich gut und billig obendrein. Antike Möbel würden hier gut reinpassen. Wenn du so was kaufen willst, habe ich nichts dagegen. Zum Essen könnten wir den Tisch auch benutzen. Meinetwegen kannst du auch dort sitzen und mir bei der Arbeit zusehen. Na gut, Spaß beiseite, ich mach uns einen Tee.«
[33]Ich fragte mich, wo meine Mutter den Ausdruck »echt heiß« aufgeschnappt hatte, ließ mir aber nichts anmerken. Wie jemand, der, gerade angekommen in einem neuen Land, sich rasch mit der fremden Sprache vertraut machen möchte, bemühte sich meine Mutter anscheinend, den Jargon der jungen Leute hier im Viertel zu übernehmen.
»Mama, wo ist denn der Darjeeling, den du mitgebracht hast?«
»Im Kühlschrank.«
»Okay.« Als ich den Kühlschrank aufmachte, schoss es mir auf einmal durch den Kopf, dass wir diese Art von Alltagskonversation schon unzählige Male in der alten Wohnung gehabt hatten. Ich kam einfach nicht von zu Hause weg!
Na gut, was soll’s. Jetzt ist jetzt, und hier ist hier, das musste ich eben schlucken. Vielleicht war es das letzte Mal, dass ich mit Mutter zusammenlebte, vielleicht auch nicht. Oder aber sie würde sich… Bei diesem Gedanken zog sich mir der Magen zusammen. Äußerlich merkte man ihr nichts an, aber innerlich litt sie vielleicht Höllenqualen, und es konnte sehr wohl sein, dass ich sie, wie Vater, vom einen auf den anderen Tag verlieren würde. Dann hätte ich nie wieder die Gelegenheit, mit ihr zusammenzuleben.
Jemand, der Gespenster sah, war nicht weit von [34]