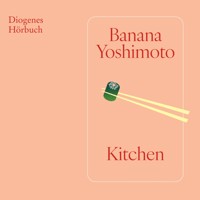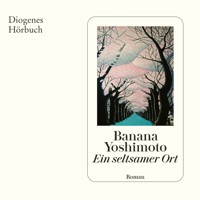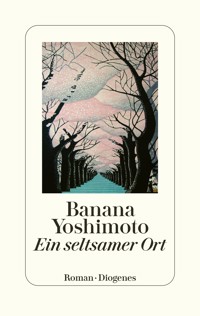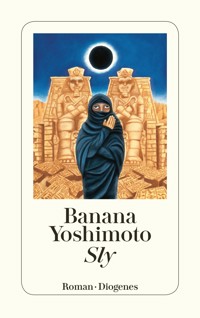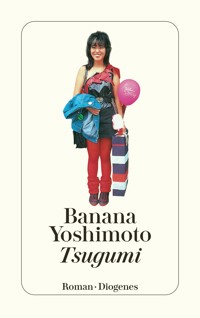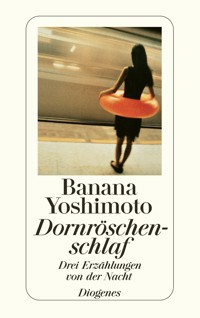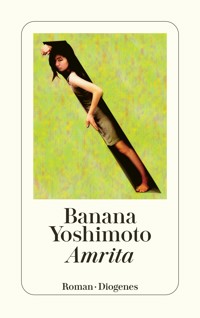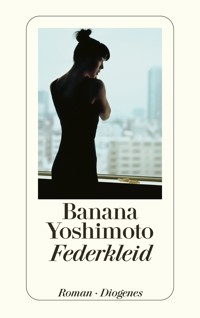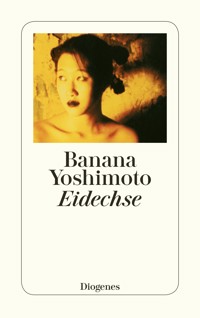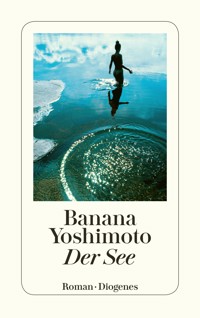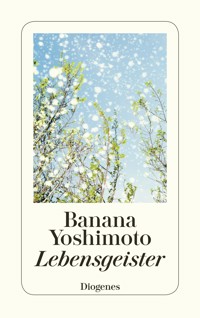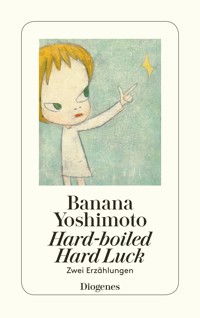
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
›Hard-boiled‹ meint: sich in der Auseinandersetzung mit dem Tod, der Trauer, ein dickes Fell zulegen. Und ›Hard Luck‹: Wer kann behaupten zu wissen, was Unglück ist und was Glück – wohl nur der Betroffene selbst. Zwei Erzählungen über die Schuld, aber auch die Unvermeidlichkeit des Verlassens. Und über die Kunst des Loslassens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Banana Yoshimoto
Hard-boiled Hard Luck
Zwei Erzählungen
Aus dem Japanischen von Annelie Ortmanns
Diogenes
{7}Hard-boiled
{9}Der kleine Schrein
Ich war für ein paar Tage allein in den Bergen unterwegs, und eines Nachmittags wanderte ich jenen Waldweg entlang.
Es war ein angenehmer, von üppigem Grün umschlossener Weg, der parallel zur Landstraße den Berghang entlangführte.
Ich wanderte los, den Blick auf die schönen Muster gerichtet, die Licht und Schatten schufen.
Da fühlte ich mich noch vollkommen unbeschwert, wie am Beginn eines Spaziergangs.
Auf der Karte war der Pfad als Wanderweg ausgewiesen, der nach einer Weile wieder auf die Landstraße münden sollte.
Ich spazierte also frohen Mutes weiter durch die frühlingshaft warme Nachmittagssonne.
Aber der Weg entpuppte sich als weit beschwerlicher, als ich angenommen hatte – bald ging es steil auf und ab.
Während ich unverdrossen weitermarschierte, ging die Sonne allmählich unter, und am {10}leuchtend königsblauen Himmel funkelte auf einmal der Abendstern, hell und klar wie ein Edelstein. Am westlichen Horizont, über dem noch ein zartrosa Schimmer lag, wurden die feinen, spätherbstlichen Schleierwolken in weiches Licht getaucht und nach und nach von der Dunkelheit verschluckt. Der Mond war aufgegangen. Eine hauchdünne Sichel, wie das Weiße eines Fingernagels.
»Wenn das so weitergeht, werde ich dieses Städtchen nie erreichen!« sagte ich zu mir selbst. Ich war so lange still vor mich hin gelaufen, daß ich fast schon den Klang meiner eigenen Stimme vergessen hatte. Meine Knie waren müde, und die Zehen fingen an weh zu tun.
»Wie gut, daß ich das Hotel und kein Gasthaus genommen hab – das Abendessen hätte ich todsicher verpaßt!«
Ich wollte vorsichtshalber dort anrufen, aber mein Handy funktionierte nicht, ich war wohl immer noch zu tief im Wald. Plötzlich überfiel mich auch noch der Hunger. Nur noch ein kleines Stück, und ich sollte das Städtchen erreicht haben, in dem ich mir ein Hotelzimmer reserviert hatte. Dann würde ich dort irgendwo etwas Warmes essen, nahm ich mir vor und beschleunigte ein wenig meinen Schritt.
Als ich mich einer Kurve näherte, die sich außer {11}Reichweite der Straßenbeleuchtung befand, beschlich mich auf einmal ein furchtbar mulmiges Gefühl. Ich bildete mir ein, der Raum zöge sich wie Kaugummi und ich könnte laufen, so lange ich wollte – ich käme doch keinen Schritt voran.
Ich habe nie übersinnliche Kräfte oder so etwas besessen, aber es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich zumindest gelernt habe, die unsichtbaren Dinge ein wenig zu fühlen.
Ich bin zwar eine Frau, aber ein einziges Mal hatte ich eine Beziehung mit einer anderen Frau. Sie konnte Dinge sehen, die für gewöhnliche Menschen unsichtbar sind. Vielleicht hat sie mich angesteckt oder meine Sinne dafür geschärft, jedenfalls habe ich, während ich mit ihr zusammenlebte, auch auf einmal zumindest so eine Art Gespür für solche Dinge bekommen.
Von ihr habe ich mich vor Jahren auf so einem Waldweg wie diesem hier, auf dem wir bei einem Autoausflug gelandet waren, für immer getrennt. An jenem Tag saß ich am Steuer. Wenn sie nicht mehr mit mir unter einem Dach zusammenleben könne, solle ich sie aussteigen lassen, flehte sie mich an, sie würde dann erst noch eine Weile herumreisen, bevor sie nach Hause zurückkehrte. Sie meinte es ernst. »Ich hab mich gleich gewundert, warum du so viel Gepäck mitgenommen hast«, {12}entgegnete ich und begriff, daß sie von vornherein nicht vorgehabt hatte, mit mir zusammen zurückzufahren. Daß ich bei ihr ausziehen wollte, bedeutete für sie einen viel schwerwiegenderen Verrat, als ich mir vorgestellt hatte. Wie lange wir auch diskutierten, ihr Entschluß stand felsenfest. So fest, daß ich schon befürchtete, sie würde mich umbringen, wenn ich sie nicht augenblicklich aussteigen ließe.
Sie sagte:
»Ich will einfach nicht mit ansehen müssen, wie du deine Sachen packst und ausziehst. Fahr schon vor, ich laß mir Zeit. Und sorge dafür, daß alles von dir aus der Wohnung verschwunden ist, wenn ich wiederkomme.«
Das sagte sie.
Und ich habe getan, was sie sagte. Obwohl es ihr Auto war, und nicht meines, habe ich getan, was sie sagte.
Ihr Gesicht, als wir uns trennten. Diese traurigen Augen, und die Art, wie ihr das Haar über die Wangen fiel. Die Farbe ihres Mantels, dieses Beige, das der Rückspiegel noch unendlich lange zurückwarf. Ihre Gestalt, die vom Grün der Wälder verschluckt zu werden drohte. Sie winkte mir lange nach, unendlich lange. Es sah aus, als würde sie für immer dort auf mich warten wollen.
{13}Es gibt Dinge, die machen dem einen überhaupt nichts aus, während sie für den anderen genauso schrecklich sind wie der Tod. Ich wußte nicht viel über ihre Lebensgeschichte. Aber mir war es unbegreiflich, warum es dermaßen schlimm für sie sein sollte, wenn jemand vor ihren Augen seine Sachen zusammenpackte und aus ihrer Wohnung verschwand. Ich weiß nicht, ob man hier von mangelnder Wesensverwandtschaft sprechen kann. Ja, ich habe sie ausgenutzt, weil ich damals nicht wußte, wohin, und bei ihr eingezogen bin, soviel steht fest. Um ehrlich zu sein, hatte ich sowieso nie vor, mit ihr, das heißt, mit einer Frau, für immer zusammenzubleiben. Die körperliche Beziehung ging ich damals nur ein, weil sie als die Frau, bei der ich wohnte, in mich verliebt war – das war alles. Aber ich habe gemerkt, daß es ihr mehr bedeutete. Nein, falsch: Obwohl ich das im Prinzip wußte, habe ich so getan, als würde ich es nicht bemerken. Das lastete mir schwer auf dem Gewissen. Also hatte ich alles, was sie betraf, in mir auf Eis gelegt, als unerledigte Erinnerung, mit der ich nichts anzufangen wußte.
Die Erinnerung an sie war zu einem Klumpen aus unzähligen Bildern geworden, der mir schonungslos das Herz verdunkelte.
Ich faßte mich wieder und blickte, fest {14}entschlossen, noch einen Zahn zuzulegen, nach vorn. Da stand er vor mir, der mysteriöse kleine Schrein. Es gab weder eine Jizō-Statue1 noch irgendeine andere Steinfigur, nur den Schrein und ein paar Opfergaben: Blumen, Papierkraniche und Sake, aber nichts davon war frisch. Sofort kam mir ein Gedanke, den ich nicht wieder wegwischen konnte: Darin schlummert sicher ein schrecklich böses Wesen, das einst die ganze Gegend hier unsicher gemacht hat!
Warum ich das glaubte, kann ich nicht erklären. Es hätte doch auch sein können, daß der Jizō oder die andere Steinfigur, die ursprünglich einmal dagestanden hatte, einfach kaputtgegangen war. Oder daß sie bloß jemand weggenommen hatte. Das versuchte ich mir einzureden – ohne Erfolg, denn es konnte einfach nicht stimmen. Etwas wie ein dickes, festes Knäuel schwebte über dieser Stätte, verdichtet aus unzähligen Schichten bleischwerer Emotionen. Das war so unheimlich, daß ich wie gebannt auf den Schrein starrte.
Bei näherem Hinsehen entdeckte ich genau in seiner Mitte zirka zehn pechschwarze Steine, die {15}wie kleine Eier aussahen und zu einem Kreis angeordnet waren. Das entsetzte mich einmal mehr.
Schnell machte ich, daß ich wegkam, möglichst ohne noch einmal hinzusehen. So etwas kommt auf Reisen manchmal vor. Auf der Welt existieren Stätten, an denen sich so einiges zusammenbraut, so viel ist sicher, und der einzelne kleine Mensch sollte sich da tunlichst fernhalten.
Ich erinnerte mich an Höhlen, die ich früher einmal auf Bali und in Malaysia besichtigt hatte und die einem das Blut in den Adern gefrieren ließen, und an all die anderen Orte in Kambodscha oder auf Saipan, wo ich die Hinterlassenschaft des Krieges in einem Ansturm bestürzender, dunkler Emotionen gespürt hatte. Ein Grund für meinen geschärften Sinn in diesen Dingen mag darin liegen, daß ich durch den Beruf meines Vaters von klein auf häufig mit solchen Stätten in Berührung gekommen bin. Ja, wirklich: Sobald ich denke, was für ein unheimlicher Ort hier, stellt sich auf Nachfrage meistens heraus, daß an der betreffenden Stelle irgendein Unfall oder eine andere schlimme Begebenheit passiert ist.
Aber die meiste Angst hatte ich immer vor den Lebenden. Verglichen mit einem lebendigen Menschen bleibt ein Ort doch nur ein Ort, egal wie schauerlich es dort auch sein mag, und ein Geist ist {16}nichts weiter als ein toter Mensch, da kann er noch so furchteinflößend sein. Nein, wenn ich mir ausmalen soll, wovor ich am meisten Angst hätte, dann ist und bleibt das der lebendige Mensch, davon war ich schon immer überzeugt.
Sobald ich um die Ecke bog, fiel mir die unheimliche Last augenblicklich von den Schultern, und es hüllte mich wieder die abendliche Stille ein.
Schnell senkte sich die Nacht herab, und um mich herum war alles erfüllt von angenehm klarer Luft. Wenn Wind aufkam, tanzte mir im Halbdunkel das bunte Ahornlaub entgegen, und ich fühlte mich umhüllt von Tüchern, gewebt aus wunderschönen Träumen.
Deshalb vergaß ich vollends meine Angst und wanderte weiter.
Schließlich ging es sanft bergab, und der Weg wurde breiter. Dann plötzlich, als ich gerade meinte, hinter den Bäumen eine Menge Lichter erkennen zu können, hatte ich das Städtchen auch schon erreicht. Zu beiden Seiten des Weges reihten sich kleine Geschäfte aneinander, der einsame Bahnsteig des unbesetzten Bahnhofs war hell erleuchtet, und in den Häusern brannte Licht, obwohl kaum eine Menschenseele zu sehen war.
Ich scheute mich, in eine der Kneipen zu gehen, {17}wo die Männer des Dorfes nach getaner Arbeit schon fröhlich beisammensaßen, daher entschied ich mich für einen heruntergekommenen Udon-Laden2.
Der Udon-Mann wollte offensichtlich gerade schließen, denn er war dabei, den geschlitzten Vorhang von der Tür zu nehmen; ich schien ihm ungemein lästig zu sein, trotzdem bat er mich notgedrungen herein, und ich nahm an, weil ich vom Laufen müde war und mich nur noch hinsetzen wollte.
Das Lokal war klein; auf dem nackten Zementboden standen nur vier Tische, und auf den Tischen standen leere Töpfchen für Sieben-Kräuter-Pfeffer, der schon vor hundert Jahren ausgegangen zu sein schien.
Mit geübten Handgriffen kochte der Mann eine Portion Udon und setzte mir die Schale mit der fertigen Nudelsuppe vor die Nase. Das Geplärre von irgendeiner Unterhaltungsshow im Fernsehen erfüllte den Raum, was die trostlose Stimmung nur noch unterstrich. Die Nudeln schmeckten so scheußlich, daß ich erschauerte, und als ich es wagte, ein Bier zu bestellen, bekam ich bloß »Hab ich nicht« zu hören. Wenn ich das gewußt hätte, wäre ich besser gleich ins Hotelrestaurant gegangen, wo {18}man von vornherein mit überteuertem schlechten Essen rechnet, dachte ich.
Der Mann trat von einem Bein aufs andere und wartete nur darauf, daß ich endlich aufaß; die Suppe war lauwarm und schmeckte scheußlich, und zu allem Überfluß waren die Udon-Nudeln in lauter kleine Stücke zerfallen, so daß man sie kaum herausfischen konnte. Um mich abzulenken, wollte ich schon mal nachsehen, wo sich das Hotel befand, griff in meine Jackentasche und zog die Karte heraus. Da plumpste etwas mit einem Klackern zu Boden.
Der Schreck fuhr mir bis ins Mark.
Es war genauso ein eiförmiger schwarzer Stein, wie ich sie in dem unheimlichen kleinen Schrein gesehen hatte.
Ja, gibt’s das, das kann doch nicht … nein, unmöglich, reiner Zufall, bestimmt, versuchte ich mir einzureden, schaffte es aber nicht, mich zu überzeugen. Ob ich denn vor lauter Angst kurzfristig so unzurechnungsfähig gewesen war, daß ich den Stein selbst in die Tasche gesteckt und dann vergessen hatte, versuchte ich mir vorzustellen, konnte es aber nicht glauben. Das würde zwar bedeuten, daß ich Angst vor mir selbst haben müßte, aber das wäre immer noch besser als die Panik, in die mich dieses Ding versetzte, dachte ich.
{19}Ich starrte den Stein eine Weile mucksmäuschenstill an, beschloß dann aber, die Sache aus dem Gedächtnis zu streichen und ihn einfach hier in diesem widerlichen, ungemütlichen Udon-Laden auf dem Boden liegenzulassen. Wobei ich inständig hoffte, er möge mich ja nicht weiterverfolgen!
Die kühl kalkulierende Seite in mir argumentierte: »So ein Stein kann unmöglich von selbst in meine Tasche gehüpft sein, also muß es sich um irgendeinen anderen handeln, der auf welchem Weg auch immer dort hineingeraten ist – vielleicht, als ich mittags unter freiem Himmel mein Lunchpaket gegessen hab«, und plädierte dafür, sich nicht länger den Kopf darüber zu zerbrechen.
Ich wollte nur noch so schnell wie möglich ins Hotel und auf mein Zimmer. Ich wollte fernsehen, mir die Haare waschen, Tee trinken – kurzum: ganz normal lauter gewöhnliche Dinge tun. Ja, richtig: Hatte da nicht gestanden, daß das Hotel über ein Thermalbad verfügte? – Bald würde ich mich im heißen Wasser aalen …
Da der Udon-Mann anfing, den Laden auszufegen, ließ ich den Rest der Nudelsuppe stehen und stand auf. Aus dem Augenwinkel bekam ich zuletzt noch mit, wie der Stein vom Besen erfaßt wurde und in eine Ecke des Ladens rollte.
{20}Im Hotel
An der Rezeption war schon alles dunkel, und der schmuddelige Teppichboden, mit dem die Eingangshalle ausgelegt war, stank nach Schimmel. Aber das störte mich nicht, ich war es gewohnt, in solchen Unterkünften zu übernachten. Ich war nur heilfroh, endlich angekommen zu sein.
Nachdem ich zum x-ten Mal die Klingel betätigt hatte, bequemte sich endlich jemand aus dem hinteren Tatami-Raum: eine hagere Frau von Mitte Fünfzig mit scharfem Blick.
Ihr schien auf der Zunge zu liegen, warum ich denn erst so spät hier aufkreuzte, aber als ich ihr sagte, daß ich noch nichts zu Abend gegessen hätte, wurde sie sofort umgänglicher.
Sie sagte, das Restaurant hätte bis zehn geöffnet, und wenn ich jetzt sofort hinginge, würde ich noch etwas bekommen; aber falls ich ihr verspräche, gleich wieder herunterzukommen, würde sie dort Bescheid sagen, daß sie auf mich warten sollten, dann könnte ich erst noch auf mein Zimmer, um {21}mein Gepäck abzustellen; der einzige Rāmen-Laden3 in der Nähe hätte nämlich heute seinen Ruhetag.
»Ja bitte, machen Sie das, ich komme auch sofort wieder herunter«, erwiderte ich und ging auf mein Zimmer.
Ich stellte mein Gepäck ab, zog die verschwitzten Socken aus und hetzte wieder zurück.
Natürlich war ich der einzige Gast in dem schummrigen Restaurant. In der seltsamen Blumenvase auf dem Tisch steckten künstliche Orchideen. Die Cremesuppe, die mir in einem Teller mit Blumenmuster serviert wurde, schmeckte natürlich nach Dose. Irgendwann mußten die Japaner da wohl etwas gründlich mißverstanden haben, daß sie so etwas für die Grundausstattung feiner westlicher Küche hielten. Aber die Suppe, das harte Brot und die kleine Flasche Bier wärmten mir endlich den Magen.
Draußen vor dem Fenster sah ich die dunklen Berge und das dunkle Städtchen. Die Lichtpunkte der Straßenlaternen erstreckten sich bis in weite Ferne. Ich bekam das Gefühl, im Nirgendwo gelandet zu sein. Als gäbe es kein Zurück. Als {22}würde dieser Weg nirgendwo mehr hinführen, als hätte diese Reise kein Ende, und als gäbe es kein Morgen mehr. Und als könnte ich nachempfinden, wie sich die Geister fühlen mußten. Sie waren schließlich auf ewig in dieser Art von Zeit gefangen, dachte ich. Und dann wunderte ich mich, wieso ich mir über so etwas wie die Gefühle von Geistern Gedanken machte. Wahrscheinlich war ich müde.