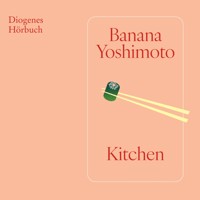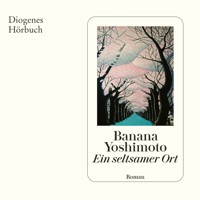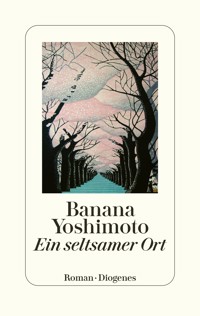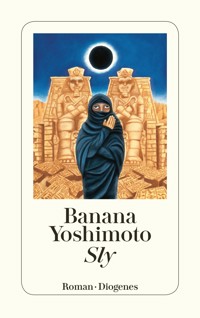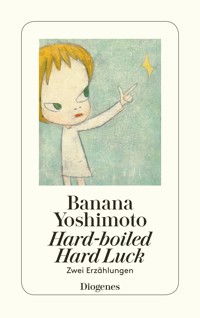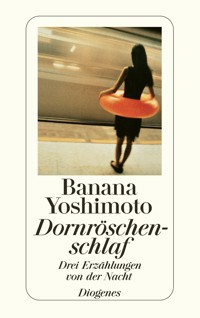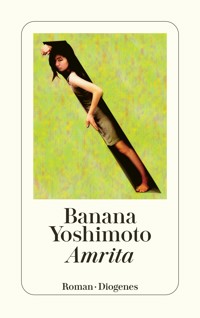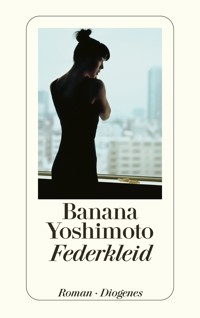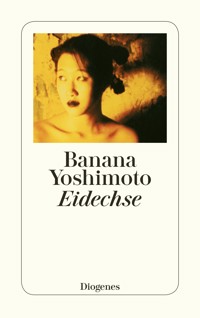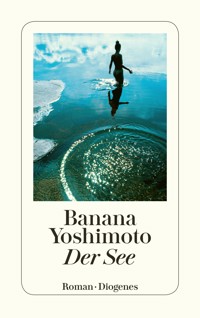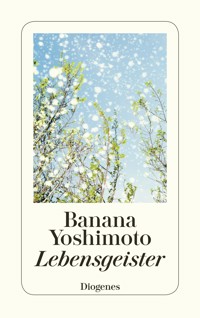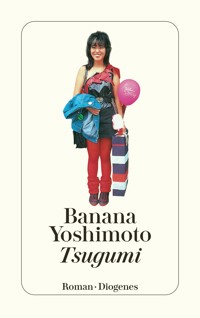
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf der Halbinsel Izu erneuern zwei Mädchen jeden Sommer ihre Freundschaft: die Ich-Erzählerin Maria und die wilde Tsugumi, deren Temperament nicht so recht zu ihrer fragilen Gesundheit passen will. Es ist der letzte Sommer einer engen Mädchenfreundschaft.Tsugumi lernt einen jungen Mann kennen, der im Ort heftig angefeindet wird. Er scheint der einzige zu sein, der das eigenwillige Mädchen zu erobern vermag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Banana Yoshimoto
Tsugumi
Roman
Aus dem Japanischen von Annelie Ortmanns
Diogenes
{7}Geisterpost
Sicher, Tsugumi1 war schon ein unmögliches Mädchen …
Ich bin in einem verschlafenen Städtchen aufgewachsen, in dem sich alles um Fischerei und Tourismus dreht. Mittlerweile lebe ich in Tokyo und habe angefangen zu studieren. Hier macht mir das Leben auch großen Spaß.
Ich bin Maria Shirakawa. Ich trage den Namen der Heiligen Mutter Gottes.
Das soll aber nicht heißen, daß ich ein heiliges Gemüt besäße. Trotzdem, aus irgendeinem Grunde scheinen sich alle meine neuen Freunde hier in Tokyo über meinen Charakter einig zu sein: »Mensch, bist du nachsichtig«, sagen sie, oder: »Du hast aber die Ruhe weg!«
Ich selbst würde mich ja eher als ungeduldig bezeichnen, als ganz normalen Menschen aus Fleisch und Blut. Und doch gibt es da ein paar Dinge, die mir seltsam vorkommen: In Tokyo regen sich die Leute sofort über alles auf, ob es nun regnet, die Vorlesung ausfällt oder ein Hund pinkelt. Ich bin da sicher anders. Kaum daß mich die Wut gepackt hat, verebbt sie auch schon wieder, wie Meereswasser, das sich vom Strand zurückzieht und im Sand versickert … Wahrscheinlich, weil ich vom Lande bin, hatte ich mir bisher immer eingeredet, bis mir vor kurzem auf {8}dem Heimweg von der Uni alles klar wurde: Schäumend vor Wut starrte ich ins Abendrot – so ein blöder Prof hatte meine Klausur nicht mehr angenommen, nur weil ich gerade mal eine Minute zu spät abgegeben hatte –, und da wußte ich plötzlich:
»Tsugumi! Das ist alles ihre Schuld, nein, ihr Verdienst!«
Jeder Mensch wird ungefähr einmal am Tag stinksauer. Jetzt fiel mir auf, daß eine innere Stimme mir in solchen Situationen immer ganz mechanisch den entsprechenden Wert auf der nach oben offenen Tsugumi-Skala zuflüstert. Das wirkt wie eine Zauberformel. Was hat man schon davon, sich aufzuregen? Diese Einstellung muß ich mir zugelegt, ja verinnerlicht haben, als ich mit Tsugumi zusammenlebte. Ich starrte immer noch in den Abendhimmel, dessen leuchtendes Orange langsam schwächer wurde, und hätte am liebsten ein bißchen geweint.
Liebe ist … wie die Japanischen Wasserwerke: Man kann verschütten, soviel man will, sie versiegt nie, selbst wenn man den Hahn ewig lange volle Kanne aufdreht. Ja, so ist das. – Keine Ahnung, wie ich in dem Moment darauf kam.
Die Geschichte, die ich erzählen will, handelt von Erinnerungen an meinen letzten Sommer in dem Küstenstädtchen meiner Jugend. Die vorkommenden Personen, die Menschen aus dem Gasthaus Yamamoto, sind längst von dort weggezogen, und ich glaube, ich werde nie wieder mit ihnen zusammenleben. Um heimzukehren, ist meinem Herzen kein anderes Zuhause geblieben als die Erinnerungen an die Zeit mit Tsugumi.
{9}Tsugumi war von Geburt an gesundheitlich furchtbar schwach, überall funktionierte etwas nicht bei ihr. Der Arzt hatte ihr ein kurzes Leben beschieden, und auch die Familie stellte sich darauf ein, weshalb sie von ihrer Umgebung verhätschelt und verwöhnt wurde. Ihre Mutter konsultierte Ärzte in ganz Japan und tat alles in ihrer Macht Stehende, um Tsugumis Leben auch nur um kurze Zeit zu verlängern. So kam es, daß sie zwar allmählich laufen lernte und heranwuchs, aber einen entschieden trotzköpfigen Charakter bekam. Es spornte sie nur noch mehr an, daß sie gesund genug war, um halbwegs normal leben zu können. Tsugumi hatte eine scharfe Zunge – boshaft, grob und unverschämt; hinterlistig war sie – mit Eigensinn und koketter Schmeichelei. Ihre triumphierende Miene, wenn sie gerade wieder ohne Umschweife und mit bewundernswertem Timing in treffende Worte gekleidet hatte, was ihr Gegenüber am meisten entsetzte, glich dem Antlitz des Teufels.
Ich wohnte zusammen mit meiner Mutter in einem Anbau des Gasthauses Yamamoto.
Mein Vater quälte sich in Tokyo mit der Durchsetzung der Scheidung von seiner schon lange von ihm getrennt lebenden Frau herum, um meine Mutter offiziell heiraten zu können. Von außen sah diese ganze Hin- und Herfahrerei immer furchtbar stressig aus, aber die beiden selbst schienen ziemlich glücklich zu sein dabei, schienen immer den Traum von jenem strahlenden Tag vor Augen zu haben, an dem wir alle drei als Familie in Tokyo würden zusammenleben können. Trotz des mehr oder weniger komplizierten äußeren Anscheins also hatte ich eine {10}harmonische Kindheit – als einzige Tochter eines sich liebenden Paares.
Die Yamamotos waren die Familie, in die die jüngere Schwester meiner Mutter eingeheiratet hatte. Während wir dort lebten, half Mutter in der Hotelküche aus. Die Yamamotos – das waren Onkel Tadashi und Tante Masako, die Betreiber des Gasthauses, und ihre beiden Töchter, die berüchtigte Tsugumi und deren ältere Schwester Yōko.
Auf der Hitliste der Personen, die unter Tsugumis unmöglichem Charakter zu leiden hatten, stand Tante Masako auf Platz eins und Yōko auf Platz zwei. Ich selbst nahm den dritten Rang ein. Onkel Tadashi kam Tsugumi nicht zu nahe. Schon meinen eigenen Namen mit auf die Liste zu setzen ist ziemlich anmaßend. Denn der tägliche Umgang mit Tsugumi hatte die zwei auf den vorderen Rängen so lieb und sanft gemacht, daß sie längst in die unerreichbaren Sphären der Engel auf Erden eingegangen waren.
Um die Altersverhältnisse klarzustellen: Yōko ist ein Jahr älter als ich, und ich bin ein Jahr älter als Tsugumi. Doch davon, daß Tsugumi jünger ist als ich, habe ich nie etwas gespürt. Sie war schon als Kind boshaft, und das Alterwerden hat nichts daran geändert.
Je schlechter es ihr ging und je öfter sie das Bett hüten mußte, desto haltloser wurde ihre Raserei. Der Ruhe wegen hatte sie ein niedliches kleines Doppelzimmer im zweiten Stock des Gasthauses ganz für sich allein. Von ihrem Zimmer aus hatte man den besten Ausblick, man konnte das Meer sehen! Das wunderschöne Meer, das in der Mittagssonne glitzerte, an Regentagen rauh und verhangen {11}war, und auf dem sich am Abend die vielen Lichter der zum Tintenfischfang ausfahrenden Boote spiegelten.
Ich kann mir nicht einmal vorstellen, was es heißt, Tag für Tag in der Aufregung und Ungewißheit leben zu müssen, ob man nun bald stirbt oder noch einmal davonkommt – ich bin ja gesund. Ich glaube nur, wenn ich lange in diesem Zimmer zu liegen hätte – ich würde den Ausblick auf die See und ihren salzigen Geruch über alles schätzen. Tsugumi schien sich jedoch überhaupt nichts aus all dem zu machen, riß die Vorhänge in Fetzen, knallte die Fensterläden zu, warf das Essen um, verstreute die Bücher aus den Regalen überall auf den Tatami – kurzum, das ganze Jahr über ließ sie das Zimmer so aussehen wie Linda Blair ihres in »Der Exorzist« und brachte ihre herzensgute Familie regelrecht zum Heulen. Einmal war sie tatsächlich der Schwarzen Magie verfallen, verkündete »Ich bin das Lehrmädchen der Großen Hexe« (oder so ähnlich) und hielt eine Unmenge von Nacktschnecken, Fröschen und Krebsen (einheimische offenbar) auf ihrem Zimmer, die sie dann in die Gästezimmer schmuggelte. Es hagelte Beschwerden. Damals vergossen meine Tante, Yōko und sogar mein Onkel wegen Tsugumis Benehmen wirklich Tränen.
Doch selbst da lachte Tsugumi sie bloß aus: »Ich werd’s euch zeigen, ihr Säcke, ich kratz einfach ab heut nacht, und dann wird’s euch leid tun. Hört schon auf zu heulen!« Seltsamerweise sah ihr höhnisches Gesicht dabei aus wie das Antlitz von Maitreya.2
{12}Ja, Tsugumi war schön.
Schwarzes, langes Haar, weiße Haut wie aus Porzellan, über den großen, großen mandelförmigen Augen lange, dichte Wimpern, die, wenn sie die Lider niederschlug, zarte Schatten warfen. Die dünnen Arme und Beine, an denen die Adern durchschimmerten, waren schlank und lang, doch im ganzen war ihr Körper zierlich klein. Sie besaß das anmutige, züchtige Aussehen einer wunderschönen Puppe, die die Götter selbst angefertigt hatten.
Seit der Mittelschulzeit hatte Tsugumi es sich zur Gewohnheit gemacht, irgendeinen Jungen aus ihrer Klasse zu behexen. Sie ging mit ihm am Strand spazieren und schmiegte sich dabei eng an ihn. Der Junge wußte meist nicht, wie ihm geschah, und machte sich total zum Narren. Normalerweise hätte man sich in so einer kleinen Stadt das Maul darüber zerrissen, doch die Leute waren davon überzeugt, daß jeder, ob er nun wollte oder nicht, der Anmut und Schönheit von Tsugumi verfallen mußte. Dem äußeren Anschein nach wirkte Tsugumi ja so lieblich und gut, wie ein ganz anderer Mensch. Tja, Gott sei Dank ließ sie wenigstens die Finger von den Hotelgästen. Sonst wäre aus dem Hause Yamamoto womöglich noch ein Bordell geworden.
Tsugumi und der Junge wandern am Abend über den hohen Deich, die Bucht liegt da im Dämmerlicht. Tief tanzen ein paar Vögel am Himmel; das Rauschen der Wellen kommt leise glitzernd näher. Niemand ist zu sehen, nur einige Hunde streunen umher; der Strand liegt da wie eine Wüste, weit und weiß; der Wind streicht um ein paar Boote. In der Ferne verblassen die Silhouetten der {13}Inseln, die zartrot leuchtenden Wolken versinken am Horizont.
Tsugumi geht gaaanz, ganz langsam.
Der Junge reicht ihr besorgt den Arm. Den Blick zu Boden gerichtet, legt Tsugumi ihre schmale Hand in seine. Dann sieht sie auf und lächelt. Ihre Wangen strahlen in der Abendsonne, ein Lächeln, so flüchtig wie der blendende Abendhimmel, der sich Augenblick um Augenblick weiter verändert. Ihre weißen Zähne, der schlanke Hals, die großen Augen, die den Jungen die ganze Zeit fest im Blick haben – alles droht jeden Moment im Sand und im Wind und im Wellenrauschen unterzugehen. – Ehrlich gesagt, es wäre gar nicht verwunderlich, wenn Tsugumi tatsächlich irgendwann einmal so verschwinden würde.
Tsugumis weißer Rock flattert im Seewind.
Wie sie sich bloß so verstellen kann, schimpfte ich im stillen, sooft ich dieses Schauspiel beobachtete, und dennoch war ich jedesmal den Tränen nahe. Der Anblick war so herzzerreißend, daß er sogar mich, die ich doch Tsugumis wahren Charakter kannte, zutiefst anrührte.
Daß aus Tsugumi und mir richtige Freundinnen wurden, kam erst durch den Vorfall, den ich gleich erzählen werde. Natürlich hatten wir auch als Kinder Kontakt zueinander. Es war sogar ganz lustig, mit ihr zu spielen, wenn man ihre gräßlichen Gemeinheiten und ihre scharfe Zunge ertragen konnte. In Tsugumis Phantasie war das kleine Fischerdorf eine Welt ohne Grenzen und jedes einzelne Sandkorn ein göttliches Mysterium. Sie hatte einen klugen Kopf und lernte fleißig, und obwohl sie ständig wegen Krankheit {14}fehlte, lagen ihre Schulnoten im oberen Bereich. Sie war eine Leseratte, las Bücher über alle erdenklichen Themen und wußte ungemein viel. Aber wie hätte sie sich auch ihr beachtliches Repertoire an Gemeinheiten ausdenken können, wenn ihr Kopf nicht ordentlich gearbeitet hätte!
In den ersten Grundschuljahren haben Tsugumi und ich immer ein Spiel gespielt, das wir »Geisterpost« nannten. Im Hinterhof der Grundschule stand ein altes verwittertes Wetterhäuschen – für uns die Verbindung zur Welt der Geister und der Briefkasten für Post aus dem Jenseits. Tagsüber gingen wir hin und legten gruselige Fotos und Geschichten hinein, die wir aus Zeitschriften ausgeschnitten hatten, um sie dann um Mitternacht zusammen holen zu gehen. Was am hellichten Tag überhaupt nichts Besonderes war, flößte uns im Dunkeln, wenn wir uns heimlich hinschlichen, echte Furcht ein, und eine Weile waren wir ganz versessen darauf. Aber wie das so ist mit solchen Spielen, geriet auch dieses neben all den anderen mit der Zeit in Vergessenheit. Als ich in die Mittelschule kam, trat ich in einen Basketballklub ein und mußte hart trainieren, weshalb ich mich nicht mehr so viel um Tsugumi kümmerte. Sobald ich nach Hause kam, schlief ich ein, und Hausaufgaben gab es schließlich auch noch. So kam es, daß Tsugumi mit der Zeit für mich nichts weiter als die »Cousine von nebenan« war. Doch just da passierte der bewußte Vorfall. Es war, da bin ich mir ziemlich sicher, in den Frühlingsferien des zweiten Mittelschuljahres.
An jenem Abend fiel sanfter Regen, und ich hatte mich in meinem Zimmer verschanzt. An der Küste riecht Regen nach Meer und Salz. Es war dunkel, ich hörte die Tropfen {15}fallen und war zutiefst deprimiert. Mein Großvater war vor ein paar Tagen gestorben. Ich hatte bis zum Alter von fünf Jahren bei meinen Großeltern gelebt und mich zu einem regelrechten »Opakind« entwickelt. Auch nachdem ich mit Mutter in das Gasthaus Yamamoto gezogen war, fuhr ich Opa und Oma besuchen, wann immer das möglich war, und wir schrieben uns regelmäßig Briefe. An jenem Tag war ich nicht zum Training gegangen, hatte kein Essen angerührt und saß nun mit verheulten Augen auf dem Boden, an mein Bett gelehnt. Draußen vor der Schiebetür hörte ich Mutter sagen: »Telefon für dich, es ist Tsugumi!«, aber ich antwortete nur: »Sag ihr, ich bin nicht da!« Mir ging es einfach nicht gut genug, um mich auch noch mit Tsugumi abgeben zu können. Und da meine Mutter Tsugumis drastische Art allzu genau kannte, sagte sie nur »Ja, in Ordnung« und ging. Ich setzte mich wieder auf den Boden, blätterte in einer Zeitschrift und muß wohl irgendwie eingenickt sein, als ich draußen auf dem Korridor die schlurfenden Schritte von jemandem in Slippern näher kommen hörte. In dem Augenblick, als ich aufschreckte und den Kopf hob, wurde auch schon die Schiebetür aufgerissen, und Tsugumi stand vor mir, klitschnaß.
Sie schnappte nach Luft – von der Kapuze ihres Regenmantels kullerten klare Wassertropfen auf die Tatami. »Maria …« oder so ähnlich sagte sie mit weitaufgerissenen Augen und dünnem Stimmchen.
»Was ist?«
Noch halb im Traum sah ich zu ihr auf. Sie schien sich zu fürchten und machte einen unsicheren Eindruck. Aufgeregt rief sie:
{16}»Mensch, wach auf! Was ganz Schlimmes ist passiert, schau dir das hier an!«
Ganz vorsichtig und behutsam zog sie ein Blatt Papier aus der Tasche ihres Regenmantels und reichte es mir. Mein Gott, was für ein Aufstand, dachte ich im stillen und nahm das Blatt gleichgültig entgegen, doch ein Blick darauf genügte, und ich hatte das Gefühl, als hätte man mich blitzartig mitten ins Rampenlicht gestoßen.
Das war unverkennbar die geliebte Handschrift meines Großvaters! In denselben kräftigen, kunstvollen Pinselstrichen und mit derselben Anrede, die er in seinen Briefen immer für mich verwendet hatte, stand da geschrieben:
Liebe Maria, mein Schatz!
Lebe wohl!
Paß gut auf Oma, Vati und Mutti auf! Mach dem Namen der Heiligen Mutter alle Ehre, und werde eine gute Frau!
Ryūzō
Ich erschrak. Augenblicklich kam mir Großvater in den Sinn, wie er aufrecht am Schreibtisch sitzt – mir wurde ganz warm ums Herz. Dann fragte ich Tsugumi eindringlich:
»Wo hast du das her?«
Tsugumi sah mich unverwandt an, ihre knallroten Lippen bebten, und sie sagte mit ernster, feierlicher Stimme:
»Das war im Geisterbriefkasten, kannst du das fassen?«
»Was sagst du?«
Im Nu blitzte in meinem Kopf die Erinnerung an das {17}Wetterhäuschen auf, das ich total vergessen hatte. Tsugumi senkte die Stimme und flüsterte:
»Ich weiß über so was Bescheid, ich bin ja dem Tod viel näher als ihr alle zusammen. Als ich vorhin eingeschlafen war, tauchte dein Opa in meinen Träumen auf. Ich wachte auf, aber es ließ mir keine Ruhe. Dein Opa hatte irgend etwas sagen wollen. Ich bin ihm schließlich allerhand schuldig, er hat früher immer an mich gedacht und mir alle möglichen Geschenke mitgebracht. Auch du kamst vor im Traum, und dein Opa versuchte, mit dir zu reden, er hat dich geliebt, weißt du. Und da schoß es mir plötzlich durch den Kopf: Ich ging zu unserem Briefkasten, um nachzusehen – und siehe da … Hast du deinem Opa zu Lebzeiten jemals von unserer ›Geisterpost‹ erzählt?«
Ich schüttelte den Kopf: »N-n-nein, ich glaube nicht.«
»Dann … Mensch, ich hab solche Angst!« schrie sie und fügte nach einer Weile in feierlichem Tonfall hinzu: »Dann ist aus dem Ding tatsächlich ein Briefkasten für ›Geisterpost‹ geworden!«
Sie preßte die Hände fest vor der Brust zusammen und schloß die Augen, als würde sie noch einmal Revue passieren lassen, wie sie selbst vorhin durch den Regen zum Geisterbriefkasten gerannt war. Draußen in der Dunkelheit tröpfelte der Regen weiter vor sich hin; es ging alles sehr schnell, Tsugumis Nacht zog mich von der Wirklichkeit weg immer weiter in ihren Bann. Es herrschte eine sanfte, unsichere Stille, in der alles, was bis dahin gewesen war, das Leben, der Tod, langsam, aber sicher in den Strudel des Mysteriums geriet, in das Reich einer anderen Wahrheit überging.
{18}Mit bleichem Gesicht und leisem Stimmchen sagte Tsugumi schließlich: »Maria, was sollen wir nur tun?«, und sah mich an.
»Auf keinen Fall …« begann ich mit fester Stimme. Tsugumi sah so brav und folgsam aus, als wäre sie in keinster Weise dem Ausmaß der Dinge gewachsen. »Auf keinen Fall sollten wir jemandem etwas davon verraten. Das wichtigste ist aber, daß du jetzt nach Hause gehst. Wärm dich auf und leg dich schlafen! Du kriegst sonst wieder Fieber! Wir haben zwar Frühling, aber es regnet. Geh und zieh dir schnell was anderes an. Wir reden morgen weiter.«
»Ja, du hast recht«, sagte Tsugumi und stand unvermittelt auf. »Ich geh jetzt besser.« Als sie hinausging, rief ich ihr noch hinterher: »Tsugumi! – Danke!«
»Ach, schon gut«, sagte sie und verschwand, ohne sich noch einmal umzudrehen oder die Schiebetür hinter sich zu schließen.
Ich blieb noch eine Weile auf dem Boden sitzen und las den Wortlaut auf dem Papier immer wieder. Tränen kullerten auf den Teppich. Eine heilige Süße erfüllte mein Herz, wie an jenem Morgen, als Großvater mich mit den Worten »Der Weihnachtsmann hat dir ein Geschenk gebracht« geweckt hatte und ich neben meinem Kopfkissen ein Paket liegen sah. Je öfter ich die Sätze las, desto weniger war ich in der Lage, die Tränen zurückzuhalten; ich hielt mich an dem Brief fest und weinte für immer.
Selig sind die, die reinen Glaubens sind!
Irgendwie verdächtig vorgekommen war mir das alles schon, bei Tsugumi weiß man nie, ich bin ja nicht blöd!
{19}Aber die kunstvolle Pinselschrift! Seine Schrift! Die Anrede, »Liebe Maria, mein Schatz!«, von der nur wir beide wußten, Opa und ich. Tsugumi, klitschnaß, mit diesem drängenden Blick und dem Nachdruck in der Stimme. Außerdem hatte sie etwas mit vollkommen ernstem Gesicht gesagt, worüber sie sonst höchstens Witze machte: »… weil ich dem Tod viel näher bin als ihr alle zusammen.« – Meine Güte, bin ich an der Nase herumgeführt worden, wirklich nach allen Regeln der Kunst!
Schon am nächsten Tag flog die Sache auf.
Ich wollte natürlich von Tsugumi sämtliche Einzelheiten über den Brief erfahren, ging also schon am Mittag des folgenden Tages hin, um mit ihr zu reden, aber sie war nicht da. Ich stieg hinauf in ihr Zimmer und wartete, als ihre Schwester Yōko hereinkam und mir Tee brachte.
»Tsugumi ist beim Arzt«, sagte sie und klang ein bißchen traurig.
Yōko ist klein und rund. Sie redet immer ganz sanft, als würde sie singen. Egal, was Tsugumi ihr auch antut, sie braust nie auf, wird nie wütend, nur traurig, im stillen. Ich fühle mich in Gegenwart eines solchen Menschen immer richtig klein. Tsugumi machte sich nur lustig über sie: »Dieser alte Lahmarsch! Das soll meine Schwester sein?« Aber ich hatte Yōko sehr gern und sogar Respekt vor ihr. Immer fröhlich, immer ein Lächeln auf den Lippen, obwohl das Leben mit Tsugumi doch kaum spurlos an ihr vorübergehen konnte – für mich war sie ein wahrer Engel.
»Geht es Tsugumi schlecht?« fragte ich besorgt. Sie hätte das Haus bei dem Regen nicht verlassen dürfen.
»Ach, ich weiß nicht, seit einigen Tagen hat sie bis zur {20}Erschöpfung Schreibübungen gemacht, und dann hat sie Fieber …«
»Waas?« sagte ich. Unter Yōkos verblüfften Augen begann ich, Tsugumis Schreibtisch abzusuchen. Und da sah ich es:
»Kalligraphie-Übungsheft.«
Außerdem fand ich Hunderte von Blättern, Tusche, Reibestein, Kalligraphiepinsel und als Tüpfelchen auf dem i einen an mich adressierten Brief meines Großvaters, den sie offenbar aus meinem Zimmer geklaut hatte.
Anfangs war ich mehr angewidert als wütend.
Warum treibt sie es so weit, fragte ich mich. Was muß sie nur für einen großen Groll gegen mich hegen, daß sie, die nie auch nur einen ordentlichen Pinsel besessen hat, so etwas fertigbringt! Woher kommt das bloß? – Ich hatte nicht den blassesten Schimmer. Ich saß in dem von der Frühlingssonne durchfluteten Zimmer, starrte ratlos aus dem Fenster auf das seidenmatt glänzende Meer hinaus und grübelte. Als Yōko gerade den Mund aufmachte, um etwas zu sagen, kam Tsugumi zurück.
Rotglühend vor Fieber schleppte sie sich schweren Schrittes und auf Tante Masako gestützt ins Zimmer, sah meinen Gesichtsausdruck, grinste breit und sagte:
»Aufgeflogen, was?«
Augenblicklich wurde ich rot vor Wut und Scham. Dann sprang ich plötzlich auf, stürzte mich entschlossen auf Tsugumi und versetzte ihr einen Stoß.
»Ma-Maria!« rief Yōko erschrocken.
Tsugumi ging zu Boden, riß krachend die Schiebetür mit und prallte schließlich mit Wucht gegen die Wand. {21}»Maria! Tsugumi ist gerade …« begann meine Tante, aber ich schüttelte den Kopf und schrie, während mir die Tränen nur so herunterliefen: »Sei still!«
Und feuerte weiter drohende Blicke auf Tsugumi ab. Weil ich so wütend war, so todernst wütend, brachte selbst Tsugumi kein Wort heraus. Niemand hatte sie bisher körperlich angegriffen.
»Wenn du nichts Besseres zu tun hast als so eine Scheiße«, sagte ich und warf das Kalligraphie-Übungsheft mit Karacho auf die Tatami, »dann kratz doch ab, von mir aus sofort, ist mir ganz egal!«
In dem Moment muß Tsugumi wohl klargeworden sein, daß ich für immer mit ihr brechen würde, wenn sie jetzt nichts täte. Ich war jedenfalls fest entschlossen dazu. Noch am Boden, sah sie mir geradewegs und klaren Blickes in die Augen. Und dann murmelte sie die Worte, die sie noch nie, zu keinem Zeitpunkt ihres ganzen Lebens, in den Mund genommen hatte, was auch immer passiert war – sie hätte sich eher die Zunge abgebissen:
»Entschuldige, Maria.«
Tante Masako, Yōko und allen voran ich selbst waren völlig baff. Wir hielten den Atem an und brachten keinen Ton heraus. Tsugumi hat um Verzeihung gebeten … Kann das überhaupt sein? Wie versteinert standen wir da, die Sonnenstrahlen überfluteten uns mit gleißendem Licht. In der Ferne war nur das Rauschen des Windes zu hören, der durch die nachmittägliche Stadt fegte.
»Phhphhphh«, prustete Tsugumi plötzlich in die Stille. »Aber, Maria, ehrlich, du glaubst wirklich alles! Hab dich ganz schön verarscht, was?« Mittlerweile platzte sie fast {22}vor Lachen und krümmte sich. »Mensch, überleg doch mal, wirf das bißchen Grips an, das du hast! Ein toter Opa, der Briefe schreibt! So ein Quatsch, dazu muß man wirklich ganz schön blöd sein, aahaha …«
Jetzt konnte sie es nicht mehr unterdrücken, hielt sich den Bauch und wieherte los, bis sie sich vor Lachen kugelte.
Das war so ansteckend, daß es auch für mich kein Halten mehr gab. Mit hochrotem Kopf stammelte ich »Mann, komm ich mir blöd vor« und platzte los. Meine Tante und Yōko starrten uns völlig entgeistert an, aber wir mußten nur immer wieder an unser Gespräch vom vergangenen verregneten Abend denken und konnten nicht aufhören, uns kaputtzulachen.
Von da an wurden wir Freunde fürs Leben, Tsugumi und ich, in guten und in schlechten Zeiten.
{23}Der Frühling und die Schwestern Yamamoto
Es war Frühlingsanfang, als Vater offiziell von seiner früheren Frau geschieden wurde und uns, das heißt, mich und meine Mutter, nach Tokyo holte. Ich wollte sowieso an eine Tokyoter Universität, hatte die Aufnahmeprüfung hinter mir und wartete auf das Ergebnis – genau zur selben Zeit, als Mutter auf Nachricht von meinem Vater wartete, weshalb wir beide damals bei jedem Klingeln des Telefons empfindlich zusammenzuckten. Tsugumi mußte uns natürlich ausgerechnet in dieser Zeit mehrmals täglich mit nervenden Anrufen beglücken, einfach so, nach dem Motto: »Och, nichts Besonderes – wie isses denn?«, oder: »Durchgefallen!« Da wir aber beide über allen Wolken schwebten, waren wir anders als sonst in der Lage, ihre Sticheleien stinkfreundlich an uns abprallen zu lassen: »Ach, Tsugumi, wie nett! Also, bis da-hann.«
»Endlich geht’s nach Tokyo!« Uns klopfte das Herz, wir platzten schier vor Vorfreude, und der Frühling lag in der Luft.
Mutter hatte wirklich lange gewartet im Haus Yamamoto, immer fröhlich, immer fleißig. Sie wirkte gar nicht so unglücklich dabei. Aber ich bin überzeugt, gerade weil sie sich so verhielt, konnte sie ihr Leid auf ein Mindestmaß begrenzen, und gerade weil sie immer so guter Dinge war, verlor Vater nie die Lust vorbeizukommen und blieb ihr treu. Mutter ist nie und nimmer ein starker Mensch, {24}nein, aber sie besitzt diesen Charakterzug, ganz unbewußt Stärke zu zeigen. Sie soll sich manchmal bei Tante Masako ausgeweint haben, doch die wußte wohl nie so recht, was sie dazu sagen sollte, weil Mutter meist mit so strahlender Miene erzählte, daß es sich – abgesehen vom Inhalt – gar nicht nach Ausweinen anhörte. Also nickte Tante Masako nur und lächelte zurück. Aber wie gut die Leute in ihrer Umgebung Mutter auch behandeln mochten – es änderte alles nichts daran, daß sie die ausgehaltene Geliebte ohne jede Perspektive war. Im stillen muß sie vor Ungewißheit oft so erschöpft gewesen sein, daß sie hätte heulen mögen. Und ich, ich bildete mir ein, ihre Gefühle zu verstehen, weshalb die pubertären Trotzphasen bei mir ausfielen und ich quasi wie von selbst erwachsen wurde.
Ja, ich habe wirklich viel gelernt in dem Küstenstädtchen, während ich mit Mutter auf Vater wartete.
Der Frühling nahte, es wurde mit jedem Tag wärmer, und mir wurde bewußt, daß ich bald von dort weggehen würde. Die uralten Flure im Haus Yamamoto, das Licht der Leuchtreklame am Abend, das immer so viele Insekten anlockte, die Berge, die man vom Wäschebalkon aus sehen konnte, die Wäscheleinen, die – man konnte machen, was man wollte – stets voller Spinnweben waren. Kleine vertraute Dinge, Alltäglichkeiten, doch auf einmal erschien mir das alles so lieb und teuer, so voller Heiterkeit und Helligkeit, daß mir das Herz überlief.
In den letzten mir verbleibenden Wochen machte ich jeden Morgen einen Spaziergang am Strand mit dem Hund der Tanakas von nebenan, ein japanischer Spitz mit dem nicht gerade einfallsreichen Namen »Pünktchen«.
{25}Bei gutem Wetter lag früh am Morgen ein ganz besonderes Leuchten über dem Meer. Die kalten Wellen schlugen an den Strand, um dann in Milliarden glitzernder Tropfen zu zerbersten, immer und immer wieder. Das Schauspiel erweckte ein irgendwie unnahbares, heiliges Gefühl in mir. Während ich mich oben auf die Spitze der Mole setzte, um dem Meer zuzusehen, lief Pünktchen allein am Strand umher und spielte mit den Anglern.