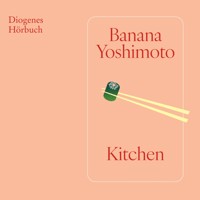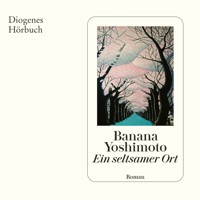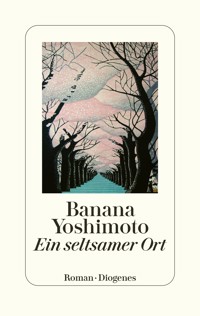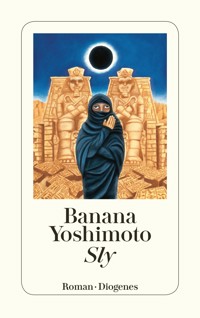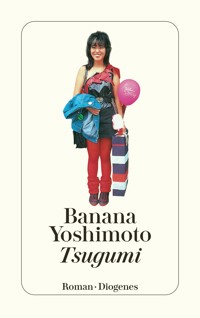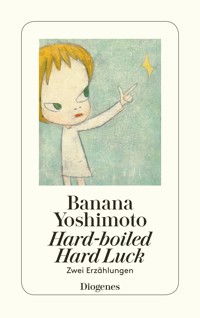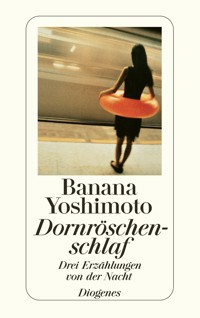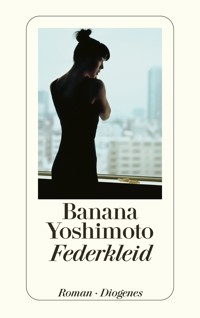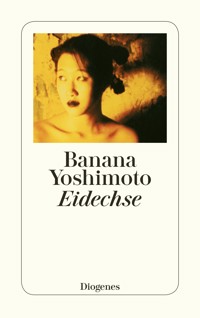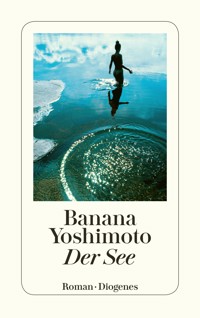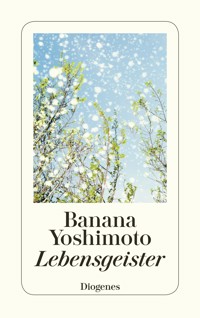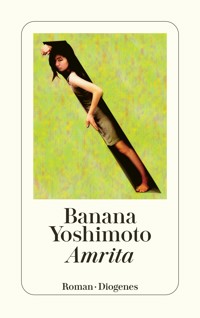
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie der längst zum Kultbuch gewordene Roman ›Kitchen‹ ist ›Amrita‹ die Geschichte einer ungewöhnlichen ›Wahl‹-Familie, die von der Trauer um einen geliebten Menschen zusammengehalten wird. ›Amrita‹ ist eine Odyssee durch die heftigsten Turbulenzen des Seelenlebens zu Selbstfindung und neuem Glück, und es ist vor allem eines: eine wunderschöne Hommage an das Leben. Es ist Yoshimotos hellsichtigstes und ernsthaftestes Buch, auch flapsig und skurril, vor allem aber von ungewöhnlicher Zartheit und Poesie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Banana Yoshimoto
Amrita
Roman
Aus dem Japanischen vonAnnelie Ortmanns
Titel der 1994 bei
Fukutake Publishing Co., Ltd., Tokyo,
und 1997 bei Kadokawa Shoten
Publishing Co., Ltd., Tokyo,
erschienenen Originalausgabe: ›Amurita‹
Copyright ©1997 by Banana Yoshimoto
Die deutsche Erstausgabe
erschien 2000 im Diogenes Verlag
Die deutschen Übersetzungsrechte
mit der Genehmigung von
Kadokawa Shoten Publishing Co., Ltd.,
unter Vermittlung des
Japan Foreign-Rights Center
Umschlagfoto von Takamitsu Kawarasaki
und Keiko Yamamoto
Für die freundliche Vermittlung
dankt der Verlag Norbert Görtz,
Galerie ARTicle, Köln
Copyright ©Takamitsu Kawarasaki / Keiko Yamamato
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright ©2015
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23329 2 (6. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60644 7
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5]Inhalt
Melancholie [7]
Amrita [43]
Willkommener Regen [45]
Der Tag der Geister [64]
Mutter und die schmerzliche Gesundheit [82]
Still Be A Lady / Girls Can’t Do[100]
Ein schöner Stern[122]
Die perfekte Erholung [142]
Das Leben [160]
Heimkehr [174]
Jede Menge Geheimnisse [192]
Halb tot [210]
Tod und Schwefel [231]
Memoria [249]
Um Haaresbreite [266]
Something’s Got to Give[289]
3 A. M. Eternal[306]
Das geheime Zimmer des Philosophen[327]
Menschen, die es gut haben [359]
What About Your Friends[390]
Mein Bruder auf dem Weg zurück [411]
Cinderella der Nacht [433]
Cruel[457]
[7]Melancholie
Ich bin ein ziemlicher Nachtmensch, deshalb komme ich meist erst nach Tagesanbruch ins Bett. Und bevor es Mittag wird, kriege ich grundsätzlich kein Auge auf.
Dieser Tag war daher die Ausnahme unter den Ausnahmen. Dieser Tag – damit meine ich den Tag, an dem das erste Paket von Ryūichirō ankam.
Ja, an jenem Morgen kam mein kleiner Bruder plötzlich wie wild in mein Zimmer gestürmt und rüttelte mich wach.
»Ein Paket, Saku-chan, steh auf, du hast ein Paket bekommen!«
Benommen setzte ich mich auf: »W-was?«
»Ein Riesenpaket, für dich!«
Er war total aus dem Häuschen – hätte ich mich wieder hingelegt und versucht weiterzuschlafen, er wäre ins Bett gesprungen und auf mir herumgehüpft, jede Wette. Was blieb mir also übrig? Schweren Herzens überwand ich mich, wach zu werden und hinunterzugehen. Auf der Treppe hing mein Brüderchen wie eine Klette an mir.
Als ich die Tür zur Küche öffnete, saß meine Mutter am Tisch und aß ein Brot. Der Duft von frischem Kaffee strömte mir entgegen.
»Morgen«, sagte ich.
»Ja, guten Morgen! So früh – was ist denn mit dir los!?« fragte Mutter mit erstauntem Gesicht.
[8]»Ach, der Zwerg hat mich wach gemacht! Wieso ist der Quälgeist eigentlich nicht im Kindergarten heute?«
»Ich hab ’n bißchen Fieber!« verkündete mein Brüderchen, wobei er sich auf einen Stuhl warf und eine Scheibe Brot angelte.
»Ach, deswegen bist du so aufgedreht!« Ich begriff.
»Bei dir war das genauso, als du klein warst. Immer, wenn man sich gewundert hat, was nur in dich gefahren ist, hattest du Fieber«, sagte meine Mutter.
»Wo sind denn die anderen?«
»Schlafen noch.«
»Kein Wunder, ist ja auch erst halb zehn!« seufzte ich. Um fünf war ich ins Bett gegangen. Es drehte sich noch alles in meinem Kopf, weil ich so unsanft aus dem Schlaf gerissen worden war.
»Willst du auch Kaffee, Saku?«
»Ja, bitte.« Ich setzte mich auf einen Stuhl. Durch das Fenster zur Straße schien direkt die Sonne herein. Die Strahlen der Morgensonne, in der ich seit langem mal wieder badete, fühlten sich an, als sickerten sie ganz in mich hinein. Von hinten, wie sie so in der morgendlichen Küche stand, sah Mutter klein und fein aus, wie eine Oberschülerin, die die frischgebackene Ehefrau spielt.
Sie war tatsächlich noch jung, mich hatte sie mit neunzehn bekommen. Das heißt, als sie so alt war wie ich jetzt, hatte sie schon zwei Kinder. Der Horror!
»Hier, dein Kaffee. Nimm dir Brot, wenn du magst.«
Auch die Hand, mit der sie mir die Tasse reichte, war schön. Man hätte nie für möglich gehalten, daß sie damit über zwanzig Jahre lang Hausarbeit gemacht hatte. Ich [9]liebte meine Mutter, so wie sie war, aber ein bißchen unheimlich war sie mir schon. Irgendwie hatte ich das Gefühl, daß sie etwas furchtbar Schlimmes getan haben mußte, um dem Älterwerden zu entgehen.
In jeder Klasse gibt es doch so ein Mädchen, das zwar keine umwerfende Schönheit ist, aber dieses gewisse Etwas an Eleganz und Sinnlichkeit besitzt, auf das ältere Männer total abfahren – genau so eine mußte Mutter früher gewesen sein. Vater war vierzig und Mutter neunzehn, als die beiden heirateten. Dann, nachdem ich und meine jüngere Schwester Mayu auf die Welt gekommen waren, war Vater plötzlich an einem Schlaganfall gestorben.
Vor sechs Jahren hatte Mutter zum zweiten Mal geheiratet. Mein kleiner Bruder war geboren worden, doch vor einem Jahr hatte sie sich von dessen Vater getrennt.
Nachdem uns das Klischee »Vater, Mutter, Kinder« abhanden gekommen war, hatte sich unser Haus zu einer Art Pensionsbetrieb entwickelt.
Damals waren wir gerade zu fünft: Außer Mutter, meinem kleinen Bruder und mir wohnten bei uns noch meine Cousine Mikiko und Junko, eine Jugendfreundin meiner Mutter, die ihre Gründe gehabt hatte, zu uns zu ziehen.
Nicht gerade ausgewogen in der Zusammensetzung vielleicht, aber wir hatten uns wunderbar zusammengerauft, und ich mochte dieses Frauenparadies irgendwie. Mein Bruder war noch klein, und so besänftigte er unsere Gemüter und hielt uns zusammen wie ein Schoßhündchen.
Mutter hatte ausnahmsweise mal einen Freund, der jünger war als sie, aber weil mein Bruder noch zu klein war und [10]weil sie keine Ehe mehr in den Sand setzen wollte, schien sie ihn vorerst nicht heiraten zu wollen. Er kam uns oft besuchen, und sein Verhältnis zu meinem Bruder war auch ziemlich gut – es war also durchaus denkbar, daß er in nicht allzu ferner Zukunft bei uns einziehen würde. Doch bis dahin würde unsere seltsam unausgewogene Zusammensetzung wohl noch eine Weile fortbestehen müssen.
Fürs Zusammenleben spielt Blutsverwandtschaft überhaupt keine Rolle.
Das war mir schon aufgefallen, als mein zweiter Vater bei uns wohnte. Er war ein schüchterner, wirklich guter Mensch, weshalb ich es damals sehr traurig fand, daß er auszog. Ich konnte mich dieser ganz bestimmten, unbeschreiblichen Melancholie, diesem drückenden Ernst, der in der Luft liegt, wenn ein Mensch aus dem Haus gegangen ist, einfach nicht entziehen.
Vielleicht hat sich deshalb langsam bei mir der Eindruck entwickelt, daß aus Menschen, die in einem Haus zusammenwohnen, irgendwann von selbst eine Familie wird, solange es nur eine zentrale, einigermaßen gefestigte Persönlichkeit gibt (in unserem Fall meine Mutter), die imstande ist, die Ordnung unter den Mitgliedern aufrechtzuerhalten.
Und noch etwas:
Ein Mensch, der lange nicht im selben Haus lebt, verblaßt mit der Zeit, wie die Erinnerung an eine liebgewonnene Landschaft, da mag man noch so enge Blutsbande haben.
Wie Mayu, meine jüngere Schwester.
Daran mußte ich plötzlich denken, als ich den Kaffee trank und auf dem harten Nußbrot herumkaute.
[11]Die Kombination von Küchentisch und Morgensonne hatte mich offenbar dazu verleitet, über Familie nachzudenken.
»So, Yoshi-chan, höchste Zeit für dich, ins Bett zu gehen, sonst wird die Erkältung nur noch schlimmer!« versuchte Mutter meinen Bruder in sein Zimmer zu bugsieren.
»Übrigens, stimmt das mit dem Paket, das für mich angekommen sein soll?« fragte ich.
Mutter drehte sich in der Tür noch einmal um und sagte: »Ja, es steht vorne im Eingang«, bevor sie sie hinter sich zuzog.
Ich stand auf und ging in die Diele.
Dort, auf dem sonnengebleichten Holzboden, ragte der riesige, längliche Karton wie eine weiße Skulptur empor.
Zuerst dachte ich an Blumen.
Ich hob ihn an. Für Blumen war er viel zu schwer. Als Absender war »Ryūichirō Yamazaki« und die Anschrift eines Gasthauses in Chiba angegeben. Eine Ferienadresse.
Was mochte nur darin sein? Ungeduldig riß ich das Paket an Ort und Stelle auf.
Ein Brief lag nicht bei.
Zum Vorschein kam nur eine schwere, fest in Plastikfolie eingewickelte Figur von Nipper, dem Werbehund von RCA-Victor. Schon durch die Folie hindurch befiel mich bei seinem Anblick ein sehnsüchtiges Gefühl, und als würde er langsam aus dem Meer auftauchen, rückte er mit jeder Schicht Folie, die ich abmachte, näher. Da war er, glatt und in altmodischem Schwarzweiß, der Hund, der in diesem herzzerreißenden Winkel den Kopf neigt und lauscht.
»Ach nein, wie lieb!« Ich stand da und schaute den Hund [12]aus meinen immer noch verschlafenen Augen eine Weile an, wie er inmitten des Durcheinanders aus Kartonfetzen und Plastikfolien saß, das ich angerichtet hatte.
Im Morgenlicht und im Geruch von Staub sah der Hund so edel und rein aus wie in einer Schneelandschaft.
Warum ausgerechnet Nipper? Ich verstand es nicht, hatte aber doch das Gefühl, die Treuherzigkeit von Ryūichirōs Gedanken auf der Reise nachvollziehen zu können, wie er diesen Hund beispielsweise vor einem Trödelladen entdeckt und die Augen einfach nicht wieder davon hatte abwenden können.
Außerdem wollte der Hund mir eindeutig etwas sagen.
Etwas, das ich unbedingt hören wollte.
Um es hören zu können, legte ich mit ernstem Gesicht den Kopf schief und spitzte die Ohren, ungefähr so wie er, aber ich verstand ihn nicht.
Ryūichirō war der Geliebte meiner jüngeren Schwester Mayu gewesen.
Mayu war tot.
Ein halbes Jahr zuvor war sie mit dem Auto gegen einen Strommast geknallt und gestorben. Alkohol am Steuer, außerdem hatte sie noch eine beträchtliche Menge Schlafmittel geschluckt.
Mayu hatte, aus welchen Gründen auch immer, von Geburt an äußerst ebenmäßige Gesichtszüge und ähnelte weder Vater noch Mutter, noch mir. Damit will ich nun nicht sagen, daß unsere Gesichter besonders schrecklich anzusehen wären, aber dieser – charmant ausgedrückt – coole, – weniger vorteilhaft ausgedrückt – sarkastische Zug, der uns [13]dreien gemeinsam war, fehlte ihr seltsamerweise ganz und gar, und als Kind ähnelte sie einem Engelspüppchen.
Dieses Aussehen hatte sie um ein normales Leben gebracht. Ehe man sich’s versah, wurde sie entdeckt: Sie wurde Kindermodell, bekam Nebenrollen in Fernsehspielen, und später, als Erwachsene, wurde sie dann Filmschauspielerin. So kam es, daß die Künstlerwelt allmählich ihre Familie wurde und sie schon sehr früh von zu Hause auszog.
Deshalb war ich erschrocken, als bei ihr, die so beschäftigt war, eine Neurose festgestellt wurde und sie sich von heute auf morgen aus diesem Geschäft zurückzog. Denn mit der Arbeit schien alles in Ordnung zu sein, und wenn ich sie traf, war sie scheinbar immer guter Dinge.
Der Einfluß der Künstlerwelt mußte für das heranwachsende Mädchen verheerend gewesen sein; kurz vor ihrem Rückzug war es so weit gekommen, daß alles an ihr – Gesicht, Stil, die Art, wie sie sich schminkte, wie sie sich kleidete – wie die fleischgewordene Wunschvorstellung alleinstehender Männer wirkte. Da es aber genügend Künstlerinnen gibt, die nicht so werden, muß es wohl an ihr gelegen haben, denke ich. Wahrscheinlich war am Ende nur noch Flickwerk ihrer selbst übriggeblieben, nachdem sie sich so lange bemüht hatte, ihre Schwachstellen mit vorgefertigten Versatzstücken notdürftig auszubessern und zu vertuschen. Die Neurose war der Hilferuf ihres Lebenswillens.
Deshalb dachte ich, daß Mayu nach ihrem Rückzug aus der Szene, als sie in ihren Männerbeziehungen gründlich aufgeräumt hatte und plötzlich begann, mit Ryūichirō zusammenzuleben, ihr Leben von Grund auf neu beginnen wollte, als unbeschriebenes Blatt sozusagen.
[14]Ryūichirō war Schriftsteller, und zu der Zeit, als er Mayu kennenlernte, soll er sich noch als Ghostwriter für Drehbuchautoren durchgeschlagen haben. Mayu mochte seine Drehbücher und konnte seine Handschrift immer herauslesen, egal, für wen er gerade schrieb. Darüber sollen sie sich nähergekommen sein.
›Schriftsteller‹ war gut: Vor drei Jahren hatte er einen einzigen umfangreichen Roman herausgebracht, und seither war nichts mehr von ihm erschienen. Doch erstaunlicherweise war dieses eine Buch für eine bestimmte Sorte von Leuten zu einer Art Klassiker geworden, denn es verkaufte sich immer noch leise weiter.
Ich hatte den Roman von Mayu zu lesen bekommen, bevor ich Ryūichirō zum ersten Mal traf. In hohem Maße abstrakt und außerordentlich dicht schildert er darin junge Leute, die kein wirkliches Herz besitzen, weshalb ich direkt Angst vor dem Autor bekam und ihn lieber nicht treffen wollte. Ich erwartete einen Wahnsinnigen. Aber als ich ihn schließlich doch traf, stellte er sich als ganz normaler junger Mann heraus. Danach hab ich mir dann gedacht, daß er eine unglaubliche Menge Zeit kondensiert haben mußte, um einen so dichten Text zu weben. Diese Art von Talent hatte er.
Nachdem Mayu sich aus der Schauspielerei zurückgezogen hatte, lebte sie ohne feste Arbeit mit ihm zusammen; sie hatte hie und da ein paar Jobs. Weil das ziemlich lange so ging, hatten Mutter und ich irgendwann sogar vergessen, daß die beiden gar nicht verheiratet waren. Ich besuchte sie oft in ihrer Wohnung, und sie kamen genauso oft zu uns. Sie waren immer ganz normal, es schien ihnen gutzugehen, daher konnte ich mir einfach nicht vorstellen, weshalb sie so [15]verrückt gespielt haben sollte und Alkohol und Tabletten verfallen war. Ich fand nichts Ungewöhnliches daran, daß sie Alkohol trank oder Tabletten nahm, weil sie nicht schlafen konnte, oder daß sie an einem sonnigen Nachmittag Bier aus dem Kühlschrank holte. Aber wenn ich’s mir recht überlege, hatte ich tatsächlich ständig das Gefühl, daß sie etwas eingenommen hat. Doch weil sie es so natürlich tat, habe ich nichts darauf gegeben.
Aber im nachhinein, wenn ich weit zurückdachte und sie mir als Kind vorstellte, wenn ich mir ihr schlafendes Engelsgesicht wieder vergegenwärtigte, die geschlossenen Augen mit den langen Wimpern, ihre zarte, vollkommen schutzlose weiße Haut, dann konnte ich mir denken, daß das schon angefangen hatte, lange bevor sie mit der Künstlerwelt in Berührung kam und lange bevor sie Ryūichirō traf.
Aber bestimmt hätte niemand wirklich wissen können, wann und wo diese Sache ihren Anfang genommen hat und wohin sie führen würde. Die Betreffende selbst lachte – nur das Herz innen drin wurde elender und elender, wurde von Motten zerfressen, bis es schließlich nicht mehr da war.
»Kann es nicht sein, daß sie die Tabletten einfach nur verwechselt hat?« fragte Ryūichirō im Krankenhausflur, als Mayu vorbeigetragen wurde. Da war ihr Zustand schon hoffnungslos.
»Ja… Sie ist doch noch so jung!« antwortete ich.
Aber keiner von uns, weder ich noch Ryūichirō, noch Mutter, die daneben stand, glaubte tatsächlich daran. Das Wissen war so unumstößlich, doch niemand sprach es aus, es wäre zu taktlos gewesen.
[16]Sie?
Sie, die so penibel war, daß sie die Tagesrationen ihrer Tabletten in einzelne Pillendöschen abpackte, bevor sie auf Reisen ging?
Was aber viel schlimmer war: Damals war ihr Leben längst dabei zu verglühen, wie ein Häuflein niedergebrannter Asche. Sie war unglaublich gealtert, und sie hatte längst aus den Augen verloren, daß sie in Wirklichkeit noch so jung war und noch so viel vor sich hatte.
Sie wird nicht zu retten sein. Sie will wohl auch nicht gerettet werden.
Obwohl sie doch zu uns gehörte und wir sie alle liebten, ließ uns dieser Gedanke auf dem kalten Venyl-Sofa nicht los und hallte immer wieder lauthals durch unsere Herzen und von den leeren, weißen Krankenhauswänden wider.
Mutters Augen waren lange Zeit so gut wie jeden Tag rot, ich aber konnte nicht weinen.
Nur ein einziges Mal habe ich wegen meiner Schwester Tränen vergossen.
Das war eines Abends, etwa zwei, drei Tage nachdem die Nipper-Figur angekommen war. Mein kleiner Bruder und meine Cousine Mikiko waren zum Videoladen gegangen und hatten sich den Zeichentrickfilm Totoro von nebenan1 ausgeliehen. »Och, bitte, guck doch mit!« Die beiden waren in mein Zimmer gekommen, und so ging ich mit ihnen [17]hinunter. Sie hatten absolut nichts Böses im Sinn. Ohne zu wissen, worum es in dem Streifen ging, machte ich Tee, holte Kekse, schob vergnügt meine Beine unter den Kotatsu,2 und begann mir den Film mit den beiden anzusehen.
Schon nach den ersten fünf Minuten dachte ich: O-oh, das geht nicht gut…
Der Film handelte von zwei kleinen Schwestern, und seine allgemeinen, suggestiven Bilder schwappten mit ihrer ganzen Nostalgie in Wellen über mich: Ja, genau so ist es gewesen, das auch und das auch. Die Farben der Glückseligkeit der allzu kurzen Kinderzeit, die die beiden Schwestern zusammen haben, der Wind und das Licht – alles war genau so wiedergegeben, wie wir es damals auch gesehen haben.
Dabei weckte der Film nicht einmal konkrete Erinnerungen an Mayu.
Zum Beispiel daran, wie wir, als wir noch klein waren, zu dritt in die Berge gefahren sind. Wie wir uns unter dem Moskitonetz Gruselgeschichten erzählt und uns dann zum Schlafen aneinandergekuschelt haben, Mayus dünnes, braunes Haar, ihr Babygeruch… Das alles sah ich nicht einmal konkret vor mir. Aber die machtvollen Faustschläge der damit verbundenen Sehnsucht, die der Film in mir wachrief, prügelten mich dermaßen durch, daß ich beinahe k.o. ging.
Das hat natürlich niemand außer mir gespürt.
Mein Bruder war völlig hin und weg und starrte nur noch gebannt auf den Bildschirm, Mikiko machte dabei ihre [18]Hausaufgaben und schien den Film nur mit halbem Auge zu verfolgen. Von Zeit zu Zeit sprach sie mich in normal gutgelauntem Ton an: »Mensch, der Vater von Shigesato Itoi synchronisiert ja grottenschlecht, findest du nicht, Saku-chan?«
»Mhm, ja, aber er trifft’s doch irgendwie, oder?«
»Tja, Geschmäcker sind halt verschieden«, warf mein Bruder ein.
Obwohl ich zur selben Zeit am selben Ort war, denselben Film sah und mit den anderen redete, hatte ich das seltsame Gefühl, allmählich von ihnen weg in eine fremde, surreale Welt abzudriften.
Doch daß ich das Video nicht allein, sondern mit den anderen zusammen sah, hatte mich sicher davor bewahrt, in Trübsal zu versinken, und mich in einem Zustand heiteren Starrens gehalten. Als der Film aus war, verließ ich das Zimmer, um aufs Klo zu gehen. Der erste Schock war schon vorbei, und ich dachte ganz normal: Ein guter Film!, als ich die Klotür öffnete.
Und da stand die Nipper-Figur. Ich hatte den Hund in das Klo im Erdgeschoß gestellt, weil in meinem Zimmer kein Platz dafür war.
Ich setzte mich hin. Als ich den Hund ansah, wie er so herzzerreißend den Kopf schieflegte, hatte ich plötzlich wieder Lust zu weinen, und ehe ich mich’s versah, liefen mir schon die Tränen die Wangen hinunter. Eine Sache von nicht einmal fünf Minuten. Aber ich weinte so heftig, daß die Welt um mich herum sich drehte und ich nicht mehr wußte, wo oben und unten war. Ein Gefühl wie beim Kotzen. Ich weinte, ohne Luft zu holen. Nicht um die ständig benebelte, dick geschminkte Mayu der letzten Jahre, deren Gefühle [19]schon völlig abgestumpft waren, sondern um die verlorene Zeit aller Schwestern dieser Welt.
Als ich vom Klo zurückkam und mich wieder an den Kotatsu setzte, sagte mein Bruder: »Saku-chan, du hast aber lange gekackt!«
»Na und – haste was dagegen?« gab ich zurück, und Mikiko lachte.
Endlich hatte ich weinen können. Es war das erste und letzte Mal.
War es das gewesen, was Nipper mir hatte sagen wollen?
Vor seiner Abreise habe ich Ryūichirō nur noch ein einziges Mal getroffen; das war an einem Abend, ein paar Tage vor Frühlingsbeginn.
Bis dahin war ich noch Büroangestellte gewesen, war dann aber gefeuert worden, weil ich mit einem Vorgesetzten Krach bekommen hatte; also hieß es erst mal, mit irgendeinem Job Geld zu verdienen, und so arbeitete ich nun an fünf Tagen in der Woche in meiner guten alten Stammkneipe.
Es sollte ein wundersam langer Abend werden. Ein denkwürdiger Abend, der trotz seiner Länge und verschiedener Sprünge durchgängig dieselbe Grundstimmung hatte.
Ich war ziemlich spät dran und ging, ohne nach rechts oder links zu schauen, durch die abendlichen Straßen, geradewegs in Richtung Kneipe. Eben erst hatte es aufgehört zu regnen, und auf dem Bahnhofsvorplatz verschwammen die Lichter, liefen auseinander wie am Meer bei Sonnenuntergang, was mich in meinem verzweifelten Lauf mächtig irritierte.
Am Straßenrand standen Leute, die den Passanten immer [20]wieder eindringlich zuriefen: »Was ist Glück?« Ich wurde auch einige Male angehalten, doch wenn ich ihnen »Weiß ich doch nicht« entgegnete, waren sie plötzlich verschwunden, als hätte man sie geschickt zurückgespult.
Aber dadurch zog jedesmal der Gedanke an das Glück für einen Augenblick sein Nachbild sanft und leise durch mein hastendes Herz wie einen pfirsichfarbenen Schweif. Und es war mir, als würden dort nacheinander bekannte Melodien vom Glück angestimmt.
Moment mal, dachte ich.
In unerreichbarer Ferne gab es noch ein viel stärkeres, golden strahlendes Bild, und das war es doch, worum es allen wirklich ging. Viel mächtiger als alle Wünsche und alles Licht zusammengenommen.
Das, wovor man schnell wegläuft, wenn man vor dem Bahnhof nach dem Glück gefragt wird; das, was dichter und dichter rückt, wenn man zuviel getrunken hat, und dann auf einmal zum Greifen nahe scheint.
Vielleicht deshalb, dachte ich. Denn was Glück anging, war Mayus Charakter vollkommen verquer gewesen, sie war unersättlich und doch unfähig und träge zugleich; sie hatte zwei Gesichter.
Wirklich toll an ihr war nur ein einziger Punkt:
Eine Gabe, für die man sie anbetete, die alles andere vergessen machte – ihr Lächeln.
Wenn sie, die geschäftsmäßiges Lächeln in hundert Variationen aufsetzen konnte, plötzlich einfach so, unschuldig und ohne jede Absicht, lachte, dann rührte dieses Lächeln die Menschen und entschädigte für alle ihre Fehler.
Dieses süße Lächeln, bei dem mit einemmal der blaue [21]Himmel und die Sonne durchbrachen und alle Wolken verschwanden, sobald sich ihre Mundwinkel hoben und die Augenwinkel sanft senkten.
Dieses blendend reine, zum Weinen herzzerreißende, gesunde, natürliche Lächeln.
Dessen Kraft selbst dann nicht getrübt war, als ihre Leber schon vollkommen angeschlagen, die Gesichtsfarbe fahl und die Haut schrecklich rauh geworden war.
Sie hat es mit ins Grab genommen.
Ich hätte es ihr sagen sollen. Jedes einzelne Mal. Anstatt sie mit offenem Mund anzustarren, hätte ich es ihr sagen sollen.
Obwohl ich mich so abgehetzt hatte, war noch kein einziger Gast da, als ich in der Kneipe ankam. Hinterm Tresen waren der Wirt und die andere Bedienung eher gelangweilt damit beschäftigt, Musik auszuwählen. Ohne Musik war es in der Kneipe so still wie auf dem Meeresgrund, die eigene Stimme schien laut zu schallen.
»Was ist denn hier los – Freitag, und kein Mensch da?« sagte ich, worauf der Wirt nur unbekümmert meinte: »Och, wahrscheinlich, weil’s regnet.«
Ich band mir die Schürze um und gesellte mich zu den beiden Schlaffis. Ich mochte diesen Laden einfach, schon als ich hier nur Gast war.
Zuerst einmal, weil es hier durch die schummrige Beleuchtung so gemütlich war. Man konnte kaum die Hand vor Augen sehen. In der Kneipe herrschten ständig Lichtverhältnisse, als sei es zwar schon dunkel geworden, man habe sich aber noch nicht dazu bequemen können, das Licht [22]einzuschalten. Sogar leer hatte der Laden seinen Reiz. Die Möblierung bestand aus einem Sammelsurium von Tischen und Stühlen, wobei jedes einzelne Stück von den seltsamen Geschmäckern längst vergangener Tage zeugte. Wie früher im Klassenzimmer der Mittelschule stank der Holzboden nach Bohnerwachs, ein brauner Grundton sorgte für das altmodische Ambiente, und der Tresen drohte zu knarren, wenn man sich etwas fester dagegenlehnte. Benommen vor Verwunderung schaute ich mich in diesem Raum um, der mit der Stille ein so ganz anderes Gesicht erhielt, als wenn er voller Leute war.
In dem Moment ging plötzlich die Tür auf, und Ryūichirō schoß herein: »Hi!«
Wir fuhren alle drei zusammen. Doch zu guter Letzt schaffte ich es, guten Abend zu sagen.
»Kriegt ihr in diesem Laden immer einen Schreck, wenn ein Gast hereinkommt?« sagte Ryūichirō, als er sich an den Tresen setzte.
»Wir hatten uns schon damit abgefunden, daß heute niemand mehr erscheint«, sagte ich.
Ryūichirō sah sich in der Kneipe um und sagte: »Schade um den vielen schönen Platz hier, was?«
»Aber wenn es alle Jubeljahre mal voll wird, dann ist es richtig voll! Allerdings auch ziemlich ungemütlich«, lachte ich.
»Sie dürfen gerne wieder gehen und warten, bis andere Gäste kommen«, sagte der Wirt. Er war ein Genußmensch von Ende Dreißig und glücklich, wenn in der Kneipe nichts zu tun war, weil er dann seine Lieblingsplatten so oft laufen lassen konnte, wie er wollte.
[23]Ich kam hinterm Tresen hervor, legte die Schürze ab und verwandelte mich in einen Gast-Dummy, der jederzeit wieder als Bedienung einspringen konnte (allerdings tauchte ohnehin niemand mehr auf an jenem Abend).
Etwas lustlos fingen wir an zu trinken. Und hörten dieselbe Jazzplatte immer und immer wieder.
Irgendwann zwischen nettem Geplaudere sagte er plötzlich: »Tja, was heißt schon Glück.«
Er meinte das eher witzig, aber ich stutzte erschrocken und fragte: »Haben sie dich etwa auch befragt, eben, vor dem Bahnhof?«
»Was? Wie kommst du jetzt darauf?«
»Na ja, das Wort Glück nimmt man doch normalerweise nicht so oft in den Mund, oder?« sagte ich. Ich starrte in mein Glas und sah zu, wie das Eis langsam schmolz und seine kalte Farbe das klare Braun noch durchsichtiger machte. Es gibt Nächte, in denen einfach alles stimmt, in denen mein Herz sich seltsam scharf auf die Dinge einstellen kann. Das war so eine Nacht. Obwohl ich allmählich betrunken wurde, drohte die Feineinstellung kein bißchen zu verwackeln. Die schummrige Kneipenatmosphäre und die Klaviermelodie, die im Takt herüberklang wie ferne Schritte, gaben meiner Konzentrationsfähigkeit die Sporen.
»Schon, aber bei dir und deiner Schwester war die Verwendungsfrequenz dieses Wortes doch wohl hoch, im Vergleich zu den meisten Leuten«, sagte Ryūichirō. »Wenn du zum Beispiel bei uns warst und ihr beiden zusammengesessen habt, dann habt ihr nur noch über Glück geschwatzt, wie die zwitschernden Vögelchen, ehrlich.«
»Typisch Schriftsteller, wie du redest«, warf ich ein.
[24]»Erstens: Eure derzeitige Familienkonstellation ist doch wie aus einem amerikanischen Film. Eine junge Mutter, ein kleiner Bruder und – eine Cousine? Und wer noch?«
»Eine Freundin meiner Mutter.«
»Na, siehst du. Das ergibt schon mehr Gelegenheiten, über Glück nachzudenken, als Personen da sind. Außerdem ist es in deinem Alter mehr als ungewöhnlich, einen Bruder zu haben, der noch in den Kindergarten geht.«
»Wieso, es ist schön, ein Kind im Haus zu haben, es hält alle jung. Obwohl er auch lästig ist. Es ist doch total interessant, jeden Tag miterleben zu dürfen, wie er größer wird.«
»Ja, aber er droht ein seltsamer Kauz zu werden, wenn er bloß unter älteren Frauen aufwächst.«
»Er soll erst mal ein schöner, junger Mann werden. Und wenn er dann in der Oberschule ist… dann bin ich ja schon über dreißig, furchtbar!…Na ja, egal, dann werde ich mich jedenfalls in meine Pumps schmeißen, mir eine Sonnenbrille aufsetzen und mich mit ihm verabreden. Da sollst du mal sehen, wie sich die jungen Mädchen aufregen werden!«
»Das darfst du nicht, glaub mir! Solche Jungs sind doch geradezu prädestiniert dafür, Muttersöhnchen zu werden!«
»Ich bleibe dabei, ich freu mich auf später. Kinder sind prima. Die pure Vielfalt der Möglichkeiten.«
»Das ist wahr, alles ist offen, alles ist Zukunft: der erste Schultag, die erste Liebe, das sexuelle Erwachen, die Klassenfahrt…«
»Die Klassenfahrt?«
»Ja – hat dich das jetzt überrascht? Es ist nur, weil… Ich hab meine verpaßt, damals in der Oberschule, weil ich plötzlich Fieber bekommen hab, und das bedaure ich bis heute.«
[25]»Und jetzt – warum unternimmst du jetzt keine Reise?« fragte ich.
Ich wußte selbst nicht, warum ich ihm diese Frage stellte. Ich hatte bloß ausgesprochen, was mir in dem Moment in den Sinn kam.
»Reisen… ja, das wäre schön. Eigentlich könnte ich jederzeit losfahren«, sagte Ryūichirō verzückt, als hätte er dieses süße, schöne Wort eben erst gelernt. »Außerdem müßte ich jetzt nicht mehr so ärmlich reisen wie früher.«
»Ja, monatelanges Reisen ohne Geld ist gar nicht gut für die Gesundheit«, pflichtete ich ihm, warum auch immer, bei. Irgendeine plötzliche Erleuchtung schien Ryūichirō in helle Aufregung versetzt zu haben, denn auf einmal war er nicht mehr zu bremsen:
»Weißt du, ich hab doch manchmal auf Kyūshū oder im Kansai-Gebiet zu tun, mit irgendeinem Verleger und Kameramann zusammen, als Autor für Reisebeschreibungen und so was. Meistens mach ich das mit irgendwelchen Bekannten, die mir die Jobs auch zugeschustert haben. Trotzdem ist es anders, als gemütlich alleine zu reisen, ich muß ja doch ständig Material sammeln und Notizen machen und so. Wenn ich dann so zwei, drei Tage konzentriert gereist bin, wird mein Kopf klar, und ich will gar nicht mehr nach Hause zurück. Komisch, aber ich bin dann allen Ernstes davon überzeugt, daß es natürlicher wäre, einfach so weiterzufahren. Ich hab ja keine großartigen Verpflichtungen, und die Miete und so könnte ich von überall her überweisen. Meinen Reisepaß habe ich sowieso immer als Ausweispapier dabei, ich könnte also unter Umständen sogar ins Ausland. Erspartes hab ich auch. Auf dem Rückweg im Flugzeug oder [26]im Shinkansen3 denk ich also mit klopfendem Herzen daran, einfach sitzenzubleiben und dann irgendwo umzusteigen und weiterzufahren, sofort, einfach so. Und dann hab ich ein Gefühl, als würde da und dort ein neues Leben anfangen. Alles Nötige könnte ich mir kaufen, Wäsche waschen im Bad vom Hotelzimmer und die Manuskripte per Fax schicken. Und dann stelle ich mir alles immer genauer vor: Hat nicht irgendwer erzählt, da oder dort wäre es wunderbar gewesen, und wann war doch gleich das Volksfest in dieser oder jener Stadt? Dann komme ich in meiner Wohnung an und denke, jetzt hab ich schon so weit gedacht, hab mich so darauf gefreut, wieso bin ich bloß ausgestiegen? Ob ich doch nach Hause zurückwollte?«
»Vielleicht weil Mayu da war?«
»Ja, aber jetzt ist sie nicht mehr da.«
»Das ist wahr.«
In dem Moment wurde mir plötzlich ganz melancholisch zumute, als wäre ich auf einer Abschiedsfeier für jemanden, der weit weggeht und nie mehr wiederkommt. Dabei befand ich mich ganz normal bei der Arbeit, wie immer. Und doch ging diese etwas unheimliche Melancholie um. Ich fürchtete mich davor, in Trauer und Trübsal zu versinken. Hilfesuchend warf ich einen Blick über den Tresen, aber mein Chef und die andere Kellnerin waren nach wie vor in ein ernstes Gespräch vertieft und sahen nicht gerade so aus, als würden sie uns in absehbarer Zeit mit einem netten Witz beglücken.
Auf einmal sagte Ryūichirō: »Mayu-chan – das war ein [27]reisemäßiger Mensch.« Es war das erste Mal an diesem Abend, daß er von sich aus auf Mayu zu sprechen kam.
»Was heißt das – reisemäßig? Ist das so ein Adjektiv, das man sich als Schriftsteller einfallen läßt?« Ich lachte.
»Ja, ja, warte nur, ich werde es schon noch näher erläutern«, sagte Ryūichirō grinsend. »Ich meine, sie war ein Mensch, dem die Arbeit gleichgültig war, sie war überhaupt bei allem ziemlich cool, aber ein unvorhersehbarer, eigenartiger Teil von ihr war echt. Und darin lag auch ihre Anziehungskraft… Eine Reise ist schon was Seltsames… Ich will jetzt gar nicht anfangen von wegen ›Das Leben ist eine Reise‹ oder ›Reisekameradschaft‹, aber wenn man zwei oder drei Tage mit den gleichen Leuten unterwegs ist, dann wird man doch – ob das nun daran liegt, daß Männer und Frauen nicht getrennt sind oder daß man nicht arbeitet, oder daran, daß man müde ist – so komisch high, oder? Auf der Rückfahrt will man sich gar nicht mehr trennen, man benimmt sich total ausgelassen, alles ist total komisch, egal, was man sich erzählt, man bildet sich ein, das hier wäre das richtige Leben, soviel Spaß hat man. Und auch, wenn man längst zu Hause angekommen ist, scheinen die anderen noch dazusein, wie Nachbilder, und wenn man am anderen Morgen alleine aufwacht, denkt man: Wie? Wo sind sie denn auf einmal alle?, und wird ganz trübsinnig in der Morgensonne, total verschlafen. Na ja, aber wenn man erwachsen ist, behält man immer im Hinterkopf, daß so etwas schön ist, weil es vorbeigeht, oder? Nicht so Mayu. Sie war so naiv zu glauben, wenn sie dieses seltsame Gefühl einmal gehabt hatte, müßte sie auch dafür einstehen und es weiterverfolgen. Und damit nicht genug: Von allen Arten der Sympathie hielt sie [28]ausgerechnet dieses Gefühl für Liebe, und die hatte für sie, glaube ich, gerade damit zu tun, daß ich nie einen festen Job hatte und sie in ihren Gedanken ganz auf die Außenwelt fixiert war, daß wir also kein normales Paar waren – das, bildete sie sich ein, sei Liebe. Sie hat nie davon gesprochen, daß wir heiraten sollten, was wir zusammen machen wollten oder überhaupt von der Zukunft. Für sie gab es keine Zukunft. Nur Kurztrips. Und das war gerade das Beängstigende für mich… Irgendwie, als drohte auch ich in den Strudel dieser ›ewigen Jugend‹ mit hineingezogen zu werden.«
»Sie wird so geworden sein, weil sie Filmschauspielerin gewesen ist, wenn auch nur kurz«, sagte ich. Als Mayu gestorben war, hatte ich nämlich lange über diesen Punkt nachgedacht. »Der Regisseur, der Mitarbeiterstab, die Besetzung: Für eine bestimmte Zeit und mit einem bestimmten Ziel war sie doch immer mit denselben Gesichtern zusammen. Tag und Nacht, ohne Unterschied, hundemüde, konzentriert. Viel tiefer, viel enger als mit der Familie oder dem Geliebten. Physisch und psychisch. Aber die Verbindung besteht nur für ein einziges Szenario, das sich in alle Winde zerstreut, sobald der Film im Kasten ist. Dann kehren alle in ihren Alltag zurück. Was bleibt, sind die Filmszenen, als Nachbilder dieser Tage. Beim preview wird sie sicher bei jeder einzelnen Szene noch einmal nachempfunden haben, wie diese Tage waren. Aber sie würden nie mehr wiederkommen. Das mag ja vielleicht wie eine Miniaturausgabe des Lebens an sich sein – nur, unter normalen Lebensumständen wird man nicht so sehr darauf gestoßen. Vielleicht war Mayu weniger nach Alkohol und Tabletten als nach diesem extremen Kreislauf von Kennenlernen und Abschied süchtig.«
[29]»Aha, dann wart ihr also die Schwestern Süchtig«, lachte Ryūichirō.
»Ich bin doch anders«, sagte ich erschrocken. »Ich würde dafür nicht sterben.«
»Ah, ja. Ja, sicher, du bist ein ganz anderer Typ«, sagte er, aber ich hatte noch eine Weile daran zu knabbern.
Konnte ich das wirklich behaupten?
Konnte ich wirklich behaupten, ich gehörte nicht zu denen, die ihre Madeleine in den Tee tunken und dabei Kurztrips zu vergangenen Augenblicken der Glückseligkeit unternähmen? Konnte ich wirklich behaupten, daß ich mein momentanes Leben, die Menschen, mit denen ich zusammenlebte, nicht als kurzen Ausflug betrachtete?
Ich konnte es einfach nicht sagen. Und ich wollte es auch gar nicht herausfinden. Ich hatte Angst davor.
Wenn ich nämlich lange genug darüber nachdächte, könnte auch ich mich, genausogut wie jeder andere, als Mayu entpuppen.
Um zwei machte die Kneipe zu. Nachdem alles aufgeräumt war, traten wir auf die Straße hinaus. Von Regen war nichts mehr zu spüren, die Nacht war sternenklar und kühl, und es roch ganz leise nach Frühling. Durch den dünnen Mantelstoff hüllte mich der weiche Nachtwind ein.
Die anderen verabschiedeten sich, und ich war mit Ryūichirō allein. Ich fragte ihn: »Nimmst du ein Taxi?«
»Mir wird wohl nichts anderes übrigbleiben.«
»Kannst du mich unterwegs rauslassen?«
»Klar, liegt ja auf dem Weg… Warte mal, hast du nicht sowieso ein Buch von mir?«
[30]»Wie?«
»Ja, ich such es schon seit Tagen und kann es nicht finden. Hatte plötzlich Lust, es noch mal zu lesen. Hab auch schon die Buchläden der Nachbarschaft abgeklappert, aber die hatten es nicht vorrätig. Es ist bestimmt mit den Büchern von Mayu bei dir gelandet. Flow My Tears, the PolicemenSaid von Philip K. Dick. Ist nicht so schlimm, nur ein Taschenbuch, aber wenn es wirklich bei dir ist, spring ich gleich schnell mit zu euch rein und hole es, das wäre doch das Bequemste, meinst du nicht?«
»…Weißt du noch, um was es geht?« erkundigte ich mich erschrocken.
Zwischen den Häuserreihen, die nur noch als dunkle Schatten zu erkennen waren, schob sich der endlose Strom der Nachttaxis um die Kurve. Die Dunkelheit strotzte vor der frischen, saftigen Schwärze des Jahreszeitenwechsels, und in der Luft, die ich einatmete, lagen unzählige traumhaft klare Düfte.
Die Antwort kam wider Erwarten unbefangen.
»Nee – ich hab’s vor ewigen Zeiten gelesen, und jetzt bringe ich es total mit seinen anderen Sachen durcheinander – ich erinnere mich überhaupt nicht mehr. – Kennst du es?«
»M-m«, verneinte ich. »Ach so«, sagte er und winkte ein Taxi heran.
Das Haus war schon vollkommen dunkel, und so schlich ich mit Ryūichirō auf leisen Sohlen die Treppe hinauf, direkt in mein Zimmer.
Bis auf weiteres hatte ich sämtliche Bücher von Mayu [31]bekommen, aber ich hatte sie noch nicht geordnet. Die Taschenbücher, zum größten Teil noch in den Umschlägen vom Buchladen, lagen in vier hohen Stapeln neben meinem Bett.
»Warte kurz, ich suche sie systematisch durch.«
»Soll ich dir helfen?«
»Nee, laß nur, setz dich doch irgendwo hin«, sagte ich, während ich ihm schon den Rücken zugewandt und mich vor den Bücherberg gehockt hatte.
»Kann ich Musik anmachen?«
»Klar. Da vorne sind alle meine CDs und Kassetten, such dir was aus!«
»Okay.«
Ich hörte, wie er hinter mir zu kramen anfing. Erleichtert begann ich, Buch für Buch aus dem Umschlag zu nehmen.
In Wahrheit hatte ich den Roman sehr wohl gelesen und kannte die Geschichte genau. Ich hatte nur nicht die geringste Lust gehabt, darüber zu reden. Er handelte von der schönen, jungen, tablettensüchtigen Schwester eines Polizeibeamten, die unter Einfluß einer seltsamen Droge ein Verbrechen begeht und am Ende unter tragischen Umständen stirbt. Alles paßte genau auf Mayu, bis hin zur Charakterisierung der Figur der Schwester.
Wenn er also nicht nur so getan hatte, als erinnere er sich nicht mehr (und da war ich mir ziemlich sicher), sehnte er sich bestimmt danach zu weinen.
Dachte ich.
Er konnte nicht weinen, obwohl er wollte, also suchte er unbewußt nach Anlässen dazu – und fand sie.
Wie bitter.
[32]Ich war in Verlegenheit, weil der Inhalt des Buches so überaus augenfällig war, und wußte nicht recht, ob ich nicht lieber so tun sollte, als könnte ich es nicht finden… da dröhnte mir plötzlich aus den Lautsprechern in meinem Rücken ein Riesenlärm ins Ohr.
Das Stimmen von Streichinstrumenten, das Gequatsche von Leuten, die gebrochenen Klänge von background music, das Aneinanderstoßen von Gläsern.
»Was ist denn das?« fragte ich laut, ohne meine Suche zu unterbrechen. In aller Unschuld las er mir die Beschriftung vor, die auf der Kassettenhülle stand.
»Äh, also hier steht nur: ›April 1988. Band Omnibus.‹ – Ein Live-Mitschnitt, oder? Ich wollte damals in dieses Konzert, hab’s aber verpaßt. Da haben doch die XYs gespielt, die ich so mochte – kurz darauf haben sie sich dann getrennt…«
So oder ähnlich redete er weiter, aber da hörte ich seine Stimme schon nicht mehr, weil mich tiefe Rührung ergriffen hatte.
Das war Gedankenübertragung. Oder er hat meine gelesen.
Währenddessen lief das Band weiter und weiter, und die lautlose Stimme in mir schwoll immer lauter an. Sie fragte: Warum bloß? Warum hat er ausgerechnet dieses Band gefunden? Obwohl ich selbst doch total vergessen hatte, daß es existierte.
Ob mir überhaupt die passenden Worte einfallen für das, was sich danach in meinem Herzen abspielte: für die subtilen Wellen der heiklen Wahl, für die Kluft der Entscheidung, in der abertausend Gedanken hin und her schwirrten? – Nein, ich durfte das nicht zulassen; wenn ich das Band jetzt [33]sofort anhielte, ließe es sich noch vertuschen. Aber was war mit dem Buch und damit, daß er zufällig aus Bergen von Kassetten ausgerechnet diese eine herausgefischt hatte? Wenn die Trauer, die sich auf dem tiefsten Grund seines Herzens verborgen hielt, dermaßen schrie, dann war es vielleicht meine Pflicht, ihn weiter zuhören zu lassen. Diese beiden Ansichten flatterten wild durcheinander.
Güte und Gehässigkeit, tausendfach ineinander verschlungen, Güte und Gehässigkeit aus viel tiefer liegenden Schichten, Melodram und Nonfiction – die unterschiedlichsten Dinge vermischten sich miteinander, gerieten ins Stocken, Romantik kam noch hinzu, und irgendwann neigte sich die Waage dahin, ihn doch weiter zuhören zu lassen.
Ein herzzerreißender Entschluß – wie Maria Muttergottes, die vom Himmel herab über das Ende eines Liebespaares wacht.
Als das Band eine Weile gelaufen war, mischte sich plötzlich eine bekannte Stimme in die allgemeine Unruhe:
»Ey, Schwesterherz, wie nimmt man denn auf mit dem Ding? Ist es so richtig?«
Mayu.
An jenem Tag hatte sie plötzlich angerufen und gesagt, sie wäre eigentlich mit Ryūichirō verabredet gewesen, aber der sei nun verhindert und ich müsse mit meinem Aufnahmegerät vorbeikommen. Was soll’s, ich machte mich also auf den Weg ins Live House. Das war vor zwei Jahren, als es ihr noch gut ging. Zumindest so gut, daß sie Musik, die sie mochte, noch aufnehmen wollte. Es war die einzige meiner Kassetten, auf der ein bißchen was von Mayus Stimme zu hören war.
[34]Irgendwann kurz vor Konzertbeginn hatte Mayu mich so angesprochen. Die Saalbeleuchtung verdunkelte sich, die Scheinwerfer erhellten die Bühne, und die Leute dämpften ihre Gespräche und warteten auf den Anfang des Konzerts.
Dann meine Stimme: »Ja, ja, alles in Ordnung. Das rote Lämpchen ist doch an, siehst du? Da, wo REC dransteht. Laß es so.«
»Ja – brennt. Danke«, sagte Mayu. Diese wohlvertraute, lang vermißte Stimme. So hell und klar. Sie verklang langsam, wie ein wertvoller Ton.
»Schwesterherz, meinst du wirklich, das Band läuft?«
»Ja, alles in Ordnung, faß jetzt lieber nichts mehr an!«
»Ja, ich weiß: Ewig hab ich Schiß, daß was schiefgeht.« Während sie noch auf das Gerät hinuntersah, mußte sie ein wenig lachen. Durch das gedämpfte Licht lag ihr Gesicht vollkommen im Schatten, trotzdem war es zu sehen, ihr Lächeln, dieses phantastische Lächeln, das zu nichts anderem als zum Lächeln da war.
»Den ewigen Schiß hast du von Mutter«, meinte ich, und Mayu entgegnete, das Gesicht immer noch nach unten gewandt: »Wie geht es ihr eigentlich in letzter Zeit?«
Stürmischer Applaus, Begeisterungsschreie.
»Ah, es fängt an, es fängt an!«
Da sah Mayu traumhaft langsam zur Bühne auf.
In einem Winkel, gekonnter als in allen Filmen, in denen sie bislang aufgetreten war.
Ihr bläulichweiß erhelltes Profil schwebte einsam in der Dunkelheit wie ein von der Sonne angestrahlter Mond. Die Pupillen weit geöffnet, als träume sie, die losen [35]Haarsträhnen zitterten golden, die spitzen Öhrchen in dem lauteren Wunsch aufgestellt, jeden einzelnen Ton zu hören…
Endlich begann die Musik. Ich schrak zusammen und kehrte in die Gegenwart zurück. Ryūichirō sagte: »Wie kannst du mich das anhören lassen?«
Ich drehte mich zu ihm um, aber er weinte nicht. Er hatte nur leicht die Augen zusammengezogen und lächelte gequält.
»Das hab ich nicht gewußt«, sagte ich. Die zweite Lüge an diesem Abend. Damit hatte die Spannung sich endlich gelöst, und die Zeit war wieder in ihrem normalen Fluß. Ich drehte ihm den Rücken zu und suchte weiter nach dem Buch.
Ob er an jenem Abend hatte weinen können, als er alleine war?
Das Buch war wohlbehalten aufgetaucht. »Tja – willst du nicht wenigstens einen Tee…?« Leise tappten wir also die Treppe wieder hinunter. Doch als ich vorsichtig die Tür zur Küche aufmachte, saßen dort Mutter und Junko am Eßtisch, im Schein der Tischlampe, und tranken Bier. Ich zuckte zusammen.
Dann sagte ich: »Na, so was – seid ihr etwa die ganze Zeit hiergewesen?!«
»Ja, wir haben uns festgequatscht«, lachte Junko. Sie war eine uralte Freundin von Mutter, aber vom Charakter her das genaue Gegenteil: Sie wirkte unkompliziert, gelassen und sanft. Jetzt, im Schein der nächtlichen Küchenlampe, [36]strahlte ihr rundes Gesicht eine Stimmung aus wie in den Märchen, die ich als Kind immer gehört hatte.
»Und wir haben auch gehört, wie ihr hereingeschlichen seid. Wir haben nachgeschaut, die Männerschuhe entdeckt und uns schon so schön ausgemalt, wie wir dich ein Leben lang damit aufziehen könnten, wenn ihr zwei Stunden lang nicht heruntergekommen wärt – aber da seid ihr ja schon wieder, nach kaum einer Viertelstunde! Und dann gehören die Männerschuhe auch noch zu dir, Ryū-chan. Wie fad, kein Funken Erotik.«
Mutter hatte mal wieder ganz wie Mutter gesprochen und lachte.
»Setzt euch doch zu uns. Wie wär’s mit ’nem Bier?«
Und so saßen wir bald zu viert um den Tisch und tranken Bier. Ein komisches Gefühl.
Ryūichirō sagte: »Ich hab mir hier ein ausgeliehenes Buch zurückgeholt. Ich werde nämlich bald verreisen.«
»Verreisen?« sagte Mutter. Sie wußte nur zu gut, wie sehr Mayu ihm fehlte.
»Ja. Ohne besonderes Ziel. Ich möchte eine Weile herumfahren, nur so«, sagte Ryūichirō betont unbekümmert.
»Leute, die Romane schreiben, müssen ja auch ab und zu alleine durch die Gegend reisen, Material sammeln und so«, meinte Junko bewundernd.
»Ja, genau«, antwortete Ryūichirō.
Hier griff ich ein, um möglichen Komplikationen vorzubeugen: »Mich würde ja viel mehr interessieren, was ihr beide hier mitten in der Nacht zu bereden habt. Also, was ist los?«
»Zieh uns bitte nicht auf. Wir haben nämlich wirklich [37]ernsthaft über so einiges gesprochen, vor allem, wie es bei mir weitergehen soll«, sagte Junko leise und lächelte.
Junko befand sich gerade mitten in ihrem Scheidungsprozeß. Sie hatte eine kleine Tochter, die zur Zeit bei ihrem Mann und seiner Geliebten wohnte. Junko wollte mit ihrem Kind zusammenleben, und darum stritten sie sich. Der Ehemann wollte seine Tochter nicht hergeben, und auf sich alleine gestellt, war Junko in einer wirtschaftlich prekären Lage; das kleine Mädchen war zwischen den beiden hin und her gerissen. In dieser Situation hatte Mutter Junko zu sich eingeladen, bevor sie sich alleine irgendwo ein Zimmer nähme und depressiv würde, und so war Junko in unser Haus gezogen. Ryūichirō kannte selbstverständlich die Umstände.
»Ja, und dann sind wir plötzlich auf das Thema Liebe zu sprechen gekommen, und auf die Männer, und wie ER denn sein müßte, wenn… und zu guter Letzt sind wir doch tatsächlich beim Heiraten angelangt – bescheuert, als ob wir beiden betagten Damen uns seit der Oberschule kein bißchen verändert hätten! Wir waren gerade dabei, uns das einzugestehen, als ihr herunterkamt«, kicherte Mutter.
»Ja wirklich, es war genau wie früher, wenn wir zusammen in einem Zimmer geschlafen und die Nächte durchgequatscht haben. Genau dieselben Themen«, sagte Junko, gleichermaßen amüsiert.
»Aha, deshalb sind Sie beide auch so jung geblieben!« bemerkte Ryūichirō ganz ernsthaft, und die beiden kicherten über das Kompliment, aber ich dachte, ja, das genau sind die Eindrücke eines Schriftstellers, und blickte voller [38]Bewunderung auf sein Profil und auf die beiden fröhlich lachenden Frauen mittleren Alters. Im Schein der Lampe sahen ihre straffen, lachenden Gesichter ganz anders aus als sonst, im Alltag: jung und voller Hoffnung, als hätten sie die Zeit tatsächlich schadlos überstanden.
Die Küche um Mitternacht, geheime Zwiegespräche. Die beiden Frauen, die miteinander flüsterten, lachten und scherzten, von ihren Träumen erzählten und dabei jünger wurden.
Und was war mit mir? Wo war mein Platz unter diesen Menschen, mit denen ich zusammenlebte? Was war das, dachte ich, ein wunderbares Ammenmärchen oder ein Alptraum? – Schwer zu sagen.
»Ja, dann«, sagte Ryūichirō an der Haustür.
Wir hatten ihn zu dritt zur Tür gebracht.
»Paß auf dich auf!«
»Gute Reise! Und komm gesund wieder!«
»Halt die Ohren steif!« riefen wir durcheinander und winkten ihm nach. Als Ryūichirō zurückwinkte, glänzte sein blaßblauer Arbeitshandschuh in der Dunkelheit wie ein Leuchtkäfer.
Wie mag der Eingang zu unserem Haus wohl für Ryūichirō ausgesehen haben? Hell erleuchtet, mit drei Blumen, die sich im Wind wiegten?
Schon kurze Zeit später war er abgereist.
Rief ich bei ihm an, meldete sich nur der Anrufbeantworter mit der Nachricht: »Ich bin zur Zeit verreist. Bitte sprechen Sie aufs Band.«
[39]Dieselbe Nummer, unter der sich früher Mayu mit ihrem goldenen Lächeln gemeldet hatte: »Ah, Saku-chan?« Je higher, desto fröhlicher.
Das Krankenhaus. Die Drogen. In der Apotheke frei erhältliche und verschreibungspflichtige. Alkohol, alle möglichen Sorten aus aller Herren Länder, die es im Spirituosenladen zu kaufen gab. Soviel man nur wollte.
Im Handumdrehen hatte ich mich an die Mayu in diesem Zustand gewöhnt.
Weil es ihr so gut zu schmecken schien.
Weil sie mit der Pose absoluter Selbstverständlichkeit trank, mit einer Mimik, als würde sie pure Energie tanken: ihr schönes Profil, wie ihr zartes Hälschen schluckte, mit perfektem Timing.
Vor drei Tagen erst sind die Äpfel gekommen: der Paketserie zweiter Streich.
Als ich nach Hause kam und die Tür aufmachte, stand mein Bruder im Weg und biß in einen Apfel. Neben ihm stand ein sperriger, grüner Karton. Der Karton war bis zum Rand gefüllt mit leuchtendroten Äpfeln in hellbraunem Sägemehl. Ein blendendes Farbenspiel. Und über allem schwebte ein süß-sauer-saftiger Duft.
»Wo kommen die denn her?« fragte ich.
»Aus dem Tōhoku-Gebiet«, sagte mein Bruder.
Mutter und Junko kamen lautstark die Treppe herunter. Junko hielt einen riesengroßen Korb in den Armen und sagte lächelnd: »Wir wollten sie ins Wohnzimmer stellen und haben dafür einen Korb gesucht, es sind so viele – Äpfel, meine ich.«
[40]Mutter sagte: »Ryū-chan ist offenbar gerade in Aomori.«
»Aha, in Aomori…«, sagte ich.
Wo mochte Ryūichirō mit dem traurigen Taschenbuch im Gepäck wohl jetzt gerade sein?
Woher würde das nächste Paket kommen?
Was wohl darin war?
Zusammen mit dem Rauschen ferner Winde und dem Duft nach Meer?
Da überkam mich eine Ahnung: Irgendwann auf seiner Reise würde er soweit sein, dieses Etwas, das man nicht bloß mit Dingen ausdrücken kann, in Worte zu fassen und aufzuschreiben. In einem Brief. Warum? Weil er ein Schriftsteller war. Außerdem ahnte ich, daß als Adresse für ihn momentan, nach jenem Abend, nur meine in Frage kam.
Ich warte auf dieses Werk.
Es würde sein wie der Weihnachtsmorgen in Kinderzeiten, bestimmt.
Das weiße, nagelneue Gefühl der Erwartung im Moment des Aufwachens. Dann der nächste Augenblick, wo einem die mit bunten Schleifen geschmückten Geschenke der Eltern neben dem Bett ins Auge fallen. Das wohlig-warme Zimmer, die Winterferien, die vor der Tür stehen.
Auf keinen Fall wird es etwas Romantisches. Es wird ein Symbol des Loslassens und der Vergebung.
Es wird so etwas wie eine Antwort darinstehen, in genau den richtigen Worten, Worte, die die Leere ausfüllen werden, die meine Schwester hinterlassen hat. Worte, die etwas ganz Ähnliches ausdrücken werden wie Nipper, der Hund aus Porzellan, oder die Kiste voller Äpfel, bestimmt.
[41]Worte, die nur er allein zu Text weben kann.
Ich warte sehnlichst darauf, denn sie werden mich erlösen, bestimmt.
[43]
[45]Willkommener Regen
Ich hab schon oft gehört, daß einem plötzlich alles vollkommen verändert vorkommen soll, wenn man etwas extrem Heftiges erlebt hat, aber bei mir, glaube ich manchmal, liegt der Fall doch noch anders.
Jetzt weiß ich! Jetzt kann ich mich endlich an alles erinnern, an sämtliche Episoden meines Lebens als Sakumi Wakabayashi seit meiner Geburt vor achtundzwanzig Jahren, an die Zusammensetzung meiner Familie, an meine Lieblingsspeisen, an die Dinge, die ich hasse – ich kann mir diese ganzen Elemente, die mich zu der Person machen, die ich bin, genau wie eine Geschichte in Erinnerung rufen.
Aber nicht anders. Nur als Geschichte.
Deshalb fehlt mir, um ehrlich zu sein, jedes Mittel, herauszubekommen, welche Gedanken oder Gefühle ich über mein Leben gehabt habe, bevor dieser kleine Unfall passierte. Aber vielleicht habe ich auch schon immer so gedacht wie jetzt. Tja, wer weiß?
Sind es Tage und Monate gewesen, die sich einfach so angehäuft haben wie leise fallender Schnee?
Wie bin ich mit mir selbst ausgekommen?
Wenn man sich die Haare radikal abschneiden läßt, soll sich, weil die anderen einem eine Spur anders [46]gegenübertreten, auch der eigene Charakter etwas verändern… Auch so eine Geschichte, die ich oft zu hören bekomme. Nachdem ich bei der Operation zum Glatzkopf geworden war, habe ich jetzt endlich, wo der Winter vor der Tür steht, zumindest wieder einen nennenswerten Kurzhaarschnitt.
Meine Familie, meine Freunde sagen alle wie aus einem Mund: »Saku-chan, so haben wir dich ja noch nie gesehen, du siehst ganz neu aus, so frisch, wie ein anderer Mensch!«
Ja? Ich lächele sie an und schlage nachher heimlich meine Fotoalben auf. Und wirklich, da bin ich: mit langen Haaren, lachend. An allen möglichen Orten, im Urlaub, in allen möglichen Situationen. Ich weiß das auch alles noch ganz genau. Da war das Wetter soundso, hier hatte ich in Wahrheit gerade Menstruationsschmerzen und konnte so eben wieder stehen… und so weiter und so fort. Deshalb bin ich das, und niemand anders.
Aber es sagt mir nichts.
Ein eigenartiges Gefühl, als schwebte ich im luftleeren Raum.
Am liebsten würde ich mir Beifall klatschen, weil ich trotz dieses seltsamen Gemütszustands unermüdlich weitermache, »mich selbst« zu spielen, als wenn nichts wäre.
Um es kurz zusammenzufassen: Bei uns zu Hause leben derzeit meine Mutter, ich, mein kleiner Bruder, der in die vierte Klasse geht, außerdem Junko, eine Jugendfreundin meiner Mutter, die freie Kost und Logis bei uns hat, und meine Cousine Mikiko, die studiert. Mein Vater ist schon lange tot, meine Mutter hat noch einmal geheiratet und sich wieder scheiden lassen. Das heißt, mein Bruder Yoshio und [47]ich haben verschiedene Väter. Zwischen mir und Yoshio gab es eigentlich noch Mayu. Meine jüngere Schwester. Wir hatten denselben Vater. Sie war Künstlerin, hat aber damit aufgehört, mit einem Schriftsteller zusammengelebt, ist schließlich seelisch krank geworden und gestorben, durch eine Art Selbstmord. Das ist lange, lange her.
Fünf Tage die Woche arbeite ich als Kellnerin. Abends schenken wir auch Alkohol aus, aber es ist eine kleine, altmodische Kneipe, nichts Anstößiges. Ein Laden, wie es viele gibt, mit dem Ambiente einer Studentenparty – der Wirt ist ein alter Hippie. Wenn ich Zeit habe, arbeite ich tagsüber noch im Büro der Firma eines Freundes – na ja, und was sonst so anfällt. Mein verstorbener Vater hatte einigermaßen Geld. Es muß eine Zeit gegeben haben, in der ich lange an dieser Lebensweise rumüberlegt habe, es irgendwie gut und schick zu finden, daß ich Geld habe, daß ich mich amüsieren und einfach so leben kann. Unbewußt, aber lange. Dann, als es mir bewußt wurde, hatte ich mir eine seltsame Position erobert: Ich war weder ein verwöhntes Töchterchen geworden, noch war ich in der rebellischen Phase steckengeblieben. Ich mag mein Leben, ich liebe es, ich liebe es zum Schlapplachen, ich kann nichts dafür, ich bitte um Verzeihung. Das muß an meinem Weltbild liegen, deshalb wünschte ich, Ihr würdet das alle so sehen, bitte, ich kann nicht anders!
Als ich in jener Nacht um drei Uhr von der Arbeit nach Hause kam, saß meine Mutter mit zusammengezogenen Brauen am Küchentisch.
Das macht sie oft, wenn sie etwas mit mir zu bereden hat. [48]Vor Urzeiten zum Beispiel, als sie wieder heiraten wollte. Ich dachte an Mutter, wie sie damals unnötigerweise ein todernstes Gesicht aufgesetzt hatte, obwohl ihr die Mundwinkel vor Glück zuckten. In letzter Zeit schien sie alles mit Junko zu besprechen, deshalb war eine solche Situation lange nicht mehr vorgekommen.
Wahrscheinlich geht’s um Brüderchen, erfaßte ich sofort. Er war ein wenig seltsam und sorgte offenbar in der Schule des öfteren für Gesprächsstoff. Seit Mayu gestorben war, schien »Kindererziehung« für Mutter zu einer Obsession zu werden. Es machte mich immer ein bißchen traurig, wenn ich an Mutter dachte. Sie schien ihr Leben nämlich manchmal nicht gerade zu lieben.
Es war traurig, mit ansehen zu müssen, wie jemand unter demselben Dach das Leben schwernahm, während man es selbst in vollen Zügen genoß.
»Gibt’s was?« fragte ich.
Im Haus schliefen bereits alle, die Küche war dunkel, nur die kleine Neonröhre über der Spüle war an. In ihrem Schein glich Mutter einem Schwarzweißporträt.
Auf ihren grimmig verzogenen Brauen und Lippen lagen tiefe Schatten.
»Komm, setz dich ein bißchen zu mir«, sagte sie.
»Ja. – Ach, willst du nicht auch einen Kaffee?«
Darauf sagte sie sofort: »Laß nur, ich mach uns schon einen«, und stand auf. Ich zog mir quietschend einen Stuhl heran und ließ mich drauffallen. Wegen der Arbeit im Stehen verließen mich sofort sämtliche Kräfte, als ich mich hingesetzt hatte. Ich spürte, wie die Müdigkeit schleichend vom Kreuz auf den ganzen Körper übergriff.
[49]Irgendwie verbinde ich schöne Erinnerungen mit heißem Kaffee in der Nacht. Warum bloß? Ich denke an früher, als ich Kind war. Obwohl ich doch damals gar keinen getrunken habe. Heißer Kaffee in der Nacht ist mir jedesmal willkommen, so wie der Morgen nach dem ersten Schnee oder eine Taifun-Nacht.
Mutter sagte: »Es geht um Yoshio.«
»Und inwiefern?«
»Er sagt, er will Schriftsteller werden.«
Das war ja mal was ganz Neues.
»Und wie kommt er plötzlich darauf?« fragte ich. Im großen und ganzen war mein Brüderchen nämlich ein vollkommen normaler Junge von heute, das heißt so ein fieser Bengel, der allen Ernstes Geschäftsmann in einer großen Firma werden wollte, weil man da viel verdient oder weil das in irgendeiner Fernsehserie so prima ausgesehen hatte.
»Ja, also… er sagt, daß Gott im Traum an seinem Bett gestanden hätte«, sagte Mutter. Fast wäre mir der Kaffee zur Nase rausgekommen.
»Ach, so was ist wahrscheinlich gerade in«, sagte ich lachend. »Er ist doch noch ein Kind, laß ihn einfach in Ruhe.«
»Aber er ist so komisch.« Mutter blieb ernst.
Ich sagte: »Trotzdem, das Beste wird sein, du siehst es dir eine Weile an, ohne ihn darauf anzusprechen.«
»Du meinst, er wird irgendwann genug davon haben?«
»Ja, und außerdem: Was ist denn eigentlich so schlecht daran, wenn einer Schriftsteller werden will?«
»Ach, irgendwie…«
»Wahrscheinlich, weil er der einzige Junge in der Familie ist. Du mußt abwarten, was aus ihm wird«, sagte ich.
[50]»Mayu ist tot, du hast dir den Kopf angeschlagen, und jetzt das. Ich möchte wirklich wissen, ob ich irgendwann auch mal eine Zeit ohne Probleme erleben darf!« sagte Mutter. »Das Kind schreibt Blatt um Blatt voll, als wäre es besessen von irgendwas!«
»Das ist wirklich merkwürdig.« Ich nickte.
Strahlt ein Leuchtturm allzu hell, verwirrt er die vorüberfahrenden Schiffe und zieht die wunderlichsten Schicksale an, dachte ich bei mir. Mutter war wie so ein Leuchtturm, das wußte ich instinktiv. Ich glaube, es gibt eine bestimmte Art von Anziehungskraft, deren Daseinsenergie unermüdlich nach Veränderung verlangt. Mutter ahnte das schwach, und sie litt darunter. Deshalb sprach ich es nicht an.
»Bestimmt wird allerhand passieren in unserem Haus, wie in Yukio Mishimas Ein schöner Stern.4 Das wär doch toll, ich freu mich schon!« Das sagte ich einfach so, obwohl ich später erst erfahren sollte, wie sehr es in gewisser Weise stimmte.
Mutter lachte.
»Aber ich werd mir Yoshio mal vorknöpfen und ihn interviewen, morgen oder so.«
»Ja, mach das, dann wirst du endlich begreifen, warum ich mir Sorgen mache!«
»Ist er so merkwürdig?«
»Wie ein anderer Mensch!« Sie nickte, machte aber ein viel fröhlicheres Gesicht als vorhin. So mußte das sein, das war noch in Ordnung.
[51]Alleine in einer nächtlichen Küche können einem die Gedanken nämlich für immer stehenbleiben, so ein Ort ist das. Auf keinen Fall sollte man sich lange darin aufhalten. Man darf die Mutter, die Ehefrau, die Tochter nicht dort einschließen. Neben tollen russischen Eintöpfen entstehen hier nämlich auch Mordgelüste und heimliche Alkoholikerinnen. In diesem großartigen Herzen des Hauses.
Kürzlich hatte ich am eigenen Leib erfahren müssen, daß so ein Mensch, diese scheinbar stabile, feste Masse, in Wirklichkeit ein furchtbar weiches, wabbeliges Geschöpf ist, das jederzeit, durch einen winzigen Stich oder Stoß etwa, ganz einfach kaputtgehen kann.
Ein wahres Wunder, daß dieses Ding, zerbrechlich wie ein rohes Ei, auch heute wieder unversehrt durchs Leben gekommen ist und funktioniert hat, daß all die Leute, die ich kenne, die ich liebe, auch den heutigen Tag wieder unbeschadet über die Runden gebracht haben, obwohl sie ständig mit unzähligen Instrumenten umgehen, mit denen sie sich ohne weiteres kaputtmachen könnten… Seit ich diesen Gedanken das erste Mal gedacht habe, bekomme ich ihn einfach nicht mehr aus dem Kopf.
Noch heute denke ich jedesmal, wenn jemand, den ich kenne, stirbt und ich mit ansehen muß, wie die Leute in seinem Umkreis trauern, warum es etwas so Schlimmes auf der Welt geben muß, klar, aber auch, daß es auf der anderen Seite gar nicht verwunderlich ist, verglichen mit dem Wunder, daß er überhaupt bis jetzt dagewesen ist… Und dabei bekomme ich dann jedesmal das Gefühl, mitten im Leben stillzustehen.
[52]Das Weltall, die, die ich kenne, deren Eltern und wiederum deren Lieben… Eine endlose Zahl, ein endloses Leben und Sterben. Ein Zahlenwert, der einen erschauern läßt. Ich versuche sie mir vorzustellen, diese Zahl, nahe an der grenzenlosen Ewigkeit. So, wie ich hier sitze, mit diesem immer noch nicht klaren Kopf.
Es geschah im Frühherbst, an einem 23.September – bei meinen Freunden nur bekannt als »der Tag, an dem sie die Treppe hinunterfiel«.
Ich beeilte mich, zur Arbeit zu kommen. Ich wollte eine Abkürzung nehmen und rannte die steile Treppe einer Seitengasse hinunter, durch die ich sonst nur selten gehe. Es war hinter einer Mittelschule, eine breite, lange Steintreppe, die für ihre Steilheit berühmt war und im Winter, wenn Schnee lag, aus Sicherheitsgründen sogar gesperrt wurde. Meine Aufmerksamkeit war durch den gelben Halbmond abgelenkt, der aussah, als würde er sich zwischen den dunkler und dunkler werdenden, tiefblauen Abendhimmel und den schummrigen Schein der Straßenlampe schieben, und ich trat daneben. Dann spürte ich einen furchtbaren Schlag auf den Kopf. Ich verlor das Bewußtsein, und man mußte mich ins Krankenhaus tragen.
Anfangs, als ich wieder zu Bewußtsein kam, begriff ich überhaupt nichts. Mein Kopf dröhnte vor Schmerzen, als hätte ich einen Krampf im Schädel. Als ich hinfaßte, fühlte ich einen Verband. Da fiel mir die Treppe wieder ein, der Schmerz, der Schreck.
[53]