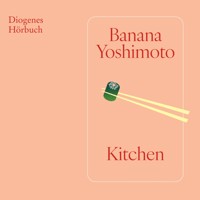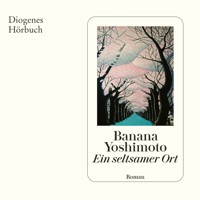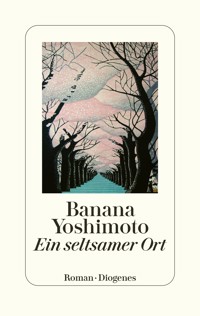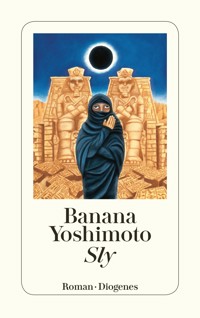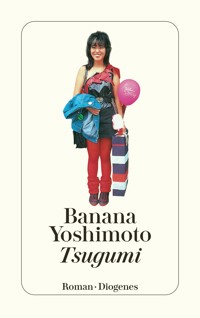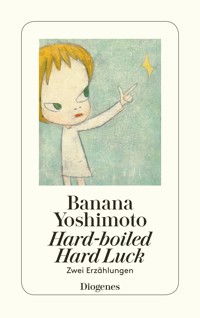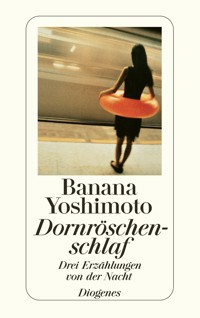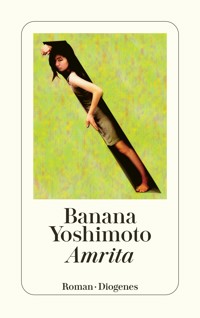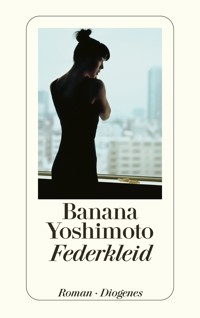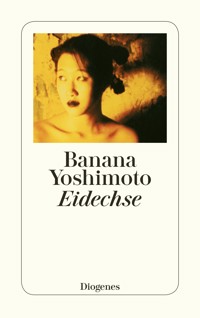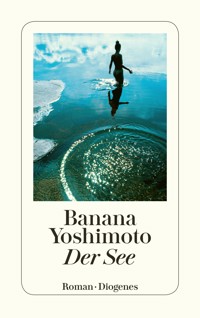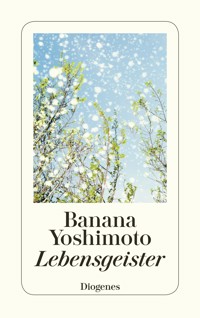7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Zentrum des Romans stehen junge Menschen voller Lebenshunger und Sehnsucht nach Liebe. ›N.P.‹ hat die Spannung eines Thrillers, aber die subtile Beunruhigung, die der bizarren, doch taghellen Logik des Unbewußten entspringt. Noch meisterhafter als in ›Kitchen‹ gelingt es der jungen Autorin, die Verstrickungen von Jugendlichen in erotische Leidenschaften, ihre sexuelle Unruhe zu schildern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Banana Yoshimoto
N·P.
Roman
Aus dem Japanischen von Annelie Ortmanns-Suzuki
Diogenes
{5}Sarao Takase war ein zweitklassiger Schriftsteller gewesen, der in den USA gelebt und im Laufe seines zweitklassigen Lebens jede Menge Erzählungen geschrieben hatte.
Ansonsten wußte ich noch über ihn, daß er sich im Alter von achtundvierzig Jahren das Leben genommen hatte, daß er mit seiner Frau, von der er getrennt lebte, zwei Kinder hatte und daß seine Erzählungen in einem Band herausgekommen waren, der in den USA für ganz kurze Zeit großen Erfolg gehabt hatte.
Der Band trug den Titel N.P. und enthielt siebenundneunzig Kurzgeschichten. Lauter prosaische Kürzestgeschichten, eine nach der anderen – Takase schien ein Mann ohne Ausdauer gewesen zu sein.
Erfahren hatte ich das alles von meinem früheren Freund Shōji. Er hatte Takases unveröffentlichte achtundneunzigste Erzählung entdeckt und übersetzt.
Es heißt, wenn die letzte von hundert Geschichten zu Ende erzählt sei, geschehe etwas.1 Was mir aber im vergangenen Sommer widerfahren ist, muß jene hundertste Geschichte selbst gewesen sein. Mir ist, als hätte ich sie wirklich erlebt, gelebt. Die intensiven Stimmungen, {6}Gefühle, die vom Sommerhimmel aufgesogen zu werden schienen – klar, alles ist eine Erzählung gewesen, die sich innerhalb kürzester Zeit tatsächlich abspielte.
{7}Ja, richtig, Sarao Takases Kinder hatte ich vorher schon einmal gesehen, vor mehr als fünf Jahren, als ich noch zur Oberschule ging.
Es war auf der Party eines Verlags, zu der Shōji mich mitgenommen hatte. Ein geräumiger Saal, Silberplatten mit bunten Speisen auf großen Tischen, eine Menge Menschen, die im Schein vieler kleiner, orchideenförmiger Leuchter plauderten.
Junge Leute waren kaum da, weshalb ich ziemlich froh war, die beiden zu entdecken.
Shōji war gerade in ein Gespräch vertieft, und so wandte ich mich ab, um die zwei besser sehen zu können. Sofort befiel mich ein seltsames Gefühl. Einen Augenblick lang war mir, als sei ich ihnen schon mehrfach nachts im Traum begegnet. Doch dann wurde mir klar, daß es jedem bei den beiden so gehen mußte, und ich kehrte in die Wirklichkeit zurück.
Ein Paar, das eine undefinierbare Sehnsucht in einem weckte.
Ganz in Gedanken starrte ich sie an, als Shōji sich mir zuwandte: »Das sind die Kinder von Takase«, sagte er.
»Beide?« fragte ich.
»Ja, es sollen zweieiige Zwillinge sein.«
»Ich würde mich gern mit ihnen unterhalten.«
»Soll ich dich vorstellen?«
»Warum nicht, schließlich gelte ich hier als zwanzig, du Feigling!« Ich mußte lachen.
{8}Shōji lachte auch: »Na umso besser. Komm, ich stell dich vor.«
»Nein, laß, ich beobachte die beiden lieber noch ein bißchen.«
Sie aus einer gewissen Entfernung anzuschauen schien mir am reizvollsten zu sein. Würde ich sie ansprechen, wäre es mit der eingehenden Beobachtung vorbei.
Die beiden waren die Kinder aus Takases Ehe, die er in ganz jungen Jahren geschlossen hatte. Sie waren ungefähr so alt wie ich, und ihr Vater hatte die Familie verlassen, als sie noch klein waren. Nach seinem Tod war ihre Mutter mit ihnen zu Takases Familie nach Japan gezogen. Das war so ungefähr alles, was ich über sie wußte.
Die müssen schon eine Menge gesehen haben, dachte ich und beobachtete weiter. Beide waren groß und hatten braunes Haar. Das Mädchen wirkte zerbrechlich, hatte aber einen frischen Teint und zarte, glatte Haut. Feste Waden über schwarzen Stöckelschuhen, ein tief ausgeschnittenes Kleid unter einem unschuldigen Gesicht. Sie strahlte eine seltsam heitere Sinnlichkeit aus.
Der Junge hatte ebenfalls hübsche Züge. Von den leicht melancholischen Augen abgesehen, strotzte sein ganzer Körper vor hoffnungsvoller Gesundheit. In seinen Augen hingegen lag ein Schimmer von Wahnsinn, man sah in ihnen die Macht der Vererbung.
Die beiden lachten viel. Die ganze Zeit redeten sie miteinander, lächelten sich an.
Als ich sie so betrachtete, erinnerte ich mich an ein Erlebnis, bei dem ich ein ganz ähnliches Gefühl wie jetzt bekommen hatte:
{9}Ich ging im Park in der Nähe unseres Hauses spazieren. Auf der Wiese sah ich eine Mutter mit ihrem Kind. Der weite, menschenleere Park, das grüne Gras waren in goldenes Abendlicht getaucht. Die junge Mutter hatte das winzige, vielleicht sechs Monate alte Baby auf ein weißes Badetuch gelegt und sah es an. Sie spielte nicht mit ihm, sie lächelte nicht, sie sah ihr Kind einfach nur an. Und von Zeit zu Zeit schaute sie in den Himmel.
Das Haar der beiden wurde gleichermaßen von der Sonne durchschienen und vom Wind durchweht, ihre dunklen Schatten verharrten still wie Figuren aus einem Gemälde von Wyeth.
Ich sah sie an. Mein Blick schien sich plötzlich von mir zu entfernen, schien sich in den Blick Gottes zu verwandeln. Melancholie und Glück flossen zusammen an diesem Abend von Unendlichkeit.
Die Geschwister Takase umgab etwas ganz Ähnliches. Die Melancholie des leuchtenden Abendrots. Eine Melancholie, die weder durch Jugend noch Fröhlichkeit hätte ausgelöscht werden können, vergleichbar vielleicht dem Ruf der Begabung, die im Blut liegt.
Ich fragte Shōji: »Wirst du die Erzählung von Sarao Takase übersetzen?«
Er sah mich an und sagte nicht ohne Stolz: »Ja.«
»Wie war noch der Titel, irgendwas mit Initialen.«
»N.P.«
»Was bedeutet das?«
»Es ist die Abkürzung von North Point.«
»Und wofür steht das?«
{10}»Es gibt ein altes Lied mit diesem Titel.«
»Was für ein Lied?«
»Hm, ein sehr trauriges Lied«, sagte Shōji.
{11}Das Klingeln des Telefons riß mich unsanft aus dem Schlaf.
Ich streckte den Arm aus dem Bett, um den Hörer abzunehmen: »… Hallo?«
An mein Ohr drang nun die gedämpfte Stimme meiner Schwester: »Kazami? Ich bins, wie gehts?« Das typische Ferngesprächfeeling, dieser Ton, der immer wieder auszusetzen scheint, machte mich hellwach.
»Ist was passiert?«
Im Zimmer wurde es wieder dämmrig-still, und ich sah auf die Uhr: Es war fünf Uhr morgens. Durch den Spalt im Vorhang konnte ich den bleigrauen Himmel der Morgendämmerung sehen. Immer noch Regenzeit, dachte ich träge.
»Nein, nichts. Ich ruf nur so an«, sagte sie.
»Du hast wieder nicht an den Zeitunterschied gedacht. Hier ist es fünf Uhr morgens!« sagte ich.
»Entschuldigung!« lachte meine Schwester. Sie war mit einem Ausländer verheiratet und lebte in London.
»Wie spät ist es bei euch?«
»Acht Uhr abends.«
Die Vorstellung des Zeitunterschieds bereitet mir jedesmal Unbehagen. Daß die Telefonleitung überhaupt eine Verbindung herzustellen vermag, grenzt für mich an ein Wunder.
»Alles klar bei dir?« fragte ich.
»Ich hab von dir geträumt«, sagte sie. »Ich hab {12}geträumt, ich hätte dich bei uns in der Straße gesehen. Du gingst Arm in Arm mit einem bedeutend älteren Mann.«
»Bei uns … du meinst in London?«
»Ja, hinten bei der Kirche.«
»Wär das schön, wenn dein Traum wahr würde!« sagte ich glücklich. Die Träume meiner Schwester wurden oft wahr, schon immer.
»Ihr saht aber beide traurig aus. Ansprechen konnte ich euch nicht. Der Mann war groß und schien nervös zu sein. Er trug einen weißen Pullover. Komischerweise hattest du eine Schuluniform an. Das war so typisch, deshalb hab ich sofort an ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann gedacht.«
»Ich hab kein Verhältnis mit einem verheirateten Mann«, sagte ich, doch mir schauderte. Der Mann, den meine Schwester im Traum Arm in Arm mit mir gesehen hatte, war zweifellos Shōji.
Sie hatte Shōji aber nie gesehen.
»Mein sechster Sinn läßt wohl nach, was?«
»Scheint so. Kein Treffer diesmal«, sagte ich und überlegte. Was dieses Vorzeichen wohl zu bedeuten hatte? In letzter Zeit war Shōji auch mir wieder häufiger in den Sinn gekommen. Aber nicht als Erinnerung. Wie in einer Rückblende war sein Gesicht vielmehr plötzlich am Regenhimmel, auf naßschwarzem Asphalt oder im blitzenden Schaufenster an der Straßenecke erschienen. Obwohl ich es lange vergessen hatte.
»Und wie gehts deinem Mann?«
»Gut, gut. Im Winter kommen wir euch in Japan besuchen. Siehst du Mutter öfter?«
{13}»Ja, manchmal. Sie vermißt dich.«
»Bestell ihr viele Grüße. Na dann, bis bald. Tut mir leid, daß ich dich geweckt habe. Ich ruf wieder an.«
»Rechne aber gefälligst vorher aus, wie spät es hier ist!«
»Ich werds mir zu Herzen nehmen. Und du paß auf, daß du dich nicht unglücklich in einen verheirateten Mann verliebst!« lachte meine Schwester.
»Ja, ja«, sagte ich und legte auf.
Als der Hörer wieder auf der Gabel lag, bekam die Stille im Raum deutliche Konturen, wurde drückend. Das Blau vor Tagesanbruch.
Es ließ mir keine Ruhe. Ich stand auf, öffnete die Tür zum unteren Schreibtischfach, nahm die so selten geöffnete Schachtel heraus und hob den Deckel ab. Der alte Umschlag mit der Aufschrift N.P., der Aktenordner und die ungemein schwere Rolex.
Shōjis Vermächtnis.
Er hatte sich vor vier Jahren mit Schlaftabletten das Leben genommen. Und seither, seit ich diese drei Gegenstände besitze, haben sie in meinem Herzen ihren festen Platz.
Ich brauche zum Beispiel nur an meinem Arbeitsplatz im Seminarraum zu sitzen und zufällig von irgendwoher in der Stadt Sirenen heulen zu hören. Noch während ich mich frage, ob es aus der Richtung meiner Wohnung kommt, tauchen diese drei Gegenstände schon vor mir auf. So ganz aus meinem Bewußtsein verschwunden sind sie nie.
Wie um mich ihrer zu vergewissern, nahm ich sie in die Hand. Dann legte ich sie sorgfältig an ihren Platz zurück und ging wieder ins Bett. Ich schlief noch einmal ein.
{14}Bis ich zu studieren begann, lebte ich mit meiner Mutter und meiner Schwester zusammen.
Unsere Eltern ließen sich scheiden, als ich neun und meine Schwester elf war. Der Grund: mein Vater hatte sich in eine andere Frau verliebt.
Meine Mutter, die bis dahin als Dolmetscherin ständig außer Haus tätig gewesen war, beschränkte sich danach uns zuliebe auf Übersetzungsarbeiten, die sie zu Hause erledigen konnte. Sie nahm jede Art von Übersetzung an, von Rohübersetzungen bis zu Übertragungen von Interviews.
Es war zwar traurig, daß Vater nicht da war, aber dieses Leben zu dritt machte Spaß. Mehrmals täglich mußten wir Alter und Rolle tauschen. Eine weinte, eine tröstete, eine jammerte, eine munterte auf, eine wollte schmusen, eine nahm sie zärtlich in die Arme, eine wurde wütend, eine machte ihren Fehler wieder gut.
Mit der Zeit gewöhnten wir uns an diese Art zu leben.
Unsere gemeinsame Zeit sei begrenzt, meinte Mutter und brachte uns deshalb Englisch bei. Abends nach zehn schlugen wir am Küchentisch unsere Hefte auf und lernten eine Stunde lang Englisch. Aussprache, Vokabeln, einfache Konversation. Wir waren jung und dachten insgeheim ›was fürn Quatsch‹, rissen uns aber ihr zuliebe zusammen und spielten mit.
Beim Stichwort ›Mutter‹ erscheint deshalb in unseren Köpfen nicht etwa ihr Rücken, das heißt, wie sie in der Küche steht und arbeitet. Wir sehen statt dessen ihr {15}unvorteilhaftes Profil beim Englischunterricht, auf der Nase die Brille mit Metallrand, und ihre weißen Hände, die mit atemberaubender Geschwindigkeit in dicken Wörterbüchern blättern. Die Leidenschaft, mit der sie uns unterrichtete, war bezaubernd – so, als gelte es, sich selbst noch einmal die Grundlagen der englischen Sprache einzuprägen, so, als zöge sie die Linien ihres eigenen Lebens nach.
Jetzt wohnen wir nicht mehr zusammen. Mutters Kommentar dazu, daß meine Schwester mit einem Ausländer verheiratet ist und ich eine Stelle am Seminar für Anglistik bekommen habe, lautet: »Ihr habt das bloß geschafft, weil ich euch gezeigt habe, wie interessant Englisch ist.« Jedesmal, wenn wir uns treffen, sagt sie das und lacht. Das liebe ich immer noch am meisten an ihr.
{16}Mit einem Schlag war ich wieder hellwach. Als erstes fiel mir durch den Spalt zwischen den Vorhängen der klare Sommerhimmel ins Auge. Im Farbton ganz wie der Traum, in dem ich eben noch gewesen war.
Ich hatte im Schlaf geweint, hatte dieses sichere Gefühl, aus dem klaren Traumfluß Goldstaub mitgebracht zu haben.
Noch ziemlich benommen überlegte ich, ob ich nun aus Traurigkeit geweint hatte oder weil ich von Traurigkeit erlöst worden war. Fest stand jedenfalls, daß ich noch nicht aufwachen wollte.
Durch das Fenster, das einen Spalt offenstand, kam frischer Wind herein.
Den ganzen Tag, auch nachdem ich ins Seminar gegangen war, wurde ich dieses Gefühl nicht los.
Darum passierten mir lauter Mißgeschicke, ich zerschlug Teetassen, goß Kaffee daneben, et cetera, et cetera.
Ein ›Komisch!‹ nach dem anderen entfuhr mir. Irgendetwas ging in der Tat nicht mit rechten Dingen zu.
Als habe sich das Gefühl aus dem Traum nahtlos in die Wirklichkeit fortgesetzt.
Ich erwischte mich ständig bei dem Gedanken, was das nur für ein Traum gewesen sein konnte.
Was auch der Grund dafür war, daß ich jenes Gespräch nicht annahm und das Telefon klingeln ließ. Das x-te Mißgeschick an diesem Morgen. Ich kam wieder zu mir, {17}als der Professor abnahm und sich mit »Ja, hallo« meldete, wobei er mir einen verwunderten Blick zuwarf.
»Frau Kanō, für Sie!«
Mit gezwungenem Lächeln reichte er mir den Hörer. Ich murmelte eine Entschuldigung und meldete mich.
Aber als ich »Hallo« sagte, wurde am anderen Ende aufgelegt. Verdutzt fragte ich den Professor: »Wissen Sie, wer das war?«
»Nein, nur daß es eine Frau war. ›Ist Frau Kanō da?‹ sagte sie, sonst nichts«, antwortete er. »Abgesehen davon, Sie scheinen heute erschöpft zu sein, Frau Kanō. Gehen Sie ruhig schon in die Mittagspause.«
»Ja, aber es ist doch erst elf Uhr.«
Kaum hatte ich dies entgegnet, hoben plötzlich sämtliche Kollegen den Kopf an ihren Schreibtischen und sagten wie aus einem Munde: »Aber das macht doch nichts, geh schon.«
Ich fühlte mich regelrecht hinausgeworfen und verließ den Raum.
Bin ich denn dermaßen komisch heute, ging es mir durch den Kopf, während ich über den menschenleeren Sportplatz zum Unitor hinausging. Mir selbst war das gar nicht so bewußt geworden. Mein Körper hatte sich lediglich noch nicht an die Wirklichkeit gewöhnt, und die Welt sah frisch und neu aus. Vielleicht, fiel mir ein, habe ich ja meine eigene Geburt geträumt!
Auf der ansteigenden Straße hinter der Uni gab es einen Buchladen. Für die verlängerte Mittagspause wollte ich mir was zu lesen kaufen.
{18}Und auf halbem Weg dorthin traf ich plötzlich Otohiko. Die zweite Begegnung unseres Lebens.
Ich mußte gerade die alte Einkaufsstraße, die seitwärts auf die bergan führende Straße trifft, überquert haben und sah wohl noch ganz in Gedanken zur Seite, hingerissen vom glitzernden Silber und Rosa der in den blauen Himmel ragenden Straßendekoration. Ich erinnere mich nämlich genau, daß sie mir noch im Augenwinkel flimmerte.
Als ich mich wieder nach vorne wandte, sah ich auf einmal eine bekannte Gestalt die Straße herunterkommen.
»Ach, du bists!« platzte ich heraus. »Takases Sohn.«
»Das stimmt, aber …?« sagte er und sah mich fragend an. Kein Wunder! Hastig stellte ich mich vor.
»Wir haben uns vor ziemlich langer Zeit mal auf einer Party vom H-Verlag gesehen. Ich heiße Kazami Kanō.«
Er starrte mich an, bis er schließlich sagte: »Ja, richtig. Das Mädchen, das mit Shōji Toda, dem Übersetzer, zusammen war.«
»Du hast ein gutes Gedächtnis«, sagte ich.
»Kein Wunder, wir waren da weit und breit die einzigen jungen Leute!« lachte er.
»Wohnst du hier in der Gegend?« fragte ich.
»Ja. Das heißt, eigentlich wohne ich in Yokohama, doch momentan schmarotze ich bei meiner Schwester. Sie wohnt in dieser Straße, weiter oben, und studiert an der T-Uni gleich da vorne Psychologie.«
»Was!? An der T-Uni?«
»Ja.«
»Was für ein Zufall! Ich arbeite da am Institut für Englische und Amerikanische Literatur.«
{19}»Na so was! Weißt du, das Mädchen, das damals mit mir auf der Party war, das war meine Schwester. Sie heißt Saki.«
»Wir sind garantiert schon aneinander vorbeigegangen, ohne uns erkannt zu haben!«
»Hast du Zeit für einen Kaffee?« fragte er. Zeit hatte ich massenweise.
»Ja, okay«, antwortete ich.
Wir saßen uns in dem vormittäglich leeren Café gegenüber und tranken Kaffee – was ich nie zu träumen gewagt hätte. Für mich war er eine Gestalt aus der Vergangenheit, die nur in der Welt der Fiktion zu existieren schien. Ein merkwürdiges Gefühl. Auf den zweiten Blick hatte er sich sehr verändert. Diese melancholischen Augen, die so gar nicht zu dem weißen Polohemd und den glatten Wangen paßten. Andere Augen als damals, als ich ihn das erste Mal sah.
»Du hast dich aber verändert, Otohiko.«
»Ja?«
»Du wirkst viel älter als ich. Dabei sind wir nur zwei Jahre auseinander. Du siehst, ich weiß alles über dich.«
»Dann bist du also jetzt zweiundzwanzig?«
»Genau.«
»Demnach mußt du damals noch Oberschülerin gewesen sein, richtig?«
»Richtig.«
»Fünf Jahre ist das her …? Ich komm mir kein bißchen älter vor – hm, wahrscheinlich, weil ich im Ausland war.«
»Du warst weg? Wo denn?«
{20}»In Boston. Ich bin erst diesen April zurückgekommen.«
Irgendwie besaß er jene undurchdringliche Verschlossenheit, die einem Menschen eigen ist, der im Wirrwarr seines aus der Bahn geratenen Schicksals verzweifelt seinen Stolz zu wahren sucht. Dieses Gefühl hatte ich damals noch nicht gehabt, als ich ihm das erste Mal begegnet war.
»Vorher hast du doch lange in Japan gewohnt, oder?«
»Ja, bei meinen Großeltern in Yokohama.«
»Sofort, nachdem dein Vater gestorben ist?«
»Ja. Er war zwar schon von zu Hause fortgegangen, als wir noch klein waren, aber meine Eltern haben sich nie scheiden lassen. Meine Großeltern fühlten sich einsam und baten uns, zu ihnen zu ziehen.«
»Wie alt warst du da?«
»Vierzehn oder so. Vaters Tod schien für Mutter ein Schock gewesen zu sein, und wir, plötzlich merkwürdig erwachsen, versuchten sie zum Reisen zu bewegen. Wir fuhren also eine Zeitlang herum – tja, und als wir wieder zurückkamen und uns fragten, wie es weitergehen soll, hieß es, ob wir nicht nach Japan zurückkehren wollten. Mutter zögerte, aber wir redeten ihr zu. Die Großeltern waren aufgeschlossen, was Mutters Zukunft anging … ich meine, sie hatten nichts gegen eine zweite Ehe oder so was, und außerdem dachten wir, daß dieses Leben zu dritt Mutter auf die Dauer kaputtmachen würde. Eigentlich wollten wir unser gewohntes Zuhause nicht verlassen, aber wir gaben einfach vor, gehen zu wollen – eigentlich ziemlich tapfer von uns.«
»Wem sagst du das, bei uns wars genauso. Vater und {21}Mutter ließen sich scheiden, und wir Frauen waren zu dritt – Mutter, meine Schwester und ich.«
»Ganz schön ungesund, wenn die Übriggebliebenen so auf einem Haufen hängen, was?«
»Genau. Schon allein dieses überwältigende, ständige Bewußtsein, daß Vater nicht vorhanden ist.«
»Jede von euch hat bestimmt Phasen durchgemacht, die hart an Neurose grenzten, oder?«
»Ja, sicher«, sagte ich. »Ich konnte eine Zeitlang nicht sprechen.«
»Deswegen?« fragte er interessiert.
»Scheint so. Ohne besondere Ursache fiel meine Stimme aus, und ohne besondere Ursache kam sie wieder.«
»Hm, das läßt auf einen tierisch heftigen Kampf in deinem kleinen Körper damals schließen«, sagte er.
Im dritten Monat, nachdem Vater uns verlassen hatte, streikte auf einmal meine Stimme – wie um den Zusammenbruch von Mutter, die sich bis dahin zusammengerissen hatte, abzuwenden.
Es hatte stark geschneit an dem Tag, und nach der Schule hatte ich viel zu lange draußen gespielt. Abends bekam ich hohes Fieber. Ich blieb mehrere Tage im Bett und ging nicht zur Schule. Der ganze Körper tat mir weh, und mein Hals war dick geschwollen.
Einmal, ich dämmerte gerade in Fieberphantasien dahin, nahm ich die Stimmen meiner Mutter und meiner Schwester wahr.
»… warum glaubst du das?« sagte Mutter.
{22}»Ich weiß auch nicht, irgendwie kommts mir so vor«, sagte meine Schwester.
»Daß Kazami nicht mehr sprechen kann?« fragte Mutter, mittlerweile mit deutlich anschwellendem hysterischem Tonfall.
»Ja, es kommt mir so vor«, antwortete meine Schwester trocken.
Sie hatte immer schon eine Art sechsten Sinn gehabt und konnte Kleinigkeiten meistens richtig voraussagen, etwa, wer am Apparat war, wenn das Telefon klingelte, oder ob das Wetter umschlagen würde. Bei diesen Gelegenheiten wirkte sie immer merkwürdig gelassen und erwachsen.
Ein bißchen erschrocken sagte Mutter: »In Kazamis Gegenwart sollten wir aber darüber nicht reden!«
»Nein, da hast du recht«, erwiderte meine Schwester.
Ich kann also nicht mehr sprechen, dachte ich merkwürdig cool. Ich mühte mich ab, aus meiner vom vielen Versuchen ausgetrockneten Kehle irgendeinen Ton herauszupressen, erzielte jedoch nicht einmal ein heiseres Krächzen.
Ich drehte den Kopf ein wenig und sah aus dem Fenster, mein Blickfeld halb verdeckt durch den Eisbeutel: Die vom Abendrot rosa gefärbten Wolken bildeten prächtige Treppen und zogen gen Westen. Einen Augenblick lang wußte ich nicht mehr, ob alles Tatsache war oder nur Phantasmen meines fiebernden Kopfes:
Vater war fort und besaß anderswo noch eine Familie.
Allabendliche Englischstunden.
Massenweise Schnee – der Schulhof begraben unter {23}strahlendem Weiß – glühende Hitze, schon auf dem Nachhauseweg – diffuses Licht der Straßenlaterne.
… Aah, plötzlich wurde mir klar, wie es sein mußte, wenn ›alles auf einmal passiert‹.
Tatsächlich, die Erkältung besserte sich, aber meine Stimme kam nicht wieder. Mutter und meine Schwester behandelten mich wie ein rohes Ei, und der Arzt gab zu verstehen, daß meine Nerven überreizt seien, was Mutter auf dem Rückweg von der Praxis beinahe zum Weinen brachte.
Alle waren verunsichert. Wahrscheinlich hatte sie die Furcht gepackt, ich hätte bereits die Gewalt über meinen Körper verloren.
Zu Anfang haßte ich meine Stummheit – sie machte mich nervös, aber da Mutter glücklicherweise ihren Optimismus wiedergewann und mich in Ruhe ließ, ging es auch mir bald wieder gut. Ich blieb der Schule fern und tagsüber zuhause, frühmorgens und abends ging ich draußen spazieren.
So ohne Stimme kam mir allmählich die Sprache abhanden.
In den ersten beiden Tagen, in denen ich nicht sprechen konnte, hatte ich absolut die gleichen Gedanken gehabt wie sonst auch. Trat mir meine Schwester zum Beispiel auf den Fuß, dachte ich klar und deutlich: »Aua!« – als Wort. Wurden im Fernsehen Bilder mir bekannter Orte gezeigt, dachte ich: »Ach, das ist ja da und da, wann das wohl aufgenommen wurde?« – genauso, als würde ich es aussprechen.
{24}Doch mit anhaltender Artikulationsunfähigkeit vollzog sich ein subtiler Wandel. Die Farbe hinter den Worten wurde sichtbar.
Wenn meine Schwester mich liebevoll umsorgte, erschien sie mir in hellem, rosa Licht. Die Worte und Blicke meiner Mutter beim Englischunterricht erreichten mich in ruhigem Gold, und beim Streicheln einer Katze am Straßenrand nahm meine Handfläche goldgelbe Freude auf.
Ich lebte, indem ich mir alles erfühlte, und dabei wurde mir die immense Begrenztheit der Sprache bedrohlich klar.
Da ich so jung war, nahm ich das wohl eher physisch wahr, doch ich spürte damals zum ersten Mal ein tiefes Interesse an solchen Worten, die im Begriff stehen, die Mauern des Ausdrucks zu durchbrechen. – Gefäße, die Augenblick und Ewigkeit gleichzeitig zu halten imstande sind.
Die Heilung kam eines Tages ebenso schlagartig.
Es regnete, meine Schwester war aus der Schule zurück. Wir beide hatten es uns am Kotatsu2 gemütlich gemacht und warteten auf Mutter. Ich hatte mich hingelegt, schlief aber nicht, sondern blickte träumend in die Richtung, wo meine Schwester saß und eine Zeitschrift las. Mit der Regelmäßigkeit eines tropfenden Wasserhahns blätterte sie Seite für Seite um. Durch das Rauschen des Regens hindurch hörte man den Fernseher des Nachbarhauses. Von der Feuchtigkeit beschlugen die Fenster, und im Zimmer war es schwül geworden. Ich dachte:
{25}Bald kommt Mutter nach Hause, wie immer mit etwas müdem Gesicht und in jeder Hand eine Einkaufstüte. Der Rest der Miso-Suppe vom Morgen, irgendein Fertiggericht, Mutters Spezialsalat, Obst. Sie geschäftig inmitten des Duftes von kochendem Reis. Wir beim Reisausteilen, sobald alles fertig ist. Nach dem Essen Englischunterricht, Fernsehen, Baden, Gute-Nacht-Sagen und Schlafengehen. Beim Einnicken noch die beiden kurzen Schlurfer, mit denen Mutter ihre Schlappen abstreift, bevor sie nebenan zu Bett geht.
Heißes Glück. Wir waren nur zu dritt, besaßen aber ein Gefühl der Geborgenheit wie in einer Großfamilie.
In dem Augenblick fragte meine Schwester: »Schläfst du, Kazami?«
»’m-’m«, verneinte ich. Eigentlich war gar nichts dabei, man mußte es nur versuchen. Unheimlich war bloß, daß sich meine eigene Stimme so weit weg anhörte. Wie hatte ich diese Tonlage vermißt!
»Kazami, hast du was gesagt?« fragte meine Schwester überrascht.