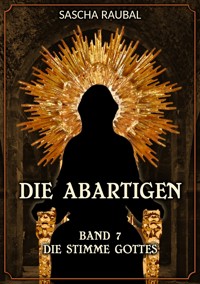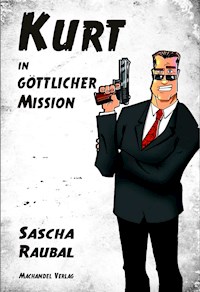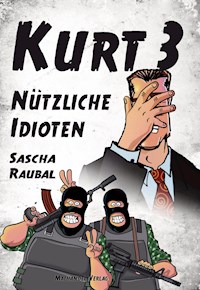2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Abartigen
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte von Mikail und Loris ist noch lange nicht zu Ende. Mikail macht sich mit seinen Freunden, der Riesin Jekarina und dem schnellen Läufer Tabo, auf den Weg, das Waldland zu erkunden. Sie wollen herausfinden, wie die Menschen dort unter dem Erhabenen und seinem Gott leiden und was man dagegen tun kann. Loris dagegen schlägt sich nch seiner Flucht mutterseelenalleine durch die Wildnis. Raubtiere, Hunger und Verletzungen setzen ihm zu, doch er gibt nicht auf. Mehrfach entgeht er nur knapp dem Tod, aber immer wieder findet er auch Hilfe – von Menschen, mit denen er dort draußen nie gerechnet hätte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Sascha Raubal
Die Abartigen 6 – Neuland
In dieser Serie bereits erschienen:
Band 1 – Karawane nach Cood
Band 2 – Der Prozess
Band 3 – Die Freien
Band 4 – Kampf um Or
Band 5 – Flüchtlinge
Inhaltswarnung:
In diesem Buch wird gelebt und gestorben – mit allem, was dazugehört.
Sascha Raubal
Fantasy
Die Abartigen 6 – Neuland
1. Auflage 2023
© 2023 Sascha Raubal
ISBN: 978-3-384-06010-5
Covergestaltung und Innenteilillustrationen:
Markus Gerwinski (http://www.markus.gerwinski.de)
Druck und Distribution im Auftrag :
tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Inhalt
Cover
Halbe Titelseite
Titelblatt
Urheberrechte
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Nachbemerkung
Danke
Der Autor
Die stimme gottes
Die Kurt-Reihe
Leseprobe Band 7
Die Abartigen
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
1
Leseprobe Band 7
Die Abartigen
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
1
Die brennende Gestalt kam näher und näher. Lohen umspielten sie von Kopf bis Fuß, beleuchteten die graue Fratze unter der Kapuze, der die Hitze das Fleisch von den Knochen schmolz. Trotzdem grinste die Kreatur böse, streckte die Hände aus, um ihn zu packen und an sich zu ziehen, hinein ins tobende Feuer. Er wollte zurückweichen, sich umwenden und fliehen, doch in seinem Rücken befand sich massiver Stein, ebenso wie zu beiden Seiten. Der flammende Tod hatte ihn in die Enge getrieben, es gab kein Entrinnen.
Mit einem Schrei erwachte Loris, blickte sich schweißgebadet um, versuchte, seinen hektischen Atem unter Kontrolle zu bringen. Kein Flammenmann, nur die Reste des kleinen Feuerchens, das er vorhin entzündet hatte. Stein um ihn herum, ja, das wohl, jedoch nicht etwa der schmale Gang des Ratsgebäudes, in dem er eben noch vor dem brennenden Sandor geflohen war, sondern die Höhle, in der er Zuflucht gefunden hatte.
Immer noch schwer atmend setzte er sich ganz auf. Dieser Albtraum hatte es in sich gehabt. Kein Wunder, war er doch erst vorige Nacht mit knapper Not dem Wahnsinnigen entkommen, der ihm erst den Mord an Donald in die Schuhe geschoben hatte, um dann auch ihn aus dem Weg zu räumen. Die Todesstrafe, die der seltsame Kuttenträger aus der Fremde ihm zugedacht hatte, gab es zu dessen großer Enttäuschung in den Städten nun mal nicht.
Ob Sandor wohl noch lebte? Nachdem bei dem nächtlichen Kampf Loris’ Bett in Flammen aufgegangen war und auch die Kutte des mörderischen Fremden Feuer gefangen hatte, war dieser ihm noch brennend hinterhergelaufen. Beinahe wünschte Loris dem Wahnsinnigen, in den Flammen umgekommen zu sein. Seinetwegen hatte er aus Or fliehen müssen, aus Angst, entweder weiterer Morde beschuldigt oder von den Anhängern des Kuttenträgers am Ende doch noch umgebracht zu werden.
Draußen brach eben die Nacht herein. Loris hatte den größten Teil des Tages verschlafen, nachdem er kurz nach dem Morgengrauen das Umland der Stadt verlassen und durch einen glücklichen Zufall bald darauf diese Höhle entdeckt hatte. Er blickte sich in seiner Unterkunft um. Hier also hatte Mikail nach dessen Ausweisung gelebt. Zumindest passte vieles von dem, was er heute früh gesehen hatte, zu den Erzählungen seines Freundes. Der kleine Bach, der in der Höhle aus der Felswand entsprang und draußen in einem Loch verschwand, der Talkessel, der den Eingang umgab, und das mittlerweile ziemlich verrottete Bärenfell, das zwischen den Trümmern irgendwelcher Gestelle lag, die Mikail zu welchem Zweck auch immer gebaut haben musste. Die Größe des Felles bewies, dass der Bär wirklich gigantisch gewesen sein musste. Den hatte Mikail nur mit seinem Messer erlegt? Und natürlich mit seiner übermenschlichen Kraft, aber trotzdem: unglaublich.
Noch unglaublicher allerdings war die Tatsache, dass da draußen eine tote Monsterechse lag, zwischen deren Kiefern er zerbrochene Speere gefunden hatte. Offensichtlich war sie mit einem Menschen aneinandergeraten, und da keine menschlichen Knochen herumlagen, schien der sogar gewonnen zu haben. Auch das konnte nur Mikail gewesen sein. Wer sonst war in der Lage, es selbst mit diesen Bestien aufzunehmen?
Loris rappelte sich auf und ging zu seinem Rucksack. Er holte die Wasserflasche hervor, die Tomasch ihm mitgegeben hatte, und schüttete den schal gewordenen Inhalt aus. Hier gab es ja wunderbares, frisches Wasser in Mengen. Dann kramte er nach etwas von den Speisen, die Mikails Bruder ihm für die Flucht eingepackt hatte.
Kurz darauf saß er an seinem erneut angefachten Feuer und kaute. In Gedanken sandte er Tomasch einen Dank für dessen Hilfe. Dafür kannte Mikails großer Bruder ihn dann doch zu gut, als dass er ihn für einen Mörder gehalten hätte. Ohne Tomasch wäre er entweder schon wieder gefangen oder läge irgendwo bibbernd vor Angst in einem Versteck.
Dieser elende Drecksack von Sandor! Kaltblütig Menschen umzubringen. Aus Rache, weil Loris ihn lächerlich gemacht hatte. Wie konnte man nur so krank sein?
Diesem Wahnsinnigen hatte er es zu verdanken, dass er jetzt nicht bei Mitena war und sich mit ihr auf das gemeinsame Kind freute, sondern hier draußen saß und nicht wusste, wohin er sich wenden sollte. Nach Or konnte er erst wieder zurück, wenn seine Unschuld erwiesen war. Und das mochte dauern. Bis dahin musste er irgendwie überleben. Tomasch hatte gesagt, er solle entweder im Umland bleiben oder sich in eine andere Stadt durchschlagen.
Das mit dem Umland war so eine Sache. Erstens war er hier auf sich gestellt, und das ganz ohne Waffen, und zweitens gab es dann ja gar keine Möglichkeit zu erfahren, was in Or vor sich ging, ob man den wahren Mörder gefunden hatte oder ihn selbst weiter verdächtigte.
Natürlich konnte er zu einem der beiden Erzbergwerke schleichen, die seinem Vater gehörten, und versuchen, dort Unterstützung zu bekommen. Wenn er beispielsweise mit Binka sprach, würde sie ihm sicher helfen. Seine frühere Dürrerätin traute ihm einen Mord ganz bestimmt nicht zu. Andererseits durfte er sich nicht darauf verlassen, dass Yusefs Angestellte alle auf seiner Seite waren. Itai, der im Stahlwerk arbeitete, hatte nicht nur den Zeugen angeschleppt, der die Tatwaffe als Mitenas eigenes Küchenmesser identifiziert hatte, er war auch zusammen mit Sandor ins Ratsgebäude eingedrungen, um Loris zu ermorden.
Außerdem, auch wenn ein guter Mensch ihm half, brachte derjenige sich damit nur selbst in Schwierigkeiten. Das wollte Loris von niemandem verlangen.
Die Alternative war also, in eine andere Stadt zu reisen, von dort eine Nachricht an Tomasch zu senden und abzuwarten, was der antwortete. Wunderbare Aussicht. Er alleine sollte Hunderte Kilometer durch die Wildnis zurücklegen? Wo nicht nur das übliche Getier lauerte, sondern seit einigen Monaten auch noch riesige Wölfe und viele Meter lange Echsen, die vor nichts halt machten?
Oder Mikail suchen? Er musste irgendwo hier draußen sein, zusammen mit diesen seltsamen Leuten. Gut, sie hatten sich im Streit getrennt, doch deswegen hätte sein alter Freund ihm niemals Hilfe verweigert. Aber nein. Aussichtslos. Wo hätte er beginnen sollen? Von den Städten wusste er wenigstens, wo sie lagen.
Missmutig warf er ein paar Steinchen in die Gegend. Blieb ihm etwas anderes übrig? Wohl kaum. Also sollte er nicht länger hier herumsitzen und die kargen Vorräte dezimieren, sondern besser sehen, dass er vorankam. Immerhin, ein Pferd hatte er. Auch von Tomasch. Er schuldete dieser Familie inzwischen so viel, wie konnte er das jemals wieder gutmachen?
Über seine Gedanken war allerdings die Abenddämmerung hereingebrochen. Im Dunkeln wollte er lieber nicht reisen. Das Pferd, das sich im Talkessel frei bewegen durfte, stand schon ganz schläfrig herum. Nun gut, dann sollte er versuchen, noch etwas Schlaf zu bekommen, um morgen ganz früh loszureiten.
Beim ersten Licht des neuen Tages brach er auf. Der Braune hatte das wenige Gras, das in dem Talkessel gewachsen war, sowieso bereits abgefressen und freute sich, in die Ebene zu kommen, wo jetzt, in den letzten Wochen der Regenzeit, alles in saftigem Grün stand. Loris ließ ihn erst eine Weile gemütlich gehen und immer wieder hier und da am frischen Gras knabbern, bevor er ihn in einen lockeren Trab brachte, den so ein kräftiges Tier lange durchhalten konnte.
Er ritt nach Westen, nah am Gebirge entlang, um schließlich am Odonla nach Süden abzubiegen, dem großen Fluss, der sich aus den Bergen in die Ebene ergoss, um bei Sawan in einem riesigen, fruchtbaren Delta im Boden zu versickern. Ihn musste er queren, um dem aus ihm entspringenden Odorun bis nach Kuvunja zu folgen.
Sawan wäre ebenfalls ein mögliches Ziel gewesen, allerdings war Loris dort die Gefahr zu groß, von jemandem erkannt zu werden. Sawan schickte immer wieder Karawanen nach Or, mit deren Teilnehmern – vor allem den weiblichen – Loris doch so einige Stunden verbracht hatte. Kuvunja dagegen trieb nur mit Sawan direkten Handel, von dort aus wurden die Güter dann von neuen Karawanen weitertransportiert. Ebenso, wie man das Salz aus Cood nach Or brachte und erst von dort aus nach Sawan. Und weiter nach Kuvunja.
Die Stadt am Großen Bruch war kaum weiter entfernt als die am Delta. Zwei, drei Tagesreisen vielleicht. Das machte nun wirklich nichts mehr aus. Das größere Problem war die Frage, wie er den Odonla queren sollte. Bei Sawan gab es natürlich eine Brücke, aber nördlich davon? Zumindest wusste Loris nichts darüber. Das musste er wohl auf sich zukommen lassen.
Vor dem Aufbruch hatte er noch einmal seine Vorräte kontrolliert. Ein Laib Käse, ein Schinken, zwei Hartwürste und zwei kleinere Brote, alles in Wachstuch eingeschlagen. Und manches davon bereits gestern angeknabbert. Außerdem eine Flasche und einen Schlauch, beide heute früh mit frischem Wasser gefüllt.
Tomasch hätte ihm noch mehr mitgegeben, aber für vier oder fünf Tage würde das schon reichen. Mehr wäre womöglich nur verdorben. Das Wasser musste er natürlich immer wieder auffüllen, aber das war nun wirklich seine geringste Sorge. Nach wochenlangem Regen plätscherten alle paar Wegstunden kleine und größere Bäche aus dem Gebirge in die Ebene.
Wie er sich im weiteren Verlauf der Reise mit Nahrung versorgen sollte, war das eine ernsthafte Problem. Er hatte keine Jagdwaffen. Anders als Mikail war dessen älterer Bruder nie zur Jagd gegangen, die Eltern ebenso wenig. Es gab nur ein paar Messer auf dem Hof, aber nichts, was für die Jagd getaugt hätte. Oder zur Abwehr von Raubtieren.
Womit er beim zweiten, womöglich noch größeren Problem angelangt war. Selbst einem einzelnen Bären oder einem Rudel Wildhunde war Loris hoffnungslos unterlegen. Er konnte nur darauf hoffen, dass sein braver Brauner schneller und ausdauernder lief als alles, was ihnen an Fressfeinden begegnen mochte. Deshalb schonte er das Pferd möglichst, nahm lieber ein etwas langsameres Vorankommen in Kauf, als dass sein Reittier im Gefahrenfall zu müde für eine Flucht wäre.
Während der Wallach gleichmäßig vor sich hin trabte, schweiften Loris’ Gedanken ab. Daheim saß Mitena, schwanger, und zitterte um ihn. Tomasch hatte ihr sicher bereits gesagt, dass ihr Gefährte aus Or geflohen war. Immerhin, sie konnte auf die Unterstützung von Loris’ Familie zählen. Mona, Yusef und auch seine Schwester Lia würden ihr durch diese Zeit helfen. Aber eigentlich hätte er selbst an ihrer Seite sein sollen. Stattdessen würde sie schlaflose Nächte haben bei dem Gedanken, dass er hier draußen in der Wildnis umherstreifte.
Er schloss die Augen, ließ sich von den Sonnenstrahlen, die durch den nur noch teilweise bewölkten Himmel brachen, das Gesicht wärmen und stellte sich Mitenas geliebte Züge vor. Sie würde auf ihn warten, da war er ganz sicher. Vor allem, wenn er ab und zu einen Weg fand, ihr eine Nachricht zukommen zu lassen.
Ein nervöses Schnauben des Pferdes riss ihn aus seinen Gedanken. Loris schlug die Augen auf und sah sich um. Hmm … nichts Verdächtiges zu sehen. Aber der Gaul war merklich unruhig.
»Na, Brauner, was ist los?«, fragte er ihn. »Witterst du was?«
Eigentlich schade, dass bei all den Veränderungen, die die Tierwelt hervorbrachte, nicht mal sprechende Pferde dabei waren. Andererseits … wahrscheinlich würden die sich dann ständig beschweren, warum die Menschen ihnen ihre dicken Hintern auf den Buckel pflanzten.
Er kicherte leise über den dummen Gedanken, als sein Reittier schon wieder schnaubte und unvermittelt nach rechts schwenkte. Loris zog am Zügel, brachte es wieder auf einen Kurs parallel zum Gebirgsrand und sah sich ein weiteres Mal um, nun noch gewissenhafter.
»Jetzt seh ich’s auch«, murmelte er. Etwas Geflecktes huschte einige Dutzend Meter links von ihm durch das mehr als hüfthohe Gras.
»Ahnenverdammte Scheiße!« Das waren Wildhunde. An eine größere Gruppe Menschen trauten die sich normalerweise nicht heran, aber ein einzelner Reiter war was anderes. Hatten sie das Pferd erst einmal mit ein paar Bissen ihrer Giftzähne geschwächt, war der Rest ein Kinderspiel für die Tiere, die in Rudeln von einem Dutzend bis über fünfzig Tiere jagten. Zuletzt hatte Loris auf der Karawane nach Cood mit ihnen nähere Bekanntschaft gemacht. Da waren sie im Dunkel der Nacht über ihn hergefallen, doch dank der Schutzhunde war alles gut ausgegangen. Die hätte er jetzt auch gerne dabeigehabt.
Er ließ dem Wallach die Zügel schießen und drückte ihm die Fersen in die Flanken. »Also los, zeig, was du kannst!«
Der Braune machte einen Satz und verfiel in gestreckten Galopp. Tief beugte sich Loris über den Hals des Pferdes, ging mit dessen Bewegungen mit und trieb ihn mit sachten Klapsen zu noch schnellerem Lauf an.
»Komm schon, die hängst du locker ab!«
Als er sich umwandte, sah er bereits rund zehn Tiere hinter sich herrennen, weitere stießen von beiden Seiten zu ihnen. Verdammt, die hatten ihn schon beinahe eingekreist. Der leichte Wind war von vorne gekommen, deshalb hatte das Pferd die Räuber erst gewittert, als es fast zu spät gewesen war. Fast.
Loris lachte auf. Es war ein aufregendes Gefühl, auf dem Rücken des Pferdes durchs hohe Gras zu fliegen und die Wildhunde langsam, aber sicher hinter sich zu lassen. Die hatten sich sauber verrechnet!
Im nächsten Moment schoss links vor ihm ein Schemen durchs Gras, hielt direkt auf ihn zu. Loris riss den Braunen gerade noch ein Stück herum, da erhob sich das massige Raubtier auch schon mit einem mächtigen Sprung aus dem Gras, flog ihm entgegen und rauschte nur Zentimeter an der Flanke des Pferdes vorbei.
Scheiße! Das war knapp gewesen. Loris lenkte den Wallach erneut in die alte Richtung zurück und versuchte, trotz der wilden Jagd zu erkennen, ob sich weitere Wildhunde vor ihm verbargen und ihn doch noch abfangen konnten. Ja! Dort, diesmal rechts vorne, sah er das gefleckte Fell zwischen den Halmen. Er zog sein Pferd etwas nach links, gerade so weit, dass der Hund ihn nicht mehr erwischen würde, und sah nach dem Rest der Meute.
Sie alle rannten immer noch hinter ihm her, fielen jedoch langsam, aber stetig zurück. Wenn jetzt nur der Gaul nicht schlappmachte! Er nahm die restliche Umgebung in Augenschein. Nein, nun sah er keine weiteren Gegner mehr. Aber das musste nichts heißen, in dem nach Monaten des Regenwetters rund einen Meter hohen Gras konnte sich problemlos noch mal dieselbe Zahl Tiere verbergen. Ihm blieb nur zu hoffen, dass sie den Kreis um ihn wirklich noch nicht ganz geschlossen hatten und er nun endlich durchgebrochen war.
Langsam zeigte sein Pferd erste Ermüdungserscheinungen. Schaum flog ihm vom Maul, das Fell glänzte nass, der Galopp war nicht mehr ganz so kraftvoll.
»Halt durch, mein Guter!«, sprach er ihm gut zu. »Noch ein paar Minuten, dann geben sie auf.« Zumindest hoffte er das.
Als er sich erneut umsah, lagen seine Verfolger schon beinahe hundert Meter zurück, waren aber offenbar noch nicht gewillt, sich geschlagen zu geben. Vor allem einige besonders große Tiere hielten stur durch, zählten sicher darauf, dass dem Pferd bald die Puste ausgehen würde. Aber der Abstand wuchs zusehends.
»Bald haben wir’s geschafft.« Loris verzichtete darauf, sein Pferd noch weiter anzutreiben. Die Angst vor den Beutegreifern war sicher Ansporn genug, und wenn das arme Tier vor Erschöpfung zusammenbrach, war niemandem gedient. Aus dem gestreckten wurde bald eine Art Arbeitsgalopp, der sicher den schwindenden Kräften des Wallachs zuzuschreiben war. Ein Blick zurück zeigte Loris, dass auch die Wildhunde bereits bedeutend langsamer geworden waren. Nun trabten sie beinahe schon, gaben aber leider immer noch nicht ganz auf. Verdammt zähe Biester!
Trotzdem erlaubte er sich aufzuatmen. Wildhunde waren keine Langstreckenjäger. Sie versuchten, ihre Beute einzukreisen, hetzten sie oft noch ein paar Kilometer, aber dann ließen sie es gut sein.
Seine Erleichterung hielt nur kurz. Das durfte doch nicht wahr sein! Genau vor ihm, nur wenige Hundert Meter voraus, ragten zwei Geschöpfe weit aus dem hohen Gras, die er nur allzu gut kannte: Riesenechsen.
»Ahnenverfluchter Sauscheiß, was hab ich denn angestellt?«, schimpfte er, nur, um sich im nächsten Moment panisch an seinem Pferd festzuklammern, das die riesigen Monstren nun wohl auch gewittert hatte und prompt scheute. Der Braune blieb abrupt stehen, wieherte verängstigt und stieg sogar kurz auf die Hinterhand.
Loris saß in der Falle. Die Wildhunde hinter ihm sahen offenbar ihre Chance und beschleunigten wieder, fächerten sich auf, um ihm jeden Fluchtweg abzuschneiden, die Echsen vor ihm hatten vermutlich das Pferd gehört und blickten interessiert in seine Richtung. Gehetzt sah er sich um. Wohin jetzt? Sein Brauner hielt nicht mehr lange durch, und wenn der Gaul erst zusammenbrach, würde auch er nicht entkommen. Ganz davon abgesehen, dass eine längere Flucht vor den unglaublich schnell rennenden Echsen vollkommen aussichtslos war.
Es blieb nur noch eine Richtung: in die Berge. Da hinten schien sich ein schmales Tal zur Ebene hin zu öffnen. Klar, die Wahrscheinlichkeit war groß, dort in der Falle zu sitzen, aber die Ebene bot ihm erst recht keinen Schutz. Schlimmstenfalls musste er eine Möglichkeit finden, sich alleine in die Felsen zu retten und das Pferd im Stich zu lassen. Ein herber Verlust, und er hatte das Tier auch schon ins Herz geschlossen, aber immer noch besser, als wenn sie beide gefressen wurden.
Loris trieb den Braunen zu einem letzten Kraftakt an, holte alles aus ihm heraus. Schwer schnaubend rannte das Tier auf den roten Sandstein zu, der sich aus der Ebene erhob, die Wildhunde weiter im Genick. Ein kurzer Blick zeigte Loris, dass die beiden monströsen Echsen in vorerst noch eher gemächlichem Tempo näherkamen. Das konnte sich schnell ändern. Wenn sie sich erst einmal auf ihre starken Hinterbeine erhoben und mit voller Kraft rannten, bebte die Erde unter ihren mächtigen Tritten. Dann entkam ihnen höchstens ein ausgeruhtes Pferd, aber sicher nicht der Wallach, der nun schon einige Kilometer gerannt war.
Das Pferd stolperte, Loris schrie vor Schreck auf, doch es fing sich wieder und lief weiter. Nach einer gefühlten Ewigkeit änderte sich der Ton des Hufschlags, sie hatten den felsigen Boden des Gebirges erreicht und jagten nun über Stein und Sand, statt durch saftiges Grün. Links und rechts rauschten die ersten Felsen vorbei. Nun gab es kein Zurück mehr. Sollte sich dieses Tal als Falle erweisen, war er geliefert.
Laut hallte das Getrappel von den Wänden wider, mischte sich mit dem aufgeregten Gekläff der Hunde, die nun ebenfalls den Einschnitt zwischen den Felsen erreicht hatten und wohl genau dasselbe dachten: Hier kam ihre Beute nicht mehr heraus.
Der Braune schoss um eine Biegung, rutschte, stolperte, fing sich wieder. Loris blieb nur noch, sich festzuklammern und sein letztes bisschen Mut nicht zu verlieren.
Eine weitere Biegung, dann tauchte die Wand auf. Verfluchte Ahnensch… was? Das war keine Felswand, sondern eine Mauer! Mit einem Tor. Und das stand offen. Loris konnte sein Glück nicht fassen. Dann sah er, dass nicht allzu weit dahinter tatsächlich Felsen aufragten, die ein Weiterkommen unmöglich machten. Ein Blick zurück, ja, er konnte es schaffen.
Er lenkte das Pferd durch das Tor, riss hart an den Zügeln und sprang ab. Der Wallach lief sofort wieder weiter, immer noch in Panik vor den Raubtieren. Loris jedoch eilte auf zitternden Beinen, die unter ihm nachzugeben drohten, zum linken Torflügel, der nur halb geöffnet war, schob mit aller Kraft und knallte ihn zu. Schon tauchten die ersten Wildhunde auf, die die letzte Biegung nun ebenfalls erreicht hatten. Schnell jetzt!
Loris stolperte zum rechten Flügel, stemmte sich dagegen. Viel zu langsam bewegte sich das Tor, gezimmert aus sicher zwanzig Zentimeter dicken Bohlen. Das Gebell der Wildhunde wurde immer lauter, sie wähnten sich schon am Ziel, und wenn sich dieses verdammte Ding hier nicht endlich etwas schneller schloss, behielten sie womöglich auch recht.
»Scheiße, geh zu!«, brüllte Loris verzweifelt und drückte mit aller ihm noch verbliebenen Kraft. Dieses verfluchte Stück Holz war gerade mal einen Meter breit – allerdings drei hoch. Endlich, endlich bekam das Ding Schwung. Draußen hörte er schon das Hecheln der Hunde, das Kratzen ihrer Krallen auf dem Felsboden. Jeden Moment mussten die ersten hereinstürmen.
Dann knirschte etwas, und mit einem Mal gab der Torflügel nach, schwenkte beinahe von selbst krachend zu.
Einen Lidschlag später gab es mehrere dumpfe Schläge, gefolgt von schmerzerfülltem Winseln, als einige der Räuber nicht mehr rechtzeitig bremsen konnten und auf das Tor schlugen. Loris spürte jeden Aufprall in der Schulter, mit der er sich immer noch gegen das Holz stemmte.
Völlig erschöpft und nassgeschwitzt sank er zu Boden, den Rücken ans Tor gelehnt. Es aufzudrücken, das würden die Wildhunde sicher nicht schaffen. Was diese auch gar nicht versuchten, sie sprangen nur draußen herum, kläfften und winselten und ärgerten sich wahrscheinlich maßlos über den Verlust der schon sicher geglaubten Beute.
»Leckt mich!«, rief Loris ihnen zu, so schwach, dass es jenseits der Mauer vermutlich nicht zu hören war. Für einen Moment schloss er die Augen und genoss einfach das Gefühl, in Sicherheit zu sein.
Dann hörte er es: Bumm, bumm, bumm. Dieses Geräusch kannte er nur zu gut. Die Monsterechsen waren auf dem Weg, und zwar in vollem Lauf. Schon spürte er, wie der Boden unter ihren schweren Tritten erbebte.
Müde stemmte er sich wieder hoch. Wäre ja auch zu schön gewesen. Er musste das Tor irgendwie verriegeln.
Ah, da gab es Halterungen für insgesamt vier Riegel. Diese standen brav neben dem Tor, bereit, eingelegt zu werden. Allerdings waren sie wohl nicht dafür gedacht, von einem einzigen, noch dazu ziemlich entkräfteten Mann gehoben zu werden. Aber was half es? Er holte alles aus sich heraus, kippte mühsam einen der oberschenkeldicken und beinahe zwei Meter langen Balken herum und legte ein Ende in eine der Halterungen, die etwa in Brusthöhe am Tor angebracht waren. Dann schob er das andere Ende an, ächzte und stöhnte, bis das Holz sich endlich bequemte, an seinen Platz zu rutschen. Ja! Ein Stück mehr Sicherheit. Ein weiterer Riegel kam rund einen Meter über den Boden.
Der dritte Balken allerdings musste auf Kopfhöhe eingelegt werden, der vierte noch höher. Und draußen waren die Echsen unüberhörbar heran. Sinnlos, das schaffte er nicht mehr.
Loris ließ das Tor, wie es war, und sah sich um. Das Innere dieses Talkessels war frei, wirkte geradezu aufgeräumt. Zäune markierten offensichtlich Pferche für Tiere. An den Wänden fanden sich diverse Bauten, manche sahen wie riesige Backöfen aus, das dort hinten mochte eine Schmiede sein. Wer, bei den Ahnen, hatte das gebaut? Es sah alles viel zu gepflegt aus, um noch aus der Zeit zu stammen, bevor sich die Menschen in die großen Städte zurückgezogen hatten. Ein Rätsel, für das er im Moment leider gar keine Zeit hatte.
Jetzt interessierten ihn vor allem zwei Dinge: die Eingänge zu einigen Höhlen, die sich in den Wänden des Talkessels auftaten, und die Treppen, die an diesen Wänden entlang nach oben führten. Holzgestelle, gut in Schuss, auf denen man problemlos aus dieser Falle hinausgelangen konnte. Er selbst zumindest, sein Pferd jedoch …
Vor der Mauer wurde es jetzt erst richtig laut. Offenbar waren die Echsen angekommen und versetzten nun die Hundemeute in Panik. Gut so, dachte er grimmig. Fresst die verdammten Köter, und lasst mich in Ruhe!
Das Pferd trottete ängstlich, aber am Ende seiner Kräfte, in dem Talkessel hin und her. Sein Fell dampfte, sein Atem ging schwer, die Augen waren weit aufgerissen vor Furcht. Loris konnte es dem armen Tier nachempfinden. Er hastete auf es zu, um es zu beruhigen, doch in seiner Panik sprang es von ihm weg, lief ein paar Meter, änderte die Richtung, suchte verzweifelt nach einem Ausweg.
Während Loris noch händeringend über eine Lösung nachdachte, dröhnte der erste Schlag gegen das Tor. Verdammt! Die paar Hunde waren den Echsen wohl nicht genug. Loris sprintete zur nächstbesten Treppe, die auf den Rand des Kessels hinaufführte. Das Pferd musste er wohl drangeben, so leid es ihm tat. Hinter ihm krachte es erneut, und diesmal mischte sich laut und deutlich das Geräusch berstenden Holzes hinein. So schnell brachen die Riegel? Er holte das Letzte aus sich heraus, rannte, wie er wahrscheinlich noch nie in seinem Leben gerannt war. Wieder ein Schlag, diesmal war sicher mindestens ein Riegel komplett in Stücke gegangen.
Er erreichte das Gestell, wollte gleich zwei Stufen auf einmal nehmen und schlug prompt schmerzhaft hin. Das machten die Beine nicht mehr mit. Also hastete er Stufe für Stufe, so schnell er es nur vermochte, die Treppe hinauf. Dutzende Meter führte sie nach oben, weg von den Bestien.
Loris riskierte einen kurzen Blick zum Tor. Was? Ahnenscheiße, daran hatte er ja gar nicht mehr gedacht: Die Mistviecher konnten klettern! Während eine der Echsen eben Schwung holte, um einen weiteren Hieb mit ihren Pranken gegen das Holz zu führen, zog sich die zweite eben auf die Mauerkrone hinauf. Beinahe meinte er, sie böse grinsen zu sehen, als sie ihn auf seinem plötzlich sehr zerbrechlich scheinenden Gestell entdeckte. Einen Moment später war sie auch schon auf der anderen Seite heruntergesprungen, richtete sich auf die Hinterbeine auf, spreizte drohend ihren Nackenschild und rannte los, direkt auf ihn zu. Nur einen Augenblick danach flog mit lautem Getöse das Tor auf. Auch das zweite Monstrum hatte sich Zugang zum Kessel verschafft.
Loris wirbelte herum und hetzte weiter nach oben. Sicher noch zwanzig Meter trennten ihn von der Oberkante der Wand. Klettern konnten sie, aber so hoch? Er musste es versuchen.
Seine Lungen brannten, die Beine wollten ihm kaum noch gehorchen, doch er zwang sich voran, Stufe um Stufe, der Rettung entgegen. Dann ließ das Geräusch splitternden Holzes sein Blut gefrieren. Die Treppe unter seinen Füßen geriet ins Schwanken.
2
»Wenn das so weitergeht, bin ich demnächst komplett durchgeweicht«, maulte Tabo nicht zum ersten Mal. Seit den frühen Morgenstunden goss es wie aus Eimern.
»Passt doch«, giftete Jekarina zurück. »Du bist ja auch quengelig wie ein Windelpisser.« Sie schüttelte genervt den Kopf. »Und sowas will ein Freier sein. Selbst unser Stadtkind Mikail jammert nicht ständig herum wie ein Kleinkind.«
Ja, dachte der sich, ich beiße halt die Zähne zusammen. Es hilft ja nix. Aber auch er wunderte sich, dass ausgerechnet jemand, der Jahr und Tag in freier Natur und unter offenem Himmel lebte, sich dermaßen über den Regen beschwerte. Allerdings hielt er tunlichst den Mund, mischte sich nicht in den Streit der beiden ein. Das konnte ja heiter werden, gerade mal seit gestern waren sie unterwegs, und schon jetzt war die Laune auf dem Tiefpunkt angelangt.
Zum Glück ließ sich Tabo diesmal nicht auf Jekarinas Sprüche ein, schwieg nun nur noch verbissen.
»Das ist doch grundsätzlich am Ende des Winters so, wenn die Wolken sich wieder hier an der Nordflanke des Gebirges abregnen«, erklärte die Riesin kurz darauf. »Im Winter schaffen sie es problemlos über die Gipfel, und auf der anderen Seite haben sie dann Regenzeit. Jetzt bleiben sie immer mehr hier hängen, und bald lösen sie sich ganz auf. Dann haben wir hier Sommer und drüben, im Süden, Trockenzeit. Solltest du eigentlich gelernt haben.«
»Ja doch«, antwortete Tabo missmutig. »Nur, dass sich vernünftige Menschen um diese Zeit eben nicht ausgerechnet am Nordrand der Berge aufhalten. Entweder gleich im Süden oder eben noch ein Stück nördlicher, aber nicht genau hier.«
»Ach, so ist das. Der Herr hätte lieber eine etwas angenehmere Marschroute«, ätzte Jekarina. »Wir können gerne extra nach Norden abschwenken, bis wir aus dem Pisswetter raus sind, und dann trockenen Hauptes weiter nach Westen. Kostet uns halt noch ein paar Tage zusätzlich, aber Zeit haben wir ja im Überfluss.«
Na schön, Klappe halten alleine reichte nicht. Mikail musste wohl doch irgendwie diesen Zank beenden, bevor er noch die ganze Reise ruinierte.
»Eigentlich …«, überlegte er laut, »… haben wir ja wirklich Zeit. Drängt uns irgendwas? Müssen wir unbedingt so schnell wie möglich im Waldland ankommen?«
Jekarina sah ihn verblüfft an. »Willst du unserem zarten Bubilein jetzt auch noch zu Hilfe kommen?«
»Um ehrlich zu sein«, stöhnte er, »ist mir momentan alles lieber als eure ewige Streiterei. Scheiß doch auf ein paar Tage hin oder her. Wenn ihr euch schon am zweiten Tag dermaßen in die Haare kriegt, können wir die ganze Unternehmung gleich abblasen. Denn offen gesagt ist dein Gemecker mindestens ebenso kindisch wie Tabos Gejammer, und beides geht mir seit Stunden gewaltig auf den Sack.«
Für einen Moment erwartete er, dass Jekarina in die Luft ging wie ein ganzes Fass Pulver. Dann stahl sich erst ein leichtes Schmunzeln in ihr Gesicht, um sich einen Augenblick später in ihrem berühmtberüchtigten, dröhnenden Lachen zu entladen. Man meinte fast, es noch über den Regen hinweg von den gut zwei Kilometer entfernten Bergflanken widerhallen zu hören. Sogar die Pferde und die sonst beinahe unerschütterlichen Mulis schraken bei dem donnernden Gelächter sichtlich zusammen.
Tabo hielt sich noch ein paar Atemzüge zurück, dann brach auch er in schallendes Lachen aus, und Mikail fiel nur zu gerne mit ein. Na also! Das war doch gleich viel besser.
»Dass mir mal ein Bengel so was vor den Latz knallt, der grad halb so alt ist wie ich«, japste Jekarina nach einer Weile, »das hätte ich mir nie träumen lassen.« Sie holte tief Luft und grinste Mikail an. »Und das Peinliche ist: Du hast auch noch recht!«
»Ich hab meistens recht«, konterte der verschmitzt. »Nur leider sehen das die anderen oft nicht ein.«
Tabo, der sich ebenfalls inzwischen halbwegs beruhigt hatte, prustete bei dem blöden Spruch gleich noch mal los. »Du bist schon ein frecher Hund, was?«
»Wuff!«
Eine Weile ritten sie schweigend, aber immer wieder vor sich hin glucksend nebeneinander her. Dann griff Mikail das Thema noch mal auf.
»Im Ernst jetzt. Drängt uns was? Müssen wir so schnell wie möglich ins Waldland? Oder sollen wir die paar Tage Umweg in Kauf nehmen, wenn wir dafür trockener, bequemer und besser gelaunt reisen können? Ich meine, angenehm ist das doch für keinen von uns. Und der Ausrüstung tut das sicher auch nicht gut.«
Jekarina konnte sich einen theatralischen Seufzer nicht verkneifen, stimmte dann jedoch zu. »Ist ja recht, bevor ihr armen Zuckerpüppchen euch noch in den Regenfluten auflöst, nehmen wir halt den längeren Weg.«
Insgeheim war sich Mikail sicher, dass sie ganz und gar nicht böse darum war, aus dem Dauerregen herauszukommen. Schließlich pflegten auch die Freien zu so unangenehmen Zeiten irgendwo ihr Lager aufzuschlagen und den Regen unter den Dächern ihrer Zelte abzuwarten. Das hatte er auf seiner monatelangen Reise mit Connors Clan mehrfach erlebt. Aber Jekarina hatte nun mal den Ruf der unerschrockenen und durch nichts zu erschütternden Jägerin zu verteidigen. Sollte sie, Hauptsache, die Laune der kleinen Reisegruppe besserte sich wieder.
Er sah nach Norden. So weit entfernt war die Grenze der dicken Wolkendecke gar nicht, fand er. Vielleicht täuschte aber auch nur das endlose, flache Gelände. Egal, ein oder zwei Tage hin oder her, was machte das schon? Geschlossen lenkten sie ihre Pferde und die beiden Packmulis nach rechts, auf den hellen, Trockenheit verheißenden Streifen Himmel zu.
Das Mittagessen nahmen sie immer noch in strömendem Regen zu sich, ohne anzuhalten, auf dem Rücken der Pferde. Der Wind blies ihnen nun leider auch noch das Wasser stetig entgegen, da halfen selbst die großen, breitkrempigen Hüte nicht, die ihnen Ratsfrau Liv in weiser Voraussicht mitgegeben hatte.
»Das werden wirklich einige Tagesritte, bis wir den Dreck hinter uns haben, oder?«, fragte Mikail irgendwann und zog den Kopf noch weiter zwischen die Schultern.
»Na, jetzt maul du mal nicht rum«, wies Jekarina ihn zurecht, aber ihr Tonfall war weit freundlicher als noch am Vormittag. »Du wolltest schließlich nach Norden, und da wusstest du, woher der Wind weht.«
Da musste Mikail ihr leider recht geben.
»Aber tröste dich«, fuhr sie fort, »wir haben ja erst vorhin die Richtung gewechselt. So schnell kann das doch nicht gehen! Diese Nacht sollten wir uns ein Wäldchen suchen, das zumindest das Schlimmste abhält, und morgen Nachmittag könnten wir schon trockeneres Gebiet erreicht haben … mit Glück.«
Tja nun … das mussten sie dann eben noch durchstehen. Immerhin, vor ihnen lagen wahrscheinlich anderthalb bis zwei Wochen, die sie nur nach Westen reiten würden, und dann doch lieber noch etwas mehr als einen Tag Regen im Gesicht als die ganze Zeit in dem Mistwetter.
Also kämpften sie sich weiter voran. Die Tiere hatten ihre liebe Not mit dem aufgeweichten Boden. Vor allem Jekarinas mächtiger Kaltblüter, der normalerweise große Kutschen zog und mit dem Gewicht der Riesin ansonsten kein Problem zu haben schien, tat sich schwer. Aber auch die an jegliches Wetter und Gelände gewöhnten Reitpferde der Freien ermüdeten zusehends davon, dass sie bei jedem Schritt die Hufe aus dem Schlamm ziehen mussten.
Das fiel schließlich auch den beiden anderen auf, und Jekarina selbst war es, die vorschlug, heute besonders früh das Lager aufzuschlagen und den Pferden und Maultieren ihre Erholung zu gönnen.
»Wie du schon so richtig sagtest«, erklärte sie an Mikail gewandt, »hetzt uns nichts. Da sollten wir die armen Viecher nicht unnötig quälen.«
Also steuerten sie noch weit vor Einbruch der Dämmerung einen kleinen Wald an, der nur ein oder zwei Kilometer westlich ihrer Route lag. Nach dem fast obligatorischen Buschgürtel, der diese Wäldchen hier umgab, tauchten sie in den Schatten von Birken und Erlen, aber auch mächtigen Eichen und Ahornbäumen, zwischen denen die eine oder andere Fichte emporragte. Das Unterholz war dicht, immer wieder mussten sie umgestürzten Bäumen oder undurchdringlichen Dickichten ausweichen.