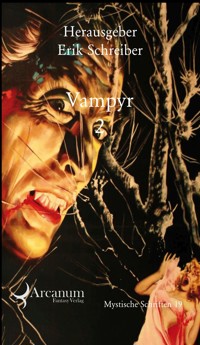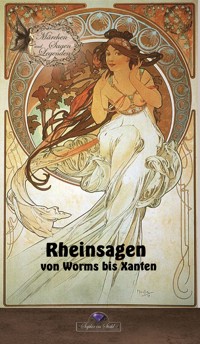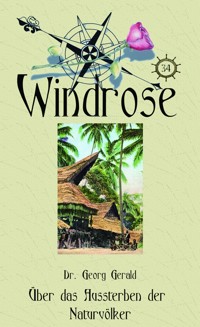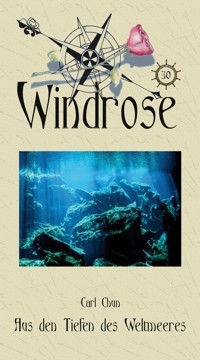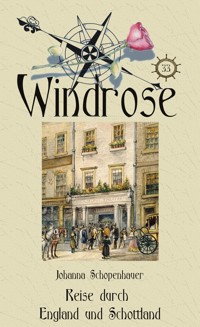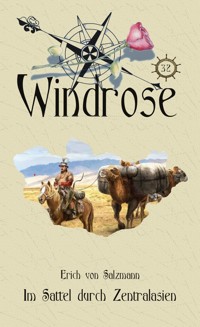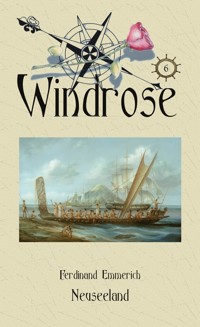
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Windrose
- Sprache: Deutsch
Mein Reiseziel war die große Doppelinsel Neuseeland. Während ich mich mit rasch gewonnenen Freunden in Valparaiso über die einzuschlagende Route unterhielt, tönte vom Hafen her ein merkwürdig heulender Sirenenton. So beginnt der Roman über eine spannende Seereise aus dem Jahr 1910. (etwa) Erschienen ist das Buch erstmalig 1929.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Herausgeber
Erik Schreiber
Windrose 6
Reiseerzählungen
Ferdinand Emmerich-Hoegen
Neuseeland
Saphir im Stahl
Reiserzählungen 6
e-book 196
Ferdinand Emmerich-Hoegen - Neuseeland (ca. 1929)
Erscheinungstermin 01.11.2023
© Saphir im Stahl Verlag
Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
www.saphir-im-stahl.de
Titelbild: Archiv Andromeda
Lektorat: Peter Heller
Bearbeitung: Simon Faulhaber
Vertrieb neobook
Herausgeber
Erik Schreiber
Windrose 6
Reiseerzählungen
Ferdinand Emmerich-Hoegen
Neuseeland
Saphir im Stahl
Mein Reiseziel war die große Doppelinsel Neuseeland. Während ich mich mit rasch gewonnenen Freunden in Valparaiso über die einzuschlagende Route unterhielt, tönte vom Hafen her ein merkwürdig heulender Sirenenton.
„Was mag denn das für einer sein?“, fragte Oldehaver, der junge Bierbrauer aus Santiago. „Den Ton haben wir hier doch noch nie gehört. Der heult ja wie ein Kriegsdampfer.“
„Lass' ihn heulen“, fiel ihm Köhler in die Rede. „Solange es kein Kosmosdampfer ist, der unseren Forscher nordwärts entführt, hat er kein Interesse für uns. – Prosit!“
„Merkwürdig, dass man keine einzige direkte Verbindung von hier nach Australien hat, wo doch die beiden Länder, Chile und Neuseeland, auf denselben Breitengraden liegen und beide einen regen Handelsverkehr haben.“
„Aber nicht miteinander“, antwortete der Agent der Kosmoslinie. Höchstens Kohlenschiffe wählen den direkten Weg. Wer, wie Sie, nach der anderen Leite des Stillen Ozeans will – und das kommt nicht oft vor – muss bis San Franzisko nach Norden hinauf und dann dieselben fünfundsechzig Breitengrade wieder zurückfahren, um Australien oder Neuseeland zu erreichen. Das ist noch ein wunder Punkt in unseren Verkehrsverhältnissen.“
„Ich würde ein Segelschiff nehmen“, fiel der Kapitän der ›Denderah‹ ein, die gerade im Hafen lag und ›heimwärts‹ bestimmt war. „Draußen liegt ein feiner Blankeneser Dreimaster, der nach Sidney will. Reden sie doch ein Wort mit dem Kapitän. Seegewohnte Passagiere nimmt er vielleicht mit.“
„Na, ich weiß doch nicht ...“, sagte der Agent, wurde aber in seiner Rede von einem jungen Hamburger unterbrochen, der atemlos in die Bierhalle stürzte und rief:
„Draußen liegt ein amerikanischer Vergnügungsdampfer! Alles machen uns die Yankees nach. Kaum haben unsere großen Reedereien damit angefangen, da kommt auch schon der Amerikaner und lässt auch solche Luxusdampfer laufen. Nur, dass es mit der Aufmachung ein wenig windig ist. – Ich war eben an Bord ...“
„Wohin geht denn die Vergnügungsreise?“, unterbrach ich den Wortschwall.
„Nach den Südsee-Inseln, Australien, was weiß ich!“
„Donnerwetter!“, rief ich aufspringend. „Das wäre ja etwas für mich. An wen muss ich mich da wenden. Wie heißt der Agent?“
„Hm – glauben sie, dass Sie das aushalten? Vier bis fünf Wochen mit den Yankees beiderlei Geschlechts auf dem langweiligen Pazifik zu leben? – Übrigens fragen sie beim amerikanischen Konsul an. Da steht er gerade an der Bar und nimmt seinen Whisky mit Soda ...“
Der junge Landsmann sprach noch weiter, als ich schon mit dem mir bezeichneten Herrn verhandelte.
„Mit dem ›Washington‹ wollen sie nach Australien?“ fragte der Konsul, indem er mich mit kritischem Blicke musterte. „Das wird viel Geld kosten, denn wir müssen von Ausländern natürlich den Überfahrtspreis erheben, den unsere Dampfer von hier nach Frisko und weiter nach Auckland nehmen. – Es ist wegen der Konkurrenz. Die Vergnügungsdampfer dürfen unseren anderen Linien keine Passagiere wegnehmen. Fair play, you know?“
„Das begreife ich alles, bester Herr. Aber ich mache im Auftrage eines hervorragenden wissenschaftlichen Institutes der glorreichen Vereinigten Staaten eine Forschungsreise. Und da auch Engländer nach Neuseeland unterwegs sind, möchte ich denen den Rang ablaufen und Galveston die ersten Berichte sichern ... Sie verstehen ...“
„Aoh, wenn das so ist, dann wird der Kapitän mit sich reden lassen. – Sie haben doch Papiere von der Universität?“
„Hier sind sie, Herr Konsul!“
„Well! Kommen sie heute Abend zu mir. Ich werde Ihnen Nachricht geben. – Hm, also Engländer wollen auch die Veränderungen im Gebiete des ... wie nannten sie doch das Ding da? ...“
„Des Rotomahanasees ...“
„Na ja, das wird der Kapitän wissen! Also die wollen das auch durchforschen und sind schon unterwegs?“
„Sie sind im Begriff abzureisen. Wenn mich der ›Washington‹ mitnimmt, sichern wir den Vereinigten Staaten die ersten Berichte.“
An unseren Tisch zurückgekehrt, ging das Fragen los. Nicht direkt, aber auf Umwegen wollte der Kosmosagent gern wissen, ob er Gefahr liefe, seinen Passagier zu verlieren.
„Der Amerikaner wird keine Passagiere von hier mitnehmen, nicht wahr? Ich las die Absage auf seinem Gesicht.“
„Nicht doch! Ich hoffe, morgen an Bord gehen zu dürfen. Es sind nur noch Formalitäten zu erfüllen.“
„Ja, ja, die hiesigen Behörden sind streng. Nicht jeder Dampfer kann hier so ohne weiteres Passagiere mitnehmen.“
„Möchte wissen, wer mir das verbieten will?“, fragte der Kapitän.
„Schauen wir uns den Dampfer in der Nähe an, meine Herren“, schlug Köhler vor. „Mir als chilenischen Offizier wird man es nicht abschlagen, die Einrichtungen an Bord in Augenschein zu nehmen.“
Außer mir folgte keiner der Anwesenden der Aufforderung. Unterwegs fragte mich mein Begleiter nach dem Papier, das ich dem Konsul ausgehändigt hatte.
Ich musste lachen.
„Wenn Sie mich nicht verraten, sage ich es Ihnen. Ich habe den guten Mann ein wenig verkohlt. Ich reise im Auftrage der Universität in Galveston nach Neuseeland, um dort die geologischen Veränderungen festzustellen, die bei dem jüngsten Erdbeben in dem berühmten Becken der Taupozone stattgefunden haben. – Nun habe ich als Grund meiner Eile angegeben, dass auch von England aus Gelehrte aufbrechen, um dasselbe zu untersuchen. Wenn nun Amerika zuerst da ist, dann hat dieses Land auch die ersten Berichte ... Ich spekulierte dabei auf den Nationalstolz der Yankees.“
„Wann sind denn die Engländer abgereist?“
„Was weiß ich! Ich habe keine Ahnung, ob überhaupt jemand dorthin reist. Es ist ja eine englische Insel, dieses Neuseeland, und es wird nicht an Männern in Auckland fehlen, die das feststellen. – Für mich handelt es sich darum, von hier fortzukommen, und das hoffe ich zu erreichen.“
„Das haben sie gut gemacht,“ lachte Köhler. „wenn Sie den Engländer gegen die Amerikaner ausspielen, dann gewinnen Sie die Partie.“
Am nächsten Tage wurde ich feierlich an Bord des Dampfers ›Washington‹ empfangen. Ich sage feierlich, denn gegen die Regel auf solchen Dampfern standen der Konsul, der Kapitän, ein paar Offiziere, der Doktor und eine Anzahl von Herren und Damen oben an der Treppe und begrüßten den „berühmten“ Forschungsreisenden in ihrer Mitte. Ich bekam eine sehr gute Kabine und erfreute mich während der ganzen Reise bester Bedienung und größter Zuvorkommenheit aller Mitreisenden, besonders der älteren Damen. Alles das, was ich in den ersten sechs Bänden dieser „Erlebnisse“ niedergeschrieben habe, musste ich erzählen. – Allabendlich umgab mich ein wissensdurstiger Kreis, an den sich, nach verschwinden der alten Damen, die Schiffsoffiziere anschlossen. Dann allerdings wechselte das Thema und man vertiefte sich in Gespräche, die besser zum „Whisky mit Soda“ passen.
Juan Fernandez, die Robinson-Insel, oder, wie sie offiziell in den chilenischen Karten heißt, „Mas a tierra“ war unser erster Haltepunkt. Schon am Tage vorher hatte fast jeder der Passagiere das bekannte Buch von Defoe „Robinson Crusoe“ in der Hand und las eifrig die Abenteuer des armen Matrosen nach, damit man nachher auch alle die Orte kennen lernte, an denen sich diese und jene Begebenheit abspielte. Dass ich dabei von allen Seiten mit Fragen bestürmt wurde, brauche ich kaum zu erwähnen. Alle Proteste, dass ich die Insel nie besuchte, fielen nicht ins Gewicht. Ich musste eben alles wissen. – „Wozu sind Sie denn Forschungsreisender.“ Mit Mühe nur konnte ich mich der Aufforderung, den verschiedenen Gruppen als Führer zu dienen, entziehen. Zum Glück gab es unternehmungslustige Eingeborene, die sich gern ein paar Dollars verdienten. Unter deren Leitung verteilten sich die wissbegierigen Passagiere auf der Insel.
Obwohl auch bei uns in Deutschland fast jeder Schüler seinen Robinson verschlungen hat, herrscht doch allgemeine Unkenntnis über die Insel selbst, deren Einwohner und sogar deren Lage. Einige Worte darüber sind daher hier am Platze.
Die aus mehreren Inseln bestehende Gruppe liegt etwa vierhundert Seemeilen vom chilenischen Festlande entfernt im Stillen Ozean. Sie besteht aus den beiden größeren Inseln Mas a tierra (Mehr beim Festlande) und Mas a fuera (Mehr draußen), sowie auch einigen kleineren Inseln. Bewohnt ist nur Mas a tierra, deren Hafenstadt mit dem Namen Juan Fernandez bezeichnet wird. Für uns Deutsche hat die Inselgruppe ein größeres Interesse, weil hier in der Bucht der kleine Kreuzer ›Dresden‹ gegen alles Völkerrecht im Weltkriege von den Engländern in den Grund geschossen wurde, und weil die Bewohner der Insel in der Mehrzahl – Deutsche sind. Im Jahre 1867 siedelten sich sechzig sächsische Kolonisten auf der Insel Mas a tierra an. Sie schufen aus dem damals wild verwachsenen Lande ein wahres Paradies. Leider verfielen auch sie dem alten Fehler der Deutschen. Sie vermischten sich rasch mit den anwesenden und nachfolgenden Chilenen. Obwohl in der Mehrzahl, verzichteten unsere Landsleute gar bald auf ihre Muttersprache und nahmen dafür das Spanische an. Zwanzig Jahre später, als ich mit dem ›Washington‹ die Insel besuchte, sprachen nur noch die älteren Leute, die ersten Ansiedler, deutsch, oder richtiger ein spanisch anmutendes Sächsisch. Unser altes Nationalunglück! Über unserer Sucht nach dem Fremdländischen vergessen wir unsere eigene Sprache und unsere deutsche Eigenart – wie wir es ja leider täglich in unserem eigenen Vaterlande wahrnehmen können!
Das für die Reisegesellschaft auf dem ›Washington‹ Interessanteste war natürlich die Höhle, in der jener schiffbrüchige Matrose Selkirk vier Jahre lang gehaust hat. Auch ich besuchte sie. Der Weg dorthin führt über üppige Wiesen, auf denen unter der Obhut blauäugiger, kleiner Hirten, die auf deutsche Anrede spanisch antworteten, Kühe und kleine Pferde weideten. Sanft ansteigend gelangt man aus dem Tal in einen dichten, subtropischen Wald, in dem Farnbäume, Myrthen und großblätterige Tropenpflanzen unter riesigen, immergrünen Bäumen oft undurchdringliche Dickichte bilden. Große Taubenvögel streichen durch die Wipfel. Rascheln im Gebüsch deutete auf die Anwesenheit von Vierfüßern.
Hat man die Höhe erklommen, so bietet sich dem Auge ein erfreuender Rundblick über die Insel und das Meer. Von Norden bis Nordosten erheben sich ausgedehnte Wälder. In der entgegengesetzten Richtung dagegen bieten kahle, schroff zum Meere abstürzende Felsen Millionen von Seevögeln Nistgelegenheit. – Vom Höhenzuge abwärts läuft ein kaum wahrnehmbarer Pfad in eine Schlucht, die mit dem Meere in Verbindung steht. Sechzig Meter vom Strande entfernt, dessen Einbuchtung noch heute den Namen „El Puerto del Ingles“ führt, liegt die Höhle. Ein hohes, gewölbtes, nur zwei Meter tiefes Felsenloch, das nichts Sehenswertes bietet. Im Gegenteil. Es schien mir eher als eine Ablagerungsstätte für allen möglichen Unrat zu sein. – Die Amerikaner allerdings bestaunten diese Öffnung und gingen an der Hand des Buches gewissenhaft bis zu der Stelle, wo das Schiff seinen Untergang gefunden haben soll und wo der junge Seemann dann später seine ersten Balken behauen hat. – Nachdem in mehrstündigem Bewundern auch der kleinste Stein vor den wissensdurstigen Augen vorübergerollt war, griff jeder ein.
Stück Holz, eine Muschel, einen Stein auf – zum Andenken an die Robinson-Insel!
Mit der sinkenden Sonne verließ der ›Washington‹ die Insel. Das Wetter war umgeschlagen und die See begann sich mit „Katzenpfötchen“ zu schmücken. So nennt man die kleinen Schaumköpfe, die bei auffrischenden Winden sich auf den Wellen des Ozeans bilden. Als wir an den steil ins Meer abfallenden Klippen vorüberdampften, kam alles an Deck und bewunderte das herrliche Schauspiel, das die sich an den Klippen brechenden Wellen boten. Die See phosphoreszierte stark. Als dunkelgrün schillernde Masse rollte die heranstürmende Woge dem Lande zu. Dort, wo der Strand seicht war, verlor sich das Wasser als breites Band von Goldschaum in der Dunkelheit. Traf es aber auf die starren Felsen, dann schoss eine Funkengarbe in goldgrün auseinanderstäubendem Regen bis hoch hinauf in die grauen Zacken der Insel und entlockte den Zuschauern begeisterte Rufe des Erstaunens und der Bewunderung. Das prachtvolle Schauspiel ließ es die Mehrzahl der Fahrgäste übersehen, dass sich die Besatzung des Schiffes in etwas überstürzter Weise mit den auf Deck lose herumliegenden Gegenständen und deren Bergung beschäftigte. Mich veranlasste diese ungewöhnliche Geschäftigkeit, mich an das Navigationszimmer heranzuschlängeln und einen Blick auf das Wetterglas zu werfen. Zu spät bemerkte das der auf der Brücke diensttuende zweite Offizier. Er legte mir Verschwiegenheit ans Herz.
„Warum sollen wir den Passagieren vorzeitig Mitteilung von dem machen, was zu erwarten steht?“, fragte er.
„Sehr recht. Sie merken es ohnehin früh genug, wenn ihnen der Sturm seinen Morgengesang bläst, Wann erwarten sie das Wetter?“
„Die See läuft jetzt schon auf. In zwei bis drei Stunden werden wir die Kajütstüren von außen verschließen. Sie wissen ja, wie unangenehm es ist, wenn bei schlechtem Wetter die Passagiere frei herumlaufen dürfen. Und erst unsere ... na, ich will mich nicht weiter aussprechen!“
„Kenne das, lieber Freund. Aber ich als Mann vom Fach bin doch vom Einsperren ausgeschlossen, oder ...?“
„Bedaure, aber sie sind Passagier und Ausnahmen dürfen wir hier nicht machen.“
„Auch nicht, wenn dringende Gründe dazu vorliegen?“
„Was wären das für Gründe?“
„Nun, wenn ich zum Beispiel eine eben angebrochene Flasche besten Whisky, echten Monongahela, besäße, die ich nur in Ihrer Gesellschaft, also in Ihrer Kabine, trinken möchte ...“
„Dann allerdings dürfen Sie sich unter meinen Schutz stellen“, lachte der Offizier verständnisvoll. „Um zwölf Uhr werde ich abgelöst. Sie kennen ja meine Kammer?“
Wir hatten eben auf eine gute Fahrt angestoßen, als ein kurzer, scharfer Pfiff durch die Takelung ging. Die See war jetzt schwarz wie Tinte und rauschte hohl. Träge brachen sich die schwerfällig heranrollenden Wogen am Schiffskörper. Eine beängstigende Stille lagerte in der Luft.
„Gleich wird er da sein“, sagte ich, als ich von einem Gang an die Reling wieder in die Kammer trat. „Wollen sie nicht die Eisenplatten vor das Bullauge schrauben?“
„Oh, bis hier herauf werden die Seen nicht laufen, meinte der Offizier, der zum Erstenmale auf einem so großen Dampfer Dienst tat und die Wogen des südlichen Pazifik noch nicht kannte.
„Warten sie es ab, Mann“, erwiderte ich. „Ich habe Erfahrung in dem Wüten der Stürme hier unten. Lassen Sie alles dichtmachen, denn ich fürchte, dass auch die großen Glasfenster im „Wintergarten“ auf dem Oberdeck gefährdet sind.“
Die letzten Worte hatte der Erste Offizier gehört, der, von dem Geruch angelockt, seine Nase in die Kabine steckte.
„Eben gab ich den Befehl dazu“, sagte er. „Ich denke, wir werden in den nächsten vierundzwanzig Stunden nicht viel zu essen und zu trinken bekommen ... Und dabei ist mir schon jetzt ganz trocken im Halse ...“
„Ich verstehe Ihren Kummer, Mate“, erwiderte ich lachend und reichte ihm ein gefülltes Glas, „wenn Sie dienstfrei sind, berichten Sie wohl, was in Ihrer Wache vorgefallen ist.“
„Hm, hält das so lange vor?“, fragte er, indem er die Flasche gegen das Licht hielt.
„Nee, aber wenn sie mir den Steward mit einer neuen Flasche hierherschicken, bevor das Deck unter Wasser steht, dann sind Sie sicher, dass noch etwas da ist.“
Der Sturm setzte mit gewaltiger Kraft ein. Er warf den großen Dampfer auf die Seite und hielt ihn in der schrägen Lage so fest, dass man hätte glauben können, er wolle sich nie wieder aufrichten. Aber das gibt es natürlich nicht. Über einen gewissen Punkt hinaus kann er nicht gedrückt werden. Das aber wussten die plötzlich unsanft aus ihren Betten geschleuderten Vergnügungsreisenden nicht. Man hörte vereinzelte Rufe. Herren versuchten auf das Oberdeck zu gelangen. Da sie aber überall nur verschlossene Türen fanden, begannen sie ihre Kaltblütigkeit zu verlieren und aus den Rufen wurden Flüche, untermischt mit Klopfen und Poltern. Das machte natürlich die Damen nervös. Und während draußen die Windsbraut heulend über die See fegte, entstand in den Kabinengängen ein Lärm, der selbst den Sturm übertönte.
„Herr des Himmels, ist das eine Gesellschaft!“, rief ich aus und schenkte dem Offizier das Glas voll. „Gehen sie doch hinein und stiften sie Ruhe, sonst geschieht ein Unglück!“
„Das ist Sache der Stewards! Wenn ich hineingehe – und das kann nur durch die Schottentüre geschehen, die den untern Kajütengang gegen das Zwischendeck abschließt – dann zwingt man mich, ihnen diesen Ausgang freizugeben ... nee, dann ist es schon besser, sie schreien sich heiser, sie hören dann von selbst auf!“ „Aber die Angst kann unheilvolle Folgen nach sich ziehen ...“
„Dafür ist der Doktor da“, erwiderte kaltblütig der Offizier.
Darauf ließ sich nichts erwidern. Als jedoch der Sturm an Stärke zunahm und das Schiff in der kochenden See, wie ein Kork herumgeworfen wurde, entschloss ich mich, in den Kajütssalon zu gehen und den geängstigten Reisenden Mut zuzusprechen. Ich ließ mich zu der nur der Mannschaft bekannten Tür geleiten. Nachdem man mir versprochen, mich um vier Uhr wieder herauszulassen, schlüpfte ich in den zum Glück ziemlich düstern Kabinengang und stand wenige Minuten später mitten unter den im großen Speisesaal versammelten Reisenden.
Der Anblick dieser angstverzerrten Gesichter, all' dieser Menschen in einer Kleidung, deren Unzulänglichkeit nur mit der Todesangst entschuldigt werden konnte, entlockte mir ein lautes Lachen. Ich konnte nicht anders, ich musste wirklich hell herauslachen. Dieser Ton wirkte indessen Wunder. Die Angstrufe verstummten. Alles blickte auf mich und mein vor Heiterkeit strahlendes Antlitz. Eine Dame, die mich besonders auszeichnete, eilte auf mich zu und rief in vorwurfsvollen, weinerlich hervorgestoßenen Worten:
„Oh, Mister Emmerich, wie können sie angesichts eines vielleicht nahen Todes noch lachen?“
„Sie irren, Miss Price, ich habe durchaus keine Selbstmordgedanken. Ich befinde mich äußerst wohl auf dieser Welt. Besonders seit einigen Tagen, wo mir ein gütiges Geschick eine so liebenswürdige Dame in den Weg geführt hat.“
Dabei küsste ich ihr, gegen alle Regel der Amerikaner, leicht die Hand.
„Lassen Sie das, Sir,“ entgegnete sie streng, „wer weiß, wie nahe wir dem Untergange sind!“
„Meinen Sie dieses Schiff, Miss Price?“
„Natürlich, was denn sonst?“
„Das geht nicht unter, verehrte Dame!“, rief ich mit einer Bestimmtheit, die ihren Eindruck nicht verfehlte. „Unser ›Washington‹ wird doch das bisschen Sturm noch vertragen können. Haben Sie so wenig Vertrauen in die Schiffbaukunst Ihrer Landsleute?“
„Aber sehen Sie doch, wie er sich auf die Seite legt. Einmal muss er doch umfallen!“ jammerte eine alte Dame.
Wieder lachte ich ungebührlich laut.
„Gerade das Überlegen nach einer Seite verhindert ein Kentern. Die Schiffe sind so gebaut, dass sie nur bis zu einem gewissen Grade auf die Seite gedrückt werden können. Dann müssen sie sich wieder aufrichten ...“
„Aber man weiß doch von gekenterten Dampfern!“ warf ein Herr ein.
„Frachtdampfer – ja. Wenn denen die Getreide- oder Kohlenladung losschlägt und nach einer Seite schießt, dann mag es vorkommen. Aber unser ›Washington‹ mit seiner schönen Ladung kann nicht kentern. Beruhigen Sie sich nur. Der Sturm braust vorüber und nachher freuen Sie sich, dass Sie auch einmal das Meer von seiner unangenehmen Seite kennen lernten.“
„Aber dass man uns nicht auf Deck lässt! Wenn etwas passiert, können wir uns ja nicht einmal retten!“
„Eben deshalb schließt man uns ein. Der Kapitän weiß es so gut wie ich und jeder Seemann, dass dem Schiff keine Gefahr droht. Um uns Reisende vor Schaden zu bewahren, schließt er uns ein ... Nur finde ich es unrecht, dass man den Damen keinen Tee serviert. Ich werde mich sofort auf die Suche nach dem Steward begeben ... Nehmen Sie ruhig Platz und unterhalten Sie sich inzwischen.“
Diese Unterhaltung hatte wirklich die weniger ängstlichen Gemüter beruhigt. Einige Damen bemerkten, dass ihre Nachtgewänder doch nicht ganz salonfähig waren und eilten in ihre Kabinen, um in passenderer Kleidung in den Saal zurückzukehren. Andere erkundigten sich, ob man sich auf das Bett legen könne, ob man auch ganz sicher sei ...
Ich fand die Türe im Schott zur angegebenen Stunde wieder geöffnet und berichtete dem inzwischen eingetroffenen Ersten über meine Mission im Saal.
„Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie wieder hinübergingen“, sagte er ernst. „Das Wetterglas fällt immer noch, und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir beidrehen müssen. Dabei kann es krachen und wenn dann einer da ist, der zur rechten Zeit beruhigend wirkt, dann ist viel gewonnen. Besonders auf dieser ersten Fahrt, die wir als „Vergnügungsdampfer“ machen, darf keine Panik aufkommen, sonst geht uns kein Mensch mehr mit.“
„Warum gehen sie denn gegen die See an? Es ist doch einerlei, wo sie in der Südsee zuerst landen. Wenn sie mit dem Wind laufen, arbeitet das Schiff doch nicht so schwer.“
„Das wohl. Aber unser Kapitän hat einen Kopf für sich ...“
„Na ja! Dann allerdings begreife ich es. – Übrigens werde ich mein Bestes tun. Sorgen Sie nur für ein reichhaltiges Frühstück, denn beim Essen lässt sich überzeugender sprechen.“
„Das glaube ich weniger!“, erwiderte er lachend.
„Warum werden dann alle wichtigen Geschäfte und Verhandlungen, die einschneidende Wirkung haben sollen, durch ein besonders reiches Mahl unterbrochen? Doch nur, um, bewusst oder unbewusst, durch den Magen auf die Stimmung und Urteilskraft der Geladenen einzuwirken!“
Eine donnernde See unterbrach unser Zwiegespräch. Sie kam brüllend von vorn über die Back, überflutete schäumend das Vorderschiff und brach sich krachend an dem hohen Decksaufbau, wo eine ungeschützte Scheibe dem Druck nachgab und nach innen fiel, wo sie zersplitterte. Ein gellender Schrei aus zahlreichen Kehlen folgte dem Unfall.
„Eilen Sie, bitte,“ drängte der Offizier. „Es wird vielleicht noch besser kommen. Tun sie Ihr Möglichstes ...“
„Vor allen Dingen schicken sie das Frühstück ... und zu meiner Gesellschaft den Doktor.“
„Der ist seekrank. Aber das Frühstück wird besorgt.“
Im Speisesaal war wieder alles in heller Aufregung. Kaum erblickte mich Miss Price, als sie auch schon auf mich zustürzte:
„Oh Gott, wo waren Sie denn soeben bei dem Unglück ...?“
„Was ist denn vorgefallen?“, fragte ich erschreckt. „Ich weiß ja gar nichts von einem Unglück.“
„Haben Sie denn den Krach nicht gehört ... und das Klirren? Da muss doch ein großes Loch in die Schiffswand geschlagen sein.“
„Im gewissen Sinne haben Sie recht“, antwortete ich. „Allerdings war das Loch schon da und zwar verglast. Als ich unvorsichtigerweise, und gegen die Vorschrift, mein Kabinenfenster öffnete, schlug mir die See die Scheibe ein und – wie Sie sehen – bekam ich ein wenig Seewasser mit.“
„Ach ja, Sie sind ja ganz nass! Und es war wirklich nur eine Scheibe? ... Kein Leck ...?“
Mein Lachen brachte wieder einige Beruhigung hervor. Das Erscheinen der Aufwärter lenkte auch das Gespräch in andere Bahnen und zehn Minuten später war der größte Teil der Passagiere mit dem Verzehren des Frühstücks beschäftigt.
Mitten in dieser Beschäftigung riss mich ein Laut aus meiner Ruhe, der den andern entgangen war. Ein Signal wurde von der Kommandobrücke aus zur Maschine gegeben. Dieses Klingelzeichen während der Fahrt auf hoher See hat immer etwas Beunruhigendes. Meist handelt es sich um Manöver zur Verhütung eines Zusammenstoßes oder um plötzlich hereingebrochenen Nebel, der ein Langsamgehen der Maschine erforderlich macht. In allen solchen Fällen ist der Fachmann gern auf Deck. Ich erhob mich daher und ging in den unteren Kajütsweg, um auf die mehrerwähnte Art zu den Offizieren zu gelangen. Der Ausgang war jedoch verschlossen. Es gelang mir aber durch die Küche in den Wohngang der Heizer zu kommen und dort erblickte ich eine dicke weiße Wand, die durch den abflauenden Sturm zu einer wild durcheinanderwirbelnden Masse aufgebaut, sich schwer vor uns hinschob. Da ich keinen Sirenenton vernahm, erkundigte ich mich bei einem Maschinisten, wie lange denn der Dampfer schon in dem Nebel säße.
„Oh, erst eine Viertelstunde“, erwiderte dieser sorglos.
„Und da gebt Ihr kein Signal mit der Sirene?“, fragte ich verwundert.
„Das ist hier nicht nötig“, erwiderte der hinzutretende Erste Maschinist. „In dieser Gegend sind wir ganz allein. Da brauchen wir nichts zu befürchten. Die Passagiere sind durch den Sturm schon nervös genug. Die brauchen nicht noch aufgeregter zu werden.“
„Aber es sind doch Segler unterwegs. Wie leicht könnte man da einen armen Teufel in den Grund bohren. Die Passagiere müssen sich eben damit abfinden.“
„Unser Kapitän denkt da anders. – Er wird schon das Richtige anordnen,“ entgegnete der Maschinenmann, indem er unter leichtem Gruße seine Kammer aufsuchte. Eben wollte ich mich zu dem Offizier begeben, um ihm einen Guten Morgen zu wünschen, als ein seltsamer Ton durch die von der Dämmerung heller gefärbte Nebelwand drang. Erschreckt blieb ich stehen und blickte zur Kommandobrücke empor, wo der Kapitän neben dem Zweiten und Vierten stand und sich lebhaft mit diesen unterhielt. Durch Zeichen wollte ich die Aufmerksamkeit der Offiziere auf den Laut lenken, da ertönte wiederum das Geräusch. Diesmal war es unverkennbar der Ton eines von Menschen geblasenen Nebelhornes. Es war so dicht bei uns, dass ich förmlich das, was nun kommen musste, im Voraus empfand und mit einem lauten „Achtung“ die Treppe zur Brücke hinaufsprang.
Auch denen auf der Brücke war der Schrecken in die Glieder gefahren. Der Kapitän riss an der Leine, um die Sirene anzuschlagen, sie war aber so voll Wasser, dass kostbare Sekunden vergingen, bevor der heulende Ton zur Geltung kam – und da war es zu spät! Ein Ruck ging durch das ganze Schiff. Ein Krachen und Splittern, untermischt mit menschlichen Hilferufen. Zu beiden Seiten unseres Dampfers tauchten blitzartig Masten und Segel auf. Der Dampfer bäumte, wie wenn er über ein welliges Gelände glitte. Die Schraube klapperte ... dann verhüllte die weiße Wand mitleidig die entsetzliche Katastrophe, die durch die Schuld eines gewissenlosen Schiffsführers über brave Seeleute hereingebrochen war.
Natürlich folgte auf den ersten Schrecken das Signal, die Maschine zu stoppen.
„Boote aussetzen!“ entfuhr es mir unwillkürlich und fast unbewusst sprang ich zum nächsten Davit, um die Taue zu lösen. Aber das erwartete Kommando von oben blieb aus. Auch die wenigen Matrosen, die der blitzartig erfolgten Kollision zugesehen, rührten keine Hand. – Ich eilte wieder zur Brücke. Da trat mir der Zweite Offizier entgegen. Mein erstauntes Gesicht traf doch wohl sein Gewissen. Er eilte zurück und sprach einige Worte mit seinem Vorgesetzten. Dann kam ein Befehl:
„Boot Nr. 4 zu Wasser. Rasch – ruft die Mannschaft!“
Das Kommando war ungeschickt gegeben, weil es Verwirrung anrichten musste. Auf großen Personendampfern hat jedes Boot, für den Fall einer Katastrophe, seine vorher bestimmte Besatzung. Trifft ein Unfall das Schiff, so dass die Rettungsboote ausgesetzt werden müssen, so begibt sich jeder, der zur Mannschaft gehört, zu der ihm bekanntgegebenen Nummer, ohne sich um die Kameraden zu bekümmern. Die Passagiere finden in ihren Kabinen ebenfalls eine kleine Tafel, auf der es heißt: „Im Falle eines Alarms begeben sie sich zum Boot Nr. ...“ In diesem Falle nun rannte die Deckswache kopflos umher und es vergingen fast zehn Minuten, bevor der Erste Offizier die des Segelns und Ruderns kundigen Leute zusammengebracht hatte. Der Dritte Offizier wurde mit dem Befehl über die Rettungsmannschaft betraut und gab sich alle Mühe, das Boot über Bord und zu Wasser zu bringen. Bei dieser Gelegenheit zeigte es sich, wie unsinnig es ist, die Bootstaue und Blöcke dick mit weißer Farbe zu streichen. Bevor es gelang, die steifen Taue überhaupt zu lockern und sie dann durch die, von der in zehnfacher Schicht aufgetragenen, jahrealten Farbschicht unbeweglich gemachten Blöcke zu ziehen, verging eine weitere Viertelstunde ...
„Die Mühe können sie sich sparen“, rief ich, innerlich empört, dem jungen Schiffsoffizier zu. „Was nicht beim Übersegeln ertrunken ist, hat die See längst verschlungen.“
Er gab mir keine Antwort, aber sein Blick sagte mir, dass er meine Ansicht teilte. Auch der Zweite schüttelte bedauernd den Kopf, als er den Kollegen mit der ungeübten Mannschaft im Nebel verschwinden sah. Ich fürchte, dass wir auch das Boot nicht mehr wiedersehen,“ sagte ich, zu dem Offizier gewendet. „Die Menschen verstehen ja nicht einmal zu rudern, wie wollen sie das Boot gegen die See halten?“
„Ja, das ist ja das Schlimme auf den modernen Dampfern, dass sie keine Seeleute mehr haben. Sieben Achtel unserer Mannschaft stammt aus allen möglichen Landberufen. Wirkliche Seeleute haben wir nur wenige an Bord. – Träfe uns ein Unglück, was Gott verhüten möge, so wären die meisten Boote durch die Schuld ihrer Bemannung verloren, die weder segeln, noch steuern, noch den Kompass lesen kann. – Übrigens erzähle ich Ihnen damit nichts Neues. Sie kennen das aus eigener Erfahrung.“
„Leider ja. Aber was ich heute hier sah, hätte ich doch nicht für möglich gehalten. Ich meine, dass Sie bei dickem Wetter fahren, ohne Nebelsignale zu geben. Nicht einmal der Ausguck war doppelt besetzt ... Das kostet Ihrer Gesellschaft viel Geld und dem Kapitän das Patent.“
„Der Segler gab auch kein Warnungszeichen, sonst wäre der Zusammenstoß sicher nicht erfolgt. Das mindert unsere Schuld.“
„Sie irren, Verehrtester. Der Segler gab Nebelsignale. Ich selbst habe sie deutlich gehört. Aber unser Dampfer ließ nichts von sich hören ...“
„Der Kapitän wollte die Passagiere nicht erschrecken. Es war auch nicht anzunehmen, dass sich hier gerade Segelschiffe befinden. Übrigens hatte ich die Wache. Sie werden doch Ihre Wahrnehmungen nicht weiter melden?“
„Wie wäre es, wenn Sie die Passagiere über unser Stillliegen ein wenig aufklärten. Sehen Sie, wie man die Nasen gegen die Scheiben drückt. Man könnte die Türen ruhig aufschließen. Das Wetter ist vorüber.“
Mit dieser Ablenkung wurde ich einer Antwort auf die Frage des Offiziers überhoben. Ich wollte mein Verhalten von dem Ergebnis der Rettungsexpedition abhängig machen. Keinesfalls aber wollte ich die Hand zur Vertuschung der Pflichtwidrigkeit unseres Kapitäns bieten. Noch viel weniger den Eigentümer des Seglers um seinen Anspruch auf Schadenersatz bringen. – Dasselbe sagte ich dem Ersten Offizier, der sich später zu mir gesellte und die Fragen wiederholte. – Dass ich mir damit die Freundschaft der Schiffsführer verscherzte, lag auf der Hand, obwohl sie es in ihrem Benehmen nicht zum Ausdruck brachten, während des ganzen Tages genoss ich noch die „Ehre“, von ihnen ins Gespräch gezogen zu werden, wenn es sich um nautische Dinge handelte, denn das Rettungsboot ließ sich nicht blicken, trotz wiederholter Signale mit der Sirene.
„Hoffentlich trifft Ihre Vorhersage nicht ein“, bemerkte der Zweite, als er sein Erstaunen über das Ausbleiben des Bootes immer dringlicher betonte.
„Ich möchte wissen, wie es Ihr Kamerad machen soll, um den Dampfer in dem Nebel wiederzufinden. Er weiß ja gar nicht, wo er ihn suchen soll.“
„Wir zeigen ihm unsere Lage doch mit der Sirene an. Die wird er doch hören.“
„Vielleicht. Sie wissen aber auch, wie sehr die Schallrichtung bei Nebel täuscht, wenn Sie wenigstens die ebenfalls vorgeschriebenen Signale für stillliegende Dampfer gäben – ich meine das Läuten der Schiffsglocke – dann hätte er mehr Anhaltspunkte.“
„Allerdings – ja – Sie haben recht. Der Erste hat vergessen, das anzuordnen und der „Alte“ hat sich schlafen gelegt. – Ich werde es sofort befehlen.“
Der Doktor schob sich mit dem Ersten Maschinisten neben mich an die Reling. Er schien sehr zufrieden, dass die Seekrankheit ihn nun endlich aus ihren Klauen losgelassen hatte.
„Warum mag unser Kapitän hier wohl vor Anker gegangen sein?“, fragte er seelenvergnügt. „Fürchtet er bei dem Nebel irgendwo auf den Strand zu laufen?“
Verwundert blickte ich den Frager an. War es möglich, dass jetzt, fünf Stunden nach dem Zusammenstoß, noch jemand an Bord war, der von dem Unglück keine Kenntnis hatte. Ich überließ dem Ersten Maschinisten die Beantwortung der Frage. Der aber gab so geschraubte Erklärungen, dass selbst der Arzt argwöhnisch wurde.
„Ist denn etwas passiert?“, fragte er, und man sah es ihm an, dass ein jäher Schrecken durch seine Glieder fuhr. „Der Erste Offizier sagte uns, dass wir wegen des Nebels hier liegen bleiben müssten.“
Der Maschinist schien nicht gesonnen, seinem Kameraden reinen Wein einzuschenken. Er wollte wahrscheinlich das Unglück so wenig als möglich bekanntgeben. Mir aber lag mehr der Segler am Herzen und je mehr Zeugen nachher für diesen aussagten, desto besser war es für die Geltendmachung seiner Ansprüche. Ich ließ daher die Worte fallen:
„Warum geben Sie dem Herrn Doktor keine Aufklärung, Chief?“
Ein unwilliger Blick traf mich und verlegen rückte er an der Mütze.
„Worüber soll ich den Doktor aufklären. Ich weiß so viel, wie er selbst.“
„Ist das wirklich wahr? Dann würde ich Ihnen raten, einmal die Schraube zu probieren und den Schaft nachsehen zu lassen. Wie leicht kann da etwas gebrochen sein. Oder spürten sie den Stoß nicht?“
„Was sagen Sie?“, rief der Doktor. „Haben wir auf Grund gestoßen? Sind wir gestrandet?“ Er wurde fast weiß im Gesicht.
„Ich bin mir nicht bewusst, etwas von Strandung oder Grundstoß gesagt zu haben“, erwiderte ich.
„Ach, das ist nicht der Rede wert,“ fiel nunmehr der Ingenieur ein. „wir stießen auf ein Wrack und liefen darüber hin. – Schaden haben wir nicht weiter davongetragen.“
„Wissen sie das ganz bestimmt?“, fragte ich.
„Na, ich würde es doch sofort bemerken“, erwiderte er giftig.
„Auch wenn wir stillliegen und die Maschine nicht arbeitet?“
„Auch dann!“ lautete die kurze Antwort, worauf er sich entfernte.
„Noch einen Feind!“ entfuhr es mir. Der Doktor griff das Wort auf.
„Warum sagen sie das? Die Frage konnte ihn doch nicht beleidigen.“
„Wie man's nimmt. Wenn er sich von dem überzeugte, was er sagt, dann nicht. Sonst aber kann er meine Zweifel als Hieb empfinden.“
„Was ist denn eigentlich vorgefallen? Sie scheinen mehr zu wissen, als Sie eingestehen und – hm – jenen Herrn lieb ist.
„Merken Sie das auch? Nun, ich setze voraus, dass Sie kein Interesse daran haben, Ihre Brotherren zu schädigen, was der Fall wäre, wenn die Vergnügungsreisenden das erführen, was ich mit eigenen Augen sah. – Unser ›Washington‹ hat ein Segelschiff überrannt. Boot Nr. 4 ist fort, um die etwa noch im Meere treibenden Seeleute zu retten – falls es sie findet. – Nun kehrt auch dieses nicht mehr zurück. Deshalb liegen wir hier.“
„Und die Glocke läutet man, damit das Boot weiß, wo wir liegen?“
„Nein, weil es Vorschrift ist. Nebenbei soll auch der Rettungsmannschaft ein Fingerzeig gegeben werden.“
„Warum aber diese Heimlichkeit. So etwas kann doch jedem Schiff zustoßen, wenn der andere nicht aufpasst ...“
„So etwas darf eben nicht vorkommen! Noch dazu, wenn man ein paar hundert Passagiere an Bord hat. Was würden die wohl sagen, wenn sie die Wahrheit erführen? Ich glaube, der Kapitän müsste nach Valparaiso zurückkehren und sie dort ausschiffen.“
„Aber was fällt denn Ihnen ein! Was kann der Kapitän dafür, wenn es ein gewissenloser Schiffsführer unterlässt, die vorgeschriebenen Warnungssignale zu geben und dadurch ins Unglück rennt?“
„Wenn aber der andere die Signale gab? Hörten Sie in der Nacht unsere Sirene?“
„Donnerwetter – nein! Also liegt die Schuld nicht bei dem Segler?“
„Das mögen die Gerichte entscheiden. Ich hörte das Nebelhorn des Segelschiffes und weiß, dass unsererseits keine Antwort gegeben wurde.“
„Dann allerdings begreife ich es, dass die Offiziere sich bemühen, eine von der Wahrheit abweichende Ursache zu geben. – Da bin ich ja auf einen empfehlenswerten Dampfer geraten. Von jetzt ab schlafe ich nicht mehr ruhig.“
„Gar so schlimm müssen sie das nicht nehmen. Wir lassen die Nebel bald hinter uns und dann ist keine Gefahr mehr vorhanden. Sie sind wohl noch nicht lange auf See?“ „Dies ist meine erste Reise. Genau drei Wochen bin ich ›Seemann‹“.
„Dann bewahren sie nur Ihre Ruhe und reden Sie erst wieder über das, was Sie wissen, wenn man Sie auf dem Seeamt fragt. Es kann sein, dass ich nicht gerade bei der Hand bin, wenn der Segler seine Ansprüche geltend macht. Sie teilen dem Gericht dann wohl mit, was ich Ihnen sagte.“
Fortan war der Doktor mein steter Begleiter auf Deck. Je mehr sich die Schiffsführer von mir zurückzogen, um so enger schloss sich jener an mich an – zu seinem Nachteile.