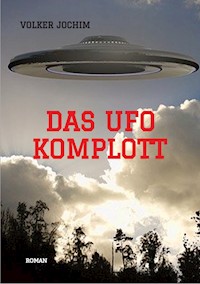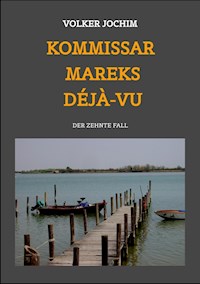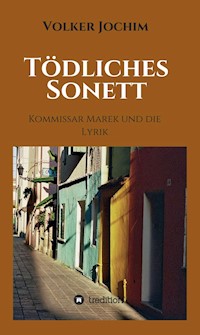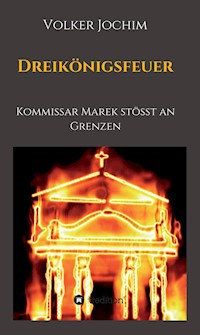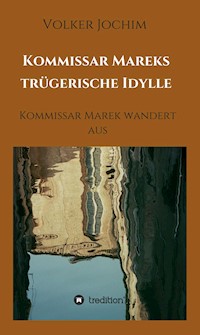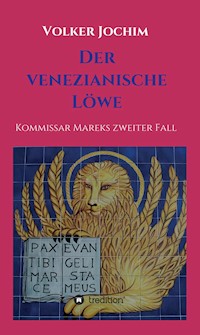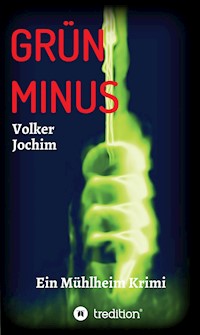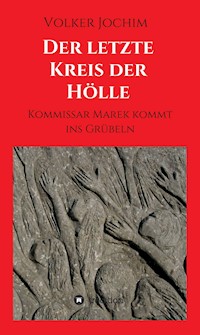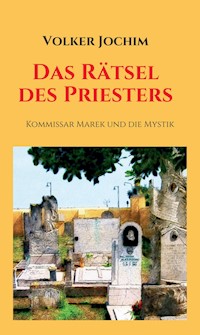3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Nacht zu Fastnachtssamstag. Eine schwarz gekleidete Gestalt mit einem auffallend weißen Gesicht eilt durch den Nebel, der von Main und Nidda kommend, in die Straßen des Frankfurter Stadtteils Nied zieht. Kurz darauf wird diese Gestalt auf der Treppe an der Wörthspitze ermordet aufgefunden. Kommissar Keller, ein kauziger, wortkarger Mann, der wegen seiner unkonventionellen Methoden bei seinem Dezernatsleiter schon lange in Ungnade gefallen ist, muss mit den Ermittlungen beginnen, bekommt den Fall am nächsten Tag aber wieder entzogen.Ein junger Hauptkommissar übernimmt und präsentiert kurz darauf einen Verdächtigen - einen Künstler, der die Tote als letzter gesehen hatte.Heimlich ermittelt Keller mit seinem Assistenten Petersen weiter und kommt zu dem Schluss, dass das Motiv dieses Mordes weit in die Zeit des zweiten Weltkrieges zurückreicht. Der Fall nimmt eine für alle völlig überraschende Wendung. Ein spannender Frankfurt Krimi mit historischem Hintergrund.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Volker Jochim
Nied Blues
Ein Frankfurt Krimi
(überarbeitete Neuauflage)
© 2015 Volker Jochim
Umschlag, Illustration: trediton,Volker Jochim (Foto)
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Die erste Auflage erschien 2012 im Projekte- Verlag Cornelius
ISBN
Paperback
978-3-7323-5872-4
Hardcover
978-3-7323-5873-1
e-Book
978-3-7323-5874-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Epilog
1
April 1944
S
2
Heute
Freitag 12. Februar
Der Literaturabend im Lokal Zur Waldlust war, trotz der späten Stunde, noch relativ gut besucht, was aber eher der Tatsache zu verdanken war, dass dieser Abend auf den Freitag vor Fasching fiel, als dass es plötzlich ein vermehrtes Interesse der einheimischen Bevölkerung an einer solchen Veranstaltungen gegeben hätte.
Trotz intensiver Unterstützung durch eine lokale Tageszeitung, und den Versuch einiger Journalisten dieser Zeitung, den Frankfurter Westen zu einem kulturellen Zentrum zu machen, blieb die Zahl der Teilnehmer an diesen regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen doch sehr überschaubar.
Das sah auch Andreas Volkmann so, der, nachdem der ortsansässige Autor seine Lesung beendet hatte, sich mit schwerer Zunge noch ein Bier bestellte. Volkmann war ein hoch begabter Kunstmaler und ein mittelmäßig begabter Dichter, was er aber natürlich völlig anders sah. Dazu litt er noch unter chronischem Geldmangel, was aber in der Hauptsache mit dem übermäßigen Alkoholkonsum und der dadurch verminderten Schaffenskraft des Künstlers zu tun hatte.
„Du hast genug, glaube ich“, meinte der Wirt, „außerdem wird es Zeit, dass du mal deinen Deckel bezahlst.“
„Sei doch nicht so spießig, oder wendest du dich wegen des schnöden Mammons nun auch gegen die Kunst des Proletariats?“
„Mein Gott“, dachte der Wirt, „jetzt fängt er schon wieder mit dieser Proletariermasche an“, und beeilte sich noch ein Bier zu zapfen, um die aufkeimende Diskussion, die zu einem Monolog geworden wäre, im Keim zu ersticken.
„Hier, das ist aber das Letzte für heute.“
„Danke mein Freund, des Volkes Dank sei dir gewiss, und meiner natürlich auch. Wenn ich erst einmal groß rauskomme, werde ich all meine Freunde am Erfolg teilhaben lassen.“
Aber auch ein Proletarier benötigt Geld zum Leben, und ohne das Geld seines Mäzens, eines extrem reichen Privatbankiers, könnte er nicht einmal die Miete für sein kleines Dachatelier unweit von hier in der Lotzstraße bezahlen.
Volkmann war Mitte vierzig, mittelgroß, von kräftiger Statur und einem durchaus nicht unattraktiven Äußeren, was aber unter seinem mehrere Tage alten Bart verborgen blieb. Seit frühester Jugend war er überzeugter Kommunist. Allerdings interpretierte er den Kommunismus nach den Lehren von Karl Marx und Friedrich Engels und nicht nach dem, was in der früheren UDSSR und ihren Bruderstaaten als solcher propagiert wurde.
„Auf die Kunst des Volkes“, rief Volkmann aus, und prostete mit seinem Glas in die Runde. Die Leute an seinem Tisch erhoben ebenfalls ihre Gläser und stimmten ein. Die einen, damit er endlich die Klappe hält, die anderen in der Hoffnung, vielleicht noch einen ausgegeben zu bekommen.
Der Wirt schaltete die Lampen über den nicht mehr besetzten Tischen aus, um an die verbliebenen Gäste ein diskretes Signal zu senden, dass er nun schließen möchte.
Langsam leerte sich nun die Gaststube, bis nur noch Volkmann und zwei Gäste, die im kleinen Hotel über dem Lokal logierten, übrig waren. Da es offensichtlich war, dass er von diesen Gästen auch nichts mehr erwarten konnte, erhob sich Volkmann und stolperte die Treppe hinunter auf die Oeserstraße. In dem Moment als er die Straße überqueren wollte, rauschte ein schwarzer, tiefergelegter Golf heran und verschwand mit quietschenden Reifen über die alte Nidda Brücke.
„Verdammter Bastard!“ schrie Volkmann ihm nach und fuchtelte wild mit der Faust in der Luft herum. „Den Hals sollst du dir brechen!“
„Wenn die Bullen hier ein Blitzgerät aufbauen würden“, dachte er, „könnten sie jeden Abend ein Dutzend Führerscheine kassieren.“ Er kramte in seinen Taschen und fand noch eine übrig gebliebene Zigarette. Gerade als er sie sich anstecken wollte, sah er auf der anderen Straßenseite eine schwarze Gestalt vorbeieilen. Zuerst glaubte er an eine Halluzination. Vielleicht sollte er doch mit der Sauferei aufhören, bevor er auch noch beginnen würde, weiße Mäuse zu sehen. Er schloss kurz die Augen, aber die Gestalt blieb real. Was aber besonders seine Aufmerksamkeit erregte, war weder der weite, schwarze Umhang, noch der seltsam geformte, schwarze Hut, sondern vielmehr das weiße, eigenartig starre Gesicht, von dem in der dürftigen Beleuchtung gelegentlich ein Glitzern auszugehen schien.
„Was für ein Bild“, dachte er, und ließ das Streichholz fallen, mit dem er sich gerade die Finger verbrannt hatte, „das müsste ich malen können.“ Sein Blick folgte der Gestalt, bis sie eilig in Richtung Alt Nied im Nebel verschwand.
***
„Der ist ja schon wieder besoffen“, dachte Vera Breuninger, als sie mit ihrem Hund an der Einmündung der Sauerstraße, fast mit dem heimwärts torkelnden Maler zusammenstieß.
Im Lokal Zur Waldlust verlöschte das Licht und die Oeserstraße lag dunkel und gespenstig im Nebel, der von Main und Nidda heraufzog. Vera Breuninger zog den Kragen ihres Mantels enger zusammen. Diese nächtliche Einsamkeit und der Nebel, der alle Geräusche verschluckte, waren ihr unheimlich, doch ihrem Hund, einer lebhaften Promenadenmischung, war das egal, er hatte auch seine Bedürfnisse. Der Hund zog an der Leine in die Richtung seines ihm vertrauten Weges zur Nidda und Vera Breuninger setzte sich in Bewegung. Auf Höhe der Nidda Schule überquerte sie die Straße und folgte ihrem Hund zum Fluss. Selbst der Spielplatz neben der Schule, auf dem sonst nachts Jugendliche unbehelligt ihr Unwesen trieben, lag still und ausgestorben in der Dunkelheit. Sie folgte ihrem Hund über den großen Platz, auf dem sich im nahenden Frühjahr wieder Karussells drehen würden, bis zur Brücke. Unter dem niedrigen Brückenbogen blieb der Hund stehen, verrichtete kurz sein Geschäft, scharrte mit den Pfoten etwas Sand darüber und zog wieder an der Leine. Kurz vor der Treppe aber, die linker Hand hinter der Brücke wieder zurück, vorbei an der kleinen, kürzlich renovierten Polizeistation, nach Alt Nied führte, blieb er plötzlich stehen und fing an zu knurren.
Vera Breuninger hatte Angst. Ihr Herz schlug schneller und trotz der nächtlichen Kälte brach ihr der Schweiß aus. So etwas tat ihr Hund normalerweise nie, nicht einmal wenn er Angst hatte. Dann klemmte er den Schwanz zwischen die Hinterbeine, ließ die Ohren hängen und verkroch sich in eine Ecke, in der Hoffnung, in Ruhe gelassen zu werden. Diese Reaktion hier war ihr neu. Er saß vor der Treppe und knurrte. Sie ließ etwas Leine nach und sofort erhob er sich, und ging, aufgeregt hin und her tänzelnd, dicht an die linke Seite gedrängt, die Stufen hinauf. Sie hatte Mühe ihm zu folgen, doch plötzlich blieb er stehen, fing wieder an zu knurren und sie stolperte über etwas, das sie in der Dunkelheit nicht sehen konnte, denn die Laterne, die diese Stiege sonst beleuchtete, war wieder einmal Opfer sinnlosen Vandalismus’; geworden. Vera Breuninger holte mit zitternden Händen die kleine Taschenlampe, die sie für Notfälle immer bei sich trug, wenn sie nachts mit dem Hund raus musste, aus der Manteltasche und schaltete sie an. Der spitze Schrei, den sie beim Anblick, der sich ihr bot, ausstieß, wurde nur von ein paar Möwen beantwortet, die weiter unten am Fluss die Nacht verbrachten.
Im trüben Schein ihrer Lampe, lag eine schwarze Gestalt auf der Treppe die sie aus einem ausdruckslosen, weißen, teils blutverschmierten, Gesicht anstarrte. Die Gestalt lag mit dem Kopf nach unten. Auf dem Kopf trug sie eine Art Dreispitz und das, worüber sie gestolpert ist, war ein in unnatürlichem Winkel ausgestreckter Arm.
3
Samstag 13. Februar
Marius Keller blinzelte in die Dunkelheit seines Schlafzimmers. Ein ekelhaftes Geräusch hatte ihn geweckt. Er sah auf das Leuchtzifferblatt seines Weckers auf dem Nachttisch. Es war fünf Minuten vor halb eins. Das Telefon, der Verursacher des penetranten Geräuschs, klingelte unaufhörlich weiter. Keller knipste die Nachttischlampe an. Sofort durchzuckte ein stechender Schmerz seinen verkaterten Schädel. Er hatte bis vor zwei Stunden noch mit ein paar Freunden in seinem Stammlokal, im Gallusviertel, gesessen, und nach einem hervorragenden Essen noch ein paar Flaschen Wein geleert. Keller hielt sich das Kissen vor das Gesicht, doch das Telefon kannte kein Erbarmen. Schließlich kapitulierte er, richtete sich langsam auf und nahm den Hörer ab.
„Na endlich Chef, ich versuche schon die ganze Zeit Sie zu erreichen“, hörte er am anderen Ende seinen Assistenten Petersen.
„War nicht zu überhören“, brummte er in den Hörer, „wehe, wenn es nichts Wichtiges ist, was ich mir eigentlich auch nicht vorstellen kann, dann kannst du schon einmal das Ave Maria beten.“
„Befehl vom Chef. Er ließ mich anrufen und mir ausrichten, ich solle Sie ausfindig machen. Das wollte er wohl nicht selbst tun.“
„Der weiß auch warum. Also was liegt an? Ist die Katze der Frau Bürgermeisterin entlaufen? Oder hat irgendjemand die Einfahrt von irgendeinem Bänker blockiert?“
„Nein, es gab einen Mord. Eine Frau wurde an der alten Nidda Brücke in Nied ermordet aufgefunden. Sie sollen sofort dort erscheinen. Ich fahre auch gleich los.“
Damit war das Gespräch beendet. Keller starrte noch eine Weile den Hörer an, den er unschlüssig in der Hand hielt, dann legte er ihn auf den Apparat zurück, erhob sich schwerfällig und ging ins Bad, in der Hoffnung, nach einer ausgiebigen Dusche wieder einigermaßen fit zu werden. Die Kopfschmerzen konnte die Dusche aber auch nicht vertreiben.
Kommissar Keller verließ seine kleine Wohnung in der Frankenallee, stieg in seinen alten Renault R16 und fuhr los.
***
Dieses alte Auto war so ziemlich das Einzige, was in seinem Leben Bestand hatte. Seit nunmehr dreißig Jahren war er bei der Frankfurter Mordkommission tätig, und das mit Erfolg, wie seine zahlreichen Auszeichnungen belegten, von denen er aber heute nicht mehr sagen konnte, wo er sie hin geräumt hatte. Irgendwann gab es dann einen Knick in seiner Lebenslinie. Sein damals neuer Chef fand seine Methoden antiquiert, Disziplinarverfahren folgten, weil er sich höchst selten an Vorschriften hielt und zuletzt wurde er von größeren Fällen ganz ausgeschlossen, und nur noch mit Kleinkram betraut, den jeder Verkehrspolizist hätte übernehmen können.
Vor drei Jahren verließ ihn dann noch seine Frau, was ihn ganz in Schieflage brachte. Gewiss sie war zehn Jahre jünger und sehr attraktiv, während er mit seinen verbeulten Baumwollhosen und dem zerknautschten Trenchcoat eher einer billigen Colombo Karikatur glich, aber irgendwann muss ja da mal etwas gewesen sein.
Auf einem Polizeiball hatte er ihr den leitenden Staatsanwalt vorgestellt, einen drahtigen Mittvierziger, der mehr Zeit im Fitnessstudio, als hinter seinem Schreibtisch zubrachte. Heute lebten sie zusammen. Offenbar hatte sie sich auf jenem Ball in diesen Schönling verliebt. Sie tanzten den ganzen Abend zusammen, während Keller die Zeit deprimiert an der Bar verbrachte. Sie tanzte leidenschaftlich gerne. Er hatte ihr aber von Anfang an klar gemacht, dass er es nicht wollte. Entweder hatte es sie damals nicht gestört, oder sie war in dem Glauben ihn ändern zu können. Er ließ sich aber nicht verbiegen.
Im vergangenen Jahr teilte man ihm mit, dass er das Mindestalter für eine Pensionierung erreicht hätte und eine Weiterbeschäftigung nicht angedacht sei. Er hatte sich nicht gewehrt und zählte seit dieser Zeit die Wochen herunter. Ende des Monats, genauer gesagt in zwei Wochen, sollte es dann soweit sein.
Einige alte Weggefährten aus besseren Zeiten, die so dachten wie er, sind ihm dennoch geblieben, und sein treuer Assistent Ralf Petersen, der trotz seiner bisweilen schrulligen Art, wie eine Klette an ihm hing. Petersen gehörte zwar mit seinen gerade einmal fünfundzwanzig Jahren zur neuen Generation der Polizei, war aber im Gegensatz zu den meisten anderen Kollegen, von dem kauzigen, introvertierten Kommissar begeistert. Selbst Warnungen, dass eine Zusammenarbeit mit Keller sich nachteilig auf seine Karriere auswirken würde, waren ihm egal.
***
Keller raste die Mainzer Landstraße hinunter und bog an der St. Markus Kirche mit quietschenden Reifen nach rechts in Richtung Alt Nied ab. In einiger Entfernung sah er im Dunst schon die Blaulichter blinken. Da er auf Anhieb keinen Platz fand, ließ er sein Auto einfach mitten auf der Straße stehen und stieg aus. Petersen kam auf ihn zugeeilt.
„Sieht übel aus, Chef. Ich habe erst einmal Polaroid Fotos machen lassen, bevor die sich alle darauf gestürzt haben.“
Die, das waren die Leute von der Spurensicherung und der Arzt.
„Sehr gut, Petersen. Sehen wir uns die Bescherung mal an.“
Vom ersten Tag an hatte Keller seinen Assistenten geduzt, aber er nannte ihn trotzdem immer nur beim Nachnamen.
Im grellen Schein der Scheinwerfer, die hier aufgebaut wurden um den Tatort zu beleuchten, sah die ganze Szenerie aus, wie aus einem billigen Horrorfilm entliehen. Keller trat vor die schwarze Gestalt, die wie hingegossen auf der Treppe lag, und um die herum die Kriminaltechniker lauter kleine Täfelchen mit Ziffern aufgestellt hatten.
„Venezianisch.“
„Was?“, fragten Petersen und der Arzt, der sich gerade an der Gestalt zu schaffen machte, unisono.
„Das ist ein klassisches, venezianisches Karnevalskostüm. Maske, Dreispitz und Umhang. Passt alles. Hallo Doc.“
„Hmm“, machte der Doc, und wandte sich wieder seiner Arbeit zu.
„Es ist halt Fasching, Chef, da wird sie auf irgendeinem Maskenball gewesen sein.“
„Gib mir mal die Fotos.“
Keller betrachtete intensiv die kleinformatigen Bilder. Dann gab er sie seinem Assistenten zurück.
„Dachte ich mir.“
„Was denn, Chef?“, fragte Petersen, der oftmals Schwierigkeiten hatte, den akrobatischen Gedankengängen seines ohnehin sehr wortkargen Vorgesetzten zu folgen.
„Sie war nicht auf irgendeinem Maskenball wie die, die hier im Saalbau stattfinden.“
Keller umrundete langsam die Leiche.
„Und wieso nicht?“, fragte Petersen verblüfft.
„Ja, wieso nicht? Das würde mich auch interessieren“, stimmte der Arzt mit ein.
„Das Kostüm. Es ist nicht nur ein Faschingskostüm. Es ist perfekt, und es ist teuer, sehr teuer. Petersen, sieh mal auf den Fotos nach, auf denen nur die ausgestreckten Arme zu sehen sind.“
Petersen beeilte sich die Fotos herauszusuchen und sah sie sich genau an.
„Ja und?“, fragte er, da er nichts Ungewöhnliches sehen konnte.
„Der Ring, den sie über dem Handschuh trägt. Der passt genau in die Zeit, aus der das Kostüm stammt, und der war bestimmt auch nicht billig. Diese Frau war garantiert auf dem Weg von oder zu einem Kostümball der besseren Gesellschaft. Du findest jetzt heraus, wo in dieser Gegend so ein Fest stattgefunden hat.“
„Respekt Keller, nur schade, dass Sie den Fall nicht übernehmen“, meinte der Arzt anerkennend und widmete sich wieder seiner Arbeit.
Kommissar Keller hatte das Gefühl, der Boden würde unter seinen Füßen weggezogen. Was war das wieder für ein linkes Spiel? Er kramte in seinen Taschen nach Zigaretten und fand noch ein zerknäultes Päckchen. Er steckte sich die letzte, verbogene Roth Händle zwischen die Lippen, ließ die leere Schachtel achtlos fallen, inhalierte tief, sah in den dunstigen Nachthimmel und seufzte. Was hätte er auch anderes erwarten können? Er war es ja seit Jahren gewohnt.
„Petersen“, rief er nach seinem Assistenten, „was weißt du davon?“
„Tut mir leid, Chef. Ich kam noch nicht dazu es Ihnen zu sagen. Wir sollten nur hierher, weil kein anderer Zeit hatte.“
„Ach so ist das. Uns schmeißen sie mitten in der Nacht raus, während die anderen morgen erst einmal ihren Rausch ausschlafen und dann ausgeruht unsere Arbeit übernehmen. Wer bekommt denn eigentlich den Fall?“
„Hauptkommissar Liebeneiner.“ Petersens Stimme klang abfällig.
„Scheiße. Wieso dieses gelackte Arschloch?“
„Wahrscheinlich denkt unser Chef, dass sein Musterschüler hier nichts falsch machen kann.“
Petersen hatte schon die gleiche negative Einstellung zur neuen Generation im Dezernat, wie Keller, obwohl es ja eigentlich auch seine Generation war.
„Dann kannst du den Fall gleich zu den ungelösten ins Archiv bringen.“
***
Peter Liebeneiner gehörte zu der neuen Generation Polizeibeamter, die ihr Jurastudium mit Auszeichnung abgeschlossen haben, und der Meinung waren, ihre Fälle nur mit der Fähigkeit tabellarisch zu denken, vom Schreibtisch aus lösen zu können. Eine Tabelle bedeutet Ordnung, eine Tabelle bedeutet Logik, und in einer Tabelle kommt ja logischerweise unter dem Strich etwas heraus. Dazu musste natürlich ein immenser Personalaufwand betrieben werden. Es wurden Teams gebildet, die nur den Auftrag hatten, den Mann hinter dem Schreibtisch mit Informationen zu versorgen. So einer war Liebeneiner. Dazu kam er noch aus sehr reichem Hause, was seiner Karriere natürlich auch noch zuträglich war. Er war über zwanzig Jahre jünger als Keller, hatte noch keinen einzigen Erfolg vorzuweisen, ihn aber in der Hierarchie schon überholt.
***
Keller schluckte seinen Ärger hinunter und warf seine Zigarettenkippe weg. Mittlerweile hatte der Arzt der Toten auch die Maske abgenommen und Keller starrte in das blutverschmierte, aber selbst im Tod noch schöne Gesicht einer jungen Frau.
„Haben Sie schon etwas, Doc?“
Der Arzt hatte sich erhoben, streifte seine Gummihandschuhe ab und wandte sich Keller zu.
„Die Schweinerei ist vor höchstens eineinhalb Stunden passiert. Die Frau ist zwischen zwanzig und dreißig Jahre alt. Ihr wurde mit einem extrem scharfen Gegenstand der Hals durchgeschnitten, eigentlich eher durchgehauen. Alles Weitere nach der Obduktion. Aber dann ist ja euer Schönling zuständig.“
„Danke, Doc. Wie meinen Sie das – durchgehauen? Mit einem Beil?“
„Nein, eher mit einem Schwert oder einer Machete, irgendeiner scharfen Langwaffe. Der Schlag kam seitlich von vorne und die Waffe wurde dann durchgezogen. Machen Sie es gut, Keller.“
Die Tote wurde nun in den bereitstehenden Sarg gelegt und zur Gerichtsmedizin abtransportiert. Nur die Kriminaltechniker hatten noch eine Weile zu tun, bis alle Spuren gesichert waren.
„Wer hat die Tote denn gefunden?“
„Eine Frau Breuninger. Sie wohnt da vorne in der Sauerstraße.“
„Was hat sie denn um diese Uhrzeit hier gemacht?“
„Sie war mit ihrem Hund unterwegs. Eigentlich hat er ja die Tote entdeckt.“
„Dann komm, wir werden ihr noch ein paar Fragen stellen müssen. Vielleicht bekommen wir ja bei ihr einen Kaffee.“
„Machen Sie doch weiter?“, freute sich Petersen, „Mit dem Kaffee wird es wohl nichts. Die Frau steht noch dort hinten.“
„Schade! Ich möchte noch so viel in Erfahrung bringen wie möglich, bevor dieser Arsch den Fall in den Sand setzt. Die Fotos bekommt er nicht, klar?“
„Klar, Chef. Welche Fotos?“
Vera Breuninger stand mit ihrem nervös zappelnden Hund in der immer größer werdenden Schar der Schaulustigen, und berichtete einigen Frauen aus der Nachbarschaft, unter deren Mantelsaum noch die Nachthemden oder Schlafanzugshosen hervorlugten, von ihrem schaurigen Erlebnis.
„Frau Breuninger? Kommissar Keller, meinen Kollegen Petersen kenne Sie ja schon. Wir hätten noch einige Fragen.“
„Ja wissen Sie, Herr Kommissar, das war so …“, fing sie ohne Umschweife an und Keller musste schmunzeln.
„Halt, halt, Frau Breuninger, könnten wir uns darauf einigen, dass wir die Fragen stellen und Sie antworten?“
Sie stoppte ihren Redefluss und sah ihn zu tiefst beleidigt an.
„Danke. Sie gingen also heute Nacht mit ihrem Hund hier spazieren …“
„Ja, das arme Vieh muss ja auch mal raus, und außer mir macht’s ja keiner, obwohl ich als erste wieder aus den Federn muss“, unterbrach sie ihn gleich wieder.
„… wann war das ungefähr?“
„Das war genau um halb zwölf“, kam es wie aus der Pistole geschossen.
„Und woher wissen Sie das so präzise? Hatten Sie auf die Uhr gesehen, als Sie das Haus verließen?“
„Gewissermaßen, ja. Bevor ich nachts aus dem Haus gehe, sehe ich immer auf mein Handy, ob es noch genug Akku hat, falls mal unterwegs was ist. Die Gegend ist ja nicht mehr die sicherste, wenn Sie verstehen?“
„Ja, ja, böse Welt“, resignierte Keller, dem mehr und mehr die Erkenntnis kam, die Frau einfach reden zu lassen. Vielleicht ergaben sich dabei noch einige, für sie später wichtige Nuancen, die sonst nicht ausgesprochen würden.
„Und auf dem Handy steht ja die Uhrzeit. Daher weiß ich das so genau. Manchmal geht das Handy auch ein- oder zwei Minuten nach, aber es ist ziemlich genau.“
„Darf ich das Handy mal sehen?“
Keller verglich die Uhrzeit auf dem Display mit seiner Uhr, einem relativ hochwertigen Chronografen, den er zum fünfundzwanzigsten Dienstjubiläum geschenkt bekam, aber auch nur, weil jeder zu diesem Jubiläum solch eine Uhr bekommt.
„Drei Minuten.“
„Was?“
„Das Handy geht drei Minuten vor.“
„Oh, dann muss meine Tochter die Uhr mal wieder stellen. Ist das jetzt schlimm?“
„Im Moment nicht, aber es könnte eventuell im Rahmen der Ermittlungen von Bedeutung sein, die genaue Uhrzeit zu kennen. Was haben Sie dann gemacht?“
Vera Breuninger sah ihn verständnislos an. Sie wurde von Kellers rapiden Themenwechsel überrascht.
„Sie verließen gegen halb zwölf, plus/minus drei Minuten, das Haus. Und dann?“, drängte er.
„Ach so, dann bin ich wie immer den üblichen Weg gegangen.“
„Und der wäre?“
„Wollen Sie jetzt jeden einzelnen Schritt von mir wissen?“
„Wenn es möglich ist, ja.“
„Also ich bin dann die Sauerstraße bis zur Oeserstraße runtergelaufen, und …“
„Rechts oder links?“, unterbrach er sie.
„Wie?“
„Ob Sie auf der rechten oder der linken Seite der Straße gelaufen sind.“
„Links. Da steht ja auch unser Haus.“
Keller ließ sich nun von Frau Breuninger den ganzen Weg, bis zum Auffinden der Leiche, beschreiben, und hörte auch geduldig ihren Ausschmückungen zu.
„Danke Frau Breuninger, wenn Sie uns jetzt nur noch sagen könnten, ob ihnen unterwegs irgendetwas aufgefallen ist, oder ob Sie jemanden gesehen haben.“
Sie dachte angestrengt nach.
„Nein, eigentlich nicht. Nur unten an der Nidda hat mal ein Reiher geschrien, aber sonst war alles totenstill. Der verdammte Nebel verschluckt ja auch jedes Geräusch.“
„Gut, nochmals vielen Dank.“
Keller und sein Assistent hatten sich schon zum Gehen abgewandt, als Frau Breuninger sie noch einmal zurück rief.
„Ich hab doch noch wen gesehen.“
Petersen zückte sofort seinen Notizblock.
„Ich weiß ja nicht, ob das wichtig ist, aber als ich in die Oeserstraße abbiegen wollte, stieß ich fast mit diesem besoffenen Kerl zusammen. Der hat nicht einmal geschaut, wo er hin läuft.“
„Natürlich ist das wichtig. Haben Sie ihn erkannt?“
„Das war dieser Maler. Muss wohl gerade aus der Waldlust gekommen sein. Da ist er immer und lässt sich volllaufen. Hält sich für einen großen Künstler.“
„Wissen Sie auch eventuell wie er heißt und wo er wohnt?“
„Ja, ich glaube er heißt Volkmann oder so ähnlich und wohnt in einer Dachwohnung in der Lotzstraße. Nummer weiß ich nicht. So jetzt muss ich aber, sonst kann ich gleich aufbleiben.“
„Haben Sie vielen Dank, Frau Breuninger. Damit haben Sie uns sehr geholfen.“
Nachdem sie mit ihrem ungeduldig an der Leine ziehenden Hund verschwunden war, blieb Keller plötzlich stehen und hielt den Kopf schräg, als wolle er in die Dunkelheit lauschen.
„Da-damdamdam-dada-die … da-damdamdamdada-die …“, intonierte er leise die ersten Takte der Vier Jahreszeiten von Vivaldi, die der leicht aufkommende Wind von irgendwo aus dem Nebel an sein Ohr dringen ließ. Petersen sah ihn entgeistert an.
„Du wirst nicht lange suchen müssen, ganz bestimmt nicht lange.“
„Was denn?“
„Na, das Kostümfest. Wo Vivaldi erklingt, wird bestimmt nicht mit einem Bierhumpen in der Hand geschunkelt. Irgendwo da unten am Main.“
„Ach so. Und nun?“, fragte Petersen.
„Jetzt legen wir uns noch ein paar Stunden aufs Ohr. Morgen, respektive später, befragen wir dann den Künstler.“
Als Keller zu seinem Wagen kam, hatte sich dahinter schon ein Stau mit laut schimpfenden Fahrern gebildet. Ein junger Polizist kam auf ihn zu.
„Herr Kommissar, wissen Sie wem die alte Karre hier gehört?“
„Das ist ein Oldtimer und keine alte Karre, mein Freund, und der Oldtimer gehört mir.“
„Oh, Entschuldigung, aber es gibt schon einen Stau bis zur Mainzer Landstraße.“
„Der löst sich auch wieder auf. Hätten Sie hier die Gaffer ferngehalten, hätte ich auch einen anderen Parkplatz bekommen.“
Keller setzte sich in seinen Wagen und ließ den Motor an. Als er an Petersen vorbei rollte, hielt er noch einmal kurz an und kurbelte das Fenster herunter.
„Petersen, können Reiher eigentlich schreien?“
4
Samstag 13. Februar
Petersen war schon wieder früh auf den Beinen. E s ließ ihm keine Ruhe, dass der Fall, der ja eigentlich schon nicht mehr ihr Fall war, von diesem arroganten Kerl übernommen werden sollte. Er parkte seinen Wagen vor dem Supermarkt schräg gegenüber dem Tatort und überquerte die Straße.
Der Nebel hatte sich fast komplett verzogen und ein paar Sonnenstrahlen versuchten verzweifelt das milchige Grau des Himmels zu durchbrechen. Um die kleine Bank vor der alten Polizeistation standen Dutzende leerer Flaschen. Scheint wohl der Treffpunkt der Alkoholiker von Alt Nied zu sein. Wie passend. Die Turmuhr der Christuskirche hinter ihm schlug zur vollen Stunde, und die ersten Hausfrauen und Rentner trafen sich vor dem Markt zum morgendlichen Plausch. Petersen sah auf seine Uhr. Vor sieben Stunden stand er noch hier, Teil eines gespenstigen Szenarios. Jetzt sah alles wieder friedlich aus, so, als wäre hier nie etwas geschehen. Die Stadtreinigung hatte auch ganze Arbeit geleistet. Nichts war mehr von dem grausamen Verbrechen zu sehen. Hier war mit Sicherheit nichts mehr zu finden, aber ihm war das egal. Keller und er hatten alles, was sie brauchten und Hauptkommissar Liebeneiner hätte ohnehin nichts gefunden, selbst wenn er darüber gestolpert wäre. Bei dieser Vorstellung hätte er beinahe laut gelacht.
Petersen ging die Treppe hinunter und an der Nidda entlang zum Ufer des Mains. Er atmete tief die kühle Luft ein und sah sich um.
„Schön hier“, dachte er, „hier könnte man es aushalten. Wie hoch hier wohl die Mieten sind?“
Petersen bewohnte zwar immer noch seine Studentenbude in der Leipziger Straße, nahe der Universität, aber das Haus wurde zwischenzeitlich luxussaniert und die Mieten hatten sich binnen zwei Jahren fast verdreifacht.
„Alles Abzocker“, dachte er wütend, „es ist doch nicht gerecht, wenn man weit über die Hälfte seines Nettogehaltes alleine nur für die Miete hinblättern muss.“
Zu seiner Linken sah er ein größeres Gebäude an der Promenade stehen, und davor ankerte ein großes, weißes Schiff. Eines wie diese Ausflugsdampfer, die ab dem Frühjahr wieder den Main hoch und runter schipperten, nur viel größer. In der anderen Richtung war bis hinunter nach Höchst nichts zu sehen.
Petersen setzte sich in Bewegung. Die Musik, die Keller gestern Nacht gehört hatte, wie hieß sie doch gleich, ach ja, Vivaldi, die musste hier aus der Nähe gekommen sein. Du musst gar nicht lange suchen, hatte Keller gesagt, und er hatte meistens Recht.
Zum Goldenen Wok stand auf dem Gebäude. Muss wohl ein asiatisches Lokal sein. Aber ob hier ein Kostümball der besseren Gesellschaft stattgefunden hatte? Petersen hegte seine Zweifel. Trotzdem inspizierte er das Gebäude, aber alle Türen waren verschlossen, und auch sonst fand er keinen Hinweis auf ein solches Fest.
Blieb noch das Schiff. Euro City stand in großen, blauen Buchstaben auf dem blütenweißen Bug. Bis zum Heck waren es bestimmt über hundert Meter.
An der Stelle, an der normalerweise die Boote des unter dem Goldenen Wok beheimateten Rudervereins ins Wasser gelassen wurden, ging ein massiver Landungssteg zum Schiff. Über den wollte Petersen gerade hinüber laufen, als er von der Brücke herab angerufen wurde.
„Das ist privat, Unbefugte haben keinen Zutritt!“
Petersen blinzelte nach oben und holte seinen Dienstausweis aus der Tasche. Dort stand ein richtiger Kapitän mit Uniform und Mütze. Er dachte, dass es so etwas nur noch im Fernsehen gibt, wie in dieser albernen Traumschiffserie.
„Kriminalobermeister Petersen, Kripo Frankfurt, ich hätte ein paar Fragen. Sind Sie der Kapitän?“, fragte er dann noch überflüssiger Weise.
„Ja, Kapitän Niemeyer von der MS Euro City. Um was geht’s?“
„Das würde ich ihnen ja gerne sagen, aber nicht auf diese Entfernung.“
„Meinetwegen, kommen Sie an Bord. Gleich vor Ihrer Nase ist der Aufgang zur Brücke.“
Als Petersen über die schmale Treppe die Brücke erreicht hatte, kam Kapitän Niemeyer ohne Vorrede gleich zur Sache.
„Erstens habe ich nicht viel Zeit. Wir müssen klar Schiff machen, denn morgen müssen wir schon in Bonn ankern. Zweitens hat niemand von meiner Crew irgendetwas verbrochen, also was wollen Sie?“
„Ich habe auch niemanden beschuldigt. Ich sammele nur Informationen. Vergangene Nacht wurde dort oben, nur einen Steinwurf entfernt von hier, ein Mord begangen ….“
„Und was haben wir damit zu tun?“ unterbrach ihn Niemeyer sofort.
„Die Person, die ermordet wurde, war auf dem Weg von oder zu einem Kostümball.“
„Na und? Wir haben Fasching. Solche Bälle gibt es doch an jeder Ecke. Ich verstehe noch immer nicht, was Ihre Fragen bezwecken sollen.“