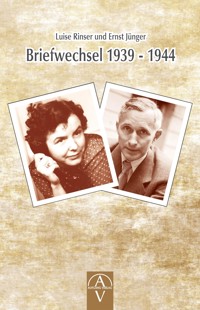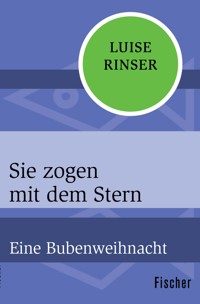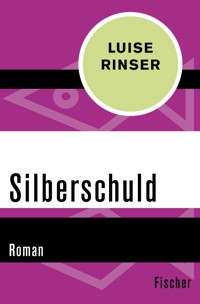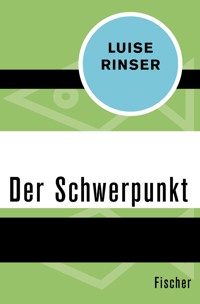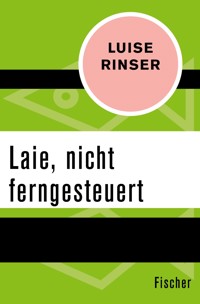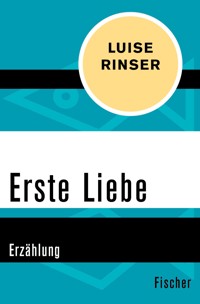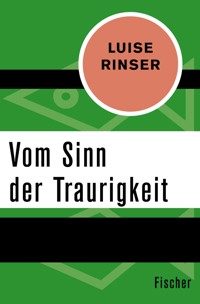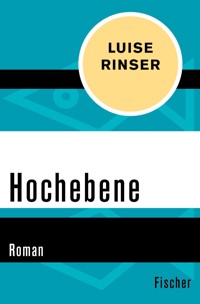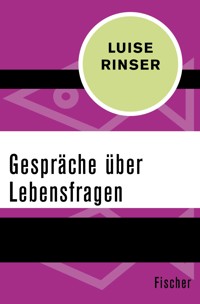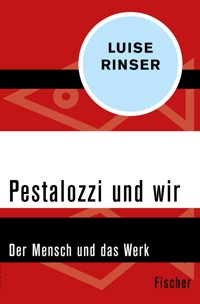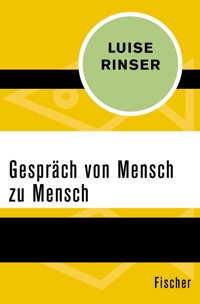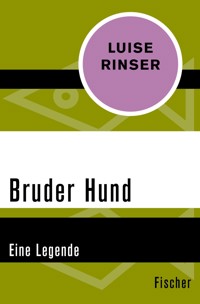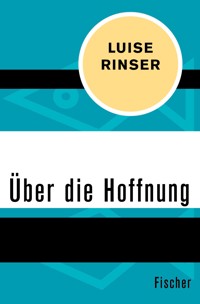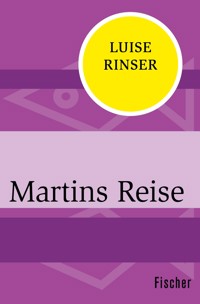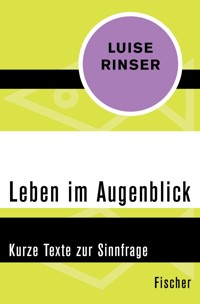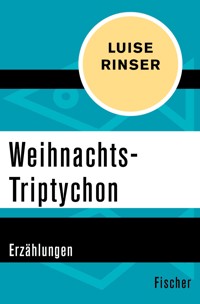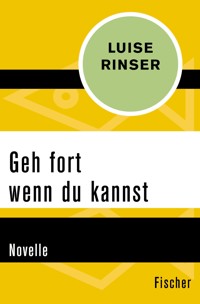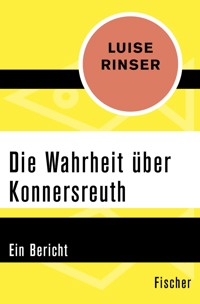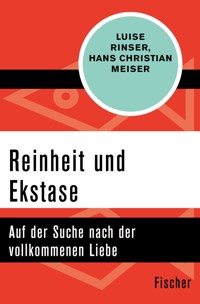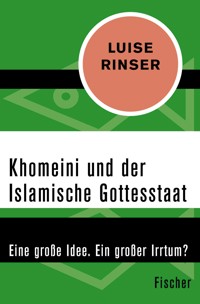9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Luise Rinser hat im Jahre 1980 eine mehrwöchige Reise nach Nordkorea unternommen. Hier ihr tief in die besonderen Verhältnisse des Landes eindringender Bericht. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Luise Rinser
Nordkoreanisches Reisetagebuch
Über dieses Buch
Luise Rinser hat im Jahre 1980 eine mehrwöchige Reise nach Nordkorea unternommen. Hier ihr tief in die besonderen Verhältnisse des Landes eindringender Bericht.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Lykurg brachte nicht nur [...]
Es können keine Generationen [...]
Vorwort
Die erste Reise
I. Anfänger-Beobachtungen
Im Flugzeug von Moskau nach Pyeongyang
Pyeongyang
Ahnen-Ehrung
II. Politischer Unterricht
III. Überraschungen
IV. Geschichtsunterricht
V. Die kleinen Könige des Landes
VI. Die nordkoreanische Frau
VII. Kunstprobleme
VIII. Die Dschudsche-Ideologie
IX. Intermezzo am Drei-Tage-See
X. Reise durchs Land
Im Kumgangsan-Gebirge
XI. Dorf-Erfahrungen
XII. Information über Selbstkontrolle
XIII. Land ohne Gott
Im buddhistischen Kloster
XIV. Wiedervereinigung: Zentralproblem
Aktuelles zur Frage der Wiedervereinigung
XV. Kim Il Sung
Die zweite und dritte Reise
I. Zum zweiten Mal in Pyeongyang
II. An der Demarkationslinie
III. Nordkoreas Gefängnisse
IV. Der Nachfolger
Ergänzung zur Frage des Nachfolgers, 1982
V. Ungemach und Ungeschick
VI. Noch einmal etwas zum »Personenkult«
Nachwort
Zum aktuellen Stand der Wiedervereinigungsfrage
Nachtrag Januar 1983
Lykurg brachte nicht nur Reden und Schriften, sondern einen konkreten, unnachahmlichen Staat ans Licht und stellte denen, welche die Möglichkeit der Existenz eines weisen Politikers leugnen, einen ganz um Weisheit bemühten Staat vor Augen.
PLUTARCH
Es können keine Generationen verheizt, aufgeopfert werden, um eine künftige Harmonie zu düngen, ein unvermitteltes Eschaton bloßer Ferne … Das Fernziel muß sich in jedem Nahziel kenntlich machen, damit das Fernziel nicht leer, abstrakt, unvermittelt ist und damit das Nahziel nicht blind, opportunistisch, in den Tag hineinlebend sei.
ERNST BLOCH
Vorwort
Als ich den ersten Teil dieses Buches schrieb, war mir nicht recht klar, welch heißes Eisen ich damit berührte. Ich wollte nichts anderes als einen Reisebericht schreiben, also aufzeichnen, was ich mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört hatte und damit – wenn auch subjektiv gefärbte – Informationen geben über ein Land, von dem man fast nichts und das Wenige nur verzerrt wußte.
Obwohl ich mich viele Jahre mit der Gesamt-Korea-Frage befaßt hatte, wußte ich zwar viel über Südkorea, aber wenig vom Norden des Landes, und was ich wußte, stand unter negativem Vorzeichen: Nordkorea, eine finstere Diktatur.
Auf meiner ersten Reise, 1980, traf ich ein Land an, das diesem Vorurteil nicht entsprach. Was sich mir darbot, war soviel besser als das bisher Gewußte. Schon aus Gründen der Dialektik mit dem Ziel der Wahrheitsfindung sah ich mich gedrängt, das Positive zu betonen, um das fixierte Vorurteil des Westens zu korrigieren. So mag manches, was ich schrieb, allzu positiv geraten sein, freilich manches auch zu negativ. Es ist sehr schwer, Nordkorea zu verstehen, zumal bei einem ersten Besuch.
Auf der zweiten Reise im Herbst des Jahres 1981 war ich bestrebt, mein erstes Bild rücksichtslos zu korrigieren. Aber ich begriff, daß ich die Wirklichkeit Nordkoreas nur verstehen könne, wenn ich aufhörte, es mit westlichen Augen anzuschauen. Die zweite Reise wurde mir zu einem harten Lernprozeß. Plötzlich sah ich überall Widerhaken und Widersprüche! Meine Aufzeichnungen von 1981 habe ich nach der dritten Reise 1982 wiederum korrigiert, als ich bereits gelernt hatte, den Fernen Osten mit fernöstlichen Augen anzuschauen. Ich bin sicher, daß ich auf meiner nächsten Reise mein Bild wiederum verfeinern muß, denn Nordkorea ist, wie der ganze Ferne Osten, nur in intensiver Auseinandersetzung und immer wieder neu erfahrbar.
Natürlich habe ich mich inzwischen auch theoretisch mit Nordkorea befaßt. Dabei war mir besonders hilfreich die Arbeit eines Mannes, der bestimmt nicht im Verdacht stehen kann, kommunistenfreundlich zu sein: Gregory Henderson, der 1947 als Offizier der US-Armee nach Korea kam, sieben Jahre Mitarbeiter der US-Botschaft in Seoul und Busan war, Spezialist für Koreafragen, und hernach drei Jahre Berater im State Department Washington. Von 1964 bis 1965 war er Professor an der Harvard-Universität und dann Gastprofessor an der Freien Universität Berlin. Die Informationen, die ich bei meiner persönlichen Begegnung mit ihm im Oktober 1982 in Boston erhielt, ergänzten sich mir bei der Lektüre seiner Arbeiten über Korea. Sehr aufschlußreich war mir der Vergleich zweier seiner Arbeiten aus verschiedenen Jahren: zwischen dem 1968 entstandenen Buch ›Korea‹ (Harvard University Press) und seinem Aufsatz in der Zeitschrift ›Korea Scope‹ vom Juni 1982. Vierzehn Jahre redlicher Arbeit brachten den Politologen und Diplomaten dazu, Kritik zu üben an der Regierung Südkoreas und auch an der Einmischung der USA in die Koreapolitik. Ich zitiere ein Beispiel aus seiner neuen Arbeit: »Als der US-General Hodge 1945/46 eine Polizeiarmee aufstellte, welche der südkoreanischen Polizei helfen sollte, die internen Unruhen zu bekämpfen, wurde er damit der Begründer jener US-Militärmacht, die Südkorea heute beherrscht.«
Diese Maßnahme sei, sagt Henderson, der US-Regierung nicht recht gewesen, aber Hodge habe es verstanden, die USA wie auch Japan davon zu überzeugen, daß sie nötig sei. Er schreibt dazu wörtlich:
»Es gab damals in Südkorea selbst keinen zwingenden Grund, eine solche Streitmacht aufzubauen, und es gab keinen Beweis für eine Streitmacht in Nordkorea, die seinerzeit solche Maßnahmen gerechtfertigt hätte.«
Als die Sowjets 1948 aus Nordkorea abrückten, forderten die Vereinten Nationen den Rückzug auch der US-Armee aus Südkorea. Statt dessen bauten die USA ihre Militärmacht in Südkorea weiter aus.
Das heißt: Es bestand für die USA keine Notwendigkeit, in Südkorea eine derart starke Militärmacht zu unterhalten! Der einzige Grund war, den USA im Fernen Osten einen festen Militärstützpunkt zu sichern und sich Südkorea zum absolut abhängigen Partner zu machen. Seither ist die dortige US-Streitmacht die stärkste, welche im Ausland aufgebaut worden ist. Südkorea selbst hat heute 600000 reguläre Soldaten, dazu die Reservisten, die sich jedes Jahr vervielfachen, und ein Militärbudget von 5 Billionen Dollar, wovon ein Drittel aus südkoreanischen Quellen stammt; den Rest bezahlen die USA. Südkorea hat das höchste Pro-Kopf-Militärbudget der Welt. Die Folgen der hohen Eigenkosten spüren die Südkoreaner, vor allem die Arbeiter, die für Hungerlöhne zu arbeiten gezwungen sind und selbstverständlich kein Streikrecht und keine funktionierenden Gewerkschaften haben! Die Spanne zwischen den geringen Produktionskosten und den hohen Verkaufspreisen ist der Gewinn, den die in Südkorea arbeitenden Fabriken der USA und Japans einstecken. Der in Südkorea verbleibende Rest wird für die Rüstung verwendet. Zwischen 1975 und 1980 wurden 500 Millionen Dollar für die Rüstung ausgegeben. In Südkorea gibt es 90 Waffenfabriken. Ihre Produktion wurde in den letzten vier Jahren verdoppelt.
Südkorea ist eine Militärdiktatur strikter Observanz. Henderson schreibt dazu:
»Das Militär, gegründet und unterstützt durch die USA, wurde – nach dem Plan der US-Regierung zwischen 1951 und 1954 – zu einer Institution mit einer deutlich feststellbaren erzieherischen, organisatorischen und ideologischen Einheitlichkeit, welche die Regierungsgewalt beherrschte.«
Dies habe, sagt Henderson, die US-Regierung so nicht gewollt. Sie habe versäumt, alternative zivile Institutionen zu begründen oder zu fördern, welche die Invasion der Militärmacht in alle Bereiche des Lebens hätte verhindern können. So wurden die USA
»verantwortlich für die Schaffung – oder beitragend zur Schaffung – genau jenes Zustands von Autoritarismus und Repression einer Volksregierung, vor welcher Washington und Jefferson die Bürger der USA so nachdrücklich gewarnt hatten.«
Dies muß man wissen, um die Haltung Nordkoreas zu begreifen. Ein kleines Land, blockfrei, also ohne militärische Hilfe der Sowjetunion und Chinas, sieht sich faktisch aufs höchste bedroht von der vereinten Macht der USA und Südkoreas. Dazu kommt neuerdings die Bedrohung durch Japan, das, durch strategische und wirtschaftliche Überlegungen geleitet, einem Dreierbündnis USA, Südkorea, Japan zustimmt. Dazu schreibt Saki Hiroharu, Professor für internationale Politik an der Tokyo-Universität, in der Zeitschrift ›Korea scope‹ (1982), daß dieses Bündnis gegen Nordkorea gerichtet sei, das, seiner Blockfreiheit entsprechend, die Reduzierung aller Waffen auf der koreanischen Halbinsel fordert und Frieden will.
Wer die Vorgeschichte des Koreakrieges kennt, wird wissen, daß Nordkorea im üblichen, d.h. undifferenzierten Sinne, wohl der Angreifer war, aber auch, daß dieser Krieg aufs schärfste provoziert worden war durch die enorme Aufrüstung im Süden, die Nordkorea gegen sich gerichtet wußte. Sollte es warten, bis es vom Süden her überrollt würde? Wieviele nationale und internationale Konflikte, wieviele Menschenleben, koreanische und amerikanische, wären nicht sinnlos geopfert worden, hätte Kim Il Sung das ganze Land befreit.
Die Anwesenheit einer so geballten Streitmacht in Südkorea und die Anwesenheit eines starken Potentials von Atomwaffen in so großer Nähe machen es verständlich, daß Nordkorea sich in ständiger Verteidigungsbereitschaft befindet. Es kann sich keine inneren Zwiespälte erlauben. Das Volk muß wie ein Block hinter einem Führer stehen. Jede Abweichung wäre Schwächung der Verteidigungskraft. Daher die Ausrichtung auf eine einzige Persönlichkeit, die das Symbol der Einheit ist. Daher die Sicherung der Nachfolge. Daher die für westlichen Geschmack so unerträgliche Erziehung zu einheitlichem Denken. Darum all das, was uns, vom sichern westlichen Zuschauerplatz aus als tyrannische Diktatur nur erscheint.
Kim Il Sung will nichts als Frieden. Wie könnte er, in der augenblicklichen Situation, einen Angriff auf den Süden auch nur planen?
Aber auch abgesehen von seinen politisch-militärischen Gesichtspunkten kann er nichts anderes wollen als Frieden, denn der Zwang zur Defensiv-Aufrüstung ist ein schweres Hindernis für das, was er eigentlich will: seinem Volk zu Wohlstand und Glück zu verhelfen. Die Rüstung kostet zuviel Geld und verursacht Verschuldung im Ausland. Es ist durchaus möglich, daß die eigentliche Absicht des militärischen Dreierbündnisses USA, Südkorea, Japan dieselbe ist, welche die USA der Sowjetunion gegenüber anwendet: durch den Zwang zu immer höherer Aufrüstung das Land wirtschaftlich ausbluten zu lassen. Seit ich Kim Il Sung persönlich kenne, weiß ich, daß er, auch ohne alle Rücksichten auf den Druck der Russen, ein Mann des Friedens geworden ist.
Es ist falsch, ihn immer noch zu sehen als den Partisanenführer und den General im Krieg, als den Verfolger aller Oppositionellen beim Aufbau des Staates. Er wurde ein Mann der Milde. Wenn ein westdeutscher Journalist ihn einen »weisen Tyrannen« nennt, so hat er so unrecht nicht, doch liegt der Akzent auf dem Wort »weise«. Alle Besucher Nordkoreas, die ihn sahen, können sich des Eindrucks nicht erwehren, daß sie einen großen Mann vor sich haben.
Wer dies nicht wahrhaben will, muß wenigstens wahrhaben, daß er eine große Leistung vollbracht hat. Kein anderes Land, zumindest der Dritten Welt, hat so viele positive Züge wie Nordkorea: keine Arbeitslosen, keine Wohnungsnot, keine Mafia, keine Korruption, keine Art von Armut, keine Drogensucht, keine nennenswerte Kriminalität, keinen Alkoholismus, kein Einsamkeits-Syndrom, keine Chaotik, keine Zerstörung ethischer und humaner Werte. Dies wenigstens muß anerkannt werden, und es ist sehr viel; wir wären froh, wenn es im Westen so wäre. Könnte man eine Einbuße an individueller Freiheit dafür nicht in Kauf nehmen?
Was mich erheblich stört, ist freilich die unzulängliche Information. Die Massenmedien sind gleichgeschaltet und bringen nichts Außenpolitisches, und wenn je, dann nur Nachrichten über positive Reaktionen befreundeter Staaten. Nur die höheren Funktionäre sind unterrichtet, sie freilich genau. Das Volk selbst lebt in friedlicher Unwissenheit. Ob die junge Generation, von der viele im Ausland studieren, nicht eines Tages dagegen rebellieren wird, bleibt abzuwarten. Wie so vieles abzuwarten bleibt, da Nordkorea seine hermetische Verschlossenheit Zug um Zug preisgibt.
Nun: Was geht uns das alles an?
Daß es uns angeht, sieht man daran, daß man sich im Westen immer intensiver mit Nordkorea befaßt, wenn auch häufig mit negativer Absicht. Vor allem die Bundesrepublik, ihrem amerikanischen Partner konform, übt negative Kritik, dabei vor absichtlichen Falschmeldungen nicht zurückschreckend. Andere Länder, wie Italien und Frankreich, sind besser informiert und weit positiver eingestellt. Sie kennen die hysterische Angst vor dem radikalen Sozialismus nicht und sind offen für den Dialog.
Wäre Nordkorea nicht wichtig für den Westen, würde es der Westen nicht angreifen und verleumden. Inwiefern ist dieses ferne, kleine Land wichtig? Weil es beweist, daß ein radikal sozialistisches Land nicht identisch ist mit einem traditionell kommunistischen, und weil es beweist, daß eine radikal sozialistische Regierungsform über drei Jahrzehnte funktioniert und eine Reihe nicht ableugbare, positive Erfolge hat, und also den lebendigen sinnenfälligen Gegenbeweis darstellt zur anti-sozialistischen Hetzpropaganda.
Vor allem aber ist Nordkorea wichtig, weil es zu jenem Pulverfaß gehört, das Gesamtkorea ist, solange dort akute Kriegsgefahr herrscht. Wenn auch alle sich darüber klar sind, daß nicht Nordkorea einen Krieg will oder plant, muß man bedenken, daß unter Umständen die nukleare Hochrüstung in Südkorea die potenten kommunistischen Nachbarn China und Sowjetunion zu Aktionen kriegerischer Natur provoziert, was den Ausbruch des Dritten Weltkriegs bedeuten würde, und, da dabei natürlich alle vorhandenen Nuklearwaffen eingesetzt würden, unser aller Tod wäre.
In dem klaren Bewußtsein, daß gegenseitige Verhetzungen eines der wirksamsten Mittel der psychologischen Vorbereitung zum Krieg sind und daß die große Menschheitskrise unsrer Zeit nur dann überwunden werden kann, wenn wir alte Feindbilder abbauen und dafür Freundbilder aufbauen und die Koexistenz verschiedener politisch-gesellschaftlicher Systeme bejahen, wie es Kim Il Sung für Nord- und Südkorea vorschlägt, habe ich die zweite Hälfte dieses Buches geschrieben. Es geht also nicht, wie mir unterstellt wurde, um eine Propaganda für das System Nordkorea, sondern um eine Korrektur eines alten starren Feindbildes, dessen Aufrechterhaltung den Frieden im Fernen Osten und damit den Frieden der Welt gefährdet. Nichts als ein kleiner Beitrag zur Entspannung will diese Arbeit sein.
Die erste Reise
I. Anfänger-Beobachtungen
Im Flugzeug von Moskau nach Pyeongyang
Eingezwängt in dem engen Abteil für Gesellschaftsreisende. Ich habe eine Flugkarte erster Klasse Moskau–Pyeongyang. Ich muß froh sein, in der economy-class überhaupt mitgekommen zu sein. Wie das? Mein Flug war gebucht. Das Flugzeug sei voll besetzt, sagte man mir in Moskau. Man hielt mich am Moskauer Flughafen vier Stunden im ungewissen. Man ließ mich einfach vor dem Ausgangsschalter sitzen. Soldaten beobachteten mich. Keiner sprach deutsch oder englisch. Keiner konnte mir Auskunft geben. Würde ich in alle Ewigkeit hier in der Enge, im überheizten Vorplatz sitzen müssen? Das war die Vorhölle. Endlich eine Angestellte. Sie erklärte mir in gutem Deutsch eisig, ich müsse bis Dienstag warten, da gehe ein Flugzeug über Sibirien nach Korea. Wie? Mein Platz ist heute gebucht! Achselzucken.
Heute ist Sonntag. Ich würde im Flughafen-Hotel eingesperrt sitzen, zwei Tage lang. Dann der Flug über Sibirien, mit zwei Zwischenlandungen, jedesmal neue Kontrollen, auch Leibesvisitationen, das weiß ich von anderen Reisenden. Ich beschloß, nach Rom zurückzufliegen. Wozu diese Strapazen, dieser Ärger? Zehn Minuten vor Abflug tauchten zwei Soldaten auf und eine stämmige Beamtin, die meinen Koffer ergriff und mir bedeutete zu laufen. Wohin? Ich lief. Ich lief zwischen zwei Soldaten wie der Dieb zwischen Polizisten. Was würde geschehen? Wurde ich abgeschoben, ins Gefängnis gebracht? War da ein Mißverständnis, eine Verwechslung? Ohne Kontrolle wurde ich durch die Sperre geschoben, in ein wartendes Zubringerauto gedrängt und zum Flugzeug gefahren, dessen Motoren schon liefen. Die stämmige Russin schob mich die Rolltreppe hinauf, warf meinen Koffer in die Kabine, eine andre wies mich auf einen Mittelplatz, und wir flogen ab. Ein Alptraum.
Ich sitze inmitten einer russischen Touristengruppe, oder sinds Sportler, oder ists eine Musikband, ich weiß nicht, die Leute sind jung und lustig, sie lassen die Wodkaflasche reihum gehen, sie reden laut, ich kann nicht schlafen.
Zum Zeitvertreib schreibe ich. Ich ärgere mich über mich selbst. Warum zum Teufel habe ich diese Einladung angenommen? Was geht mich Nordkorea eigentlich an? Was geht mich die Politik des Fernen Ostens an? Weil ich mich vor sechs Jahren auf das Abenteuer der Südkorea-Reise eingelassen habe, muß ich jetzt das Abenteuer der Nordkorea-Reise auf mich nehmen. Muß ich? Offenbar ist mir das schicksalhaft gesetzt. Ja, schon, aber: was erwartet mich? Werde ich zu Propagandazwecken mißbraucht, wie man sich das in Südkorea so vorgestellt hatte? Dort unterlief ich die Absicht der Einlader, dort entschlüpfte ich den Bewachern, dort gelang es mir, selbst den CIA zu täuschen, dort sah ich nicht nur brav das Erlaubte, das Schöne, sondern auch das Verbotene, das Weg-Gelogene: die Slums, die Studenten im Untergrund, die Mutter des gefangenen und gefolterten Dichters Kim Chi Ha, die entlassenen Universitätsprofessoren, die Kinder mit den Hungerödemen, die armen bäuerlichen »Ami«-Huren an der Nordgrenze und die Edel-Kisängs in den Luxushotels. Und darüber schrieb ich einen Aufsatz im SPIEGEL, der dann Leserbriefe brachte, die mir vorwarfen, ich lüge. Die Schreiber waren allesamt CIA-Leute, und auch mein Einlader wurde gezwungen, mir in so einem Leserbrief Propagandalügen vorzuwerfen. Heute weiß jedermann, daß ich nichts als die Wahrheit gesagt habe, und die viel zu wenig scharf.
Wie wird das nun in Nordkorea sein? Man wird mich überwachen, man wird mir Positives erzählen, man wird mir Potemkinsche Dörfer zeigen, alles wird herrlich anzusehen sein, die Butter- und Honigseite werde ich sehen … Aber wenn es mir in Südkorea gelang, den Bewachern zu entschlüpfen, wird es mir auch in Nordkorea gelingen, oder etwa nicht?
Aber warum bin ich so entsetzlich mißtrauisch? Warum diese Vorurteile? Falsch ist das. Wer mit Vorurteilen ein Land betritt, der sieht NICHTS. Nichts als das, was er sehen will. Nichts als das, was seine Vorurteile bestätigt.
Weiß ich denn nicht schon zu viel über Nordkorea? Habe ich nicht zu viele Bücher darüber gelesen? Habe ich mich nicht mit der Geschichte Nordkoreas befaßt seit langem? Die Biographie des Präsidenten Kim Il Sung gelesen? Kann ich noch unbefangen sein? Ich habe auch, ehe ich nach Südkorea flog, Bücher darüber gelesen und den Bericht des dortigen, des damaligen, inzwischen ermordeten Präsidenten Park Chang Hee, und der las sich gut und glaubhaft und war doch erlogen. Was ich sah und hörte, war anders. Die Reise war demaskierend. Ich sah die Wirklichkeit des Lebens dort, die Misere der Arbeiter ohne jeden Rechtsschutz, die Unfreiheit der Studenten, die Armut der Kleinbauern, den Reichtum der CIA-Leute und der feigen Mitläufer, ich spürte die Angst der Menschen vor dem Diktator, ich traf die Intellektuellen, die schon oft in den Gefängnissen gesessen hatten und nun arbeitslos waren und keinen Pfennig Unterstützung bekamen, ich sah die Tränen der Frauen und Mütter eingesperrter Studenten und Journalisten.
Was werde ich nun in Nordkorea sehen?
Ein »marxistisches Regime«. So sagt man. Was ist das aber? Was für eine Art von »Marxismus«? Sowjetisch, chinesisch? Oder anders? Personenkult werde ich sehen, auf jeden Fall. Kim Il Sung als der größte Held aller Zeiten. Personenkult macht mir Angst, wem immer er gilt, ob einem Diktator oder einem Papst. Einer SACHE, einer IDEE muß man dienen, nicht einem Manne.
Aber ich DARF keine Vorurteile haben, sonst bin ich blind für die konkrete Wirklichkeit. Also noch einmal: weg mit allen Vorstellungen. Ich befehle mir, daß ich NICHTS weiß von diesem Land. Ich öffne mich. Ich werde sehen und hören und spüren, was dort wirklich geschieht. »Wir befinden uns im Anflug auf Pyeongyang.«
Es wird immer heller, wir fliegen in den Morgen hinein, die Sonne geht auf.
Pyeongyang
Ich bin nach dem langen Flug und dem Zeitunterschied von acht Stunden übermüdet, ich kann und kann nicht einschlafen, ich versuche zu schreiben.
Der Empfang am Flughafen: was für ein Unterschied zu jenem in Seoul vor fünf Jahren! Zwar erwartete mich auch hier eine Abordnung von Funktionären in dunklen Anzügen, aber sie zwangen mich nicht zu einem offiziellen Interview, das eher ein Verhör war und mitgeschrieben wurde. Wie denken Sie über Südkorea, was haben Sie darüber gehört … Hier in Pyeongyang fragte man mich nur besorgt über den Verlauf der Reise und hörte gespannt meinen Bericht von meinem Ärger am Moskauer Flughafen, und man lächelte: »Ja, ja, so sind DIE dort eben.« Der junge Übersetzer bemühte sich, mir ihr Lächeln so zu übersetzen. Man scheint den großen Bruder Sowjetunion nicht sehr zu mögen.
In Seoul hat man mir meinen Paß und meinen Koffer und die Tasche abgenommen und verschwand damit. Ich erhielt alles sechs Stunden später im Hotel zurück: man hatte das Gepäck durchsucht nach unerlaubtem, das heißt nach »kommunistischem« Schrifttum. Hier in Pyeongyang stand mein Gepäck immer neben mir, niemand berührte es, und es fuhr mit mir zugleich ab, im selben Auto. Keinerlei Kontrolle. Natürlich hatte man sich vorher genau nach meiner Zuverlässigkeit erkundigt. Aber nach welchen Gesichtspunkten wurde ich beurteilt? Nur nach meinem Interesse an der Wiedervereinigung Koreas? Könnte ich nicht auch ein Spion Südkoreas oder der Bundesrepublik Deutschland sein? Man vertraut mir, das ist sicher. Man ist freundlich und herzlich und offen. Die Menschen sind ganz anders als jene in Südkorea. Sie sind natürlich. Nichts von angewinkelten Armen, jener Geste, die geheime Angst verrät. Kein scheuer Blick nach allen Seiten, kein vorsichtiges Abwägen der Worte.
(S., italienischer Journalist, Kenner des Fernen Ostens, sagt mir heute, daß er bei seinem Aufenthalt die Leute in Nordkorea nicht so gelöst fand wie ich. Ich überprüfe meine Erinnerung: es stimmt, daß einige der Funktionäre, die ich traf, gespannt aussahen. Diese Gespanntheit kann ich mir wohl erklären: sie fühlen sich stark gefordert, sie müssen gute Figur machen vor Ausländern, sie sind im Dienst, sie haben große Verantwortung, und sie wollen das Beste leisten. In einem Buch über China [»Cara Cina« von Goffredo Parise] las ich, daß es im China Maos sehr viele Neurotiker und Depressive gab, auch Selbstmörder. Wie das? Sie lebten unter dem Druck ihres eigenen, hochgezüchteten Gewissens, sie meinten nicht genug für die Revolution zu tun, sie fühlten sich schuldig, ohne daß jemand ihnen Schuld gab. Ich glaube nicht, daß dies in Nordkorea auch so ist, aber bei einigen empfindlichen, ehrgeizigen Funktionären mag es wohl vorkommen, wie es unter ehrgeizigen Schülern vorkommt, die sich umbringen, wenn sie nicht das allerbeste Zeugnis haben. Aber im allgemeinen ist das Volk in Nordkorea sichtbar gelassen und heiter. Leute unter Streß gebe es nicht, sagte man mir, so wenig wie es Leute mit dem Einsamkeits-Syndrom gebe. Das ist gewiß: in Nordkorea ist jedermann in eine Gruppe und in die Volksgemeinschaft eingebettet. »Kommunikationsverlust« gibt es nicht. Hier macht man alles gemeinsam und ist gern beisammen. Keiner wird hilflos allein gelassen. Das bedenkend, kann auch der Gegner des nordkoreanischen Sozialismus-Modells nicht behaupten, daß dies den christlichen westlichen Staaten bis jetzt gelungen sei. Altersselbstmorde und Drogensucht und Jugendkriminalität als Folgen der Einsamkeit werden im Westen zwar beklagt, aber nicht behoben. Nordkorea hat das Problem approximativ gelöst).
Mitternacht: kein Schlaf. Im Westen ist es jetzt früh acht Uhr. Ich wohne nicht im Hotel, sondern im Gästehaus der Regierung. Ich habe eine ganze Wohnung für mich: Arbeitszimmer mit Bibliothek, Schlafzimmer, Bad, Vorraum und Konferenzzimmer. Viel Raum, aber kein Luxus. Kein Portier, kein Mensch am Eingang, kein Bewacher, die Tür ist unversperrt, ja unversperrbar, es gibt im ganzen Haus keine Türschlösser. Ich bin noch einmal ins Freie gegangen. Kein Mensch begegnet mir. Tiefe Stille. Bin ich allein im Haus? Wohin sind die Begleiter gegangen?
Ich gehe durch den nächtlichen Garten. Keine Absperrungen. Alles offen zum freien Land hin. Keine Wachtposten in der Nähe. Ziemlich weit weg an der Autozufahrt steht ein Schilderhäuschen mit einem verschlafenen, fröstelnden Soldaten. Ich gehe ins Haus zurück. Ich schreibe weiter.
Habe ich mir nicht immer gewünscht, in Japan die Kirschblüte zu sehen? Ich sah sie hier. Längs der Straße vom Flughafen zur Stadt Blüten, Blüten, weiß und dazwischen rosa und rot: Pfirsiche und gefüllte Mandelblüten, und der Himmel darüber ganz blau, sehr blau, weil unverschmutzt: keine Fabriken, die sind weit weg, sagt mein Dolmetscher, und die richtige Blüte, sagt er, beginnt erst, das ist der Anfang nur, dieses Jahr wird genau zum ersten Mai die volle Blüte sein, zum Kirschblütenfest.
Wir nähern uns schon der Hauptstadt, aber der Übergang ist sanft. Das Land verengt sich zu breiten Straßen mit Grünstreifen und Alleebäumen, viel Grün, viel Laub, viel blühendes Gesträuch, wenig Verkehr, niemand in Eile.
Aber dann: auf einem Hügel das bronzene Riesenstandbild des Präsidenten, und rechts und links ebenfalls gewaltige Bronzetafeln mit Szenen aus dem Koreakrieg, ich kenne sie schon aus den Bildbänden, sie sind auftrumpfend, viel zu schreiend in diesem stillen Land. Warum haben alle Diktatoren diesen zwanghaften Hang zum Überdimensionalen? Selbstdarstellung, Imponiergehabe, Kompensation geheimer Angst vor dem Sturz? Warum diese Altäre im Freien, diese grellbunten Farbtafeln mit Szenen aus dem Leben des Präsidenten: Kim Il Sung im Partisanenkrieg, Kim Il Sung bei den Bauern, Kim Il Sung bei den Kindern, Kim Il Sung bei den Industriearbeitern im Hüttenwerk …»Personenkult«.
Freilich: in katholischen Gegenden hängt auch überall der Papst in Farbdruck. Für Katholiken ist das etwas anderes, als wenn da der Präsident hinge. Aber für Nichtkatholiken ist es auch Personenkult. Das muß ich bedenken. Ich werde noch verstehen lernen, was dieser Kult um Kim Il Sung WIRKLICH meint. Und wenn meine Begleiter am Rockaufschlag das Medaillon mit dem Bild Kim Il Sungs tragen statt eines Partei-Abzeichens, was bedeutet das? Ist es besser oder schlechter, als ein Hakenkreuz oder eine Plakette mit Hammer und Sichel zu tragen? Ist es menschlicher, ein Menschenbild zu tragen, als ein abstraktes Zeichen einer anonymen Macht? Ich weiß es noch nicht.
Ahnen-Ehrung
Ich hatte mir das so schön ausgedacht: gleich am ersten Tag wollte ich die Gräber der Eltern Kim Il Sungs besuchen und Blumen dort niederlegen. Ich dachte mir, die Gräber lägen irgendwo auf dem Land in aller Abgeschiedenheit, auch das Geburtshaus des Präsidenten wollte ich sehen. Das gehört sich so, dachte ich, daß man die Ahnen des Gastgebers ehrt. Mein Wunsch wurde als Selbstverständlichkeit betrachtet: die Fahrt war schon eingeplant, sie gehört zum üblichen Programm der Gäste. Nicht gestern, sondern erst heute morgen fuhren wir aufs Land. Mein Wunsch nach großen schönen Blumensträußen schaffte einige Aufregung: obgleich die Gärten der Stadt überquellen von Blühendem, gibt es keine Blumen zu kaufen, weder gibts Geschäfte dafür noch offene Blumenstände. Wieso ist es in allen sozialistischen Staaten, die ich kenne, so schwer, Blumen zu kaufen? Man sagt mir, die Sträuße würden besorgt und nachgebracht, wir sollten ruhig abfahren. Wir taten es.
Wie töricht ich war, als ich mir vorstellte, Gräber und Geburtshaus lägen irgendwo in der Einsamkeit und ich sei an einem ganz gewöhnlichen Wochentag vielleicht der einzige Besucher! Ganz Pyeongyang, halb Nordkorea schien unterwegs. Heerscharen, Pilgerzüge, alle in derselben Richtung, alle zu Fuß, die Busse parken weit entfernt, selbst unser Regierungsauto darf nicht den Hügel hinauffahren. Recht so. Mir gefällt es, wenn niemand Privilegien hat.
Die Leute gehen in mehr oder minder geschlossenen Gruppen, aber es sind keine Touristen, vielleicht, so denke ich, ist das so etwas wie ein Betriebsausflug mit politischem Akzent. Ganze Schulklassen wandern da, uniformiert, die Mädchen mit den kurzen dunklen Faltenröckchen an gekreuzten Trägern über weißen Blusen, im Haar eine grellbunte Stoffblume, die Buben in kurzen Hosen mit dem roten Dreieckstuch um den Hals, das sie als »Pioniere« ausweist. Die Studenten haben eine Art Uniform, die an jene der Soldaten erinnert, aber sie tragen sie lässig. Alle sehen heiter aus und entspannt und satt und ohne Aggressionen, und doch merkt man die Disziplin. Mir scheint, sie ist vielmehr eine innere als eine anerzogene. Sie ist schon in Fleisch und Knochen eingewachsen. Uralte konfuzianische Tradition plus Parteierziehung, das prägt stark.
Aber diese Mädchen in Militär-Uniform, sind das weibliche Soldaten? Es sind, sagt man mir, Ärztinnen und Krankenpflegerinnen, also Sanitäterinnen, die für den Fall eines Angriffs ausgebildet werden. Ist diese Ausbildung Pflicht? Wie ist das hier mit der Wehrpflicht überhaupt? Drei Jahre Ausbildung. Ist sie Pflicht?
»Pflicht? Aber ich bitte Sie! Es ist selbstverständlich, daß jeder bereit ist, das Land zu verteidigen, wenn es angegriffen würde. Die Jugend hat das Beispiel ihrer Väter und Großväter vor Augen, die ihrem Land Freiheit, Selbständigkeit, Frieden erkämpft haben. Es wäre eine Schmach, wenn die Jungen das vergäßen. Im übrigen haben wir viel mehr Freiwillige, als man nehmen kann.«
Da ich gegen jede Militärpflicht bin, gegen jede Ausbildung zum Töten von Mitmenschen, macht mir diese Auskunft, so strahlend gegeben, Unbehagen. Kann in einem Land richtig und recht sein, was in einem anderen böse ist oder auch nur sinn- und nutzlos?
Ich sage: Sie sprechen nur von Verteidigung.
Aber natürlich, denn wir machen keinen Angriffskrieg. Wir haben auch 1950 nicht angegriffen, wir haben uns nur verteidigt.
Ich mag jetzt nicht darauf eingehen. Mir ist die südkoreanische Version bekannt, und das ist auch jene der ganzen übrigen Welt, mit Ausnahme der sozialistischen Länder. Herr Kim, einer meiner Begleiter, Historiker von Beruf, bemerkt meine Abwehr, meine Verwirrung. Er sagt still und höflich: Darüber müssen wir einmal in Ruhe reden.
Endlich kommt das Auto mit den Blumensträußen. Recht ansehnlich sind sie nicht. Ich hatte mir Prachtvolles vorgestellt. Aber es geht auch so.
Nun können wir endlich den Hügel hinansteigen, auf dem die Gräber liegen. Wir gehen wie in einer Prozession: Scharen vor uns, Scharen hinter uns. Schweigend. Vom Tal herauf tönt Musik. Heitere Musik. Folklore.
Ich möchte wohl wissen, was diese Wanderer denken, diese Angehörigen dreier oder vierer Generationen: die Überlebenden aus zwei Kriegen, die Partisanen, die Jüngeren, die den Schutt wegräumten und den Aufbau begannen, unendlich mühsam, die noch Jüngeren, die es schon leichter hatten, ihre glatten selbstbewußten Gesichter zeigen das, und die Kinder, die »kleinen Könige«, wie Kim Il Sung sagt, die »frei und glücklich« sind, sie singen das, man übersetzt mir, was da so heiter aus dem Tal herauftönt aus den Lautsprechern.
Nun kann ich endlich meine Sträuße niederlegen an den Gräbern der Eltern eines Revolutionärs, die selber Revolutionäre waren. So steht es in der Biographie Kim Il Sungs. Sie müssen starke Persönlichkeiten gewesen sein, der Vater war schon Partisan gegen die Japaner und Marxist, die Mutter erzog den Sohn zur Tapferkeit und mutete ihm zu, als er noch fast ein Kind war, im Winter aus der Mandschurei ein Geheimschreiben nach Korea zu überbringen, da den Japanern ein Kind unverdächtig war.
Ich hätte gern auch das Grab jener Frau besucht, die Kim Il Sungs Gefährtin war, Partisanin auch sie, 1947 gestorben; sie hatte ihm 1940 einen Sohn Kim Jong Ill geboren, von dem heute gesagt wird, er sei der künftige Nachfolger seines Vaters als Präsident des Landes. Eine These, die im Ausland Ursache der Verdächtigung ist, Kim Il Sung wolle eine Art Erbdynastie begründen, eine »Familien-Diktatur«. Ich könnte verstehen, wenn Kim Il Sung seinen Ältesten zum Nachfolger haben möchte: der kennt das Land, die Leute, die Ideologie, der weiß, wie man das so mühsam aufgebaute Land weiterentwickeln muß, dem kann er voll vertrauen, der würde dafür sorgen, daß nicht nach dem Tod des Präsidenten ein Bruch entstünde, eine Spaltung zum Unheil für das Volk. Noch ist Kim Il Sung nicht einmal siebzig, er ist 1912 geboren und kerngesund.
Daß Kim Il Sungs Frau so früh sterben mußte, hat ihn bewogen, gerade der Gesundheitsfürsorge der Frauen viel Aufmerksamkeit zuzuwenden. Der Bau der großen Frauenklinik in Pyeongyang geht auf seine Initiative zurück. Ich habe sie gesehen.
Sie ist eben fertiggeworden und noch nicht in Betrieb. Gruppen ausländischer Mediziner besichtigen sie. Das Haus ist sehr groß und äußerst funktionell gebaut. Es gibt die modernsten Apparate. Es gibt Einzelzimmer und zwei- und dreibettige, aber keine Säle für viele. Jede Frau kann wählen, ob sie allein sein will oder nicht. Das ist nicht eine Frage des Geldes und also nicht eine Frage der Gesellschaftsklasse, sondern ganz einfach das Angebot der besonderen Wunsch-Erfüllung. Aufenthalt, Behandlung, Operation, alles ist völlig unentgeltlich.
In der Halle ein Raum für Besucher, die von dort aus durch Fernsehgerät und Telefon sich mit den Patientinnen unterhalten können. Meine Frage: Dürfen hier die Männer bei der Geburt anwesend sein? Sie dürfen nicht. Sie möchten auch nicht. Aber man beläßt das Neugeborene bei der Mutter von Anfang an. Es kommt nicht in eine Säuglingsstation und muß nicht den Schock der Entfernung von der Mutter erleiden. Hier trifft sich die Tradition schön mit der westlichen neuen Psychologie, die das Verbleiben des Kindes in der Nestwärme der Mutter fordert.
Man sagt, die Klinik hier sei eine der modernsten der Welt. Sicher ist, daß sie schön ist, daß genügend Personal zuhanden ist und daß es genügend Betten gibt und keine Wartezeiten. Daß die koreanischen Krankenschwestern die besten sind, weiß man auch bei uns. Freundlichkeit und Behutsamkeit sind der koreanischen Frau ohnehin angeboren. Die gründliche Ausbildung garantiert ihr Fachwissen und ihr praktisches Können.
Zu meinem Programm gehört die Besichtigung des Elternhauses Kim Il Sungs. Es ist wie neu. Es ist restauriert. Eins der üblichen koreanischen, hübschen, kleinen Bauernhäuser mit drei Räumen, einem Stall und einem Schuppen daneben. Strohgedeckt. Schön ist das Dach. Schade, daß man nirgendwo mehr mit Stroh deckt, es ist ein warmes, lebendiges Material. Freilich nicht dauerhaft. Plastik dauert ewig in all seiner toten Häßlichkeit.
Alle Geräte von damals, als Kim Il Sung hier lebte, scheinen erhalten. Ein eifriges Mädchen in Tracht erklärt feierlich: »Dies ist die Mistgabel, mit der der Vater des großen Präsidenten … Dies ist der Herd, auf dem die Mutter des großen Präsidenten …« Warum zum Teufel kann man hier nicht einfach sagen: des Präsidenten? Warum, wozu diese Byzantinismen? In der englischsprachigen Zeitung las ich heute morgen: »Der große Präsident Kamerad Kim Il Sung …« Ich las auch: »Der väterliche Führer …«
Muß das sein? Wer will das so? Ich kann mir nicht denken, daß Kim Il Sung selbst das wünscht. Es widerspricht seiner Art, wie man sie mir im Westen von sachlichen Beobachtern geschildert hat. (Ich bin sehr gespannt, wie ich ihn sehen werde, wenn mein Besuch bei ihm zustande kommt. Er ist mir versprochen.)
Neben mir die Schulkinder. Wie sauber und artig sie sind, wie wohlgenährt und still. Sie langweilen sich wie alle Schulkinder aller Länder bei solchen Lehrausflügen, aber sie schwätzen nicht, sie sind beängstigend diszipliniert. Niemand braucht sie zu ermahnen. Sie sind auch nicht zappelig nervös wie unsere Kinder im Westen. Es sind eben kleine Asiaten. Aber ich lasse mich nicht täuschen, ich weiß, daß hinter diesen glatten, ruhigen Gesichtern leidenschaftliche Seelen wohnen. Man ist nie sicher bei Koreanern, daß nicht plötzlich in unerwarteter Eruption Flammen ausbrechen. Koreanische Revolutionäre im Norden wie im Süden entwickeln todverachtende Kraft. Ich will jetzt nicht daran denken, was einige hundert Kilometer südlich, jenseits des 38. Breitengrads, in Südkorea geschieht dieser Tage. Ich sah noch im Westen im Fernsehen die Panzer nordamerikanischer Herkunft, welche die Studenten in der Hafenstadt Busan und in Gwangju überrollten, die sich ihnen im Kampf um eine freie Demokratie entgegenwarfen. Die jungen Koreaner sind wie biegsame metallene Klingen: sie schnellen plötzlich hoch und treffen. Sie sind bewundernswert, aber auch ein wenig erschreckend.
Am Nachmittag fahren wir noch zum Heldenfriedhof in Pyeongyang. Er liegt an einem Hügel: eine Ansammlung von Stein-Stelen mit Köpfen. Alle aus einer Art grellweißem Gips. Man sagt mir, sie seien alle portrait-ähnlich. Der Präsident, der diese Partisanen alle gekannt hat, habe korrigiert, wenn ein Gesicht nicht ganz so ausfiel, wie er es in Erinnerung hatte. »Und er hat ein unerhörtes Gedächtnis«, sagen mir meine Begleiter. Übrigens sind viele Frauen, junge Mädchen zumeist, unter den Helden. Partisaninnen. Ich fühle tiefen Respekt, obgleich ich denke: im Westen schreibe ich gegen den Eintritt der Frauen in die Bundeswehr …