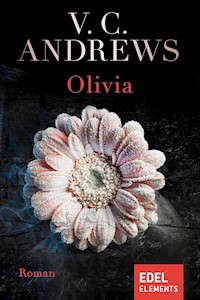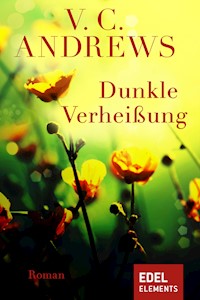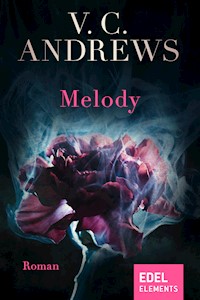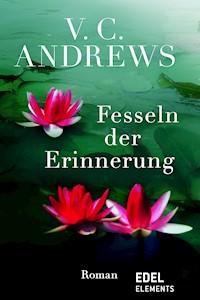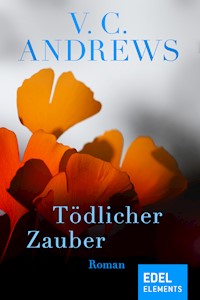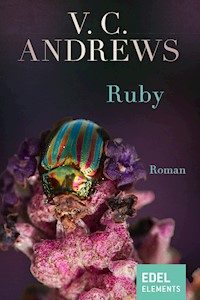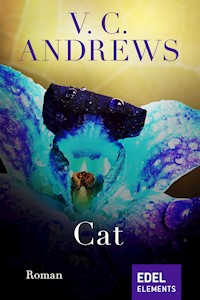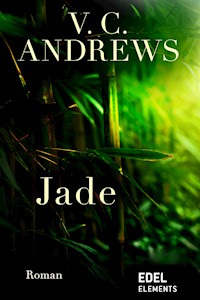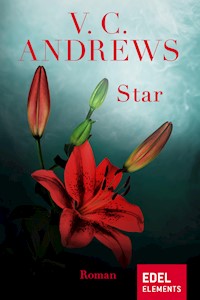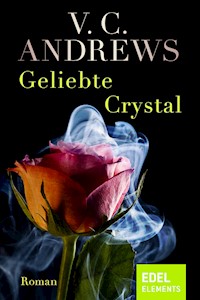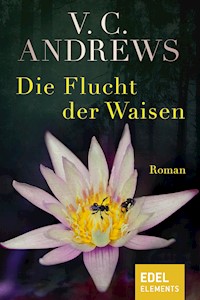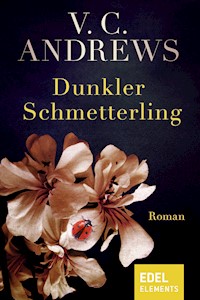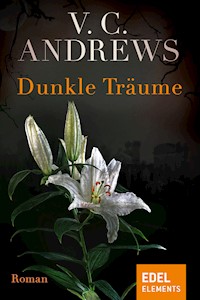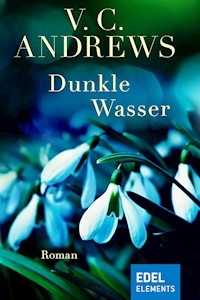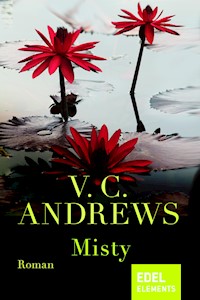V.C. Andrews – eine der erfolgreichsten Bestsellerautorinnen der Welt. Und eine Meisterin der romantischen Spannung!
Schon immer hat Olivia geahnt, dass ihre jüngere Schwester Belinda eines Tages in große Schwierigkeiten geraten würde. Flatterhaft, kokett und betörend schön, zieht Belinda die Aufmerksamkeit aller Menschen auf sich. Immer wieder drängt Olivia ihre Eltern, härter mit Belinda ins Gericht zu gehen – bis zu jener Nacht, als ihrer kleinen Schwester geschieht, wovor alle Frauen sich am meisten fürchten…
Ein spannender Roman voller Romantik und dunkler Geheimnisse – V.C. Andrews´ erfolgreiche Logan-Saga!
Prolog
Der Frühling auf dem Kap überraschte mich immer wieder von neuem. Es war fast so, als rechnete ich nie mit seiner Rückkehr. Die Winter konnten lang und trostlos sein, die Tage von der eisigen Kälte der Nacht klirrend, aber der graue Himmel und die kälteren Winter machten mir nie soviel aus wie anderen Leuten, vor allem meiner jüngeren Schwester Belinda. Solange ich zurückdenken kann, glaubten unsere Schulkameraden, der Winter sei mir ohnehin lieber. Ich kann mich nicht genau erinnern, wann oder wie es begann, aber eines Tages sprach jemand von mir als Miss Cold und von Belinda als Miss Hot, und bis zum heutigen Tage blieben diese Etiketten an uns haften.
Als sie ein kleines Mädchen war, stürzte Belinda mit Begeisterung aus dem Haus, um an die frische Luft zu eilen, den Wind in ihrem Haar einzufangen, sich im Kreis zu drehen und zu lachen, bis ihr schwindlig wurde und sie in den Sand fiel, hysterisch, aufgeregt und mit Augen, die fast so hell leuchteten wie zwei Geburtstagskerzen. Alles, was sie tat, war eine Explosion. Sie redete nie langsam, sondern sprach immer so, als würden die Worte ihre Lunge sprengen und sie müßte sie hervorsprudeln, ehe es zu spät war, und sie starb. Ganz gleich, was sie tat oder sagte, es endete im allgemeinen damit, daß sie keuchte: »Ich mußte es euch einfach sagen, ehe ich sterbe!«
Im Alter von zwölf Jahren wiegte sie beim Gehen die Hüften wie eine reife Frau, drehte kokett die Schultern und ähnelte einer gründlich ausgebildeten Kurtisane. Sie wedelte mit den Händen wie eine Geisha mit ihrem Fächer, und sie tat so, als wollte sie ihre koketten Augen und ihr verlockendes Lächeln zwischen ihren
kleinen Fingern verbergen. Ich sah, wie erwachsene Männer die Köpfe nach ihr umdrehten und sie anstarrten, bis ihnen aufging, wie jung sie war, und dann warfen sie fast immer einen zweiten Blick auf sie, um ihren Eindruck zu bestätigen, wobei sich ihre Gesichter vor Enttäuschung verfinsterten. Ihr Gelächter war ansteckend. Wer in ihrer Nähe war, wenn sie lachte, verzog das Gesicht ausnahmslos zu einem strahlenden Lächeln, als hätte sie jeden mit einem Zauberstab berührt, um den Trübsinn, die Traurigkeit oder die Depressionen zu verscheuchen. In ihrer Gegenwart verwandelten sich andere Leute, vor allem Jungen, in Trottel, die nicht mehr ernst zu nehmen waren und denen plötzlich alles andere entfallen zu sein schien; sie vergaßen ihre Verantwortlichkeiten, ihre Pflichten, ihre Termine und insbesondere ihren eigenen Ruf. Auf Belindas Geheiß hin ließen sie sich zu den albernsten Dingen hinreißen. »Du siehst aus wie ein Frosch, Tommy Carter. Laß uns hören, wie schön du quaken kannst. Mach schon«, spottete sie, und Tommy Carter, zwei Jahre älter als sie und kurz vor seinem letzten Jahr in der Highschool, kauerte sich hin wie eine Kröte und quakte zum Gelächter und Applaus der anderen. Im nächsten Moment hatte sich Belinda von ihm abgewandt und trieb jemand anderen an die gefährlichen Grenzen, an denen der gesunde Menschenverstand und die Würde enden.
Ich wußte schon immer, daß sie sich in Schwierigkeiten bringen würde. Mir war nur nie klar, wie weit die Katastrophe reichen würde. Ich versuchte, ihr Benehmen zu korrigieren, ihr beizubringen, wie sie sich damenhafter gab, und vor allem, daß man gegenüber Jungen und Männern Vorsicht walten lassen mußte. Sie überhäuften sie ständig mit Geschenken, und sie nahm alle an, wenn ich sie auch noch so nachdrücklich davor warnte.
»Damit gehst du eine Verpflichtung ein«, sagte ich. »Gib diese Dinge zurück, Belinda. Nichts ist gefährlicher, als einen jungen Mann mit leeren Versprechungen hinzuhalten.«
»Ich fordere sie doch nicht auf, mir Geschenke zu machen«, protestierte sie. »Nun ja, vielleicht lasse ich ab und zu eine Andeutung fallen, aber ich setze niemanden unter Druck. Und deshalb bin ich niemandem etwas schuldig. Es sei denn, ich möchte jemandem etwas schuldig sein«, fügte sie dann mit einem schelmischen Lächeln hinzu.
Aus irgendwelchen Gründen blieb es weitgehend mir überlassen, Belinda die Ermahnungen zu erteilen, die sie so dringend brauchte.
Unsere Mutter scheute vor Verantwortung und Verpflichtungen zurück. Jedes unerfreuliche Wort und jeder unschöne Anblick waren ihr verhaßt. In ihrem Vokabular wimmelte es von Beschönigungen, Worten, die nur dazu dienten, die dunklen Wahrheiten über unsere Welt zu verschleiern. Die Leute starben nicht, sie »gingen endgültig von uns«. Daddy war nie gemein zu ihr, er war nur »nicht bei Laune«. Aus ihrem Mund klang das so, als sei gute Laune etwas, dessen Vorrat sich erschöpfte und jederzeit aufgefüllt werden konnte, wie ein leerer Tank. Wenn eine von uns krank war, behandelte sie uns, als seien wir selbst schuld daran. Erkältungen zogen wir uns aus Unachtsamkeit zu, Bauchschmerzen, weil wir etwas Falsches gegessen hatten. Jede körperliche Beeinträchtigung war die Folge einer schlechten Wahl, die wir getroffen hatten, und wenn wir uns gehörig anstrengten, würde alles vergehen und wir würden wieder froh sein.
»Kneif die Augen ganz fest zu, und wünsch es weg. So mache ich es«, sagte sie in solchen Momenten.
Das Schlimmste war für mich, wie sie über alles hinwegging, was Belinda anrichtete. Ihre Versäumnisse waren nie etwas anderes als »nur ein vorübergehender Rückfall«. Ihre Streiche und der Unfug, den sie anstellte, waren immer darauf zurückzuführen, daß »ihre Jugend die Oberhand gewinnt. Sie wird bald aus diesem Stadium herauswachsen«.
»Dazu wird es nie kommen, Mutter«, sagte ich dann mit der Autorität einer Hellseherin.
Aber Mutter hörte nie auf mich. Sie wedelte dicht an ihren Ohren mit den Fingern in der Luft herum, als seien meine Worte nichts weiter als lästige Fliegen, die sich auf diese Art vertreiben ließen. Jedesmal, wenn ich mich beklagte, war ich »mit dem falschen Fuß aus dem Bett aufgestanden«.
Man brauchte nur zu blinzeln, und alles würde vorübergehen: Stürme, die Krankheiten, Belindas schlechtes Benehmen, Daddys miserable Laune, Konjunkturrückgänge, Kriege, Seuchen, Verbrechen, all das würde von allein verfliegen, gemeinsam mit allem anderen, was auch nur im entferntesten unerfreulich war.
Das Zimmer unserer Mutter war immer voller Blumen. Sie haßte Feuchtigkeit und modrige Gerüche. Sie füllte ihre Tage mit den Melodien von Spieluhren aus und trug tatsächlich eine Brille mit rosarot getönten Gläsern, denn sie haßte »die stumpfen Farben, das Ausbleichen der Dinge, die ärgerlichen dunklen Wolken, die ihre Gesichter mit den häßlichen Prellungen herausstrecken«.
Belinda, beschloß ich, hatte viel mehr von ihr als von unserem Daddy. Wir hatten beide Mutters zierliche Gestalt geerbt, und es stand schon früh fest, daß keine von uns beiden viel größer als eins fünfundfünfzig werden würde. Mutter maß barfuß kaum mehr als einen Meter fünfzig. Belinda war noch kleiner als ich, und ich muß zugeben, daß ihr Gesicht einen vollendeten Schnitt aufwies. Ihre Augen waren blauer. Meine waren eher grau. Sie hatte die kleinere Nase, und ihr Mund hatte perfekte Proportionen. Ihre Lippen waren immer ein wenig hochgezogen, was das winzige Grübchen in ihrer linken Wange zur Geltung brachte. Als sie noch ganz klein war, legte Daddy einen Finger darauf und tat so, als sei es ein Knopf. Dann wurde von Belinda erwartet, daß sie tanzte, und das tat sie dann auch, und wie!
Schon im Alter von zwei oder drei Jahren war sie überschwenglich.
Daddy lächelte so strahlend, daß dieses Lächeln seinem Herzen entspringen mußte, wenn sie sich im Wohnzimmer im Kreis
drehte und Pirouetten beschrieb wie eine Ballerina, mit ihrem hoch erhobenen rechten Arm und dem Zeigefinger auf ihrem Scheitel. Mutter lachte und klatschte, wie es auch unsere jeweiligen Gäste taten.
»Kann Olivia nicht auch tanzen?« fragte Colonel Childs, einer von Daddys engsten Freunden, eines Tages. Ich blickte auf, und Daddy starrte mich einen Moment lang an, ehe er langsam den Kopf schüttelte und mir dabei eindringlich ins Gesicht sah.
»Nein, Olivia tanzt nicht. Olivia denkt«, sagte er mit einem beifälligen Nicken. »Sie plant und organisiert. Sie ist mein kleiner General.«
Als wir älter wurden und Daddy mich weiterhin von Zeit zu Zeit seinen kleinen General nannte, zog mich Belinda damit auf, indem sie in den Korridoren oder am Eßtisch vor mir salutierte. Dann lachte sie, drückte mich an sich und sagte: »Ich mache doch nur Spaß, Olivia. Sieh mich nicht so haßerfüllt an.«
»Wenn man sich selbst ernst nimmt und eine gewisse Selbstachtung besitzt, dann heißt das noch lange nicht, daß man haßerfüllt ist, Belinda. Du solltest es mal ausprobieren.«
»Oh, nein, das kann ich nicht. Mein Gesicht läßt sich nicht zu solchen Falten in der Stirn verziehen. Meine Haut rebelliert dagegen. Sie spannt sich an und schnellt zurück«, rief sie aus, und als sie fortlief, wehte ihr perlendes Lachen hinter ihr her wie die Bänder eines Drachens.
Es war frustrierend, sie zu beobachten. Wie kam es bloß, daß weder meine Mutter noch mein Vater sahen, was ich sah? Unser Daddy war selten ungehalten über die Dinge, die Belinda sagte oder tat, und wenn er es doch war, dann fiel sein Mißmut so schnell von ihm ab, daß man meinen könnte, es sei nichts geschehen. Sowie er seine Stimme gegen sie erhoben hatte, riß er sich zusammen und zügelte sein ansonsten heftiges und aufbrausendes Temperament.
Viele Male war ich Zeuge seiner Wutausbrüche gewesen und hatte erlebt, wie er gegen Politiker, Regierungsbeamte, Anwälte
und andere Geschäftsleute wetterte. Ich sah ihn Dienstboten so streng ins Gebet nehmen, daß sie sich mit niedergeschlagenen Augen, gesenkten Köpfen und blassen Gesichtern zurückzogen. Seine Worte waren so ätzend, daß er jemanden mit einem Satz lebendigen Leibes häuten konnte.
Aber wenn er Belinda ausschalt, trat er im gleichen Moment den Rückzug an. Ich konnte nahezu sehen, wie er die Hand ausstreckte und die Worte zurücknahm, sie wieder zwischen seinen Lippen verbarg. Wenn sich auch nur ein Tränenschleier über ihre Augen zog und sie glasig werden ließ, behandelte er sie, als hätte sie eine tödliche Wunde davongetragen, und es endete gewöhnlich damit, daß er ihr etwas Neues kaufte oder ihr etwas Wunderbares versprach. Es war, als ermöglichten ihm nur ihr Lächeln und ihr Lachen, den Tag zu überstehen.
Manchmal, wenn wir alle zusammen am Eßtisch saßen oder nach dem Essen im Wohnzimmer etwas im Fernsehen anschauten oder lasen, sah ich Daddy an und stellte fest, daß er Belinda anstarrte, sein Gesicht voller Bewunderung, während sich seine Augen an ihren zarten Zügen labten wie die eines Kunstsammlers, der eine seltene Antiquität oder ein Meisterwerk zu würdigen versteht.
Warum sieht er mich nicht so an, fragte ich mich bekümmert. Ich hatte nie etwas getan, wofür er sich hätte schämen müssen oder was ihn unglücklich gemacht hätte. Ich wußte, daß er stolz auf meine Leistungen war, aber er benahm sich, als erwartete er genau das und nicht weniger von mir. Mir wurde klar, daß er alles, was ich leistete, als selbstverständlich hinnahm, und doch entsprach ich immer seinen Erwartungen, sei es nun, daß ich in der Schule einen Preis gewann, von seinen Geschäftspartnern Komplimente bekam oder zu Hause Erfolge zu verbuchen hatte.
Als ich das Mädchenpensionat mit den größtmöglichen Auszeichnungen abschloß, gab er mir einen Kuß auf die Stirn und drückte mir die Hand. Ich erwartete schon fast, daß er mir einen Orden an die Brust heften und mich befördern würde. Meine
Belohnung bestand darin, daß ich einen verantwortungsvollen Posten im Familienbetrieb bekam, bis zu dem Tage, an dem ein feiner junger Herr an Daddy herantreten und um meine Hand anhalten würde, um mich zu ehelichen. Ich verstand nie, aus welchem Quell er derlei Hoffnungen und Erwartungen schöpfte. Daddy weigerte sich schlichtweg zu sehen, daß sich die Zeiten geändert hatten und junge Männer heute nach Frauen mit anderen Eigenschaften als der Ausschau hielten, daß sie »aus guter Familie« stammten, und er begriff auch nicht, daß die jungen Männer heute nicht mehr so förmlich waren. Es war fast, als glaubte er, unsere Familie sei von dem gesellschaftlichen und politischen Wandel ausgenommen, der alle anderen betraf.
Wenn sein Glaube jemals angezweifelt wurde, schüttelte er den Kopf und sagte: »Es ist nicht gut für das Geschäft, wenn sich die Leute schlecht benehmen. Aus schlechtem Benehmen läßt sich kein Profit schlagen. Wann immer man in diesem Leben etwas tut, sollte man sich einen Moment Zeit nehmen und sich fragen: Was springt unter dem Strich dabei heraus? Wer danach handelt, wird immer die richtige Wahl treffen.«
Das gehörte zu den Dingen, die er Belinda beibringen sollte, fand ich, aber sie belehrte er nie. Tatsächlich erteilte er ihr nur äußerst selten einen Ratschlag. Ihr war es gestattet, ein freier Geist zu sein, der unbekümmert, spontan und ohne jede Reue durch unser Haus und unser Leben flatterte, für immer befreit von jeder Verpflichtung, Sorge und Verantwortung.
Wenn ich Daddy ihretwegen zur Rede stellte, nickte er und vermittelte mir den Eindruck, ich sei im Recht, und dann hörte er plötzlich auf zu nicken und sagte: »Du wirst eben auf sie aufpassen müssen, Olivia.«
»Wann wird sie endlich anfangen, auf sich selbst aufzupassen, Daddy? Dieses Jahr beginnt ihr letztes Schuljahr«, gab ich zurück.
»Manche Frauen werden eben nur ältere Mädchen«, brachte er vor.
Ich war der Meinung, er fände nur Ausflüchte für sie, und das versetzte mich jedesmal wieder in Wut. Weshalb fand er immer diese Ausreden für Belinda? Warum packte er sie nicht eines Tages einfach am Genick und schüttelte sie, bis dieses alberne kokette Lächeln von ihrem Porzellangesicht fiel und vor ihren Füßen zerschellte? Warum brachte er sie nicht dazu, erwachsen zu werden? Warum zwang er sie nicht, den Konsequenzen ihres Handelns ins Gesicht zu sehen? Genau darin drückt sich nämlich Reife aus, verkündete ich in meiner imaginären Ansprache, einer Ansprache, die meine Eltern nur selten zu hören bekamen, und wenn es doch einmal dazu kam, dann schenkten sie ihr so gut wie keine Beachtung.
»Ich will nicht erwachsen werden«, hatte Belinda einmal dreist gestanden. »Erwachsen sein ist langweilig und unerfreulich und bringt finstere Mienen und Sorgen mit sich. Ich will für den Rest meines Lebens ein kleines Mädchen bleiben und Männer um mich haben, die sich um mich kümmern.«
»Besitzt du denn gar keine Selbstachtung, nicht einmal einen Funken davon?« fragte ich sie.
Sie zuckte die Achseln und ließ etwas Zartes in diesen Augen und auf diesen Lippen spielen, die auf so viele Gesichter ein Lächeln zauberten.
»Ich werde sie dann haben, wenn ich sie brauche«, erklärte sie.
Manchmal schnürte sich mein Magen zusammen, wenn ich mit ihr sprach. Dann spürte ich, wie sich die Muskeln in meinen Armen und Beinen zu stählernen Tauen anspannten. Die Frustration drohte mich zu zerbrechen. Am liebsten hätte ich sie geohrfeigt und eine Spur von Verstand in dieses alberne kleine Gesicht gehämmert.
Und dann umarmte sie mich jedesmal und sagte: »Du wirst genug Selbstachtung für uns beide haben, Olivia. Das weiß ich ganz genau. Ich kann ja so froh sein, dich als ältere Schwester zu haben.«
Hinterher eilte sie aus dem Haus, um ihre Freundinnen zu treffen und mit ihrer Schar von männlichen Verehrern zu flirten, und mir blieb es überlassen, die Aufgaben oder Pflichten zu erfüllen, die Daddy uns beiden aufgetragen hatte.
Ich muß gestehen, daß ich manchmal dastand, ihr beim Flirten zusah und wünschte, ich wäre ihr ähnlicher. Wenn sie nachts ihr Gesicht auf das Kopfkissen legte, war ihr Kopf immer von zuckersüßen Gedanken erfüllt, wogegen meiner zur Hauptstraße für die Parade der Sorgen und die Inspektion der Pflichten wurde. In ihren Ohren hallten Musik und verlockende Versprechungen. Meine waren mit Fakten und Terminen angefüllt. Ich war Daddys lebender Terminkalender. Er konnte seine Fingerspitzen auf Belindas Grübchen legen und ihr dieses Lächeln entlocken, das sein Herz wärmte, aber auf mich brauchte er nur mit dem Finger zu zeigen, damit ich ihm den Zweck eines geschäftlichen Treffens in allen Einzelheiten darlegte.
Es war nicht etwa so, als wäre er undankbar gewesen. Ich glaubte ihm, wenn er mit seinem »kleinen General« prahlte, aber etwas in meinem Inneren, die Belinda in mir, wünschte sich, daß er mich auch in anderer Hinsicht erwähnte. Ich weiß, daß er mich für bedeutsamer und vielversprechender hielt, wenn es darum ging, der Familie zum Erfolg zu verhelfen, aber sagte er sich denn nie, daß auch ich hübsch war? Konnte ich nicht attraktiv und verantwortungsbewußt zugleich sein?
Leider, schloß ich, dürften sich meine Befürchtungen bewahrheitet haben: Daddy war wie die meisten Männer; er wurde schwach, wenn er ein kokettes Lächeln sah, eine alberne, oberflächliche Geste, eine schnelle Umarmung und einen Kuß bekam, als wäre Zuneigung eine Art Ersatz für Verantwortungsbewußtsein und Fleiß.
Etwas in meinem Inneren sagte mir, wenn ich von Männern bewundert werden wollte, müßte ich meine Schwester nachahmen und anstelle von Gedanken und Ideen Seifenblasen in meinem Kopf schweben lassen.
Aber wäre ich dann glücklicher gewesen? Die meisten Männer, die mir in meinem Leben begegnet waren, wollten mich davon überzeugen, daß es der Fall wäre, aber ich war wild entschlossen, nicht wie meine Mutter das Spielzeug eines Mannes zu werden. Belinda hält sich für glücklich, aber sie begreift nicht, wie wenig die Männer wirklich von ihr halten und wie gering ihr Respekt vor ihr ist, schloß ich. Sie mochten sich zwar nach ihr sehnen und sie begehren, aber wenn sie ihre Lüste gestillt hatten, wenn sie sie ausgenutzt hatten, ihrer überdrüssig waren und sie achtlos liegen ließen, wo würde sie dann enden, wenn nicht im Elend? Sie würde an einem abgeschiedenen Ort um ihre verlorene Jugend und Schönheit weinen und die Welt dafür hassen, daß es so etwas wie den Alterungsprozeß gab. Sie würde als kleines Mädchen sterben.
Ich würde als Frau sterben, und ich würde mich nicht dazu mißbrauchen lassen, einen Mann zufriedenzustellen. Ja, ein Teil von mir wollte so sein wie Belinda, aber das war der Teil von mir, den mir Männer eingeimpft hatten, der Teil, den ich unterdrücken konnte.
Nennt mich ruhig den kleinen General. Nennt mich Miss Cold und Belinda Miss Hot, dachte ich.
Aber am Ende wird man vor mir Respekt haben, und was zählt am Ende wirklich mehr, Respekt oder Liebe? Niemand wußte wirklich, was Liebe war. Wie viele Ehemänner und Ehefrauen besaßen schon dieses sogenannte Zauberband?
Es war eine simple Entscheidung, fand ich: Träumer oder Realist zu sein und den Tag danach zu gestalten, was ich wollte, und nicht, was ich mir erhoffte.
1
Schreie in der Nacht
Anfangs glaubte ich zu träumen, denn als ich wach wurde und die Augen aufschlug, hörte ich nichts weiter als das leise Pfeifen des Windes, der vom Meer her wehte. Der Mondschein, der nur durch meine hauchdünnen weißen Gardinen gefiltert hereinströmte, tauchte die Wände in ein bleiches, gelbes Licht. Meine Fensterläden klapperten gegen die Schindeln, und dann hörte ich das Geräusch wieder, diesmal mit weit aufgerissenen Augen. Ich lauschte, und die Erwartung einer entscheidenden Ankündigung oder eines bedeutenden Ereignisses ließ mein Herz einen stetig anschwellenden Trommelwirbel schlagen. Eine Weile später hörte ich das Geräusch wieder.
Es klang wie eine Katze beim Liebesspiel, aber wir hatten keine Katzen. Daddy haßte Haustiere, denn er empfand sie in erster Linie als Verpflichtung, der er keinen Reiz abgewinnen konnte. Die einzigen Tiere, die seiner Ansicht nach einen Zweck erfüllten, waren Wachhunde oder Blindenhunde, und für beides hatte er keine Verwendung. Unser Haus lag weit genug vom Zentrum von Provincetown entfernt und war von drei Meter hohen Mauern mit einem großen Tor umgeben, das Daddy jeden Abend von Jerome, unserem Hausdiener, abschließen ließ. Außerdem bewahrte Daddy seine Schrotflinte unter dem Bett auf, »nur für alle Fälle«. Er sagte, das sei viel billiger, als einen Köter durchzufüttern, was sich nämlich, unter dem Strich, nicht lohnte.
Diesmal war das Geräusch sogar noch lauter. Ich setzte mich so schnell auf, daß man hätte meinen können, eine Feder hätte mich in die Höhe schnellen lassen, aber dann erkannte ich, daß die schrillen Schreie weder meiner Einbildung noch einem Alptraum
entsprangen. Die Geräusche drangen durch die Wand zwischen meinem und Belindas Zimmer. Es war nicht direkt ein Heulen, und es war auch kein Kreischen. Die Laute klangen irgendwie vertraut, und doch ging etwas äußerst Fremdes von ihnen aus. Es war gewiß kein Laut, den Belinda selbst von sich gab, doch er drang zweifellos aus ihrem Schlafzimmer.
Ich stieg aus dem Bett, nahm meinen Morgenmantel von dem Stuhl neben dem Bett und steckte die Arme in die Ärmel, als ich mein Zimmer verließ. Daddy und Mutter waren bereits aus ihrem Schlafzimmer gekommen. Mutter trug noch ihr Nachthemd, und Daddy stand in seinem Schlafanzug da. Das gräßliche Geräusch war immer noch zu hören.
»Was zum Teufel …« Daddy ging auf Belindas Tür zu. Ich folgte ihm, und Mutter hielt einen gewissen Abstand, aber als Daddy die Tür öffnete und erkannte, daß der furchtbare Schrei von Belinda ausgestoßen wurde, stürmte Mutter an seine Seite.
»Was ist los, Winston?« rief sie.
Daddy schaltete das Licht an, und uns bot sich ein absolut erstaunlicher und bedrohlicher Anblick.
Belinda lag auf dem Fußboden. Ihr Nachthemd war blutig und bis zu ihren Brüsten hochgezogen. Zwischen ihren Beinen lag ein neugeborener Säugling, der noch mit der Nabelschnur und der Nachgeburt verbunden war.
In Belindas Augen stand rasendes Entsetzen. Die Augen des Babys waren geschlossen. Es fuchtelte mit seinen winzigen Armen herum und blieb dann reglos liegen.
»Jesus, Maria und Josef«, rief Daddy tonlos aus. Das Erstaunen hatte seine Füße am Boden festgenagelt.
Mutters Augen rollten in ihren Kopf zurück, und sie brach vor Daddys Füßen zusammen, als sei ihr Rückgrat zu Gelee geworden.
»Leonora!«
»Bring sie ins Bett, Daddy«, sagte ich. »Ich kümmere mich um Belinda.«
Er vergewisserte sich noch einmal, daß sich ihm dieses Bild tatsächlich bot und er sich den Anblick nicht nur eingebildet hatte. Dann ging er in die Hocke, schlang einen Arm unter Mutters Achseln, hob sie hoch, als sei sie selbst ein Baby, und trug sie ins Schlafzimmer zurück.
Ich betrat Belindas Zimmer und schloß eilig die Tür hinter mir. Unsere Dienstboten im Erdgeschoß waren inzwischen bestimmt auch wach geworden. Belinda wimmerte. Ihre Augen verdrehten sich, als wankte der Raum. Sie hatte die Arme erhoben, fürchtete sich jedoch, den Säugling oder sich selbst zu berühren.
»Ich konnte nichts dagegen tun. Es ist von allein so gekommen, Olivia«, stöhnte sie. Sie bebte von Kopf bis Fuß. Ich trat zu ihr und sah auf den blutigen Anblick hinab.
»Du warst schwanger? Du bist die ganze Zeit schwanger gewesen?« fragte ich ungläubig.
»Ja«, sagte sie keuchend.
Jetzt leuchtete mir alles ein. Im Lauf der letzten Monate hatten Daddy und ich mehrfach Bemerkungen dazu gemacht, daß Belinda rapide zunahm. In der letzten Zeit hatte sie sich heißhungrig auf jede Mahlzeit gestürzt und schien sich überhaupt nicht an ihren breiten Hüften und ihrem aufgeschwemmten Gesicht zu stören. Mir war das eigentlich egal. Daddy war derjenige, der sich darüber beklagte. Seine geliebte kleine Barbie-Puppe verschwand vor seinen Augen, und an ihrer Stelle wuchs dieses zügellose Geschöpf heran, das sich keinen Zwang antat und das ich meine Schwester nannte.
O doch, ein- oder zweimal hatte ich Dinge gesagt wie: »Hast du denn gar keine Angst, daß du dein Gefolge von Verehrern verlieren wirst?«
Das schien ihr keine allzu großen Sorgen zu bereiten, obwohl es stimmte, daß immer weniger junge Männer zu Besuch kamen oder sie zum Segeln einluden, zu Spaziergängen am Strand oder zu einem Abend in der Stadt. Als ich sie jetzt anstarrte,
wie sie sich auf dem Fußboden ihres Schlafzimmers wand und ihr Kind stumm und regungslos zwischen ihren Schenkeln lag, begriff ich, warum sie mehrfach glühend darauf beharrt hatte, sich nicht nackt vor mir sehen zu lassen. In ihrem Kleiderschrank entdeckte ich eine Schachtel mit einem Korsett. Was ich jetzt auch verstand, war ihr plötzlich erwachtes und ganz untypisches Interesse an diesen unförmigen weiten Kleidern, die sie immer »Omakleider« nannte, wenn ich sie trug.
Ich kniete mich neben sie und streckte eine Hand nach dem winzigen Brustkorb des Säuglings aus. Er fühlte sich jetzt schon kalt an. Kein Herzschlag war zu fühlen, und die Brust hob und senkte sich auch nicht bei jedem Atemzug.
»Ich glaube nicht, daß es am Leben ist«, sagte ich.
Sie wimmerte wieder.
»Bitte, Olivia, bring es fort. Ich … kann es nicht anfassen«, sagte sie.
Ich ließ mir Zeit und starrte das runzlige kleine Geschöpf eine Weile an, betrachtete die Gesichtszüge, die blauen Lippen und die Finger, die so winzig waren, daß selbst einer meiner kleinen Finger so groß war wie fünf Finger an einer dieser kleinen Hände.
»Es war ein Junge«, sagte ich, aber nicht etwa, weil sie es wissen wollte, sondern nur, um meinen eigenen Gedanken laut auszusprechen.
Belinda schloß die Augen und begann zu hyperventilieren. Ich sah mir einen Moment lang an, wie sie litt, denn ich war immer noch verblüfft, wie gut sie dieses Geheimnis gehütet hatte. Was würde unser Daddy jetzt von seiner süßen kleinen Prinzessin halten, fragte ich mich.
»Machst du dir eigentlich die geringste Vorstellung davon, wie furchtbar das ist, Belinda? Hast du dir denn über diesen unvermeidlichen Ausgang keine Gedanken gemacht? Warum bist du nicht eher mit der Sprache herausgerückt, damit Daddy etwas
unternehmen konnte, statt alle hinters Licht zu führen und deine Schwangerschaft geheimzuhalten?«
»Ich hatte Angst«, murmelte sie und begann zu schniefen und zu schluchzen. »Ich dachte, dann hassen mich alle.«
»Ach, und jetzt lieben wir dich alle?« konterte ich. Sie schloß die Augen und hielt einen Moment den Atem an.
»Bitte, bitte, Olivia, hilf mir«, flehte sie.
»Wie viele Monate warst du schwanger?« fragte ich.
»Ich weiß es nicht genau, aber mindestens sechs oder sieben«, sagte sie eilig.
»Deshalb ist das Kind so winzig. Es ist eine Frühgeburt. Ich wußte, daß du mit manchen deiner Freunde Sex hattest, Belinda. Ich wußte es ganz einfach. Ich habe dir doch gleich gesagt, daß das passieren wird. Ich habe dich gewarnt. Und jetzt sieh dir an, was dir dein unbändiges, selbstsüchtiges Benehmen eingetragen hat.«
Sie schluchzte.
»Genau«, murmelte ich. »Wir werden alle einmal blinzeln, und schon ist es ungeschehen gemacht.«
»Bitte, Olivia …«
»Wer ist der Vater?« fragte ich schroff. Sie antwortete nicht. »Du mußt es sagen, Belinda. Wer auch immer es ist, er trägt mindestens die Hälfte der Verantwortung. Daddy wird es wissen wollen. Wer ist es? Arnold Miller?«
Das war ein Junge, mit dem sie viel mehr Zeit verbracht hatte als mit den anderen.
»Nein«, sagte sie eilig. »Arnold und ich sind nie weit genug gegangen.«
»Wer war es dann, Belinda? Ich denke gar nicht daran, Rätselraten mit dir zu spielen. Sag es mir. Wenn du es mir nicht sagst, lasse ich dich hier liegen. Dann kannst du die … Katastrophe selbst ausbaden.«
»Ich weiß es nicht«, jammerte sie. »Bitte, Olivia.«
»Wie kann es sein, daß du es nicht weißt? Es sei denn … mein
Gott, Belinda, mit wie vielen Jungen hast du geschlafen? Und so kurz hintereinander, daß du dich nicht festlegen kannst, wer der Vater dieses … dieses Kindes sein könnte?«
In dem Moment wußte ich nicht, was mir mehr ausmachte, daß sie so viele Geliebte hatte oder daß ich keinen einzigen gehabt hatte.
Sie schüttelte einfach nur den Kopf.
»Ich weiß es nicht, Olivia. Ich weiß es nicht. Ich will niemandem die Schuld zuschieben. Bitte.«
»Daddy wird eine Antwort von dir verlangen, Belinda«, warnte ich sie. »Er wird sich nicht mit einem ›Ich weiß es nicht‹ begnügen.«
Sie schlug die Augen auf und sah mich an, und einen Moment lang glaubte ich, sie würde den Vater ihres Babys nennen. War es jemand, den ich auch gut kannte?
»Also, was ist?«
»Ich kann niemandem die Schuld zuschieben, wenn ich es nicht mit Sicherheit weiß«, erklärte sie schließlich. »Das geht doch nicht, oder?«
»Jeden von ihnen trifft die Schuld. Du könntest sie ebensogut alle nennen und jeden einzelnen schwitzen lassen«, sagte ich, denn ich fand, das sei eine angemessene Strafe und obendrein ausgleichende Gerechtigkeit.
»Ich kann es nicht tun«, sie schüttelte den Kopf so heftig, daß ich glaubte, er würde sich von ihrem Hals losreißen.
»Von mir aus tu, was du tun mußt. Du wirst ja sehen, was passiert. Du wirst es selbst sehen«, sagte ich voraus.
Ich stand auf und ging in Belindas Bad, um Handtücher zu holen. Dann kehrte ich zurück und rollte den toten Säugling auf eines der Handtücher. Ich legte ihn gerade mitsamt der Nachgeburt und der Nabelschnur auf das Bett, als Daddy die Tür öffnete und eintrat. Er sah sich um, wobei seine Augen im ersten Moment Belinda mieden. Sein Blick fiel auf das Kind, ehe er mich fragend ansah.
»Ich glaube, es ist tot, Daddy«, sagte ich.
Er nickte.
»Höchstwahrscheinlich«, sagte er und ging auf das Bett zu. Langsam streckte er seine große Hand aus und legte die Spitze seines Zeigefingers an den Hals des Säuglings. »Ja«, sagte er. »Ein Segen.«
Belinda fing an zu wimmern.
»Laß das sein!« fauchte ich und beugte mich über sie. »Willst du etwa, daß Carmelita dich hört und angerannt kommt?«
Belinda drehte sich auf die Seite und schluchzte gedämpft.
»Kannst du sie säubern und sie wieder ins Bett bringen?« fragte mich Daddy.
»Ja, Daddy.«
»Blutet sie? Oder fehlt ihr sonst etwas? Werden wir einen Arzt brauchen?«
»Nein, das glaube ich nicht.«
»Vergewissere dich. Ich komme gleich wieder«, sagte er.
»Wie geht es Mutter?«
»Ich konnte sie inzwischen ein wenig beruhigen, aber sie zittert immer noch von Kopf bis Fuß«, sagte er bekümmert. »Sowie ich Belinda in die Badewanne gesetzt habe, schaue ich nach ihr«, versprach ich ihm.
»Gut.« Er eilte aus dem Zimmer.
»Steh auf, Belinda. Ich kann dich nicht heben und ins Bad tragen. Ich lasse Wasser in deine Wanne laufen. Bedeck dich wenigstens. Du bietest einen absolut ekelerregenden Anblick, wie du ächzend und stöhnend auf dem Boden liegst«, sagte ich.
Sie antwortete mit einem Wimmern und begann sich auf die Ellbogen zu ziehen. Sie hatte Blut an den Beinen, schien aber jetzt nicht mehr zu bluten. Sie holte wieder tief Atem und seufzte so tief, daß ich schon glaubte, sie sei bewußtlos geworden.
»Hast du Schmerzen?«
»Ich brauche keinen Arzt«, sagte sie. »Mir wird es bald wieder gutgehen.«
»Es mag sein, daß du keinen Arzt brauchst, aber ob es dir bald wieder gutgehen wird, bleibt abzuwarten«, sagte ich.
Ich warf noch einen Blick auf den toten Säugling. Die Farbe seines spärlichen Haares konnte ich nicht erkennen, weil klebriges Blut den Kopf überzog. Es war zwecklos, ihn zu betrachten, um zu bestimmen, wer der Vater sein könnte, sagte ich mir. Dann ging ich ins Bad, um für Belinda Wasser einlaufen zu lassen.
Nachdem ich ihr in die Wanne geholfen hatte, hörte ich Daddy ins Zimmer zurückkommen. Ich ging zur Tür und sah, daß er einen kleinen Schuhkarton aus Pappdeckel mitgebracht hatte. Er sah mich an, als er den toten Säugling hochhob, das Handtuch enger um ihn schlang und ihn dann so behutsam, als sei er noch am Leben, in den Karton legte.
»Wir werden selbst saubermachen müssen«, sagte er und wies mit einer Kopfbewegung auf den Fußboden. »Ich will nicht, daß die Dienstboten etwas erfahren, Olivia.«
»Darum kümmere ich mich schon, Daddy.«
»Wie geht es ihr?«
»Ihr fehlt nichts. Sie ist am Leben«, sagte ich mit scharfer Stimme. Er nickte wieder und nahm den Karton.
»Was wirst du jetzt tun, Daddy?«
Er blieb stehen.
»Ich werde das arme Ding begraben müssen«, sagte er.
Einen Moment lang stand ich nur da und starrte ihn an, wie er den behelfsmäßigen Sarg an sich drückte.
»Müssen wir es nicht irgend jemandem melden?« fragte ich. »Wenn wir das tun, Olivia, dann wird in jedem privaten Haushalt und in jedem Wirtshaus von Provincetown nur noch über diesen schrecklichen Vorfall geredet. Belinda wäre damit ganz bestimmt nicht geholfen, und für die Familie wäre es äußerst schädlich. Sie hat es blendend hingekriegt, all das vor uns geheimzuhalten, aber du mußt sie einem strengen Verhör unterziehen, um sicherzugehen, daß niemand sonst etwas davon weiß«, fügte er hinzu.
»Ja, Daddy.«
»Und vergiß nicht, nach deiner Mutter zu sehen, sowie du hier fertig bist.«
»Natürlich sehe ich nach ihr, Daddy.«
Er starrte einen Moment lang vor sich hin und sah dann den Karton in seinen Armen an.
»So müssen wir es halten«, sagte er, mehr zu sich selbst als zu mir. Dann wandte er sich ab und eilte mit dem Karton im Arm aus dem Schlafzimmer.
Ich kehrte ins Bad zurück und sorgte dafür, daß Belinda sich wusch. Ich half ihr beim Abtrocknen und brachte ihr dann ein frisches, sauberes Nachthemd. Nachdem ich sie wieder ins Bett gepackt hatte, ging ich nach unten und begab mich zur Besenkammer. Ich ertappte mich dabei, daß ich auf Zehenspitzen lief und in meinem eigenen Haus herumschlich wie ein Einbrecher, weil ich Carmelita, die das Haus sauberhielt und für uns kochte, und Jerome nicht wecken wollte. Ich holte einen Eimer, einen Schrubber, Scheuerlappen und Putzmittel. Dann kehrte ich in Belindas Zimmer zurück und füllte den Eimer mit heißem Wasser.
Zum Glück hatte sie sich von der Bettkante auf den Bettvorleger sinken lassen, und der Teppich hatte das meiste Blut aufgesogen. Ich rollte ihn zusammen und wischte dann alle Spuren des grauenhaften Vorfalls auf. Belinda lag mit geschlossenen Augen da, stöhnte leise und schluchzte gelegentlich. Während ich den Boden schrubbte, ließ ich einen erbarmungslosen Schwall von Klagen und bitteren Tadeln los.
»Diesmal hast du es wirklich geschafft. Mutter ist außer sich. Und Daddy war leichenblaß. Bis in alle Ewigkeit werden wir Alpträume haben. Was hast du denn geglaubt? Daß alles von allein wieder weggeht und niemand etwas davon erfährt?«
Ich unterbrach mich und sah in ihr mattes kleines Gesicht hinunter.
»Hast du geglaubt, eine Schwangerschaft sei so etwas wie
eine Erkältung oder die Masern? Vielleicht hast du dir bleibende Schäden zugefügt, Belinda. Vielleicht wirst du jetzt nie mehr auf anständige Weise ein Kind bekommen können.
Niemand wird dich jetzt noch heiraten wollen. Was hast du dir bloß dabei gedacht?« keifte ich. Wie konnte das passieren? fragte ich mich. Wie konnte jemand sich selbst und seiner Familie etwas Derartiges antun? Nicht einmal Belinda hätte ich das zugetraut.
»Bitte, Olivia. Bitte, hör auf. Bitte«, flehte sie und hielt sich die Ohren zu.
»Ich sollte wirklich aufhören. Ich sollte alles stehen und liegen lassen. Dann kannst du den Dreck selbst wegmachen«, murrte ich. »Weiß sonst noch jemand etwas von deiner Schwangerschaft? Du hast es doch nicht etwa einer deiner albernen Schulfreundinnen erzählt, oder?« bohrte ich. Belindas Freundinnen waren vorwiegend verwöhnte Gören, die meiner Meinung nach alle nur Stroh im Kopf hatten.
»Nein, niemand weiß etwas davon«, schwor sie mir. »Ich habe mich vor und nach dem Sportunterricht immer allein umgezogen, und ich habe nie in der Schule geduscht.«
»Ich rate dir, die Wahrheit zu sagen«, warnte ich sie.
Ich ging ins Bad und säuberte die Wanne, damit Carmelita auf keine Spuren der Tragödie stieß.
Daddy kehrte zurück. Sein dunkelbraunes Haar war wüst zerzaust, und seine Augen wirkten gemartert und schockiert. Er sah den Bettvorleger und die nassen Lappen und hob alles auf.
»Das werde ich auch alles verscharren«, murmelte er. »Es muß so sein, als sei nichts von alledem je passiert.«
Er sah sich panisch um.
»Du hast alles, Daddy. Du hast nichts vergessen.«
»Gut«, sagte er und stürmte hinaus. Nie hatte ich unseren Vater so rasend erlebt. Das jagte mir tatsächlich mehr Angst ein als Belinda, die die meiste Zeit mit geschlossenen Augen dalag.
Ich stellte mir vor, daß sie sich fürchtete, ihm jetzt ins Gesicht zu sehen.
Nachdem Daddy wieder gegangen war, machte ich mich auf den Weg zu Mutter, um nach ihr zu sehen. Sie saß auf der Bettkante und sammelte gerade ihre Kräfte, um aufzustehen und nach Belinda zu sehen. Sie sah immer noch recht blaß aus und atmete schwer.
»Mutter, du solltest dich wieder hinlegen«, sagte ich und eilte an ihre Seite.
»Wie geht es Belinda?«
»Sie wird bald wieder gesund sein. Ich habe dafür gesorgt daß sie sich wäscht und sich wieder ins Bett legt.«
»Und …«
»Um alles übrige hat sich Daddy gekümmert.«
»Gekümmert?«
»Das Baby ist augenblicklich gestorben, Mutter«, sagte ich. »Es war eine Frühgeburt. Daddy hat das Baby geholt und es irgendwo begraben. Er hat gesagt, er will nicht, daß jemand etwas davon erfährt.«
»Begraben?« keuchte sie und schüttelte den Kopf. »Gott, vergib uns«, flüsterte sie.
Ich glaubte, sie würde jeden Moment nach vorn sacken und auf den Boden fallen, und daher packte ich ihre Ellbogen und versuchte, sie dazu zu bringen, daß sie sich wieder ins Bett legte, aber sie schüttelte den Kopf.
»Ich muß nach ihr sehen, Olivia.«
Sie zog sich wacklig auf die Füße. Ich schlang einen Arm um ihre Taille und half ihr zur Tür. Sie fand mit jedem Schritt mehr Kraft und kehrte in Belindas Schlafzimmer zurück.
Belinda fing an zu schluchzen, als Mutter auf sie zukam.
»Es tut mir leid, Mommy«, flüsterte sie. »Es tut mir so leid.« Mutter setzte sich auf ihr Bett und zog sie an sich. Belinda weinte, und Mutter wiegte sie in ihren Armen.
»Mein armes Kind«, sagte sie.
»Armes Kind? Sie sollte ausgepeitscht werden«, murrte ich, aber auch mir tat sie gegen meinen Willen leid. Ich wollte ihr keine Spur von Mitleid entgegenbringen.
»Ganz ruhig, mein Liebling, ganz ruhig. Es ist alles wieder gut. Es wird alles wieder gut werden«, summte Mutter.
Schließlich hörte Belinda auf zu schniefen und wischte sich die Wangen trocken.
»Ich weiß, daß ich es dir hätte sagen sollen, Mommy, aber ich konnte es einfach nicht. Ich habe mich zu sehr geschämt und gefürchtet«, erklärte sie.
»Damit hast du alles nur noch schlimmer gemacht, Belinda. Ein solches Geheimnis kannst du nicht vor deinen Eltern und deiner Schwester bewahren«, sagte Mutter und sah mich an. Belinda sah mich auch an. »Wir lieben dich alle und möchten dir gern helfen.«
»Ich weiß, Mommy. Es tut mir leid«, sagte sie.
»Wie konnte so etwas passieren?« fragte Mutter. Es war ein heiseres Flüstern, und ihr Blick war jetzt mehr mir zugewandt als Belinda.
Soweit ich zurückdenken konnte, hatte sich Mutter an mich gewandt, wenn sie etwas über Belinda in Erfahrung bringen wollte. Sie ging immer davon aus, daß ich für meine jüngere Schwester verantwortlich war, aber ich hatte den größten Teil des Jahres im Mädchenpensionat verbracht. Ich war nicht dagewesen und wußte von Belindas Eroberungen nur durch die Gerüchte, die in Umlauf waren, und das Wenige, was ich in den Ferien selbst beobachtet hatte. Es war Belindas letztes Jahr im College, und ich fand, ihr würden zu viele Freiheiten zugestanden, viel größere Freiheiten als die, die mir gestattet worden waren. Wenn ich nicht im Haus war, war Mutter nicht auf dem laufenden, was Belinda tat und wo sie sich herumtrieb. Sie durfte bei ihren Freundinnen schlafen und bis weit nach Mitternacht ausgehen. Daddy war immer zu beschäftigt, um es zu bemerken. Und jetzt konnte man sehen, wohin das geführt hatte, sagte ich mir.
»Sie behauptet, sie wüßte nicht, wer der Vater ist«, stellte ich in den Raum. »Anscheinend gibt es zu viele Kandidaten.«
»Was?« fragte Mutter mit ungläubig verzerrtem Gesicht. Hielt sie Belinda etwa für eine Art Engel, bloß weil Daddy sie immer wie seinen kleinen Cherub behandelte? »Zu viele? Wie kann es zu viele gegeben haben, Belinda?«
»Ich weiß es nicht, Mommy. Bitte, ich will nicht daran denken. Bitte«, flehte sie und fing wieder an zu schluchzen.
»Wir sollten es wissen«, beharrte ich. »Daddy sollte es wissen und persönlich hingehen.«
»Vielleicht ist es besser, wenn wir es nicht wissen«, schloß Mutter und beugte sich Belindas tränenreichen Grimassen und ihrem Wehklagen. »Was nutzt das jetzt noch?«
»Menschen sollten für ihre Handlungen zur Verantwortung gezogen werden, Mutter. Daddy wird es wissen wollen«, fügte ich mit fester Stimme hinzu.
»Ich habe Durst«, stöhnte Belinda.
»Schon gut, Schätzchen, schon gut. Olivia wird dir ein Glas Wasser holen.«
»Ich brauche etwas Kälteres, ein Getränk mit Eis«, verlangte sie.
»Dann hol es dir doch selbst«, fauchte ich.
»Olivia, bitte«, sagte Mutter und sah mich mit ihren liebevollen Augen an.
»Wir sollten sie jetzt nicht verhätscheln, Mutter. Sie hat uns allen etwas Furchtbares angetan«, sagte ich, denn ich fühlte mich mißbraucht. Mutter sah mir weiterhin wortlos ins Gesicht und flehte mit ihren Augen. Ich wandte mich ab, eilte aus dem Zimmer und lief die Treppe hinunter.
Carmelita war endlich von den Schritten auf der Treppe und dem Treiben im ersten Stock geweckt worden. Sie war eine große Frau mit sehr dunkler Haut, halb Portugiesin, halb Negerin, das, was wir auf dem Kap eine Brava nennen, und sie arbeitete schon seit zehn Jahren für unsere Familie. Sie war Mitte vierzig,
schlank, hatte ein schmales Gesicht und Augen, die die Farbe von Obsidian hatten. Carmelita war für unsere Familie die perfekte Haushälterin und Köchin, denn sie war kräftig, tüchtig und unaufdringlich. Sie schien uns alle kritiklos hinzunehmen, ohne sich eine Meinung zu bilden, und wenn sie nicht arbeitete, zog sie sich diskret zurück.
Ihr Haar, so schwarz wie Lakritze, hing gelöst auf den Schultern, als sie in Nachthemd und Morgenmantel aus ihren Räumlichkeiten kam.
»Ist jemand krank?« fragte sie.
»Belinda«, sagte ich.
»Ach. Kann ich irgendwie behilflich sein?«
»Nein, danke, Carmelita«, sagte ich. »Ich komme schon allein zurecht«, sagte ich entschieden. Einen Moment lang heftete sie ihre dunklen Augen auf mein Gesicht, ehe sie ausdruckslos nickte und sich wieder in die Dienstbotenzimmer am hinteren Ende des Hauses zurückzog. Ich wußte, daß sie mir nicht glaubte, aber selbst, als ich noch ein kleines Mädchen war, hatte Carmelita nichts, was ich zu ihr sagte, je in Frage gestellt.
Als ich Belindas Getränk aus der Küche holte, kam Daddy durch die Hintertür und die Speisekammer ins Haus. Er stand einen Moment lang da, sein Gesicht schweißüberströmt, seine Hände mit Erde verkrustet.
»Alles erledigt«, sagte er. »Wie steht es oben?« fragte er dann und blickte zur Decke auf.
»Mutter ist bei ihr. Ich hole ihr gerade ein kaltes Getränk.«
Daddy nickte und betrachtete seine schmutzigen Handgelenke und Hände, ehe er mich wieder ansah.
»Du verstehst doch, warum ich es so handhabe, nicht wahr, Olivia? Unter dem Strich ist es das Beste zum Schutz der ganzen Familie.«
»Ja, das verstehe ich, Daddy.«
»Sie hat dir gesagt, daß niemand sonst etwas davon weiß?«
»Behauptet hat sie es«, erwiderte ich, wenn auch nicht ohne skeptisch zu gucken, was Daddy jedoch ignorierte.
»Gut«, sagte er. »Gut.«
»Sie will mir allerdings nicht sagen, wer der Vater ist«, fügte ich hinzu. »Sie behauptet, sie wüßte es nicht.«
Er schüttelte den Kopf.
»Vielleicht ist es besser so. Wir können es uns nicht leisten, Anschuldigungen vorzubringen, ohne zu riskieren, daß wir in einem Hornissennest herumstochern.«
»Wer auch immer es ist, er sollte nicht ungeschoren davonkommen, Daddy.«
»Es ist aus und vorbei«, sagte er. »Wir sollten das alles begraben und die Dinge ruhen lassen«, fügte er hinzu und ging dann, um sich die Hände zu waschen, ehe er zu Belinda zurückkehrte. Wieder einmal, dachte ich, kommt meine verzogene Schwester mit einer ihrer abscheulichen Schandtaten ungeschoren davon.
Als ich mit dem Wasserglas in Belindas Zimmer zurückkehrte, hatte Mutter dafür gesorgt, daß sie es sich bequem gemacht hatte und ruhig dalag. Ich reichte ihr das kalte Getränk, und sie nippte daran und blickte lächelnd zu mir auf.
»Danke, Olivia. Es tut mir leid, daß du meinetwegen soviel durchmachen mußtest.«
»Das mußte ich allerdings«, sagte ich, ohne mit der Wimper zu zucken. Es sah aus, als würde sie gleich wieder in Tränen ausbrechen, und dann würde sich Mutter noch elender fühlen. »Ruh dich jetzt aus, Belinda. Du willst doch nicht ernstlich krank werden«, fügte ich gnädig hinzu. Ihr Gesichtsausdruck verwandelte sich augenblicklich. Dankbarkeit drückte sich auf ihren Zügen aus, und sie nahm meine Hand. »Du bist meine beste Schwester«, sagte sie. Fast hätte ich gelacht.
»Ich bin deine einzige Schwester, Belinda.«
»Ich weiß, aber du bist so gut zu mir.«
»Ja, sie ist gut zu dir. Sie ist gut zu uns allen«, sagte Mutter
und lächelte mich an. »Und jetzt haben wir alle dringend unsere Ruhe nötig.«
»Wie kannst du jetzt schlafen, als sei nichts passiert?« murrte ich. Falls Mutter mich hörte, ignorierte sie meine Worte bewußt.
Daddy öffnete die Tür und sah hinein.
»Was ist?« fragte er.
»Es geht ihr gut, Winston«, sagte Mutter.
»Das ist gut. Es ist das beste, wenn wir uns so benehmen, als sei nichts vorgefallen«, riet er uns.
»Du könntest ebensogut so tun, als sei dort draußen kein Meer«, bemerkte ich.
»Dein Vater hat recht, Olivia. Es ist niemandem damit gedient, daß wir darüber reden. Selbst unter uns sollten wir es nicht zur Sprache bringen. Laß uns die Augen schließen und uns vorstellen, es sei nur ein Alptraum gewesen«, schlug sie vor.
Es überraschte mich nicht, diese Worte von ihr zu hören. So und nicht anders handelte Mutter die meisten unerfreulichen Dinge in ihrem Leben ab. Selbst ein Ereignis wie dieses wurde nicht anders gehandhabt.
Sie beugte sich vor, um Belinda einen Kuß zu geben. Belinda lächelte sie an, und dann verließ Mutter das Zimmer. Daddy stand noch einen Moment lang da und musterte mich, den Fußboden und schließlich Belinda.
»Wir gehen jetzt alle schlafen«, sagte er und ging.
Ich sah Belinda an. Sie lächelte zaghaft, doch ich sah sie kopfschüttelnd an.
»Ich bin so müde, Olivia«, sagte sie. »Ich fühle mich auch innerlich so schwach, aber ich wollte niemandem Sorgen bereiten. Daddy würde es gar nicht gefallen, wenn ich zum Arzt gehen müßte.«
»Du wirst es überleben«, sagte ich. »Und jetzt schlaf.«
Ich sah mich noch einmal im Zimmer um, ehe ich ging. In der Tür blieb ich stehen und schaute Belinda an. Sie wirkte so zart,
als sei sie wieder ein kleines Mädchen. Im nächsten Moment war sie eingeschlafen.
Ich lag wach in meinem Bett und dachte weder an Belinda noch an meine Eltern. Ich dachte an den toten Säugling, dessen Lebensfunke so schnell erloschen war und der schon so kurz darauf irgendwo auf unserem Grundstück verscharrt worden war, so daß er gewiß keine Erinnerung besaß, jemals in diese Familie hineingeboren zu sein.
Ich fand, im Moment sei er glücklicher dran als wir übrigen.
Belinda blieb für den Rest der Woche zu Hause. Wir erzählten jedem, sie hätte die Grippe. Ich bildete mir ein, Carmelita wüßte, daß etwas viel Ernsthafteres vorgefallen war. Sie brachte Belinda die Mahlzeiten und sah daher, daß sie nicht hustete und ihre Nase nicht lief. Mutter verhätschelte Belinda und benahm sich, als seien unsere Lügen wirklich wahr. Ich hörte, wie sie am Telefon mit ihren Freundinnen redete und ihnen erzählte, wie krank Belinda war.
»Abends ging es ihr noch so gut, und am nächsten Tag hat sie sich hundeelend gefühlt«, redete sie drauflos und beschrieb die Symptome. Sie behauptete sogar, sie hätte den Arzt angerufen, um seinen Rat einzuholen.
All das widerte mich an. Am meisten überraschte mich, wie schnell sich Daddy an die Fassade gewöhnte, die er und Mutter errichtet hatten. Am folgenden Morgen war er um die gewohnte Zeit auf, saß angekleidet am Frühstückstisch und las seine Zeitung, als handelte es sich bei den Ereignissen der vergangenen Nacht tatsächlich nur um einen bösen Traum. In seinem Gesicht fand ich keinen Hinweis, bis auf den kurzen, scharfen Blick, mit dem er mich ansah, als Carmelita ins Eßzimmer kam und sich nach Belindas Befinden erkundigte. In dem Moment setzte Mutter zu ihren weitschweifigen, detaillierten Erklärungen an und sprudelte einen Schwall von plätschernden Notlügen heraus. Daddy machte einen äußerst zufriedenen Eindruck.
Seit meiner Rückkehr aus dem Mädchenpensionat arbeitete ich als Buchhaltungslehrling für ihn. Daddy hatte beschlossen, es sei die reinste Vergeudung, mich in eine liberale Kunstschule zu schicken, »nur um die Zeit zu überbrücken, bis du einen braven, anständigen Mann zum Heiraten findest, Olivia. Jeder Mann, der für eine Ehe mit dir in Frage kommt, wird es zu schätzen wissen, daß du praktische Erfahrung mitbringst.«
Ich war ohnehin nicht scharf darauf, aufs College zu gehen, und im Umgang mit Zahlen hatte ich mich schon immer sehr geschickt angestellt. Daddy behauptete, ich besäße einen ausgeprägten Geschäftssinn. Er sagte, das hätte er schon gewußt, als ich als kleines Mädchen Moosbeeren aus unserem Sumpf verkauft hatte. An der Straße, die durch unser Anwesen führte, baute ich einen Verkaufsstand auf. Die Touristen fanden es niedlich, ein kleines Mädchen zu sehen, das im Umgang mit Geld einen solchen Ernst an den Tag legte. Daddy zeigte sich beeindruckt davon, daß ich ihm mein Geld komplett aushändigte und ihn bat, es für mich auf einem verzinsten Sparkonto anzulegen, statt es in Süßwarengeschäften und Spielzeugläden auszugeben.
»Wenigstens habe ich jemanden in der Familie, dem ich mein Geschäft vererben kann«, erklärte er. Er hatte sich damit abgefunden, daß er keinen Sohn haben würde, aber ich glaube, mit der Zeit empfand er mich nicht mehr als einen minderwertigen Ersatz. Dazu machte er mir im Büro zu viele Komplimente.
Daddy war ein Selfmademan, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Millionär, dessen Erfolgsgeschichte den amerikanischen Traum veranschaulichte: ein kleiner Unternehmer, der kluge geschäftliche Entscheidungen traf und seine Firma aufbaute, die er dann langsam, aber stetig vergrößerte. Viele Lokalzeitungen berichteten ausführlich über ihn, und sogar in den Tageszeitungen von Boston wurde ein Artikel über ihn veröffentlicht.
Er hatte mit einem einzigen Fischerboot begonnen und dann ein zweites und ein drittes gekauft. Es dauerte nicht lange, bis er eine ganze Flotte besaß, die einen ständig wachsenden überregionalen
Markt mit Meeresfrüchten versorgte. Im Lauf der Expansion kam eine Konservenfabrik für Krabben in Boston hinzu. Später baute er eine beeindruckende Kette von verwandten Geschäftszweigen auf und griff zu der scharfsinnigen Maßnahme, einen maßgeblichen Marktanteil auf dem Transportsektor zu erwerben, damit er seine laufenden Geschäftskosten selbst bestimmen konnte. Seinem eigenen Eingeständnis zufolge war er zeitweilig ein unbarmherziger Geschäftsmann gewesen, der den Wettbewerb im Keim erstickt und seine Preise gesenkt hatte, um Rivalen aus seinem Territorium zu vertreiben. Sein Ansehen in der Politik wuchs ständig. Die Regierung schloß Verträge mit ihm ab, und er weitete seinen Einflußbereich zusehends aus, während er gleichzeitig die Märkte, über die er bereits herrschte, halten konnte.
Nach weniger als sechs Monaten kannte ich unser Stammhaus in- und auswendig, und Daddy gestattete mir sogar, bei einigen seiner geschäftlichen Besprechungen anwesend zu sein, damit ich zuhören und noch mehr dazulernen konnte. Nach diesen Terminen wandte er sich oft an mich, weil er meine Meinung hören wollte, und häufig befolgte er meine Ratschläge.
Belinda dagegen kannte sich nicht im geringsten aus, wenn es um unsere Firma ging. Nach ihrem Benehmen und ihren Einstellungen zu urteilen, strömte ein unablässiger Geldregen auf uns herab. Wenn wir Geld brauchten, war es da, und es kam nie zu einer Dürreperiode. Die Worte: »Das können wir uns nicht leisten, Belinda«, hatte sie niemals gehört.
Ich hielt ihr oft Strafpredigten, weil sie undankbar war und all das nicht zu würdigen wußte.
»Du nimmst alles, was du hast, als selbstverständlich hin, ganz so, als stünde es dir zu«, warf ich ihr vor.
Sie sah mich mit ihrem reizenden Lächeln an und zuckte die Achseln. Ich hätte sie eines Mordes bezichtigen können, und sie hätte genauso reagiert. Sie ließ sich selten auf eine Diskussion ein oder stritt etwas ab. Es war, als glaubte sie, gegen Verantwortung
und Schuldbewußtsein würde sie immer immun sein, weil ihr eine Art heiliger Absolution erteilt worden war, und sie genau das tun konnte, was ihr kleines Herz gerade begehrte, ungeachtet aller Konsequenzen.
Selbst jetzt bewahrheitete sich das wieder, sagte ich mir erbost, da unsere Eltern behaupteten, es sei besser, so zu tun, als sei nichts vorgefallen. Belinda hatte Grippe, das war alles. Fast glaubte ich, Daddy hätte sich selbst eingeredet, daß er keine Frühgeburt verscharrt hatte.
Als ich am Tag darauf aus dem Büro zurückkam, schlenderte ich hinter unserem Haus umher, denn ich war neugierig, ob ich die Grabstätte finden würde, obwohl sie nicht markiert war. Hinter dem Haus erstreckte sich unser Grundstück fast einen Morgen weit zu den Klippen, von denen aus man auf den Atlantischen Ozean blickte. Sie fielen jäh zu dem felsigen Strand ab. Es gab etliche ungefährliche Fußpfade, die zu unserem kleinen Privatstrand führten, nicht weiter als einen Steinwurf entfernt. In unserem Garten standen Ahornbäume mit ausladenden Kronen und einige Eichen, und ein großer Teil des Landes war in seinem ursprünglichen Zustand belassen worden. Zwischen den Brombeersträuchern wuchsen Giftsumach und wilde Rosen, und mehr als einmal war Belinda damit in Berührung gekommen und hatte hinterher wochenlang an den Folgen gelitten.
Ein großer Rasen wurde von Krokusbüscheln, Kaisertulpen, Narzissen und Osterglocken gesäumt. Es gab eine Laube und einen Teich mit Bänken am Ufer, und ich fand es enorm erholsam, dort zu sitzen und auf das Meer hinauszuschauen.
Manchmal lief ich bis an den Rand der Klippen und beobachtete die Gezeiten, hypnotisiert von den rhythmischen Bewegungen der Wellen, der Wogen, die sich brachen, der Gischt, die von den Felsen aufsprühte, und ich lauschte den Schreien der Möwen, wenn sie herabtauchten, um sich auf Muscheln zu stürzen. Oft trat ich an den Rand des Abgrunds und schloß die Augen.
Ich konnte meinen Körper schwanken spüren, als sei er in Versuchung, von der Klippe zu stürzen und auf den Felsen darunter zu zerschellen.
Als sie noch jünger war, fürchtete sich Belinda vor dem Ozean. Sie hatte keinen Spaß am Segeln, und die Gefahren der Kriegsschiffe und der Geruch von Seetang waren ihr ein Greuel. So gut wie nie, wenn überhaupt jemals, machte sie sich auf die Suche nach Treibholz. Für sie gab es nur einen einzigen Grund, an den Strand zu gehen, nämlich um dort eine Party zu feiern, und selbst dann hielt sie sich dem Wasser so fern, daß nicht einmal die Gischt der Wellen, die am Ufer barsten, sie besprühen konnte. Einmal nahm ich sie an den Rand der Klippen mit. Ich war damals neun, und sie war sieben, und ich forderte sie auf, die Augen zu schließen. Dieser Gedanke jagte ihr solche Angst ein, daß sie augenblicklich kehrtmachte und zum Haus zurückrannte. Daran dachte ich jetzt, und ich fragte mich, was ich wohl getan hätte, wenn sie von den Klippen gestürzt wäre.
Jerome war gerade damit fertig, Unkraut zu jäten, als ich auf der Suche nach dem Grab zur Hintertür hinauskam. Er nickte mir zu und machte sich auf den Weg zum Schuppen. Mit verschränkten Armen lief ich möglichst lässig den Pfad aus Schieferplatten hinunter und ließ dabei ständig meine Blicke umhergleiten, da ich nach Anzeichen Ausschau hielt, die auf frisch umgegrabene Erde hinwiesen. Ich lief bis zum Rand der Klippe, doch mir fiel nirgends etwas auf. Wo konnte Daddy den Karton und die anderen Sachen bloß verscharrt haben? Ein kleines Loch hätte wohl kaum genügt, oder doch?
Ich lief auf die Ahornbäume zu und blieb stehen, als ich glaubte, unter einem der Bäume eine Stelle gefunden zu haben, die so wirkte, als sei sie umgegraben worden. Ich trat näher, und als ich mich hinkniete und mir den Boden genauer ansah, beschloß ich, daß das der Ort sein mußte. Diese Vorstellung ließ mich erschauern, und ich stand auf, als rechnete ich damit, daß der tote Säugling stumm um Hilfe rufen würde.
Jahre später sollte ich an diese Stelle zurückkehren und sie vollständig überwachsen vorfinden, doch inmitten des Fingergrases und des flachen Gärtnergrüns würden sich Wacholdersträucher in der Brise vom Meer her wiegen und mich wieder an diese entsetzliche Nacht erinnern.
Im Moment war ich jedoch erbost. Es behagte mir überhaupt nicht, mich deprimiert zu fühlen. Und es paßte mir auch nicht, Belindas Sünden zu begraben, weil ich nichts von Lügen hielt. Wer lügt, ist angreifbar und schwach, sagte ich mir. Daddy stand aufgrund dessen, was er getan hatte, in meinen Augen jetzt als ein weitaus schwächerer Mann da als bisher, obwohl ich sicher war, daß auch er Alpträume hatte.
Ich floh von dem Ort und haßte Belinda dafür, daß sie uns alle in diese gräßliche Lage gebracht hatte.
Daddy hätte dafür sorgen müssen, daß Belinda die Konsequenzen selbst zu tragen hatte, fand ich. Statt dessen ließ er zu, daß sie die ganze Woche im Bett blieb und verhätschelt wurde. Ich glaubte, er würde das Thema nie wieder zur Sprache bringen, aber zu meinem Erstaunen schnitt er es an einem Abend gegen Ende jener Woche von sich aus an. Er saß in seinem Arbeitszimmer und überprüfte die Geschäftsbücher der Familie, als ich vorbeikam und er mich hereinrief.
»Mach die Tür zu, Olivia«, befahl er mir, sowie ich eintrat. Ich tat es und drehte mich dann zu ihm um. Er saß steif hinter seinem Schreibtisch. »Wir müssen all das hinter uns lassen, Olivia. Dein verändertes Benehmen in der letzten Woche ist mir aufgefallen. Du siehst mich an, als würdest du von mir erwarten, daß ich noch etwas sage oder tue.«
»Ich wollte mich nicht als dein Gewissen aufspielen, Daddy«, sagte ich, und er zuckte zusammen, als hätte ich ihm ins Gesicht gespuckt. »Es tut mir leid. Mir fällt es nun mal schwer, so zu tun, als sei nichts passiert.«
»Hör mir zu, Olivia. Die wichtigste aller Eigenschaften ist die Loyalität. Jede Familie ist eine Welt für sich, und jeder Angehörige
dieser kleinen Welt muß sie um jeden Preis beschützen. Nur dann kann man nach individueller Freiheit, Interessen und Talenten streben. Die Familie geht vor. Der einzige moralische Grundsatz lautet: Was gut für die Familie ist, ist gut«, sagte er und sah mich fest an. »Das ist die Lektion, die mich mein Vater gelehrt hat, und ich hoffe, daß auch du dir diese Lektion zu Herzen nehmen wirst.«
»Solange wir unter uns sind, können wir einander kritisieren und Dinge bereuen, aber sowie die Familie bedroht ist, müssen wir all das hintenanstellen. Das ist das Glaubensbekenntnis, nach dem ich lebe, Olivia. Es ist die einzige Flagge, vor der ich salutiere, und der einzige Zweck, für den ich mein Leben lassen würde.«
Ich starrte ihn einen Moment lang an. Daddy sah aus, als würde er gleich weinen. Seine Lippen waren fest zusammengekniffen, seine Wangen aufgeblasen.