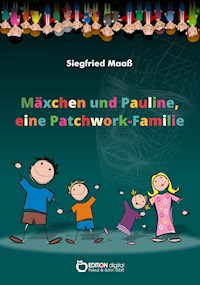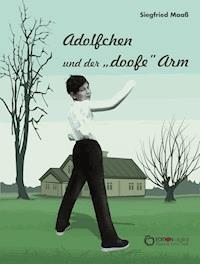6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein Mädchen sucht seinen Vater, den es mit seinen fast acht Jahren noch nie kennengelernt hat. Das ist zwar nicht schön, aber das ist so besonders auch wieder nicht. Zu etwas Besonderem wird die ganze Geschichte erst, wenn man erfährt, wie das kleine, hübsche Mädchen aussieht – etwas anders als ihre Altersgefährten: Jeden Morgen, wenn Peggy im Bad vor dem großen Spiegel steht, fällt ihr erneut auf, dass sie so ganz anders aussieht als Stefan und die übrigen Kinder in ihrer Klasse. Oder als ihr großer Bruder Mike und auch ihre Mutter. Dann wischt sie manchmal wütend über die Spiegelscheibe, als könnte sie damit das Bild, das sich ihr bietet, auslöschen oder zumindest nach ihren Wünschen verändern. Aber alles bleibt so, wie es schon seit sieben Jahren ist: Die kurze dicke Nase, die ihre Mutter als Stupsnase bezeichnet, und das schwarze krause Haar, das buschig vom Kopf absteht und das sie mit keinem normalen Kamm bezwingen kann. Ihre Augen sind so dunkel, dass sie manchmal selbst erschrickt, wenn sie sich ansieht und ihre Haut hat die Farbe von Vollmilchschokolade. Ihr seltsames und fremdes Aussehen hatte Peggy allerdings schon früher bemerkt, als sie noch kein Schulkind war, und wenn sie es nicht selbst bemerkt hätte, dann hätten sie andere Kinder darauf aufmerksam gemacht – wie Stefan, den sie zur Einschulung wiedertrifft und der sie später zu seiner Geburtstagsparty einlädt. Peggy muss auch einen Irrtum aufklären – nicht sie, sondern ihr Vater sei aus Afrika gekommen. Außerdem erklärte sie, dass man in Afrika nicht an Engel, sondern an Fügung glaubte, auch wenn sie nicht wusste, was das ist. Aber das klärt sich bald auf. Lange Zeit nicht geklärt bleibt dagegen das Verhältnis zu ihrer Oma, die nichts von ihrer dunkelhäutigen Enkeltochter wissen will und die sie deshalb im Gegensatz zu ihrem Bruder Mike nicht besuchen darf. Und es gibt noch mehr Unverständnis und regelrechte rassistische Anfeindungen, denen das kleine schwarze Mädchen ausgesetzt ist. So wird sie von mehreren größeren Jungen beleidigt und bedrängt und bei Stefans Geburtstagsparty macht eine Mitschülerin den unglaublichen Vorschlag, doch einmal eine Menschenjagd in Afrika nachzuspielen. Auch als Oma ins Krankenhaus kommt und Peggy sie dort besuchen und endlich kennenlernen darf, benehmen sich einige Leute sehr merkwürdig. Aber es gibt auch gute Menschen wie Stefan, der ihr sogar bei der gar nicht so einfachen Suche nach ihrem afrikanischen Vater hilft. Und vielleicht hat Peggy sogar Glück?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 104
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum
Siegfried Maaß
Peggy Vollmilchschokolade
ISBN 978-3-95655-634-0 (E-Book)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
Das Buch erschien erstmals 2002 im Projekte Verlag, Halle.
© 2016 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
1.
Jeden Morgen, wenn Peggy im Bad vor dem großen Spiegel steht, fällt ihr erneut auf, dass sie so ganz anders aussieht als Stefan und die übrigen Kinder in ihrer Klasse. Oder als ihr großer Bruder Mike und auch ihre Mutter. Dann wischt sie manchmal wütend über die Spiegelscheibe, als könnte sie damit das Bild, das sich ihr bietet, auslöschen oder zumindest nach ihren Wünschen verändern. Aber alles bleibt so, wie es schon seit sieben Jahren ist: Die kurze dicke Nase, die ihre Mutter als ‚Stupsnase' bezeichnet, und das schwarze krause Haar, das buschig vom Kopf absteht und das sie mit keinem normalen Kamm bezwingen kann. Ihre Augen sind so dunkel, dass sie manchmal selbst erschrickt, wenn sie sich ansieht und ihre Haut hat die Farbe von Vollmilchschokolade.
„Richtig zum Anbeißen“, hat dann auch mal jemand zu ihr gesagt und nachdem die Frau, die eine Bekannte ihrer Mutter war, sie sogar auf die Wange geküsst hatte, prüfte Peggy erst einmal vorsichtig, ob die Frau nicht tatsächlich ein Stück von ihr abgebissen hatte. Aber zum Glück fehlte nichts von ihrem Gesicht und es gab auch kein Loch in ihrer Wange. Trotzdem war sie seitdem sehr vorsichtig, wenn sie die Frau zufällig trafen, die ihr Hündchen ausführte, das so aussah, als hätte sie es selbst gestrickt. Meistens hielt sich Peggy dann an der Hand der Mutter fest und versteckte sich sogar hinter der Mutter, sobald sich die Frau zu ihr hinabbeugte. Von ihr wollte sich Peggy weder berühren oder auch nur übers Haar streichen lassen.
„Was hat sie denn nur?“, fragte die Frau Peggys Mutter darauf. Dann sah sie auf Peggy hinunter und schüttelte verständnislos den Kopf, wobei ihre langen blonden Haare wie ein Tuch im Wind flatterten. „Ich tu dir doch gar nichts.“
„Komm vor“, sagte die Mutter dann lachend und zog Peggy sanft nach vorn, sodass sie nun der Frau wieder gegenüber stand. Doch die rührte keine Hand mehr, um Peggy zu streicheln und die Lust zu einem Kuss auf Peggys Wange schien ihr dieses Mal auch vergangen zu sein. Sie bückte sich stattdessen zu ihrem Hündchen hinunter und strich beruhigend über dessen struppiges Fell, nachdem es böse zu knurren begonnen hatte, weil es wohl nicht begreifen konnte, dass jemand sein Frauchen nicht leiden mochte.
Ihr seltsames und fremdes Aussehen hatte Peggy natürlich schon bemerkt, ehe sie ein Schulkind geworden war und wenn es ihr damals nicht selbst aufgefallen wäre, hätten die Bemerkungen der anderen Kinder sie darauf aufmerksam gemacht. Sie erinnert sich, dass einmal ein Junge, der nur etwas größer war als sie selbst, zu ihr herantrat, vorsichtig seinen Finger ausstreckte und damit ihre Wange berührte.
„Du bist ja ganz braun“, sagte er erstaunt und betrachtete dann aufmerksam seinen Finger und schien sich zu wundern, dass der nicht ebenfalls braun geworden war. Das war, als sie sich nach einem Spaziergang im Stadtpark von der Hand der Mutter losgerissen hatte, um den Spielplatz zu erobern, der verlassen und scheinbar völlig vergessen vor ihr in der Sonne lag. „Peggy!“, rief die Mutter, aber Peggy achtete nicht darauf. Endlich würde ihr der schöne große Spielplatz einmal ganz allein gehören! Zuerst kletterte sie auf das Eisengerüst und kreischte erschreckt auf, weil die einzelnen Stäbe in der Sonne heiß geworden waren. Indem sie ihre in den Knien eingeknickten Beine wie ein Paar Haken benutzte, ließ sie mutig den Kopf herabhängen, der plötzlich von ihrem Rock wie von einem Vorhang verdeckt wurde. Als sie davon genug hatte, nahm sie einen weiten Anlauf und schwang sich auf das kleine Karussell, wo sie so lange ausharrte, bis es wieder stillstand. Anschließend lief sie zur Wippe, wo es ihr aber allein kein Vergnügen bereitete, sodass sie zu guter Letzt in den Sandkasten sprang, wo der Sand aufspritzte wie das Wasser in der Wanne, wenn sie mit der flachen Hand darauf schlug. Der Sand war sehr warm, was Peggy gut gefiel, genau wie heißes Badewasser und am liebsten hätte sie jetzt ‚Engel' gespielt und sich im Sand auf den Rücken gelegt und Arme und Beine weit von sich gestreckt. Aber sie wusste, dass die Mutter es nicht leiden konnte, wenn sie sich schmutzig machte und unterließ es darum. Die Mutter hatte sich inzwischen auf eine der Bänke gesetzt, die im Schatten großer Kastanienbäume standen und Peggy sah, dass sie sich eine Zigarette anzündete und sie hoffte deshalb, dass sie selbst nun genug Zeit zum Spielen haben würde. Bald darauf setzte sich eine fremde Frau auf eine der anderen Bänke und der Junge, der zu ihr gehörte, kam langsam auf den Sandkasten zu und blieb dann bewegungslos davor stehen. Er sah Peggy neugierig an, ehe er schließlich zu ihr trat und mit seinem Finger ihre Wange berührte.
„Das ist von der Sonne in Afrika und färbt nicht ab“, sagte Peggy, als sie bemerkte, wie der Junge erstaunt seinen Finger betrachtete. Dann versteckte er ihn unter den anderen und ballte eine Faust.
„Afrika ist aber weit“, meinte er und musterte Peggy so genau, dass sie unsicher wurde und drohend sagte: „Sieh mich bloß nicht so an, du, sonst ...“
„Ich hab keine Angst vor dir“, antwortete der Junge und hielt nun wie zur Abwehr seine Faust vor die Brust. „Auch wenn du aus Afrika bist.“
„Ich doch nicht“, sagte Peggy und achtete auf die Faust des fremden Jungen.
„Kommst du denn nicht von dort?“
„Nur mein Vater. Jetzt ist er wieder in Afrika. Und er ist viel dunkler als ich, sagt meine Mutter.“
„Meiner ist ganz hell, so wie ich, und er hat rote Haare.“ „So wie du? Vielleicht hat er auch solche Pickel.“
„Das sind keine Pickel, sondern Sommersprossen.“ Peggy lachte plötzlich laut und hielt sich die Hand vor den Mund. „Bekommst du dann auch Wintersprossen? Ich meine, wenn es richtig kalt wird?“
Der Junge streckte seine Faust angriffsbereit vor. „Du bist blöd“, sagte er. „Wintersprossen! So was Dummes habe ich noch nie gehört. Wintersprossen! Gibt es die vielleicht bei euch in Afrika?“
„Selbst blöd. Wintersprossen in Afrika! Ohne Winter vielleicht?“
„Ist es denn dort nie kalt?“
Peggy wusste nicht, was sie antworten sollte. Warum fragte der rothaarige Junge auch so doof! Sie ist doch selbst noch nie in Afrika gewesen und wenn sich ihre Mutter mit Rufino, ihrem Vater, nicht wieder vertrug, würde sie bestimmt auch niemals nach Afrika kommen. „Lass mich bloß in Ruhe!“, sagte sie böse und ahnte sofort, dass sie eigentlich auf sich selbst viel mehr böse war als auf den Rothaarigen. Er war doch nur neugierig und stellte seine dummen Fragen.
Wie auch sie welche stellte, das wusste sie doch von ihrer Mutter, die oft genug zu ihr sagte: „Verschon mich bloß mit deinen dummen Fragen!“
Der Junge hatte sich inzwischen in den Sand gesetzt und begann nun mit den Füßen einen Wall um sich aufzuschichten. Peggy blickte erstaunt zu seiner Mutter, die ihm von ihrer Bank aus zusah und sie wunderte sich, dass die fremde Frau kein Wort darüber verlor. Ihr Blick wanderte nun zu ihrer Mutter, die jedoch mit sich selbst beschäftigt schien und nicht auf ihre Tochter achtete. Langsam ließ sich Peggy darauf in den Sand nieder, zog sittsam ihren Rock über die Knie und versuchte nun ebenfalls einen Sandwall um sich aufzuschichten, was ihr aber nicht gelingen wollte. Darum legte sie sich flach auf den Rücken und streckte Arme und Beine von sich. „Ich bin jetzt ein Engel“, sagte sie zu dem Jungen, der seine Beschäftigung unterbrach und ihr zusah.
„Engel kommen aus dem Himmel“, meinte der Junge. „Aber du kommst aus Afrika.“
„Ich habe dir doch gesagt, bloß mein Papa kommt aus Afrika. Und wenn ich nun selbst ...“ Peggy blickte den Jungen ernst an, obwohl sie eigentlich gern gelacht hätte. Aber sie wusste plötzlich nicht, ob ihr Gedanke Ernst oder Spaß war. „Meinst du vielleicht, in Afrika glaubt man nicht an Engel?“
„Aber an schwarze“, antwortete der Junge ebenso ernst und schob nun den zusammengescharrten Sand wieder auseinander. „Ich meine, an solche wie dich.“
„Kann sein.“ Peggy wusste selbst nicht, woran man in Afrika glaubte und darüber schien auch ihre Mutter nicht gut Bescheid zu wissen. Sobald sie nämlich ihre Mutter fragte, weshalb sie beide hier lebten und Rufino dort in Afrika, erhielt sie zur Antwort, das würde sie, Peggy, noch nicht verstehen, das sei eine Art Fügung und damit müssten sie sich abfinden. Rufinos Familie habe es so beschlossen und danach müsse ihr Vater sich richten ...
„In Afrika glauben sie wahrscheinlich nicht an Engel“, sagte Peggy jetzt nachdenklich, „sondern an Fügung. Ich weiß bloß nicht, was das ist.“
Der Junge richtete sich auf und reckte seinen Rotschopf in die Höhe. „Soll ich meine Mutter fragen? Die ist nämlich ganz schlau.“
Peggy winkte ab. „Besser nicht. Sie weiß es vielleicht auch nicht und will es bloß nicht zugeben. Dann sagt sie nachher was Falsches. Oder sie sagt: Das kannst du sowieso noch nicht verstehen ...“
„Meine nicht“, begehrte der Junge auf und als ahnte sie, dass von ihr gesprochen wurde, rief die Mutter des Jungen nun: „Stefan, wir müssen jetzt gehen!“
Sofort schüttelte sich der Junge den Sand ab und sprang auf den Weg vor dem Sandkasten.
„Wenn Ferien sind und meine Mutter frei hat, kommen wir oft hierher“, erklärte Stefan. „Und du?“
Peggy hob die Schultern. „Nur manchmal, wenn wir spazieren gehen.“
„Wie heißt du?“, wollte Stefan noch wissen, obwohl es seine Mutter nun eilig zu haben schien und ihn nochmals rief. Nach Peggys Antwort riss er zuerst erstaunt seine Augen weit auf und begann dann laut zu lachen.
„Miss Peggy, wie das Schwein?“
„Unsinn!“ Peggy blickte ihn böse an. „Du bist doof! Seh ich vielleicht so aus? Außerdem heißt das Schwein Miss Piggi!“
„Ach so, stimmt ja! Hab ich bloß verwechselt.“ Stefan hob nun wieder seine Faust vor die Brust, aber Peggy wusste inzwischen, dass damit keine Gefahr für sie verbunden war. „Soll das vielleicht ein Name aus Afrika sein?“ „Kann sein.“ Peggy hob die Schultern. Warum stellte der rothaarige Junge immerzu solche Fragen, die sie nicht beantworten konnte? Aber sie nahm sich vor, gleich heute Abend ihre Mutter zu fragen, ob sie den Namen deshalb für sie ausgesucht hatte, weil sie selbst immer gern an Rufino und damit an Afrika erinnert sein wollte?
2.
Natürlich hat sich Peggy inzwischen längst daran gewöhnt, dass ihr kein helles Gesicht im Spiegel entgegensieht und es geschieht jetzt auch nicht mehr so oft, dass sie wütend über die Spiegelscheibe wischt. Trotzdem überkommt sie manchmal der Wunsch, ebenso hellhäutig wie ihr Bruder Mike oder ihre Mutter zu sein. Es brauchte für sie nie wieder etwas zu Weihnachten oder zum Geburtstag zu geben, auf alle Geschenke der Welt wollte sie gern verzichten, könnte sie nur wie die beiden aussehen. Dann würde auch jeder sofort erkennen, dass sie eine Familie sind, zu der sie genauso gehört wie Mama und Mike. Niemand würde sie dann auf der Straße neugierig und auffällig anstarren, weil sie nicht wie Weißbrot, sondern wie Vollmilchschokolade aussieht. Bestimmt könnte dann auch sie wie andere Kinder die Oma besuchen, die in einem kleinen Haus in der Altstadt wohnt, das sie aber nur von außen kennt. Mike lässt jedoch keine Woche verstreichen, ohne zur Oma zu gehen und jedes Mal prahlt er dann damit, dass er wieder einmal ‚ganz schön abgestaubt' hat, wobei er angeberisch auf seine Hosentaschen klopft. Dann raschelt es auffällig darin, aber Peggy weiß nicht, ob es tatsächlich Geldscheine sind, wie ihr Bruder behauptet. Vielleicht knistert in Wirklichkeit nur irgendwelches Bonbonpapier?
Aber meistens fällt ihrem Bruder noch rechtzeitig ein, dass er sich gemein zu ihr verhält. Vielleicht hat er auch ihr trauriges Gesicht bemerkt und will nicht, dass sie zu heulen anfängt? Oder spürt er dann, wie ungerecht es ist, dass er die Oma besuchen darf und Peggy nicht? Jedenfalls kramt Mike dann in seinen Hosentaschen und holt irgendetwas daraus hervor, das ihr Freude bereiten soll. Einen grünen Springfrosch aus Plastik zum Beispiel. Wenn man auf seinen Rücken drückt und sogleich wieder loslässt, springt er in zwei, drei großen Sätzen davon und achtet nicht darauf, wohin. Beim ersten Mal, nachdem Mike ihr sein Geschenk überreicht hatte, achtete Peggy aber nicht auf den vollen Suppenteller neben sich auf dem Tisch und ließ den Frosch einfach losspringen, mitten hinein in die heiße Suppe.
Die Mutter schrie auf und schimpfte, mal mit Mike, mal mit Peggy, aber ihr Bruder nahm Peggy in Schutz. „Ich habe ihr doch bloß etwas schenken wollen, weil sie nicht zu Oma darf. Warum lässt du sie denn nicht zu ihr? Es ist doch auch Peggys Oma.“
Peggy sah erwartungsvoll die Mutter an, deren Gesicht jetzt so aussah, als gehörte es ihr gar nicht, fremd und kalt. „Aber Peggy ist nicht Omas Enkelkind, begreifst du denn das nicht? Für Oma ist unsere Peggy überhaupt nicht da, es gibt sie einfach nicht. Das habe ich dir doch schon erklärt.“