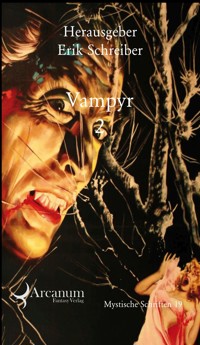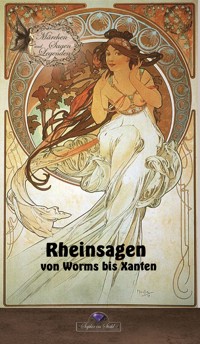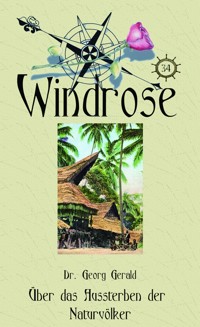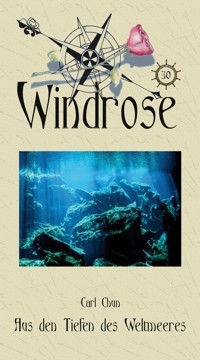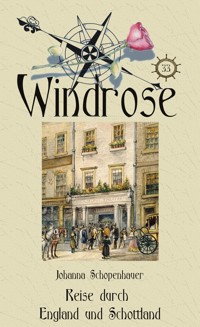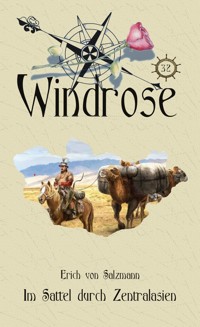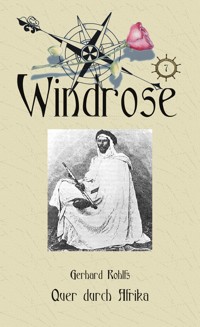
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Windrose
- Sprache: Deutsch
Das Buch Windrose mit seiner siebten Ausgabe präsentiert wieder einen Reisebericht über Afrika, während im Folgeband Neuseeland im Mittelpunkt stehen wird. Dieser alte Text beinhaltet Formen der Literatur, wie sie heute nicht mehr verwendet wird und beschreibt die Welt vor fast 150 Jahren. Wer sich für die Welt damals interessiert und sie gern mit der heutigen Zeit vergleicht ist hier richtig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum neobooks
Herausgeber
Erik Schreiber
Windrose 7
Reiseerzählungen
Gerhard Rohlfs
Quer durch Afrika
Saphir im Stahl
Reiserzählungen 7
e-book 197
Gerhard Rohlfs - Quer durch Afrika (1865 - 1867)
Erstveröffentlichung: F. A. Brockhaus (1874)
Erscheinungstermin 01.12.2023
© Saphir im Stahl Verlag
Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
www.saphir-im-stahl.de
Titelbild: Archiv Andromeda / Gerhard Rohlfs
Bearbeitung: Simon Faulhaber
Lektorat Peter Heller
Vertrieb neobook
Herausgeber
Erik Schreiber
Windrose 7
Reiseerzählungen
Gerhard Rohlfs
Quer durch Afrika
Saphir im Stahl
Erstes Kapitel
In Tripolis
Ende des Jahres 1864 kam ich von meiner Reise über den marokkanischen Atlas, durch Tafilet, Tuat und die Sahara gen Osten gehend in der Stadt Tripolis an. Es war meine Absicht, gleich dort zu bleiben, ohne erst wieder nach Europa zurückzukehren; allein die große Sehnsucht, meine Geschwister nach so langer Trennung wiederzusehen, sowie der Umstand, dass ich, alles reiflich erwogen, das Interesse an meiner neu projektierten Reise nach Innerafrika durch persönliche Vorstellung in Berlin, Gotha und Bremen nachdrücklicher als auf schriftlichem Wege zu fördern hoffte, bestimmten mich zur Änderung dieses Vorhabens. Ein längeres Weilen in Europa sollte mir freilich im Winter 1864/65 nicht beschieden sein.
Kaum hatte ich die Mittelmeerzone verlassen und war in Paris angelangt, als meine damals noch offenen Schusswunden mir derartige Beschwerden verursachten, dass ich daran denken musste, meinen Aufenthalt in Deutschland so viel als möglich abzukürzen. Nach einem flüchtigen Besuch bei meinen Geschwistern in Bremen eilte ich nach Gotha und konnte hier dem Mann, der sich meiner während der Reise durch Marokko mit so aufopfernder Tätigkeit angenommen hatte, Dr. Petermann, zuerst mündlich meinen Dank abstatten. Eingehend besprach ich mit ihm den Plan, von Tripolis aus über Rhadames dem Irharhar entlang oder im Tal desselben selbst bis Ideles zu gehen, das Hogar-Plateau zu übersteigen und auf der südwestlichen Seite desselben dem Tachirt folgend zum Niger vorzudringen.
Leider fand dieser Plan bei Dr. Barth in Berlin wenig Anklang – jedenfalls nur deshalb, weil er von Petermann, auf meine Aussagen gestützt, entworfen war. Denn der Grund, den Barth anführte, die Sicherheit meiner Person würde dabei aufs höchste gefährdet sein, da man in Tripolis in Erfahrung gebracht hatte, dass ich ein Christ und mein Gebaren nur Maske gewesen sei, erwies sich als hinfällig: Ich besuchte später in Rhadames oft die Moscheen, ohne dass jemand in meinen Mohammedanismus Zweifel gesetzt hat. Zudem verhält es sich in Afrika ebenso wie in den anderen Weltteilen: Die großen und relativ sichersten Verkehrsstraßen ziehen sich längs der Flüsse, durch die Uadis, Täler und Niederungen hin. Barth schlug dagegen vor, ich solle durch das Gebiet der Teda nach Uadai und Darfur gehen und so zu den westlichen Nilzuflüssen zu gelangen suchen. Genuss ebenfalls ein lohnendes Ziel, aber mindestens ebenso schwer zu erreichen, als über Ideles an den Niger vorzudringen.
Indes war es mir doch sehr lieb, dass ich noch mit Barth selbst über so mancherlei konferieren konnte. Mein Bruder Hermann, wegen des kalten Winters ängstlich besorgt um mich wie ein Vater um sein Kind, hatte es sich nicht nehmen lassen, mich nach Gotha und Berlin zu begleiten, und unvergesslich werden uns beiden die Stunden bleiben, die wir bei Barth, dem nun schon seit Jahren verewigten, und in dessen gastlichem Haus zubrachten. Aber trotz der sorgsamsten Pflege, die mir mein Bruder angedeihen ließ, verschlimmerte die Kälte den Zustand meiner Wunden derart, dass ich nun, wollte ich nicht bettlägrig werden, aufs schleunigste wieder ein warmes Klima aufsuchen musste.
So verließ ich denn schon am 23. Februar 1865 Bremen, um über Paris, Marseille und Malta nach Tripolis zurückzukehren. Ich hatte das Glück, in Malta, wo man sonst oft wochenlang vergebens auf eine Gelegenheit nach Tripolis warten kann, guten Anschluss zu finden, und am 19. März betrat ich wieder afrikanischen Boden.
Es ist ein eigen Ding um das Unternehmen einer Reise ins Innere von Afrika. Große und luxuriös angelegte Reisen sind in diesem Land eher hemmend als nutzbringend. Zwar hat die elegant und aufs reichste ausgestattete Barthsche Expedition, die im Verein mit denen Vogels, Richardsons und Overwegs mindestens hunderttausend Taler kostete – ich erinnere nur an die Kutsche, an das Schiff, welches mitgeführt wurde, und an die kostbaren Geschenke – im ganzen sehr gute Resultate ergeben; aber diese Expedition zerlegte sich in verschiedene Reisen, die unabhängig voneinander ausgeführt wurden.
Mir bangte deshalb auch keinen Augenblick davor, im Besitz einer verhältnismäßig so geringen Geldsumme die weite Reise anzutreten. Hatte ich doch meine erste Reise ganz ohne Mittel unternommen und auf der zweiten, durch ein Gebiet, dessen Längenausdehnung ungefähr der Distanz zwischen Lissabon und Memel gleichkommt, nicht mehr als tausend Taler gebraucht. Was mir diesmal an Geld zur Verfügung stand, belief sich auf etwa zweieinhalbtausend Taler. Dreihundert Taler hatte mir der Bremer Senat bewilligt, 275 Taler betrug das Karl Ritter-Stipendium von Berlin; das übrige bekam ich teils aus Gotha aus dem zur Aufsuchung Vogels in Deutschland aufgebrachten Kapital, teils aus meiner Vaterstadt Bremen, wo man eine freiwillige Sammlung zu meinem Besten veranstaltet hatte. An den mit Vogels Namen verknüpften Geldern hafteten übrigens keinerlei beschränkende Bedingungen für mich, und auch sonst waren mir von keinem der Geber irgendwelche Verpflichtungen in Bezug auf die Verwendung der Beträge auferlegt worden. Hinzufügen muss ich noch, dass die Londoner Geographische Gesellschaft, die mich schon einmal großmütig durch die Verleihung eines Stipendiums ausgezeichnet hatte, mir auch zu dieser Reise ein solches bewilligte.
Mit wie frohen Gefühlen landet der Afrikareisende, nachdem er die Fluten des Mittelmeeres durchfurcht, auf dem afrikanischen Kontinent, den er während der Dauer seiner Reisen gewissermaßen als seine Heimat betrachtet. Hier hofft er der geographischen Kenntnis neue Länder, neue Gebirge, Flüsse und Seen zu erschließen, hier hofft er neue Völker zu finden mit anderen Sitten, anderer Religion. Afrika ist in der Tat das Dorado der Reisenden.
Das erste Erfordernis, das ein Afrikareisender, wie überhaupt jeder, der unbekannte Gegenden durchforschen will, von Haus aus mitbringen muss, ist, dass er sich selbst gründlich kennt; denn nur nach einer strengen und unparteiischen Selbsterkenntnis darf man hoffen, sich die genügende Menschenkenntnis anzueignen, und Letztere ist nirgends so unentbehrlich als bei Reisen in Afrika, wo es täglich darauf ankommt, fremde Völker und Menschen richtig zu beurteilen. Gefahren drohen ja nur von einer Seite, von den Menschen. Die klimatischen Einflüsse dieser Gegenden lassen sich wirksam mit Chinin bekämpfen, und die von wilden Tieren kommenden Gefahren sind gleich Null; aber wie schwer ist es hier, den Freund vom Feind zu unterscheiden, umso schwerer, je höher die Stufe der sogenannten Zivilisation ist, die die Menschen einnehmen. Zweitens muss der Reisende Geduld im höchsten Grad besitzen, alle Arten von Strapazen, Hunger und Durst, selbst Kränkungen und Beschimpfungen ertragen können. Ohne diese Eigenschaften wird niemand in das Innere Afrikas einzudringen vermögen.
Mit den größten Schwierigkeiten ist immer der erste Schritt, die erste Etappe verbunden, namentlich das Durchkreuzen der Sahara. Wie viel tausend Dinge gibt es da nicht vorzusorgen und zu bedenken. Zu einer Reise durch die Sahara gehört eine ähnliche Ausrüstung wie zur Seereise auf einem Segelschiff. So wie der Kapitän eines Segelschiffes nie mit Bestimmtheit vorhersagen kann, an dem und dem Tag werde ich den Hafen erreichen, ebenso wenig kann der Karawanenführer zuverlässig behaupten, an dem oder jenem Punkt wird Wasser zu finden sein oder in so und so viel Tagen werden wir bei einer Oase anlangen. Desgleichen muss wie zu einer Seereise hinlänglicher Proviant mitgenommen werden. Trotz der mehr als tausendjährigen Erfahrung, wie oft geschieht es, dass die Lebensmittel- und Wasservorräte nicht ausreichen. Durch den Samum, durch die Hitze geht kein Mensch zugrunde, aber wie viele verschmachten alljährlich wegen Mangel an Trinkwasser. Was mich betrifft, so hatte ich einen Teil meiner Ausrüstung schon in Deutschland und Frankreich angeschafft: Ich kaufte in Paris die notwendigsten Instrumente, Aneroids, Thermometer, Hygrometer, Hypsometer, Bussolen etc., bei Lefaucheux die Waffen für meinen persönlichen Gebrauch, in Marseille die Medikamente und später in Lavalletta Teppiche, wollene Decken, Schwimmgürtel, Gewehre, Munition, Tee, Biskuits, einige Konserven und andere Gegenstände. In Tripolis endlich sollte das noch Fehlende ergänzt werden.
Aber abgesehen davon, dass Eingeborene und Europäer darin wetteifern, den europäischen Reisenden, den sie als eine Extrabeute betrachten, zu übervorteilen, hat das Einkaufen in Tripolis für den nicht Eingeweihten seine ganz besonderen Schwierigkeiten. Geht man z. B. auf den Markt, um ein Kamel oder irgendwelche Ware zu erstehen, so hat der Besitzer keinen Preis dafür oder er nennt wenigstens keinen. Auf die Frage: „Wie viel kostet das?“ hat er die stehende Antwort: „Biete!“ oder: „wie viel gibst du?“ Was soll nun aber der Neuling, dem die dortigen Verhältnisse fremd sind, auf einen Gegenstand bieten, dessen gewöhnlichen Preis er meist auch nicht annähernd kennt?
Und gar vieles fehlte noch zu meiner vollständigen Ausrüstung. Außer den Dienern, Kamelen und Kameltreibern war für diese Reise durch die wasserlose Sahara zunächst die nötige Anzahl Schläuche zu beschaffen. Auf gute Schläuche hat man das Hauptaugenmerk zu richten. Als die Besten gelten die von sudanischen Ziegen, nicht nur wegen ihrer Größe, sondern auch wegen der Dauerhaftigkeit des Leders. Ein Schlauch besteht aus dem ganzen ungenähten Fell einer Ziege oder eines Schafes. Um es ganz zu erhalten, zieht man den Körper des getöteten Tieres durch die Halsöffnung, die später als Mündung dient. Inwendig werden die Schläuche geteert, damit das Wasser länger vor Fäulnis geschützt bleibt und auch damit weniger Wasser durch Verdunstung verloren geht. Große Schläuche halten bis zu fünfundsiebzig Pfund Wasser.
Sodann mussten Kisten gezimmert werden, Kochgeschirr für die Leute und für mich, Proviant in benötigter Menge, Tauwerk, Beile und andere Werkzeuge, endlich Waren, die als Geschenke und Tauschmittel dienen sollten, gekauft werden: Burnusse von Tuch in den schreiendsten Farben, mit Gold bestickt, bunte Taschentücher, feineres und gröberes Baumwollenzeug, Maltese genannt, Turbane, achtzig Ellen lang (man denke sich, welche Zeit dazugehört, um einen solchen Turban, der allerdings aus ganz leichtem Stoff besteht, um den Kopf zu wickeln!), rote Mützen, einige Stück Samt und Seide, Essenzen, echte und unechte Korallen, ganze Zentner Glasperlen der verschiedensten Art, zirka fünfzigtausend Nadeln, wovon man in Tripolis für einen Mariatheresientaler etwa sechstausend Stück bekommt, natürlich von sehr grober Arbeit. Auch ordinäres Schreibpapier, das von Deutschland kommt, und Hunderte von Messern, ebenfalls deutschen Fabrikats, kaufte ich ein, so dass nach und nach meine Wohnung einem Kaufladen glich. Vor allem mussten dann noch Mariatheresientaler eingehandelt werden, die man in Malta, Tripolis oder Alexandria zum Durchschnittspreis von eineinhalb Taler erstehen kann.
Die Mariatheresientaler sind für Zentralafrika die beliebteste Münze. Sie müssen aber vom Jahr 1780 sein, und auf der Krone der Maria Theresia müssen sieben Punkte sich befinden. Taler, die nicht diese Jahreszahl haben oder der sieben Punkte ermangeln, werden von den Sudannegern unbedingt zurückgewiesen. In früheren Jahren hielt man in den Negerländern auch darauf, dass die Taler ein altes geschwärztes Aussehen hatten, und der Gatroner erzählte mir später, er habe unter Barth das mitgenommene Geld durch Lagerung zwischen Pulver geschwärzt. Den Grund, weshalb in ganz Zentralafrika ausschließlich der österreichische Taler gang und gäbe ist, vermochte ich nicht zu erfahren.
Überhaupt ist Deutschland keineswegs in geringem Maß an den nach Zentralafrika eingeführten Waren beteiligt. Nicht nur der Mariatheresientaler ist deutsch, die Waffen aus Hagen und Solingen, die Nadeln aus Iserlohn, Zündhölzchen und Stearinkerzen aus Wien, Tuche aus Sachsen, Papier und kleine Industrieerzeugnisse aus Nürnberg bekunden, dass die Mehrzahl der in Zentralafrika gebrauchten Waren am billigsten in Deutschland gefertigt werden. Dennoch mangelt es, mit Ausnahme weniger großer Häuser in Ägypten, gänzlich an direkten Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Nordafrika. Zum Teil liegt das wohl daran, dass bisher in den nordafrikanischen Staaten der Deutsche vollkommen schutzlos oder höchstens für seine persönliche Sicherheit auf einen fremden Konsul angewiesen war. Kamen aber, wie es vielfach geschehen ist, deutsche Kaufleute mit Waren nach Tripolis, oder wollten sie mit den dortigen Geschäftsleuten direkte Handelsverbindungen anknüpfen, so blieben ihre Bemühungen jedes Mal ohne Erfolg, weil ihnen die fremden Konsuln, auf die sie zählen zu können glaubten, alle möglichen Hindernisse in den Weg legten – ganz natürlich, denn es wäre dadurch ihren eigenen Schutzbefohlenen ein Teil des lukrativen Handels entzogen worden. Mit Unrecht sagen daher die Regierungen Deutschlands: „Weshalb sollen wir nach dem und dem Ort einen Konsul hinschicken? Wir haben dort keine Interessen, es leben keine deutschen Kaufleute da, die unseres Schutzes bedürftig wären.“ Deutsche Kaufleute können eben nicht hingehen, weil sie gegen die neidischen Umtriebe anderer Nationen keinen Schutz finden.
Ich bewohnte während meines Aufenthalts in Tripolis ein Haus in der Mschia, das ich zu dem Ende von einem Eingeborenen gemietet hatte. Ein einfaches Haus, nach orientalischer Sitte mit einem großen Hofraum, auf den sich die Wohnzimmer öffneten, auch mit Küchen-, Keller- und Wirtschaftsräumen versehen; hinter dem Haus war ein kleiner Garten, mit der Aussicht auf das Meer und mit Orangenbäumen bewachsen, welche zu der Zeit gerade blühten, so dass man sich kaum einen angenehmeren Aufenthalt wünschen konnte. Ich hatte die Wohnung auf dem Land vorgezogen, um ungestörter zu sein, da ich in der Stadt vor der allzu großen Liebenswürdigkeit und Umgänglichkeit der Tripoliner wenig Ruhe gehabt hätte.
Die eigentliche Glanzperiode in gesellschaftlicher Beziehung, die Zeit, als der Generalkonsul Warrington dort herrschte, war allerdings für Tripolis schon vorüber. Doch auch die trostlose Öde, welche jetzt über der europäischen Gesellschaft von Tripolis lagert, hatte damals noch nicht Platz gegriffen. An der Spitze des französischen Generalkonsulats stand Botta, der geistvolle Verfasser der „Monuments de Ninive“ und anderer gelehrter Bücher. Dass der Umgang mit einem so verdienstvollen Reisenden, der die Welt umsegelt, dann in Ägypten und Sennar die eingehendsten Studien gemacht und durch seine Abhandlungen über die assyrischen Keilschriften, die er in Ninive und Khorsabad entdeckte, den ersten Impuls zum Studium der Keilschriften gegeben hatte, äußerst anregend auf mich wirkte, brauche ich wohl kaum zu sagen. Dazu besaß Botta nicht nur gründliches Wissen, das er leicht und in anziehendster Form mitzuteilen verstand, sondern auch einen durchaus edlen, wahrhaft ritterlichen Charakter. Sohn des berühmten italienischen Geschichtsschreibers, folglich seiner Abstammung nach Italiener, war er in Frankreich aufgewachsen und erzogen worden, und seine Gastfreundschaft, sein freigiebiges, großmütiges Wesen stempelten ihn zu einem echten Franzosen. Als Kanzler fungierte neben ihm sein Freund Lequeux, aus Lothringen gebürtig, ein gelehrter Orientalist. Der englische Generalkonsul, der alte Colonel Hermann, ein Veteran des Krieges auf der spanischen Halbinsel, war zwar ein nicht durch Gelehrsamkeit ausgezeichneter, aber höchst liebenswürdiger Mann, dessen Haus ebenfalls von jeher einen gastlichen Sammelpunkt für die europäische Gesellschaft bildete. Leider bestand zwischen den beiden Generalkonsuln unversöhnliche Feindschaft, veranlaßt durch einen bei der Ankunft Bottas von Colonel Hermann begangenen Etikettefehler. So unbedeutend dieser Anlaß schien, hatte er doch zur Folge, dass die beiden Männer während ihrer ganzen Amtsperiode in Tripolis, die über zwanzig Jahre währte, sich niemals näher traten, nie grüßten und, falls sie es nicht vermeiden konnten, an einem dritten Ort zusammenzutreffen, einander vollständig ignorierten.
Zu den übrigen Mitgliedern der Gesellschaft in Tripolis zählten der amerikanische Konsul Mr. Porter mit Frau, der österreichische Konsul Rossi mit Frau, der spanische Generalkonsul mit großer Familie, verschiedene andere Konsuln und Kanzler, einige europäische Doktoren, darunter ein deutscher Pharmazeut und einige Kaufleute, welche die Konsular- und Gouverneurskreise frequentieren durften. Pascha-Gouverneur war zurzeit Mahmud-Pascha, der spätere Marineminister des Osmanischen Reiches.
Mit Letzterem stand ich auf dem besten Fuß. Er wusste, dass ich meine erste und zweite Reise unter der Maske eines Moslem gemacht hatte, und riet mir daher sehr ab, die südwestliche Route über Adelis und durch das Land der Tuareg zu wählen, da man mittlerweile erfahren haben müsse, dass ich kein wirklicher Muselman sei und ich mich daher in jenen Gegenden der größten Gefahr aussetzen würde. Ich blieb aber fest bei meinem Entschluss, ebendiese Route, und zwar zunächst bis Rhadames, einzuschlagen, und fuhr bis zum Ende fort, mich in mohammedanische Tracht zu kleiden, wohl wissend, dass ich von Rhadames aus nur unter dieser Verkleidung weiter vorzudringen hoffen konnte.
Meine Diener und Leute betreffend war ich diesmal recht gut bestellt. In erster Linie nenne ich Hammed Tandjaui, meinen erprobten Reisegefährten bei der Übersteigung des großen Atlas, sodann Mohammed Schtaui, einen Tripoliner, der, ehedem Diener im neapolitanischen Konsulat, wegen eines Mordes nach Amerika verbannt worden war (die türkische Regierung verbannt bisweilen Verbrecher nach der anderen Erdhälfte) und nach erfolgter Begnadigung von dort zurückkehrte. Er war wegen seines mürrischen, ungeselligen Wesens und namentlich wegen seines hervorstechenden Geizes eine wertvolle Akquisition für mich, insofern er lästige Besucher durch sein abstoßendes Benehmen von meiner Wohnung fernhielt, niemals gemeinsame Sache mit den übrigen Dienern machte und mit meinem Eigentum, selbst mir gegenüber, auf das Allersparsamste umging, weil Geizen ihm zur zweiten Natur geworden war. Nächst den Genannten wurden noch drei Farbige vom Stamm der Kanuri, Haussa und Teda engagiert.
Zu meiner Freude war ein Dampfer von Europa mit Briefen für mich eingelaufen. Ich beschäftigte mich nun eifrigst mit der Vollendung meiner Ausrüstung, und um der Stadt etwas näher zu sein, bezog ich das reizend gelegene Landhaus des Herrn Labi, eines jüdischen Eingeborenen, der mir dasselbe freundlichst zur Verfügung gestellt hatte; es war so geräumig, dass auch meine sämtlichen Diener darin Unterkommen fanden.
Von Seiten der europäischen Kolonie erfreute ich mich fortgesetzt zuvorkommender Aufmerksamkeit; Engländer, Franzosen, Spanier und Österreicher wetteiferten gleichsam, mir Liebenswürdiges zu erweisen. Unter anderen verkehrte ich viel mit dem Pater Präfekt, einem sehr würdigen Manne, der mit bischöflicher Vollmacht der katholischen Kirche in Tripolis vorsteht; wie er häufig mein Gast war, war ich auch meinerseits kein Verächter seiner trefflichen Küche und des guten Klosterweins. Die meiste Sympathie aber flößte mir der französische Generalkonsul Botta ein, denn er und sein Kanzler Mr. Lequeux waren die einzigen in der dortigen europäischen Gesellschaft, die für anderes, als was außerhalb des gewöhnlichen Lebenskreises liegt, Verständnis besaßen. Ich wusste zwischen ihm und dem englischen Generalkonsul Hermann stets meine Neutralität zu bewahren. Die beiden hatten sich, wie schon erzählt, nie gesprochen, nie besucht. Als Barth auf der Rückkehr von seiner großen Reise nach Tripolis kam, nahm er bei Colonel Hermann Quartier, mit dem er von früher her befreundet war. Botta stellte ihm schriftlich ein französisches Kriegsschiff, das gerade in Tripolis ankerte, für die Überfahrt nach Europa zur Disposition und lud ihn gleichzeitig zu einem Besuch ein. Aber Colonel Hermanns Eifersucht ließ weder das Anerbieten noch die Einladung in Barths Hände gelangen, so dass dieser sich nicht einmal für die Aufmerksamkeit bei Botta bedanken konnte. Auch zu mir hatte Colonel Hermann einst gesagt: „Ich sehe nicht gern, dass Sie die Franzosen frequentieren.“ Natürlich nahm ich keine Notiz davon, und er war taktvoll genug, mich seinen Ärger darüber nicht empfinden zu lassen.
Endlich nahte der Tag der Abreise. Den Abend vorher gab der amerikanische Konsul mir zu Ehren noch ein glänzendes Fest. Die sämtlichen Konsuln mit ihren Damen waren erschienen, selbst Mahmud-Pascha erhöhte den Glanz des Abends durch seine Gegenwart, und manche Flasche Champagner ward auf das glückliche Gelingen meiner Expedition geleert. Zum Abschied, ein Teil der Gäste hatte sich bereits entfernt, spielte mir Mrs. Porter die „Adelaide“ von Beethoven vor, was ich als ein besonders gutes Omen ansah, denn auch zu meiner zweiten Reise über den Atlas und nach Tuat hatten mir musikalische Klänge das Geleit gegeben. Als ich nämlich damals spät abends von El-Aghouat wegritt, tönten fern durch den Palmenwald Melodien aus der „Weißen Dame“ zu mir herüber, die ein französischer Offizier einem Waldhorn entlockte.
Bevor die Gesellschaft auseinanderging, ereignete sich noch eine komische Szene. Mein Diener Hammed Tandjaui war durch den Abschied von seinen Bekannten in eine wehmütige Stimmung versetzt worden und hatte dann, um sie zu verscheuchen, ganz gegen seine Gewohnheit etwas zu tief in die Arakiflasche geguckt. Da erschien ihm mein langes Ausbleiben bedenklich. Flugs machte er sich auf und lief von dem Landhaus in die Stadt, in die er, obgleich in Tripolis zur Nachtzeit die Tore geschlossen sind, sich unbemerkt einzuschleichen wusste. Plötzlich trat er nun in einem fast adamitischen Kostüm, eine große Laterne in der Hand, mitten in den Kreis der eleganten tripolinischen Damenwelt. Große Bestürzung zuerst und Ausrufe von „shocking, shocking!“, dann aber ein nicht aufhören wollendes Gelächter, unter welchem man sich trennte und eine gute Nacht wünschte – für mich die letzte in Tripolis.
Früh am 20. Mai war ich reisefertig. Als ich mich angekleidet und meine Geldbörse zu mir stecken wollte, vermisste ich ein Zwanzig-Franc-Stück; ich wusste ganz genau, dass ich tags zuvor hundert Francs aus der Kassette genommen hatte. Niemand anders, dachte ich, als Hammed, dem die Überwachung meines Geldes anvertraut war, kann das Stück entwendet haben, und in dem Verdacht, er habe sich seinen Rausch am vorigen Abend auf meine Kosten angetrunken, schlug ich, ohne auf die Beteuerungen seiner Unschuld zu hören, unbarmherzig auf ihn los. Durch die Ankunft einer Kavalkade aus der Stadt, an ihrer Spitze fast sämtliche Konsuln, welche herauskam, um mir bis zur Grenze der Mschia das Ehrengeleit zu geben, wurde glücklicherweise die Exekution unterbrochen, und zu meiner Beschämung fand ich bei wiederholtem Suchen in einer meiner Taschen das vermisste Goldstück. Hammed war außer sich; erst nach einigen Tagen gelang es mir, ihn zu beruhigen. „Ich weine nicht wegen der Schmerzen“, sagte er mehr als einmal, „die mir deine Schläge verursachten; aber ich werde nie vergessen, dass du an meiner Ehrlichkeit gezweifelt hast.“ Dennoch hat er vergessen und mir die unverdient empfangene Züchtigung nicht nachgetragen; er war und blieb mein treuester Diener, treu und ehrlich bis zu seinem frühen Tod.
„E-o-a! E-o-a!“ schrien die Kameltreiber, dann ihr einförmiges „Ssalam ala rassul oua nebbina“ (Heil und Frieden über unseren Gesandten und Propheten) anstimmend. Dazwischen wehklagten Abschied nehmende arabische Weiber oder stießen ein geltendes „Yu, Yu!“ aus. Das letzte Gepäck wurde auf die Kamele verteilt und befestigt, der Zug vollends geordnet, und um halbacht Uhr bewegte er sich, das Mittelmeer im Rücken, gemessenen Schrittes landeinwärts.
Zweites Kapitel
Von Tripolis nach Rhadames
Während am Tag zuvor ein starker Gebli (Südwind) die Temperatur schon zehn Uhr vormittags auf +40 Grad Celsius gesteigert hatte, wehte jetzt ein angenehmes Meerlüftchen, das bald zum kräftigen Behari (Nordwind) heranwuchs. „Der Wind bläst günstig!“ konnte ich wie der den Hafen verlassende Schiffer ausrufen. Unter lebhaftem Plaudern erreichten wir den östlichen Saum des Palmenwaldes, den Anfang der Sanddünen. Man hat hier in nächster Nähe von Tripolis ein echtes afrikanisches Bild vor sich: schlanke immergrüne Palmen, Orangen- und Olivenbäume mit saftigem Blätterschmuck, unmittelbar daneben aber die öde Sanddüne, und alles überwölbt von einem trübblauen Himmel. In Nordafrika ist der Himmel beständig in graue Schleier gehüllt; der klare und tiefblaue Himmel des europäischen Südens zeigt sich erst wieder in der Region der Haufenwolken, d. h. in Zentralafrika während der Regenzeit.
Beim Bir (Brunnen) Bu-Meliana am Rand der Dünen machte der Zug halt. Indes die Wasserschläuche gefüllt wurden, leerte ich mit den Herren aus der Stadt noch ein Glas Wein, dankte für ihre freundliche Begleitung und stieß auf ein glückliches Wiedersehen an. Dann bestieg ich mein Kamel; noch ein Händedruck, ein Gruß – und damit hatte ich für lange Zeit der Zivilisation Lebewohl gesagt.
Meine Karawane bestand außer mir aus sechs Leuten und ebenso vielen Kamelen. Nur ich und meine drei Diener waren bewaffnet, jeder von uns hatte immer eine Ladung für zwölf Schuss in Bereitschaft. Zuerst ging es in gerader südlicher Richtung hin; bergauf, bergab mussten sich unsere Tiere mühsam über und durch die weißen Sanddünen fortarbeiten. Nach einer Stunde kamen wir an den Bir Sbala, der wie der folgende, anderthalb Stunden davon entfernte Bir Huilet von einer kleinen krautreichen Einsenkung umfasst ist. Bei Letzterem fanden wir schon Araber mit einer weidenden Ziegenherde; der eigentliche Areg (die Sandzone) endet aber erst beim Bir Kicher, wo fruchtbares Ackerland beginnt. Hier teilt sich der Weg in zwei Arme. Man hatte uns gesagt, der westliche, der eine Richtung von 160 Grad hat, sei der nähere; wir verfolgten ihn und schlugen um halb vier Uhr nachmittags bei einem kleinen Duar (Zeltdorf) unser Lager auf. Da gab es nun noch viel zu ordnen und zu verbessern: Hier war eine Kiste zu schwer, dort ein Sack zu leicht; das Schuhzeug, d. h. die Sandalen der Leute, wurde neu und zweckmäßiger eingerichtet, kurz, die Zeit bis zur einbrechenden Nacht wurde zu allerhand Vorbereitungen für die Weiterreise benutzt.
Am anderen Morgen um sechs Uhr, nachdem ein zudringlicher Kerl, der sich für besonders heilig ausgab, mir seinen Segen, natürlich für Geld, erteilt hatte, zogen wir wieder ab, schlugen aber die südöstliche Richtung ein, da die Duarbewohner uns den östlichen Weg als den näheren bezeichneten.
Das Wetter war an diesem Tag ebenso günstig wie am vorhergehenden. Das Land fand ich zumeist gut angebaut, dennoch waren die Bewohner und ihre kleinen Zelte überaus ärmlich. Kaum kann man diese Behausungen noch Zelte nennen, und viele Familien besaßen nicht einmal solche, sondern noch elendere Hütten. Die Wirkung der das Volk aussaugenden türkischen Pascha-Wirtschaft macht sich eben auf Schritt und Tritt bemerkbar.
Südlich von uns und südöstlich zur Seite hatten wir jetzt das Gebirge. Um zwei Uhr erreichten wir die ersten Vorberge, deren östlicher, Djebel Batas, eine relative Höhe von fünfhundert Fuß haben mag. Wir begegneten hier einer Karawane, die mit Sklaven und Sklavinnen von Mursuk kam und mir von neuem bewies, dass der Menschenhandel in den türkischen Provinzen noch immer nicht aufgehört hat, trotzdem die Pforte den europäischen Mächten fortwährend das Gegenteil versichert. Ich werde später Gelegenheit nehmen, auf dieses Thema eingehend zurückzukommen; hier sei nur bemerkt, dass in Tripolis zu der Zeit – und es dürfte seitdem kaum anders geworden sein – gerade die Regierung selbst den Sklavenhandel in jeder Weise begünstigte.
Unser Marsch endete auch an diesem Tag schon um drei Uhr nachmittags. Die Treiber und Besitzer der Kamele, die ich zu meinen eigenen für die Reise gemietet hatte, weigerten sich nämlich weiterzugehen, und da ich selbst darauf bedacht sein musste, die Kräfte meiner Leute wie die der Kamele möglichst zu schonen, gab ich nicht ungern nach.
Am 22. Mai befanden wir uns bereits beim Ausmarsch zwischen den Vorbergen des Djebel Ghorian. Die Hitze hatte etwas zugenommen, belästigte uns jedoch wenig, weil wir jetzt in höhere Luftregionen eintraten. Wir kreuzten mehrere Male den Uadi Madjar und gelangten um neun Uhr an den Fuß des eigentlichen Gebirges. Die uns zugekehrte Seite seines Abhangs ist fast gar nicht bewachsen, aber die Formen der Berge bieten einen malerischen Anblick. Und während ihre Rücken meist kahl sind, strotzen die Schluchten und Täler vor herrlichstem Grün; Palmen-, Orangen-, Oliven- und Feigenwälder gewähren da eine erquickende Augenweide, umso erquickender, je monotoner die Ebene ist, die man eben durchzogen hat.
Aber wie hinaufkommen auf diese Bergwand? In der Tat hatten wir kein eigentliches Gebirge vor uns, sondern die zerklüftete Wand eines sehr hohen, ehedem wahrscheinlich die Grenze des nordafrikanischen Kontinents bildenden Ufers, das von weitem allerdings täuschend wie eine zusammenhängende Gebirgskette aussieht. Wie wird es möglich sein, dachte ich, die Kamele da hinaufzutreiben! Aber es ging besser, als ich geglaubt. Der Weg zieht sich in einer engen Schlucht aufwärts, und zwar mühsam, doch ohne erheblichen Unfall wurde er von unseren Kamelen zurückgelegt. Überhaupt ist dieser ganze Weg einer der schwierigsten, was örtliche Hindernisse anbetrifft, bedeutend gefährlicher als der über Sintan. Manchmal schauderte mich, wenn mein Kamel dicht an einem tiefen Abgrund hinschritt; aber die Kamele haben einen mindestens ebenso sicheren Gang wie die Maultiere, fast nie geschieht es, dass ein „Höcker“ zu Fall kommt. Die Araber nennen ein Kamel auch schlechtweg „Daher“, d. h. Höcker oder Buckel. Allerdings ist beim Bergabreiten die äußerste Vorsicht nötig; denn sich selbst überlassen, geraten die Tiere ins Rennen und halten nicht eher im Lauf ein, als bis sie wieder ebenen Boden unter den Beinen haben. Und wer je auf einem bergabreitenden Kamel gesessen hat, der kennt das Gefährliche dieser Situation. Unerträglich sind die Stöße und Püffe, die der Reiter empfängt; er muss sich sobald als möglich von seinem Sitz herabgleiten lassen, sonst riskiert er an einen Stein oder in die Tiefe eines Abgrunds geschleudert zu werden. Auch die Ladung, durch die heftigen Bewegungen des Tieres aus dem Gleichgewicht gebracht, löst sich los und fällt stückweise hinten und von den Seiten herab. Am schlimmsten aber ist es, wenn die zusammengebundenen Kisten oder Säcke dem Tier auf den Hals rutschen. Dann wird es wütend, rennt mit verdoppelter Schnelligkeit und prallt entweder gegen einen Felsen oder bricht sich, da es auf die Hindernisse des Weges nicht achtet, die Beine. Beim Passieren steiler Abhänge hemmt, oder um mich eines Schiffsausdrucks zu bedienen, stoppt man daher den Lauf des Kamels, indem der Treiber, bisweilen auch zwei, den Schwanz des Tieres erfasst und mit aller Macht festhaltend sich von ihm nachschleifen lässt.
Nach einer Stunde hatten wir glücklich die Höhe erstiegen und gönnten uns und den Tieren im Schatten uralter Ölbäume eine kurze Rast. Dann folgten wir dem Bett eines in südlicher Richtung ziehenden Uadi bis dahin, wo es nach Osten umbog, während wir, immer unter Oliven- und Feigenbäumen, unseren Weg gegen Süden fortsetzten.
Um halb zwei Uhr hielten wir vor dem Kasr Ghorian, einer kleinen, mit hundert bis hundertzwanzig Mann besetzten Bergfestung, zugleich Residenz des Kaids von Ghorian. In einiger Entfernung von dem Ort ließ ich mein Zelt aufschlagen. Selbstverständlich kam bald eine Menge Neugieriger, Offiziere und Soldaten, heraus, um zu fragen, woher ich komme, wohin ich gehe, wer ich sei usw. Statt einer Antwort zeigte ich ihnen meinen Bu-Djeruldi, den mir vom Generalgouverneur von Tripolitanien in arabischer Sprache ausgestellten Schutz- und Empfehlungsbrief. Mit diesem sandte ich dann Hammed zum Pascha und ließ ihn um eine Wache für die Nacht ersuchen. Nicht lange, so erschien ein Offizier der Garnison, der mir die Meldung machte, der Pascha werde nicht nur eine Wache schicken, sondern mich auch mit Lebensmitteln für mich und meine Diener sowie mit Futter für die Kamele versehen; auch lasse er fragen, wann er mich besuchen dürfe. Wohl wissend, wie ungern Türken und Araber sich von ihrem Ruhesitz erheben, trug ich dem Offizier auf, für die zuvorkommende Freundlichkeit dem Pascha zu danken und ihm zu sagen, er möge sich nicht zu mir bemühen, ich würde selbst ihm in seinem Palast aufwarten. Gegen Abend wurde denn auch das Versprochene gebracht: für meine Leute ein Schaf und Basina (eine Art Gerstenpolenta, die in einer fetten Soße schwimmt, nichtsdestoweniger aber mit den Fingern aus der tiefen hölzernen Schüssel gelangt wird), für die Kamele Gerste und für mich eine große Platte mit verschiedenen türkischen Gerichten, von denen manche freilich unseren Begriffen von kulinarischer Kunst sehr wenig entsprachen.
Am anderen Morgen stattete ich dem Pascha meinen Besuch ab. Mit einer Tasse Kaffee und dem Tschibuk bewirtet, schwur ich einen mohammedanischen Eid (die unerlässliche Höflichkeitsformel), noch nie hätte ich einen so großmütigen Mann wie Seine Exzellenz kennengelernt, wogegen er beim Haupt des Propheten beteuerte, noch niemand sei so freigiebig gegen ihn gewesen wie ich. Ich hatte ihm nämlich einen schönen weißseidenen Haik geschenkt und damit seine Gastlichkeit dreifach bezahlt, zumal er kraft meines Bu-Djeruldi verpflichtet war, mir das Benötigte zu liefern, und sogar den Preis dafür der Regierung in Anrechnung bringen konnte.
Dennoch sollte es nicht ganz ohne Differenzen zwischen uns abgehen. Man erregte den Verdacht in ihm, dass ich kein Rechtgläubiger, sondern ein Christ sei, und infolgedessen schickte er mir nun am zweiten Abend weder Essen, noch Futter für die Kamele, noch Brennholz. Erst als ich ihm ernstlich bedeuten ließ, er würde sich Unannehmlichkeiten aussetzen, falls er nicht wenigstens Brennholz und Gerste schickte (beides war für Geld nicht zu haben), willfahrte er meinem Verlangen. Ja, er bequemte sich, seine Entschuldigungen in höchsteigener Person zu überbringen, und da er mir den Gruß „Isalam alikum“, den man nur Rechtgläubigen bietet, zurief, schien er wirklich überzeugt zu sein, dass ich einst den Freuden des mohammedanischen Paradieses teilhaftig werden würde.
Das Kasr Ghorian liegt malerisch auf einem der höchsten Punkte des Gebirges, würde aber gegen europäische Belagerungswaffen nicht standhalten können, denn abgesehen von dem schlechten Material, aus dem es erbaut ist, wird es in der Nähe von mehreren Anhöhen beherrscht.
Nördlich und westlich sieht man in ein tiefes Tal hinab, in dem Oliven, Wein, Feigen und Granaten in üppiger Fülle gedeihen; doch nur dessen obere Hälfte hat das ganze Jahr hindurch fließendes Wasser. Aus der unteren Hälfte kamen Abgesandte der dortigen Höhlenbewohner zu mir. Sie brachten als Gastgeschenk Milch, Zwiebeln und roten Pfeffer und baten mich, sie in ihr Tal zu begleiten; sie hätten gehört, dass ich mich auf die Hendessia (Erdkunde, Messkunde, höhere Wissenschaft überhaupt) verstünde, und da könnte ich ihnen doch anzeigen, wo Wasser unter dem Boden zu finden sei. Gern erfüllte ich ihre Bitte, und ich konnte ihnen auch wirklich mehrere Stellen andeuten, wo sie auf unterirdisch fließendes Wasser stoßen würden. Allein was war ihnen damit geholfen? Eine hervorsprudelnde Quelle vermochte ich nicht nachzuweisen, und zum Bohren auf Quellwasser fehlten ihnen die Mittel, die Werkzeuge, vor allem aber die dazu erforderliche Ausdauer und Energie.
Während der ganzen Zeit blies ein äußerst unangenehmer Südwind, der sich nachts zu solcher Heftigkeit steigerte, dass Notseile über mein Zelt gespannt werden mussten, und trotzdem wäre es umgeblasen worden, wenn nicht die eisernen Pflöcke so starken Widerstand geleistet hätten.
Als ich am 25. Mai früh zum Aufbruch gerüstet war, fand sich, dass die Treiber meiner Mietkamele fehlten. Es war irgendwo Markt in der Nähe, und ohne mich um Erlaubnis zu fragen, hatten sie sich dorthin begeben, um Einkäufe für sich zu machen. Mehrere Stunden lang wurde meine Geduld auf eine harte Probe gestellt, erst um Mittag kehrten die Treiber zurück, und es konnte der Marsch angetreten werden. Wir kamen daher nur bis Ksebah an der südlichen Grenze des Ghoriangebietes. Alle diese südlichsten Grenzdörfer haben steinerne Hütten. Der Weg bis dahin führt, immer sanft ansteigend, durch Olivenhaine, Wein- und Feigengärten, und zahlreiche Dörfer über wie unter der Erde deuten auf eine verhältnismäßig dichte Bevölkerung hin.
Einige der unterirdischen Dörfer sind von Juden bewohnt, die hier ganz die Sitten und Gebräuche der eingeborenen Gebirgsbewohner angenommen haben, während sie sich im Äußeren stark von ihnen unterscheiden. Jene zeigen durchwegs den Typus des Berberstammes; die Juden sind heller von Farbe. Ihre Sprache ist zwar auch berberisch, aber man erkennt sie gleich an dem lispelnden Jargon. Sie tragen Locken an den Schläfen wie ihre Stammesgenossen in Polen und Marokko. Im Ganzen stehen sie mit den Eingeborenen auf gutem Fuß, weil sie diesen unentbehrlich sind, indem sie allein Handwerke betreiben, namentlich sich mit dem Ausbessern der Flinten und der Anfertigung von Schmucksachen beschäftigen. Ihre Dörfer sind übrigens ebenso schmutzig wie die der Berber; überall guckt das Elend hervor, und auch die Begüterten unter ihnen verbergen sorgfältig ihre Habe, aus Furcht, durch den türkischen Pascha derselben beraubt zu werden oder sie bei einem feindlichen Überfall zu verlieren.
Man empfing mich in Ksebah mit den Worten: „Marabah scherif“ (Willkommen, Abkömmling Mohammeds); ich lehnte aber den Titel Scherif ab, und meine Diener sagten, ich sei Mustafa-Bei. Das schien die Leute zu erschrecken; sie mochten fürchten, ich würde als vornehmer Herr sehr große Ansprüche haben. Natürlich tat ich nichts dergleichen; aber aus freien Stücken gab mir der Kaid des Orts eine splendide „Diffa“ (Gastmahl), sowie auch meine Diener reichlich bewirtet und die Kamele mit Futter versorgt wurden. Leider zersprangen hier meine beiden Kochthermometer – ein empfindlicher Verlust für mich –, und ich war nun bloß auf die Aneroide angewiesen.
Unser Abmarsch am nächsten Morgen verzögerte sich bis um sieben Uhr, weil man den Schlüssel zum „Majen“ nicht hatte finden können. Die „Majen“ sind große steinerne Zisternen, oben überwölbt oder auch nur mit Balken, Steinen und Erde bedeckt, die in der Regen- und Schneezeit – Schnee ist nämlich in einer Höhe von dreitausend Fuß im Winter nichts Seltenes – gefüllt und nachher sorgfältig verschlossen gehalten werden, damit das Wasser nicht von Unbefugten vergeudet wird.
Von Ksebah aus folgten wir dem Lauf eines Uadi, des Sseggiat-el-fers, dann ging es erst in südöstlicher, hierauf in südlicher Richtung stark bergab. Wir befanden uns im Quellgebiet des bedeutenden Flusses Sufedjin, der einen großen Teil der Gewässer des Ghoriangebirges in seinem Bett sammelt und zur Syrte hin abführt. Die ganze Landschaft heißt Gedama. Ihr Boden ist großenteils kulturfähig, da er in der Regenzeit geackert werden kann.
Einen seltsamen Aberglauben der Kameltreiber sollte ich am selben Abend kennenlernen. Sie gebärdeten sich wie außer Sinnen vor Freude, da ein kleiner Vogel in mein Zelt geflogen kam und sich mir zutraulich auf die Schulter setzte. „Es ist ein Marabut“, riefen sie, „auch du musst ein Marabut sein, du verstehst sicher wie unser gnädiger Herr Sliman (Salomon) die Sprache der Tiere.“ Die Ursache dieser außergewöhnlichen Zutraulichkeit erklärte sich indes auf ganz natürliche Weise: Das arme Vögelchen litt heftigen Durst, es war fast verschmachtet, und sobald es von dem ihm vorgesetzten Wasser gierig genippt hatte, flog es scheu wieder auf und davon. In der Sahara folgen häufig kleine Vögel, namentlich Sperlinge, tagelang einer Karawane, um die Brosamen und Speisereste aufzupicken und an den Tropfen einer Girba (Wasserschlauch) ihren Durst zu löschen. Kommen einem nach langer Wüstenwanderung Sperlinge oder Schwalben entgegen, so ist sicher eine Oase nicht mehr fern und man kann bald wie der Schiffer auf hohem Meer rufen: „Land! Land!“
Wir überschritten ein kleines Flussbett, dessen Name mir entfallen ist, und zogen durch den Chorm el-Bu-el-Oelk. Alle Namen haben hierzulande irgendeine Bedeutung; dieser würde auf deutsch lauten: „Engpass des Vaters der Blutegel“. Ich erkundigte mich, weshalb man dem Engpass einen Namen gegeben, mit dem sich doch notwendig die Vorstellung von Wasser verknüpft, da Blutegel nicht zwischen heißem Gestein ihren Aufenthalt haben; aber niemand konnte mir die Frage beantworten.
Fünf Kilometer östlich von dort ist der Brunnen Kischa, mit recht gutem Trinkwasser; wir hatten jedoch noch mehrere Schläuche voll Wasser, brauchten daher nicht vom Weg abzuweichen. Wir passierten ferner den Chorm el-Orian (nackter Engpass) und langten endlich, nachdem wir noch verschiedene Rinnen des Sufedjin durchschnitten hatten, um drei Uhr nachmittags vor Misda an.
Misda besteht aus zwei, nur durch einige hundert Schritte voneinander getrennte Ortschaften: Misda fukani, das obere im Westen gelegene, und Misda tachtani, das untere im Osten gelegene. Beide Ortschaften sind klein und zählen nach eigenen Angaben nicht mehr als je hundert waffenfähige Männer, also höchstens je fünfhundert Einwohner. Ihr hauptsächlichster Erwerbszweig ist der Karawanenbetrieb auf den Straßen nach Rhadames einerseits und nach Mursuk andererseits, besitzen sie doch in den reichlichen Weiden, welche der Sufedjin bietet, die Mittel zu einer guten und ausgiebigen Kamelzucht. Der Mietpreis für die Kamele wird hier nicht wie in Tuat und den westlichen Teilen der Sahara nach dem Gewicht der Ladung berechnet, sondern man mietet einfach so und so viele Kamele für die bestimmte Tour. In der Regel kostet ein Kamel nach Fesan sieben Mahbub, nach Rhadames fünf Mahbub. Die Miete nach letzterem Ort ist deshalb verhältnismäßig teurer, weil auf der ganzen Strecke zwischen Misda und Rhadames sich sehr wenig Wasser befindet, die Tiere also viel zu leiden haben.
Einige kleine Gärten um Misda liefern Zwiebeln, Tomaten, roten Pfeffer, Kürbisse und Wassermelonen; doch ist im ganzen der Boden wegen seines allzu großen Kalkgehalts eben nicht sehr zur Gartenkultur geeignet, auch die wenigen Palmen, die um Misda herum wachsen, sehen traurig aus.
Gleich bei meiner Ankunft gab es ärgerliche Händel. Einer meiner Diener war vorausgelaufen, und während er aus einem Brunnen trank, hatte ein in der ganzen Gegend berüchtigter Räuber namens Omar-Bu-Cheil sich herangeschlichen und ihm sein Doppelgewehr, das er aus der Hand gelegt hatte, entwendet. Dieser Räuber nebst einem Spießgesellen wurde zu der Zeit von den Misdani beherbergt und verpflegt, wogegen seine Bande, welche das Gebiet zwischen dem Gebirge und Ghorian mit ihren Überfällen heimsuchten, den Ort verschonen musste. Vergebens hatte die türkische Regierung einen Preis auf seinen Kopf gesetzt, vergebens mehrere Male Soldaten ausgeschickt, um ihn zu fangen oder zu töten; denn die Gebirgsbewohner wagten nicht, die verborgenen Schlupfwinkel des Gefürchteten zu verraten. So zog er sich auch jetzt unangefochten mit der gestohlenen Flinte in die Moschee des unteren Ortes zurück, wo er sein Quartier aufgeschlagen hatte, während seine zwanzig Mann starke Bande irgendwo auswärts mit einem Raubzug beschäftigt war. Ich schickte meinen Diener Hammed zu ihm und ließ ihm sagen, die Flinte gehöre mir, er solle sie sofort herausgeben. Er verlangte aber ein Lösegeld von fünf Talern. Es blieb mir also nichts übrig, als mich an die Medjeles (die Rats- oder Vorsteherversammlung) des Ortes zu wenden und ihnen zu erklären, sie seien haftbar für die Sicherheit meines Eigentums, und falls sie mir die Flinte nicht zurückschafften, würde ich Soldaten vom Kasr Ghorian kommen lassen; der Ort würde dann dafür büßen müssen, dass er einem notorisch bekannten Räuberhauptmann Schutz gewährt habe. Das wirkte. Aber erst nachdem sie ihrerseits bis zum Abend mit Omar-Bu-Cheil verhandelt und ihm schließlich drei Taler bezahlt hatten, gab er die Flinte heraus. Der Räuber war frech genug, anderntags selbst in mein Zelt zu kommen und mir anzubieten, wenn ich noch zwei Taler hinzufügte, könnte ich ganz sicher die Gegend bis Rhadames mit meiner Karawane durchziehen. Ohne ein Wort zu erwidern, zeigte ich ihm meine Waffen; ein Lefaucheux mit achtzehn Schuss und ein Stutzen mit neun Schuss machten denn auch den beabsichtigten Eindruck auf ihn. Übrigens ersetzte ich, nachdem mein Zweck erreicht war, den Misdani die bezahlten drei Taler und machte außerdem dem frommen Chef ein Geschenk, damit kein Zweifel an meiner Rechtgläubigkeit aufkam.
Noch eine andere große Unannehmlichkeit hatte ich in Misda zu bestehen. Ich musste hier frische Kamele mieten, und da die Besitzer keine Konkurrenz zu fürchten hatten, forderten sie die unverschämtesten Preise. Es war, als ob sich alle gegen mich verschworen hätten. Glücklicherweise fand ich in dem Mudir (Ortsvorsteher) einen vernünftigen Mann, der seine Mitbürger endlich bewegte, auf den üblichen Preis von fünf Mahbub (ein Mahbub ist etwas mehr als ein Taler) herabzugehen. Nun erhoben sie aber wieder neue Anstände. Sie behaupteten, die Ladungen seien zu schwer, und ich konnte ihren Nörgeleien nur dadurch ein Ende machen, dass ich einiges von dem Gepäck auf meine eigenen Kamele überlud.
Am 2. Juni um fünf Uhr nachmittags verließen wir Misda, legten aber bis zum Abend nur noch zwei Stunden zurück und lagerten, in einer reichlich mit Kamelfutter bestandenen Gegend, mitten im Flussbett des Sufedjin. Ich musste nachts im Freien schlafen, denn der Lehmboden war, obschon bewachsen, von der Sonnenhitze so hart gebrannt, dass die eisernen Pfosten meines Zeltes sich nicht tief genug hineintreiben ließen.
Früh um fünf Uhr zogen wir weiter. Schon um neun Uhr vormittags nötigte uns die furchtbare Hitze, Rast zu machen; weder die Kamele noch die Treiber konnten der Sonnenglut länger widerstehen. Meinem weißen Araberhund, einem Spitz, mussten wegen des brennend heißen Erdbodens Sandalen angelegt werden: eine ebenso schwierige wie gefahrvolle Operation, da er äußerst bissig war und sich von niemand berühren ließ; nur mit List gelang es endlich, ihm das Maul zuzubinden, worauf die Sandalen an seinen Beinen befestigt wurden. Später brachte ich ihn dahin, dass er während des Marsches auf dem Rücken eines Kamels Platz nahm. Er war außerordentlich wachsam, sowohl bei Tag wie bei Nacht, und deshalb unentbehrlich für unsere Karawane.
Bis halb drei Uhr „gielten“ wir – ich bediene mich dieses undeutschen Ausdrucks und werde ihn noch öfters brauchen müssen, weil es für das arabische „geila“, d. h. während der heißesten Tageszeit lagern, kein Wort in unserer Sprache gibt –, dann wurde der Tagesmarsch in Richtung 200 Grad fortgesetzt. Beim Austritt aus dem Uadi Fessano gelangt man auf ein ausgedehntes Plateau mit derselben Vegetation wie in den Tälern. Hier wohnen die Uled Mschaschia, welche Schaf- und Kamelzucht treiben. Die Gegend ist reich an Gazellen, Hasen, Kaninchen, auch Schakalen und Hyänen, und im Gebirge Kaf-Masusa, das wir südöstlich in etwa fünfzehn Kilometer Entfernung erblickten, sollen noch viele Antilopen hausen. Wir kamen an einem großen Duar (Zeltdorf) der Uled Mschaschia vorbei und wurden von den Bewohnern gastfreundlich mit einem Trunk Kamelmilch gelabt. Ihre Zelte sind geräumiger und besser als die der anderen in Tripolitanien wohnenden Araber. Nun kreuzten wir die von Sintan im Norden nach Ghorian in Fesan führende Straße und betraten nach einer Stunde die Landschaft Brega, in der um halb sieben Uhr das Nachtlager aufgeschlagen wurde. Da hier im Gebiet der Mschaschia kein Raubüberfall zu befürchten war, hielt ich es nicht für nötig, des Nachts Wachen aufzustellen, auch wurden unseren Kamelen nicht die Fußeisen angelegt. Überhaupt ist das Reisen in Tripolis, ausgenommen an der tunesischen Grenze, von wo bisweilen räuberische Stämme auf tripolitanisches Gebiet herüberstreifen, im Allgemeinen sicher. Leute wie Bu-Cheil, dessen Bekanntschaft ich in Misda gemacht habe, und seine Bande gehen mehr auf den Raub von Viehherden aus, als dass sie sich an Karawanen vergreifen, zumal Letztere ihnen doch meist durch ihre Stärke und gute Bewaffnung imponieren.
5. Juni, Aufbruch um fünf Uhr morgens in Richtung 195 Grad. Über einen niedrigen, nach Westen und Nordwesten streichenden Höhenzug führt der Pass Chorm er-Reschade. Dicht vor demselben machten wir um dreiviertelelf halt, um zu ›gielen‹. Der Boden ringsum ist wie übersät mit fossilen Überresten, doch entdeckte ich wenig nur einigermaßen gut erhaltene Stücke; allerdings machte die erdrückende Sommermittagshitze am Rande der Sahara das Suchen und Einsammeln fast unmöglich. Um halb drei Uhr nachmittags passierten wir den Chorm er-Reschade und gelangten nach einstündiger Wanderung in die sandige, aber gut bewachsene Landschaft Areg-el-Leba. Einer der Kameltreiber hatte hier das Glück, eine Gazelle zu schießen, eine sehr erwünschte Zugabe zu unserer mehr als einförmigen Kost, die des Morgens aus Brot, Butter und Datteln, des Abends aus Basina (Weizenpolenta mit Ölsoße) bestand, welchen Gerichten ich durch Zusatz von Fleischextrakt etwas Geschmack und Kraft zu geben versuchte. Aus der Areg-el-Leba kamen wir an die mehr hammadaartige, doch von vielen kleinen kräuterreichen Oasen, Gra genannt, unterbrochene Gegend Gra-es-Ssoauin. In einer dieser kleinen Oasen wurde um halb sieben Uhr Rast gemacht, und bald waren meine Diener und Kameltreiber zu einem homerischen Mahl versammelt, indem sie neben einem großen Topf voll Basina die halbe Gazelle verzehrten. Endlich waren sie gesättigt, was bei diesen Leuten viel sagen will; denn es blieb noch ein Rest von der Basina übrig, der aber schon am anderen Morgen um zwei Uhr auch noch vertilgt wurde.
Am 6. Juni befanden wir uns bereits morgens um drei Uhr wieder auf dem Marsch in derselben Richtung wie am Tag vorher. Um neun Uhr schlugen wir, um zu ›gielen‹, beim Aghadir-el-Cheil (Pferdewasserplatz) unsere Zelte auf. Mit Futter für die Tiere war unser Zug genügend versehen, aber der Wasservorrat reichte nur noch für zwei Tage, während wir bis Derdj wenigstens noch fünf Tagesmärsche zurückzulegen hatten. Ich beschloss daher, einen des Landes genau kundigen Kameltreiber mit einigen meiner Diener, mit den übrigen Treibern und sämtlichen Kamelen nach dem Bir (Brunnen) el-Klab, der gerade nördlich vor uns liegen sollte, abzusenden, damit dort die Tiere getränkt und unsere Wasserschläuche frisch gefüllt würden. Die Expedition ging nachmittags ab und hatte Weisung, am folgenden Tag wieder auf dem Lagerplatz einzutreffen.
Wir Zurückbleibenden konnten zwar unterdes ruhen, doch war unser Lager in einer völlig baumlosen Ebene bei der glühenden Sonnenhitze kein beneidenswertes. Das Thermometer zeigte jetzt beständig nachmittags fünfunddreißig bis vierzig Grad im Schatten und sank selbst kurz vor Sonnenaufgang nie unter +18 Grad. Dazu traten nun auch schon jene heftigen Windstöße, wie sie in der Sahara so häufig ganz plötzlich entstehen und ebenso plötzlich wieder verschwunden sind.
Bereits vormittags um halb zehn Uhr kehrte anderntags die Expedition zurück. Sie hatte genau mit Sonnenaufgang den Rückmarsch angetreten. In der Nähe des Bir el-Klab war man an einem Duar von Sintanleuten vorübergekommen; die Gegend ist also noch sporadisch bewohnt.
Es war Abend geworden, als wir unseren Halteplatz verließen. Wir zogen in der Richtung von 225 Grad den Uadi el-Cheil entlang aufwärts und drangen mit ihm in das steinige Gebirge ein, in dem er entspringt und durch zahlreiche Täler und Schluchten aus Süden und Norden Zuflüsse erhält. Die Wände dieser Täler, aus Sandstein und Kalk bestehend, erheben sich senkrecht zur durchschnittlichen Höhe von hundert bis einhundertfünfzig Fuß. In einer natürlichen Höhle am linken Felsenufer fand ich Figuren in die Wände gehauen, ziemlich roh ausgeführt, doch immerhin von einer gewissen Stufe der Kultur zeugend, welche die Menschen zu jener Zeit erreicht haben mussten. Die Figuren stellten Elefanten, Kamele, Antilopen und andere Tiere dar, aber auch eine weibliche Menschengestalt mit ausgeprägter Negerphysiognomie in sehr indezenter Stellung. Schriftzeichen konnte ich allerdings nicht entdecken; die eingegrabenen neuarabischen Namen wie Mohammed, Abdallah und die kurzen Koranverse stammen offenbar aus viel späterer Zeit.
Um halb acht Uhr abends berührten wir den Rand der Hammada (mit scharfkantigen Steinen bedeckte Hochebene). Ehe wir sie überschritten, veranlassten mich meine Kameltreiber, weil ich zum ersten Mal des Weges ziehe, einen kleinen Steinhügel, Bu-sfor oder Bu-saffar (Reisevater), zu errichten. Der Ursprung und die Bedeutung dieser Sitte konnten sie mir nicht erklären, oder ich verstand ihre Erklärung nicht. Erst später erfuhr ich, dass die Bu-sfor Fetische sind, welche den Reisenden, der das erste Mal solche hervorragenden Punkte berührt, vor Ungemach schützen sollen, und dass mit der Aufrichtung eines Bu-sfor zugleich die Verpflichtung verbunden ist, den Reisegefährten ein Mahl zu geben. Man kann sich denken, wie viele dergleichen Hügel an den betreffenden Stellen aufgehäuft sind.
Nachts um halb zwölf Uhr erst wurde zum Kampieren halt gemacht. Auf früheren Reisen hatte ich immer von meinen Begleitern gehört, es sei am besten, die Wasserschläuche beim Lagern aufzuhängen, da die Erde „das Wasser trinke“ oder in sich einsauge. Und bei der außerordentlichen Dürre des Bodens mag wohl etwas Wahres daran sein. Ich hatte deshalb nach Sitte der reichen marokkanischen Reisenden Dreifüße zu dem Zweck mitgenommen. Hier nun sah ich, wie meine Kameltreiber die Schläuche der Reihe nach auf eine Matte legten und mit einer anderen Matte sorgfältig bedeckten. „Warum hängt ihr die Schläuche nicht auf?“ frage ich. „Weil wir sie dann nicht so gut zudecken können“, war die Antwort. „Und warum müssen sie zugedeckt sein?“ „Weil der Mond sonst das Wasser trinkt.“ Es würde vergeblich gewesen sein, ihnen den Aberglauben benehmen zu wollen, und so ließ ich sie gewähren. Meine städtischen Diener, die sich weit klüger und aufgeklärter dünkten als die Bewohner der Hammada, protestierten zwar erst dagegen; als aber einer der Kameltreiber mit einem Schwur beteuerte, der Mond trinke das Wasser und die Schläuche müssten dann zerplatzen, schienen auch sie bekehrt und überzeugt. Sie ließen die Schläuche auf den Matten liegen und ruhten selbst auf der bloßen Erde.
Unterwegs bemerkte ich, dass die Kameltreiber einer kleinen Eidechse mit plattem Kopf, Bu-Bris genannt, einer Gekko-Art, eifrig nachstellten und jede, derer sie habhaft wurden, töteten. Sie meinten, das Tierchen vergifte durch seinen Hauch die Speisen, es könne dem Menschen einen Ausschlag anspritzen, und schwangere Frauen, die von ihm angeblickt würden (Basiliskenblick), kämen mit gefleckten Kindern nieder. Das unschuldige Tierchen ist in diesem Teil der Vorwüste überaus häufig. Um die Leute von der Torheit ihres Wahns zu überzeugen, nahm ich eine Bu-Bris in die Hand, setzte sie auf meinen Fuß und ließ sie über meinen Teeteller laufen – aber vergebens, sie blieben bei ihrem abergläubischen Vorurteil und sagten, ich sei gegen das böse Wesen gefeit.
Am 10. Juni durfte ich hoffen, endlich unser nächstes Ziel, die Oase Derdj, zu erreichen. Es war höchste Zeit: Infolge der großen Hitze waren die Kamele von dem achttägigen Marsch durch die Hammada erschöpft, meine Diener ertrugen zum Teil nur schwer die ungewohnten Strapazen, und zwei von ihnen sowie ich selbst litten an Diarrhöe, die trotz starker Opiumgaben nicht weichen wollte. Mich hatte der kurze Wüstenmarsch bereits so abgemagert, dass ich meine Geldkatze, die mir früher zu eng gewesen war, jetzt noch um fünf Zoll einnähen musste, ja, ich fühlte an den abnehmenden Kräften, dass eine ernstliche Krankheit im Anzug war.
Wir zogen noch an einigen Gra vorüber, erblickten im Norden von uns auf etwa acht Kilometer Entfernung den Djebel el-Chaschm-el-Dub und durchschritten um halb neun Uhr den Chorm Tuil-el-Nailat (Langer Paß der Sandalen). Um zehn Uhr ›gielten‹ wir. Ich sandte zwei Diener mit meinem Bu-Djeruldi voraus, damit sie mich bei den Bewohnern Derdjs anmeldeten und einen guten Lagerplatz für uns aussuchten. Der Zug folgte ihnen erst um vier Uhr nachmittags.
Abends erreichten wir endlich den Ort Derdj, nachdem schon lange vorher Spuren von Menschen und Tieren uns dessen Nähe verkündet hatten. Die Einwohner bereiteten mir einen recht freundlichen Empfang, der Bu-Djeruldi schien seine Wirkung auf sie nicht verfehlt zu haben. Für unser Lager hatten sie einen reizenden Platz, unter Palmen und hinlänglich mit Wasser versehen, bestimmt, allein ich zog es vor, auf der luftigeren Hammada zu kampieren, wo ich mir von den frischen Winden einen heilsamen Einfluss auf meine stark angegriffene Gesundheit versprach.
Außer dem Hauptort Derdj hat die Oase Derdj (Stufe), so genannt, weil sie am steilen Abhang oder Rand der Hammada liegt, noch drei kleinere Ortschaften: Tugutta, Tefelfelt und Matres. Die Bewohner von Derdj, Tugutta und Tefelfelt sind nicht arabischen, sondern berberischen Ursprungs; nur Matres ist von Arabern bewohnt. Erstere werden von den umwohnenden Stämmen auch mit dem gemeinsamen Namen Mammeluki belegt, was wohl auf ihre frühere Verbindung mit der Regierung von Tripolis hindeuten soll. Aber weder die Berber noch die Araber der Oase Derdj zeigen im Äußeren die charakteristischen Merkmale dieser Völkerrassen, sie sind so stark mit Negerblut durchsetzt, dass man sie eher wohlgestaltete Schwarze mit kaukasischer Gesichtsbildung nennen als zu den Weißen rechnen möchte. Ihre Gemütsart anlangend, fand ich sie gastfrei, gutmütig, aber etwas apathisch. Mit der Reinlichkeit schienen sie in beständigem Kampf zu leben, dagegen mit dem Schmutz auf vertrautestem Fuß zu stehen. Die Häuser, aus Stein erbaut, gleichen ganz den in den übrigen Ksors dieser tripolitanischen Gegend. Ihr Inneres ist unsauber und dient Ziegen wie Menschen zum gemeinsamen Aufenthalt. In den meisten gibt es jedoch einen abgesonderten Raum, ein Staatszimmer, in dem die Mitgift der Frau oder der Frauen, in einer großen Zahl messingener Schüsseln bestehend, aufbewahrt wird. Alle die blanken Schüsseln prangen hier an den Wänden und werden nie benutzt, scheinen also keinen anderen Zweck zu haben, als den Reichtum der Familie zur Schau zu stellen, da Kupfer hierzulande ein seltenes und kostbares Metall ist.
Der Boden um Derdj wird hauptsächlich durch das Uadi Tinaout bewässert. Außer dem oberirdisch fließenden Wasser fördert man jedoch auch Wasser durch Fogarat (unterirdische Galerien, Brunnen) sowie durch Ziehbrunnen zutage. Die vorhandenen Palmengärten würden zur Ernährung der Einwohnerschaft mehr als ausreichen, wenn nicht zwei Drittel der Gärten und Bäume an Rhadameser oder an Djebeli verkauft wären. Es zeugt für die Indolenz der Bewohner, dass sie einen Teil ihres Grund und Bodens und ihrer kostbaren Habe, der Dattelbäume, infolge schlechter Wirtschaft in fremden Besitz kommen ließen. Wie überall in den Oasen werden auch hier Bäume und der Boden, auf dem sie stehen, getrennt voneinander verkauft, ein Gebrauch, der natürlich oft zu heftigen Streitigkeiten Anlass gibt; so klagt z. B. der Besitzer einer Palme gegen den Grundeigentümer, der Baum sei eingegangen, weil er nicht genügend bewässert worden sei usw. Das Areal, selbst das von Gärten, ist in Derdj, wenn man die Fruchtbarkeit des Bodens und den Wasserreichtum in Betracht zieht, billig zu haben. Felder mit fließendem Wasser werden natürlich teurer bezahlt. Hingegen stehen die Bäume, den Wert des Geldes in Anschlag gebracht, verhältnismäßig hoch im Preis. Für eine Palme der edleren Gattung, zumal eine solche, die alljährlich eine Kamelladung Datteln liefert, zahlt man bis zu über hundert Mahbub, für eine Kamelladung Datteln der besten Sorte sieben bis acht Mahbub. Die Zahl der Dattelpalmen in den vier Orten zusammen dürfte sich auf ungefähr dreihunderttausend Stück belaufen. Was die sonstige Produktion betrifft, so unterscheidet sich die Oase Derdj nicht von den anderen Oasen der Hammada. Sie hat außer dem Zehnten von allen Früchten 1182 Mahbub an Abgaben zu entrichten.
Mein Unwohlsein steigerte sich in bedenklicher Weise. Der Mudir des Ortes riet mir, Lakbi dagegen zu nehmen, und ich nahm in der Tat einen Topf voll dieses abscheulichen Getränks zu mir. Anfangs verschlimmerte sich die Diarrhöe danach, aber gegen Abend des zweiten Tags spürte ich Besserung, so dass ich mich imstande fühlte, den kurzen Marsch nach Rhadames zurückzulegen, wo ich auf bessere Verpflegung und längere Ruhe hoffen durfte. Da meine Kameltreiber aus Misda dorthin zurückgekehrt waren, mietete ich in Matres andere, und nachdem ich noch, soweit ich es vermochte, alle Bettler in Derdj befriedigt hatte, brachen wir am 15. Juni morgens um halb acht Uhr auf.
In Richtung 275 Grad längs dem Uadi Milha hinziehend, erreichten wir nach drei Stunden Matres und ›gielten‹ daselbst im Schatten einiger Palmen. Der kleine Ort hat nur zirka hundert Einwohner, die sich hauptsächlich vom Vermieten ihrer Kamele ernähren, denn Palmen gibt es dort nicht viele, und die meisten davon sind Eigentum der Rhadameser.
Der Weg von hier nach Rhadames soll nicht allzu sicher sein. Mehrere Leute von Derdj, von Matres und einige vom Stamm der Uled Mahmud baten daher, sich mir anschließen zu dürfen, und da sie alle mit Flinten bewaffnet waren, sah ich diese Verstärkung meiner Karawane nicht ungern, obschon ich neue Angriffe auf meine Mundvorräte von ihnen gewärtigen musste, eine Voraussicht, die sich dann auch in vollem Maße bestätigte.