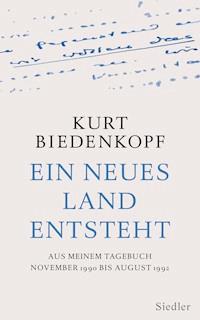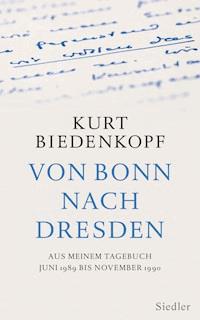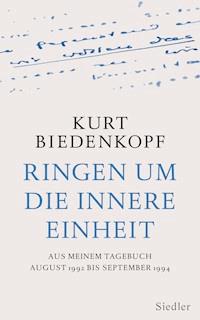
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Kurt Biedenkopfs Tagebücher der Jahre nach der Wende. Ein bedeutendes Zeitdokument.
Kurt Biedenkopf, der 1990 zum Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen gewählt wurde, führte in den neunziger Jahren ein Tagebuch: Die Aufzeichnungen aus den Jahren 1990 bis 1994 beschreiben auf brillante Weise die Zeit nach der Wende und das schwierige Ringen um die innere Einheit. Schonungslos offen und auf höchstem intellektuellen Niveau reflektiert Biedenkopf die politischen und gesellschaftliche Entwicklungen im wiedervereinten Deutschland.
Schon im Herbst 1990 wird klar, dass die politische Klasse in Bonn den Herausforderungen des vereinten Landes kaum gewachsen ist. Mit großem Weitblick analysiert Kurt Biedenkopf die ökonomischen Belastungen, aber auch die Chancen der Modernisierung, die mit der Vereinigung einhergehen. Er schildert auf eindrucksvolle Weise den Kampf um die umstrittene Finanzierung des Aufbaus Ost und eine gerechte Lastenverteilung – und analysiert zudem die großen Mentalitätsunterschiede zwischen West- und Ostdeutschen. So entsteht das Bild eines leidenschaftlichen Patrioten, der wie kaum ein zweiter Politiker die Interessen der Bürger in Ostdeutschland vertritt – und dabei auch den Konflikt mit Bundeskanzler Helmut Kohl nicht scheut.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 814
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Kurt H. Biedenkopf
Ringen um die innere Einheit
Aus meinem TagebuchAugust 1992 bis September 1994
Siedler
Erste Auflage
September 2015
Copyright © Kurt H. Biedenkopf
Copyright © 2015 by Siedler Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-17318-0
www.siedler-verlag.de
Inhalt
Zur Einführung
Tagebuch
Personenregister
Sachregister
Zur Einführung
Zweite Halbzeit der ersten Legislaturperiode des Landtages des Freistaats Sachsen. Aus der Fülle der Ereignisse und Erinnerungen ragen einige besonders deutlich hervor: die Verabschiedung des ersten Solidarpaktes, der erste Streik in der Metallindustrie, erste bedeutende Industrieansiedlungen und die erste Wiederwahl des Landtages im Herbst 1994.
Die Jahre 1991 und 1992 waren Jahre der Suche nach dem richtigen Weg in die neue Welt der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Vierzig Jahre sozialistische Diktatur hatten tiefe Spuren hinterlassen. Die Folgen der kommunistischen Herrschaft und ihrer Zentralplanwirtschaft lasteten auf dem Land und seiner Bevölkerung. Die Bausubstanz seiner Städte und Dörfer und die Infrastruktur waren verbraucht, seine Umwelt schwer beschädigt. Das Leben und Denken der Menschen war geprägt durch die Allgegenwart der Sozialistischen Einheitspartei, ihren Herrschaftsanspruch, ihre Kontrollwut und ihre Unmenschlichkeit. Furcht und Misstrauen reichten bis in die Familien und den Kreis der Freunde. Selbst nach dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung trafen wir auf unserer ersten Rundreise durch das Land auf Menschen, die umgetrieben waren von der Sorge, die überwundenen Herrscher könnten ihre Macht noch nicht verloren haben.
So kehrte nach der Freude über die wiedergewonnene Freiheit und die Hoffnung auf ein freies Leben die Sorge zurück, wie es weitergehen sollte. Vor allem: Wie lebt man mit der verantworteten Freiheit. Die marktwirtschaftliche Ordnung samt ihren sozialen Verpflichtungen stellte hohe Ansprüche an eine Bevölkerung, deren bisherige wirtschaftliche Erfahrungen sich für die Bewältigung der neuen Herausforderungen nur begrenzt nutzen ließen. Alles musste gleichzeitig angepackt werden: die Beseitigung des Überholten, die Gründung des Neuen, das Erlernen freiheitlicher Ordnungen und die Gestaltung des Lebens. Dem stand eine bisher nicht erlebte Fülle von Optionen und Möglichkeiten gegenüber. Zugleich wurde es durch zahlreiche Risiken geprägt, die ihre Ursachen nicht zuletzt in der wiedergewonnenen Freiheit hatten. Noch nie hatte sich in der Geschichte der Neuzeit eine ähnliche Umwälzung der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse in einem so kurzen Zeitraum ereignet wie in den ostdeutschen Ländern nach dem Fall der Mauer und der deutschen Wiedervereinigung.
Was dieser Umbruch für das geeinte Deutschland zu bedeuten hatte, vor allem für den Westen der wiedervereinigten Nation, beschäftigte die große Mehrheit der Westdeutschen jedoch kaum. Sie hatten schon bisher die deutsche Teilung als dauerhafte Wirklichkeit erlebt, falls sie ihr überhaupt für das eigene Leben bedeutsam erschien. Man wusste wenig über die DDR. Die von Ludwig Erhard in den 1950er Jahren begründete Erforschung ihrer Verhältnisse wurde 1972 eingestellt. Ein politisch relevantes Interesse am Schicksal der Ostdeutschen, das sich auch in dem politischen Wunsch ausdrückte, Opfer oder doch besondere Leistungen für die Überwindung der Teilung zu bringen, war kaum vorhanden. Westdeutschland hatte sich an die Teilung gewöhnt. Ihre Realität, und die damit verbundenen Entlastungen hatten sich, wenn man so will, während der vierzig Jahre seit der Teilung zu einem Besitzstand entwickelt. Es gab keinen zwingenden Anlass, ihn in Frage zu stellen. Viele traf deshalb der durch die Ostdeutschen bewirkte Fall der Mauer nach der Freude eher wie ein Schock. Selbst Helmut Kohl, der sich immer für die Einheit eingesetzt hatte, fehlte angesichts dieses Besitzstandes der Mut, vor der Bundestagswahl 1990 von einer Steuererhöhung zur Finanzierung der Kosten der Einheit zu sprechen.
So dauerte es bis in die zweite Hälfte der ersten Wahlperiode, ehe man im Westen Deutschlands damit begann, sich ernsthaft mit den wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Wiedervereinigung für den westlichen Teil Deutschlands zu befassen. Das Ergebnis langer Debatten und Auseinandersetzungen über unzureichende Vorschläge der Bundesregierung war am Ende der im Frühjahr 1993 zwischen Bund und Ländern vereinbarte Solidarpakt. In ihm manifestierte sich zum ersten Mal die Selbstverständlichkeit der gelebten Solidarität der Westdeutschen mit den Ostdeutschen. Er war aber auch Ausdruck und Ergebnis der Kreativität der föderalen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland.
Denn nicht die Bundesregierung und der Bundestag waren die Schöpfer dieses neuen und einmaligen Paktes, mit dessen Hilfe zusammenwachsen sollte, was zusammen gehörte. Es waren die Bundesländer. Ihre Ministerpräsidenten trafen sich im Februar 1993 im Cecilienhof zu Potsdam, dem Ort, an dem die vier Siegermächte nach Kriegsende 1945 die Teilung Deutschlands beschlossen hatten. An diesem historischen Ort wollten sie ihren Beitrag zu einem gesamtdeutschen Solidarpakt beschließen. Er sollte helfen, die Folgen des Unrechts zu überwinden, das den Ostdeutschen durch rund 45 Jahre Teilung und Unterwerfung unter die Herrschaft des Kommunismus widerfahren war. Einstimmig entwickelten sie ihren Gegenentwurf zu den Vorschlägen der Bundesregierung. Im März 1993 wurde ihr Konzept in Bonn nach gemeinsamen Anstrengungen zusammen mit der Bundesregierung beschlossen.
Dass es nach einer wie immer gearteten Wiedervereinigung zu einer solidarischen Anstrengung Westdeutschlands keine Alternative geben konnte, war schon vor dem Fall der Mauer meine Überzeugung. Denn wir in der westlichen Bundesrepublik Deutschland waren der Bevölkerung keines anderen Staates mehr verpflichtet, unseren Wohlstand mit ihr zu teilen, als den Deutschen im anderen Teil Deutschlands. Teilen bedeutete nicht nur die Freiheit mit den Ostdeutschen zu teilen, sondern auch die Verantwortung für eine freiheitliche, rechtsstaatliche Ordnung. Die Teilhabe musste deshalb auch die wirtschaftlichen Grundlagen der Freiheit umfassen. So selbstverständlich, wie diese den Westdeutschen geworden waren, so selbstverständlich musste es uns auch sein, zur Entwicklung des wirtschaftlichen Fundaments für die Freiheit im anderen Teil Deutschlands beizutragen: als Treuhänder der Freiheit der Ostdeutschen.
Kaum war der Solidarpakt beschlossen, zeichnete sich in Sachsen ein Tarifkonflikt ab. Die IG Metall forderte eine beachtliche Lohnerhöhung und eine längerfristige Vereinbarung über die weitere Lohnentwicklung. Die Arbeitgeber lehnten die Forderungen ab. Ihre Gegenvorschläge wurden von der Gewerkschaft nicht ernst genommen. Die Lage war ungewöhnlich, weil man sie nicht mit westdeutschen Ausgangslagen vergleichen und sich deshalb bei ihrer Lösung auch nicht an westlichen Erfahrungen orientieren konnte. Als die wirtschafts- und sozialpolitische Einheit zwischen beiden deutschen Staaten am 1. Juli 1990 in Kraft trat, verdiente ein Facharbeiter im Osten in etwa ein Drittel so viel wie sein Kollege im Westen. Arbeitete er in einem normalen östlichen Betrieb, war allerdings auch die Produktivität seines Unternehmens wesentlich geringer als die des westdeutschen Kollegen.
Daraus entwickelte sich ein Dilemma: Wurden die Ostlöhne zu schnell an die im Westen angeglichen, wurden die ostdeutschen Arbeitgeber überfordert. Wartete man zu lange mit der Angleichung, musste man damit rechnen, dass der ostdeutsche Facharbeiter seinen Arbeitsplatz im Westen suchte. Das Problem bestand darin, einen vernünftigen Mittelweg zu finden, der die weitere Produktion im Osten erlaubte ohne beide Seiten, Arbeitnehmer und Unternehmen, zu überfordern. Aber bei der Suche nach diesem Weg standen sich ebenfalls unterschiedliche Interessen im Wege. Die ostdeutschen Arbeitgeber wollten ihre Mitarbeiter nicht verlieren. Und sie fanden bei vielen Verständnis für ihre Haltung. Für die Verhandlungen mit der Gewerkschaft fehlte ihnen die notwendige Erfahrung. Denn deren Verhandlungsführer kamen aus dem Westen. Ostdeutschen Gewerkschaftsfunktionären hätte bereits das Vertrauen der Belegschaften gefehlt.
Deshalb suchten die ostdeutschen Arbeitgebervertreter den Rat der westdeutschen Arbeitgeber und ihrer Organisationen. Manche der Handelnden unter ihnen wurden jedoch verdächtigt, in Ostdeutschland an hohen Löhnen interessiert zu sein, um die Konkurrenz aus dem Osten zu schwächen und Facharbeiter aus Ostdeutschland zu gewinnen. Es war die Zeit, in der die Wiedervereinigung im Westen einen Boom und damit Nachfrage nach Fachkräften ausgelöst hatte. Um sie wurde in Ostdeutschland mit großzügigen Angeboten geworben. Ein Knäuel an widerstreitenden Interessen entwickelte sich, der das eigentliche Tarifgeschehen überlagerte und eine Einigung erschwerte. Dass sie dann doch im Mai 1993 gelang, ist Persönlichkeiten auf beiden Seiten des Verhandlungstisches zu verdanken.
Die zweite Halbzeit wurde auch zu einer Zeit der Erneuerung. VW investierte in Mosel und Chemnitz. Der damalige, für den Binnenmarkt, später für Wettbewerb in der EU-Kommission zuständige Kommissar Mario Monti ebnete uns die Wege durch das herrschende Dickicht der Subventionsregeln. Dass sie während der ersten Jahre des Wiederaufbaus überhaupt auf Ostdeutschland zum Schutz der westlichen Unternehmen angewendet wurden, machte kaum Sinn. Weitere folgten VW: Siemens, Wacker-Chemie, AMD aus den USA, Feddermann aus Israel, später BMW und Porsche. Wir nannten sie Leuchttürme. Sicher: die grünen Landschaften blühten noch nicht. Aber sie trieben zahlreiche Knospen in Gestalt einer neuen mittelständigen Wirtschaft, in allen Teilen des Landes.
Die erste Legislaturperiode endete im September 1994 mit den Landtagswahlen. Längere Zeit war ich nicht sicher, ob ich noch einmal kandidieren sollte. Schließlich war ich damals bereits 65 Jahre alt. Für einen Wechsel in die Wissenschaft oder die anwaltliche Tätigkeit war es nicht zu spät. Aber dann entschieden wir uns doch noch einmal anzutreten. Der Wahlsieg rechtfertigte die Entscheidung. Drei Aspekte des Ergebnisses escheinen mir bedeutsam.
Die Wahl widerlegte die weitverbreitete Überzeugung, man könne Wahlen nicht gewinnen, wenn man die Wähler fordert. Wir haben sie in einem ohnehin schwierigen Umfeld gefordert. Zur Zeit der Wahl war die Arbeitslosigkeit in Sachsen – wie allgemein in Ostdeutschland – mit gut 15 Prozent noch besonders hoch. Die Aussichten, sie in kurzer Zeit zu überwinden, waren gering. Wir haben die Menschen deshalb nicht bedauert, sondern ermutigt und ihnen versprochen, sie auf dem schwierigen Weg aus der Arbeitslosigkeit mit unserer Arbeit und unserem Einsatz zu begleiten.
Die wirtschaftliche Lage des Landes war ein wichtiges, aber nicht das allein dominierende Thema. Bedeutsam war auch die Sicherung und Erneuerung der Qualitäten, die Sachsen und seine Bevölkerung im Laufe ihrer Geschichte befähigt hatten, ihr Land zu einem Kernland der Industrialisierung in Deutschland und Europa zu entwickeln. Was die Vorfahren unter schwierigen Bedingungen geleistet hatten, diente nicht nur als geschichtlicher Rückblick. Es war zugleich Ansporn für den erneuten Aufbau des Landes. Die Fähigkeiten waren nicht verloren gegangen. Sie waren nur verschüttet.
Die Geschichte und die Kultur des Landes spielten dabei eine Schlüsselrolle. Geschichtlich gesehen ist Sachsen kein »neues Bundesland«. Es ist, neben Bayern, das älteste Flächenland Deutschlands und eines der kulturell, geistig, wissenschaftlich und wirtschaftlich stärksten. Als Wiege der Industrialisierung war es auch das Land, in dem sich die »große soziale Frage« des 19. Jahrhunderts mit besonderer Dringlichkeit stellte und ausgefochten wurde. Das heißt aber auch: Die sozialistische Orientierung des Landes nach dem ersten Weltkrieg entsprach durchaus seinen damaligen politischen Herausforderungen. Aber sie waren nicht ideologisch versteinert. Nach der Wiedervereinigung entschieden sich die Sachsen für eine offene, freiheitliche und dem sozialen Imperativ verpflichtete Politik: 1990 als Programm und 1994 und 1999 als erprobte Ordnung. Sie wollten einen dienenden, nicht einen vormundschaftlichen Staat und wollen ihn bis heute – und sehen dabei keinen Widerspruch zu ihren kurfürstlichen und königlichen Erinnerungen und Nostalgien. Beides zusammen macht sie stark und – bei angemessener Bescheidenheit – stolz auf ihr Land und ein wenig auch auf sich selbst. Wer diesen Stolz bewundert und mit ihnen teilt, dem gehört auch ihr Vertrauen.
K.B., im Mai 2015
Tagebuch
31. August 1992
Erster Tag im Büro und erster Tag der zweiten Halbzeit. Morgen ist es zwei Jahre her, dass ich in Dresden zum Spitzenkandidaten der CDU in Sachsen gewählt wurde. Die ersten beiden Jahre waren recht erfolgreich. Wir haben noch immer eine beachtliche Zustimmung in der Bevölkerung. Nach letzten Erhebungen würden uns bei einer Wahl am kommenden Sonntag 38 Prozent wählen. Das heißt, wir haben rund 14 Prozent der Stimmen verloren, die wir 1990 erhalten haben. Das sind rund 30 Prozent. Bayerische Umfrageergebnisse platzieren die CSU bei rund 40 Prozent. Die Verluste sind mithin ähnlich hoch, aber ohne all die Probleme, mit denen wir in Sachsen kämpfen müssen.
Die Probleme, die ich heute vorfand, unterscheiden sich nicht wesentlich von denen, die ich bei Antritt des Urlaubs zurückließ. In der Fraktion gibt es Schwierigkeiten mit der Kreisreform und der Kulturstiftung. Insgesamt wächst die Unruhe unter den Abgeordneten. Sie sind es nicht gewohnt, politische Lasten in dem Umfang zu tragen, wie es von ihnen gegenwärtig gefordert wird. In ihren Wahlkreisen werden sie für alle Schwierigkeiten in Anspruch genommen. Das veranlasst sie, in den Landtag zu kommen und Programme zu verlangen. Viele haben Dinge versprochen, die sie nicht einlösen können; andere haben den Kontakt zur Wirklichkeit verloren und müssen wieder auf die Grenzen unserer Möglichkeiten verwiesen werden. Beginnend mit der Fraktionssitzung am kommenden Mittwoch werde ich genau dies tun müssen.
Nach der kleinen Lage am Vormittag ein Gespräch mit Vertretern der Weltbank. Man will einen Bericht über Deutschland und die neuen Bundesländer schreiben und wollte sich informieren. Ich nehme mir viel Zeit, um auf die Bedeutung der nicht-ökonomischen Faktoren für die Entwicklung der Wirtschaft hinzuweisen.
In der Partei geht es langsam voran. In der Geschäftsstelle müssen wir Personal entlassen, was Hähle schwerfällt. Aber wir können die Leute nicht mehr alle bezahlen. Die CDU-Modellwoche in Zwickau muss ein großer Erfolg gewesen sein. Man habe sich gefreut, dass die CDU endlich wieder aus ihrer Ecke gekommen sei. In den kommenden Wochen werden ähnliche Veranstaltungen auch in anderen Kreisverbänden stattfinden.
Das Gespräch mit der Landesgruppe am Nachmittag war ein Gewinn. Die MdBs aus Sachsen wachsen unter der fähigen Führung ihres Vorsitzenden Joachim Schmidt zu einer handlungsfähigen Gruppe zusammen, die auch Konfrontationen mit der Regierung nicht scheut. Thema war die Finanzierung der Kulturlandschaft in Sachsen: Der Bund hat angekündigt, dass er 1994 keine Mittel mehr für die kulturellen Einrichtungen in den neuen Bundesländern zur Verfügung stellen wolle, obwohl wir noch nicht in der Lage sein werden, die Kulturlandschaft selbst zu finanzieren. Im Gespräch mit dem Bundeskanzler will man auf die Konsequenzen einer solchen Politik aufmerksam machen. Dabei wird es auch um die identitätsstiftende Wirkung der Kultur in Deutschland gehen – wie ich dies auch im Ausschuss Deutsche Einheit dargelegt habe. Zur Finanzpolitik verständigen wir uns darauf, dass in der ersten Lesung des Haushalts auf den noch nicht befriedigten Finanzbedarf der neuen Länder hingewiesen wird. Dagegen soll noch nicht darüber gesprochen werden, welche Konsequenzen es für unser Abstimmungsverhalten haben könnte, wenn dieser Bedarf nicht befriedigt wird. Die MdBs sind jedoch entschlossen, notfalls dem Haushalt auch die Zustimmung zu verweigern.
Am Wochenende gab es an zahlreichen Stellen im Land Versuche, Krawalle vor Asylbewerberheimen zu organisieren. Innenminister Eggerts Polizei war überall Herr der Lage. Vor zehn Tagen hat in Sachsen das neue Schuljahr begonnen. Es gab keine Proteste oder Aufstände der Lehrer oder Eltern. Stefanie Rehm und ihr Staatssekretär haben eine großartige Leistung vollbracht. An den Universitäten sind inzwischen mehr als 50 Prozent der Professuren erneuert. Zahlreiche Berufungen laufen oder sind mit Erfolg abgeschlossen. So haben alle drei Ressorts Erfolge aufzuweisen. Während es in Thüringen wieder drunter und drüber geht – Willibald Böck und Hans-Henning Axthelm mussten zurücktreten und Bernhard Vogel hält seinen bisherigen Innenminister zwar als solchen für ungeeignet, nicht jedoch als Landesvorsitzenden – und Werner Münch in Anhalt knapp einem erfolgreichen Misstrauensvotum entging, zeichnet sich unser Land durch relative Stabilität aus. Auch das ist ein schöner Erfolg am Ende der ersten Halbzeit.
Nebenan im Essraum herrscht große Fröhlichkeit. Zeller, Nowak, Schommer, Eggert und andere lachen herzlich miteinander. Auf den guten Geist der Zusammenarbeit in der Regierung bin ich besonders stolz. Müsste ich morgen ausscheiden, es wäre zwar schwierig für die Truppe. Aber sie könnte auch ohne mich weitermachen.
1. September 1992
Kabinettstag. Vor Beginn Besuch von Stefanie Rehm und Wolfgang Nowak. Am 20. August begann das neue Schuljahr. Wider Erwarten gab es keine Probleme und Proteste. Geringfügige Schwierigkeiten wurden örtlich mit Bordmitteln behoben. Frau Rehm war es gelungen, zusammen mit ihrem Staatssekretär, das Schulsystem neu zu ordnen und rechtzeitig damit fertigzuwerden: Eine enorme Leistung, für die ich sie nicht nur in unserem Gespräch, sondern auch im Kabinett lobte. Sie hat ihre Sicherheit wiedergefunden und strahlt Zuversicht aus. In den kommenden Monaten wird sie Schulen besuchen, die Lehrer ermutigen und motivieren, während Nowak das Haus administrativ führt. Ein großes Problem der Neuordnung ist damit gelöst.
Im Kabinett gab es keine wesentlichen Probleme. Eggert berichtete über die Maßnahmen, die er zur Verhinderung Rostocker Ereignisse ergriffen hat. Er führt die Polizei gut, gibt ihr Rückendeckung und motiviert sie damit. Am Wochenende konnte er mit seiner Truppe mehrere extremistische Unternehmungen durch rechtzeitige Vorkehrungen verhindern. Arnold Vaatz trägt eine interessante und vertiefenswürdige Beobachtung vor: In den Abendnachrichten zeige das Fernsehen die Gräuel des Krieges in Serbien. Vom Zuschauer werde erwartet, dass er sich empöre. Dann folge ein brutaler Spielfilm nach dem anderen, in dem Menschen erschossen, erstochen oder auf andere Weise umgebracht würden. Vom Zuschauer werde erwartet, dass er sich unterhalte. Auf die Dauer könne man diesen Widerspruch nicht verkraften. Früher oder später müsse die fiktive in eine reale Brutalität umschlagen. Auch darüber müsse man mit den Anstalten und in der Öffentlichkeit diskutieren.
2. September 1992
Auf dem Weg zurück nach Dresden nach einer Besprechung mit Theo Waigel, zu der Bernd Vogel und ich nach Bonn geflogen waren. Es ging um die Privatisierung von DMZ und dem vergleichbaren Unternehmen in Erfurt. Waigel hatte vor der Sommerpause als Bedingung für eine Zustimmung zum Verwaltungsratsbeschluss verlangt, dass unsere Länder sich zu 50 Prozent an den Kosten beteiligen, die über die Liquidationskosten hinausgehen. Heute haben wir ihn von rund 90 Millionen DM auf rund 40 Millionen DM, zu zahlen in vier Jahresraten ab 1993, heruntergehandelt. Außerdem soll die Entscheidung, falls sie von uns getroffen wird, keine präjudizierende Wirkung haben. Ich habe mir eine Rücksprache mit dem Kabinett vorbehalten; Vogel will ebenso verfahren. Wahrscheinlich werden wir das Angebot nicht ablehnen können. Denn es wäre schwer zu erklären, dass wir eine Fortführung der Mikroelektronik an solchen Beträgen scheitern lassen wollen. Für Waigel war wesentlich, dass seine Position nicht gänzlich aufgegeben werden muss. Er muss sein Gesicht wahren.
Auf dem Weg nach Bonn erhalte ich die Nachricht, dass Waigel sich im letzten Bayernkurier nachhaltig kritisch zu unseren finanziellen Forderungen geäußert hat. Es sind die Töne, die Teile der CSU von ihrem Vorsitzenden in der Hoffnung erwarten, durch Konfrontation nach außen könne die Zustimmung zur CSU in Bayern gestützt werden. Sie ist derzeit bei etwa 40 Prozent; wir liegen in Sachsen bei 38 Prozent.
Waigel setzt damit seine bisherige Politik fort, die DSU als Alternative zur CDU zu unterstützen. Ich habe in der Fraktion, der ich heute zu Beginn der zweiten Halbzeit berichtete, unter dem Beifall der großen Mehrheit versichert, dass ich solche Eskapaden nicht länger hinnehmen werde. Morgen werde ich den Vorgang auch im Bundesvorstand ansprechen. Wir treiben möglicherweise auf eine Konfrontation mit Waigel zu, was ich bedauern würde. Es würde das Verhältnis zu unserem Partnerland belasten, auf das wir angewiesen sind.
Die Fraktionssitzung verlief erfreulich. Ich gab einen umfangreichen Lagebericht. In der Diskussion spielten vor allem Fragen der inneren Sicherheit eine Rolle. Der Druck, der von der illegalen Einwanderung auf die Bevölkerung ausgeht, nimmt zu. Die Abgeordneten spüren ihn und wollen ihn weitergeben. Die Kreisreform wurde nur von einem der zahlreichen Redner angesprochen. Er verlangte, möglichst bald zu einer Entscheidung zu kommen. Niemand könne die Diskussion noch sehr viel länger ertragen. Der Vorschlag eines Redners, sich auf die Festlegung der Kreisgrenzen zu beschränken und die Entscheidung über den Kreissitz einer Abstimmung im Kreis zu überlassen, fand in der Fraktion nur geteilte Zustimmung. Viele fürchten zu Recht eine neue, kaum noch kontrollierbare Emotionalisierung.
Die Schulfrage spielte keine Rolle mehr. Das neue Schuljahr hat auch in den Augen der Abgeordneten ohne Probleme begonnen. Ein großer politischer Erfolg für Frau Rehm. Karl-Heinz Binus versprach, ihn beim Tagesordnungspunkt Schule zu würdigen.
4. September 1992
Die Klausurtagung des Bundesvorstandes der CDU liegt hinter mir. Mein hauptsächlicher Eindruck: Die Führung der Partei befindet sich in einem Zustand tiefer Unsicherheit und Orientierungslosigkeit. Entgegen der Tagesordnung wurde gestern nicht der Bericht des Vorsitzenden behandelt, sondern eine von Wolfgang Schäuble vorbereitete Ausarbeitung zum Solidarpakt, den die Fraktionsführung bereits auf ihrer Tagung in Leipzig gefordert hatte. Anlass war der Umstand, dass sich seit Schäubles Vorschlag, eine Zwangsanleihe zu beschließen, um dem Staat so neue Einnahmen zu verschaffen und zugleich die Investitionen in Ostdeutschland zu befördern, nachhaltige öffentliche Kontroversen entwickelt haben, die bis heute nicht abgerissen sind. Selbst während der Klausurtagung wurden von Rühe und anderen öffentliche Aussagen zur Ungerechtigkeit der derzeitigen Verteilung der Lasten der Einheit gemacht. Zu Recht spricht die Opposition deshalb inzwischen von einem Chaos in der Finanzpolitik. Weder Waigel noch Kohl waren bisher in der Lage, dieses Chaos zu beseitigen. Sie tragen im Gegenteil durch immer neue Variationen ihrer Aussagen zu seiner Vermehrung bei.
So stand im Mittelpunkt unserer gestrigen Aussprache der Streit um die Formulierung der Aufforderung zu einem Solidarpakt von Politik und Tarifparteien, vor allem die Verwendung des Wortes Investitionsanleihe. Da ich den Bundesvorstand früher verlassen habe, nehme ich an, man berät noch immer über diese Frage. Gestern Abend waren wir in einem kleinen Kreis (Schäuble, Norbert Blüm, Werner Münch und ich) nicht zu einem Ergebnis gekommen. Wir hatten lediglich Formulierungsanweisungen gegeben, unter anderem an Hans Reckers, der jetzt für Schäuble arbeitet. Dieser beeindruckte mich durch seine Frische und Offenheit. Wenn man es nicht wusste, konnte man ihm seine enorme Behinderung nicht anmerken. Dennoch halte ich ihn nicht für geeignet, Kanzler zu werden. Er ist ein glänzender Taktiker und ein guter, aber recht formal denkender Politiker. Als Kanzler erscheint er mir zu flach.
Was uns nicht gelang, auch heute Morgen nicht, war der Verzicht auf das Wort Investitionsabgabe. Schäuble wollte den Begriff, weil er für ihn die Alternative zur Steuererhöhung ist. An sich hält er Steuererhöhungen für erforderlich. Sie lassen sich jedoch in der Koalition nicht durchsetzen. Nun will er die Abgabe als Alternative anbieten, von der er selbst wenig hält. Scheitert sie und erweist es sich auch als unmöglich, die öffentlichen Haushalte im vorgegebenen Rahmen von 2,5 respektive 3 Prozent zu halten, dann soll die Erhöhung der Steuern als einzige Alternative übrig bleiben. Dies mag taktisch fein gesponnen sein. Aber es ist in der allgemeinen Unsicherheit über die weitere Entwicklung Deutschlands nicht durchzuhalten, zentrale Fragen der Finanzierung der Einheit so zu behandeln.
Als deutlich wurde, dass ich nicht bereit sein würde, auch den ansonsten mit Gewinn neu formulierten Text zu akzeptieren, solange die Investitionsabgabe als ein Angebot an den Solidarpakt in ihm enthalten war, versuchte man eine weitere Alternative. Vorher hatte Kohl, zunächst mit seiner Überwältigungsstrategie (Einsatz der Körperfülle, die in der Tat schon unästhetisch gewaltig ist, laute Töne und Dominanzgehabe, das einschüchtern soll) versucht, zu einem Formelkompromiss zu kommen. Es gelang nicht. Das veranlasste ihn, selbst nach einer Lösung zu suchen und uns dann noch einmal um Vorschläge zu bitten. Dies führte zu einer erneuten Änderung des Textes. Nunmehr wurde die Anleihe an anderer Stelle versteckt und unter den Vorbehalt gestellt, man wolle »Modelle« für Investivlohn und Anleihe in den Solidarpakt einbringen.
Inzwischen hatte die Aussprache über den Europatag des Parteitages begonnen. Dazu hatte Hintze eine rund dreißigseitige Ausarbeitung zu unserer Europapolitik vorgelegt, die völlig unbrauchbar war. Das war offenbar auch Kohl aufgefallen. Nach dem ersten Diskussionsbeitrag von Bernd Vogel, der sich in einzelnen Punkten skeptisch geäußert hatte, und vor meiner Wortmeldung nahm er selbst das Wort, um Zweifel an der Brauchbarkeit des Textes für den Parteitag zu äußern. Mit diesem und meinem Beitrag war der Text dann praktisch vom Tisch – wenn auch Renate Hellwig, die offenbar an seiner Abfassung mitgearbeitet hatte, darüber wenig glücklich war. Jetzt soll ein neuer Text erarbeitet werden: wesentlich kürzer, eher in Thesenform. Peter Hintze begleitete das Ganze in hilfloser Haltung. Ich hatte mir lange überlegt in den letzten Wochen, ob ich mich gegenüber Kohl oder öffentlich gegen eine Wahl Hintzes zum Generalsekretär aussprechen sollte. Ich werde es nicht tun: Nicht, weil ich ihn jetzt doch für geeignet halte, sondern weil es sich nicht lohnt. Das eigentliche Problem lautet nicht Hintze, sondern Kohl.
Mein Eindruck: Die Anzeichen für einen Zerfall der Koalition mehren sich. Die CSU ist geprägt durch die wachsende Angst, die nächsten Landtagswahlen zu verlieren. Ein Teil der Führung, der sich auch von Waigel trennen will, sucht die Antwort in der Konfrontation mit Bonn. Lieber in Bonn verlieren und in Bayern gewinnen, als umgekehrt. Das lähmt die Führung. In der FDP sieht es nicht viel besser aus. Lambsdorff hat keine Autorität mehr. Aber er bleibt Vorsitzender bis zum kommenden Jahr. Die Nachfolgekandidaten blockieren sich, wenn es um den Zeitpunkt der Wahl geht. In der CDU verliert die Führung ebenfalls an Zustimmung. Man nimmt Kohl nicht mehr besonders ernst. Auch dies ist ein Eindruck, den ich von der Klausurtagung mitnehme. Die Veränderung reift heran.
9. September 1992
Die Diskussion in der Partei und in der Koalition nach unserer Klausurtagung war nicht dazu angetan, das Vertrauen in die Fähigkeit der Regierung zu erhöhen. Kaum war der Bundesvorstand mit Zweidrittelmehrheit, aber gegen die Stimmen aller Wirtschaftsexperten, der Forderung Kohls gefolgt, den Solidarpakt mit dem »Angebot« einer Investitionsanleihe zu beschließen, erklärten FDP und CSU, dass es eine solche Anleihe mit ihnen nicht geben werde. Zwar wusste auch in der CSU noch niemand, um welche Art von Anleihe es sich eigentlich handelte. Nur, dass Zwang im Spiel sein sollte, war bekannt. Was folgte, war ein Wochenende mit Erklärungen und Gegenerklärungen, die es erforderlich machten, sich sonntags abends beim Kanzler in der Koalitionsrunde zu treffen, um für die bevorstehende Haushaltsdebatte zu einer einheitlichen Linie zu finden. Kohl soll dabei zunächst einmal in seiner Art nach denen gefragt haben, die eine große Koalition ohne Kohl wollten. Sein Misstrauen richtete sich wohl in erster Linie auf Schäuble, und dies nicht ohne Grund. Denn die Medien waren voll der Spekulationen, dass Schäuble und Günther Krause, die beiden Verhandlungsführer des Einigungsvertrages, sich verbündet hätten, um Kohl zu umgehen. Schäuble soll langatmig und unsicher geantwortet haben.
Anschließend wurde beschlossen, die Investitionsanleihe vom Tisch zu nehmen. Was angeblich in der Fraktion eine breite Mehrheit finden sollte – so Schäuble, aber auch Kohl, während der Klausur –, stieß tatsächlich auf den erbitterten Widerstand zahlreicher Abgeordneter aus dem Westen. Dies wiederum veranlasste die Ostabgeordneten, die von der Sache nichts verstehen – aber auch nichts verstehen können –, sich ausgerechnet die Investitionsanleihe als Symbol ihrer Selbstständigkeit und Identität zu wählen, was vor allem auf Krause zurückzuführen war, der eine zunehmend unheilvolle Rolle in Bonn spielt. So musste Kohl, der die Abgabe bereits geopfert, aber in der Klausur noch für sie gekämpft hatte, erneut seine Meinung ändern. Zwar führte er sie nicht wieder ein. Aber vom Tisch, so Kohl, sei sie noch nicht. Was er mit der Abgabe bezweckt, ist bis jetzt unklar geblieben. Wahrscheinlich hat er keine rechte Vorstellung davon, um was es sich überhaupt handeln könnte. Wie schon häufig zuvor ist auch sie für ihn ein vor allem taktisches Problem. Dass die Diskussion Investoren verschreckt, die nicht wissen, ob sie trotz Investitionen im Osten dann noch zur Kasse gebeten werden könnten, spielt im Bonner Spiel ebenso wenig eine Rolle wie die wirtschafts- und finanzpolitischen Bedenken, die man gegen ein Instrument wie eine Zwangsanleihe vorbringen kann.
Waigel wiederum hat heute im Bundestag eine Unternehmenssteuerreform in Aussicht gestellt, die zu einem gespaltenen Einkommensteuersatz führen soll. Damit werden Errungenschaften preisgegeben, die wir großen Reformen des Steuerrechts in der Vergangenheit verdanken. Wer Gewerbesteuer zahlt, soll nur 44 Prozent Einkommensteuer zahlen, die anderen 53 Prozent als Höchstsatz. Das Durcheinander wird immer größer.
Auf östlicher Seite bemühen wir uns um eine gemeinsame Position in den Fragen der Länderfinanzierung für 1993. Wir hatten im Juli in Berlin eine solche Position formuliert. Ob sie halten wird, ist nicht gewiss. Bonn versucht bereits, durch Sonderzusagen oder Pressionen die Front der Länder aufzubrechen. Man hat offenbar begriffen, dass die Ostländer den Haushalt im Bundesrat auch scheitern lassen könnten, und will deshalb die Bildung einer gemeinsamen Front verhindern. Das trifft allerdings weniger Sachsen als die anderen Bundesländer im Osten. Was Milbradt aus den Etatberatungen von Anhalt oder Mecklenburg hört, ist erschreckend. Die Neuverschuldung macht bis zu 30 Prozent des Etatvolumens aus – eine unverantwortliche Entwicklung, zu der die Länder gezwungen werden, weil der Bund keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stellt. Ich bin entschlossen, diese Entwicklung nicht hinzunehmen, auch wenn ich die Gegenposition alleine vertreten muss.
Am Wochenende der Tag der Sachsen in Freiberg. Rund 300 000 Menschen kamen, um ihn zu feiern. Noch selten habe ich so viele freundliche, optimistische und offene Gesichter gesehen wie an diesen Tagen. Obwohl das Wetter an den ersten beiden Tagen schlecht war, war die Stimmung gut. Herrliche Konzerte im Dom, die Auszeichnung unserer Olympiateilnehmer, ein Besuch im Asylbewerberheim und vieles mehr standen auf unserem Programm. Höhepunkt war für Ingrid und mich der Festgottesdienst im Dom und die Predigt Bischof Hempels. Am Beispiel des Damaskus-Erlebnisses des Saulus erläuterte er den Charakter der Wende. Sie sei, so Hempel, immer mit einer Krise verbunden, wenn es sich um eine wahre Wende handelt. Durch diese Krise gehen wir. Sie beginnt inzwischen auch Westdeutschland zu erfassen. Vor allem hier liegt die Ursache für die wachsende Unsicherheit in Westdeutschland und in der politischen Führung. Die alten Antworten taugen nicht mehr für die Bewältigung der Flut neuer Fragen, die mit der Einheit über Westdeutschland hereingebrochen sind. Wir haben die Einheit gewonnen, soweit es sich um die staatliche Einheit handelt. Was sie für Deutschland und seine neue Rolle bedeutet, müssen wir erst noch erfahren.
11. September 1992
Die Haushaltsdebatte hat gezeigt, dass die Koalition steht, aber nicht laufen kann. Kohl hat, zur Erleichterung der CDU, eine gute Figur gemacht, Sicherheit ausgestrahlt, zu einem Solidarpakt eingeladen, aber inhaltlich zu diesem Pakt kaum etwas beigetragen. SPD und Gewerkschaften, aber auch die FDP, haben die Einladung nicht abgelehnt. Aber sie formulieren Bedingungen, die den Erfolg der Veranstaltung fragwürdig erscheinen lassen. Es fällt der SPD schwer, eine Regierung zu stützen, die sie eigentlich ablösen will. Auch nach der Debatte wollen deshalb nicht die Stimmen verstummen, die der Regierung ein vorzeitiges Ende prophezeien. Für uns ist nicht der Bestand der Regierung bedeutsam, sondern ihre Fähigkeit, sich zu bewegen. Falls sie diese Fähigkeit verloren hat, wird die Wirklichkeit die Koalition sprengen, nicht Frondeure oder illoyale CDU-Politiker.
Bonn behindert auch zunehmend den Sanierungsauftrag der Treuhand, indem es eine nachhaltige Beteiligung der ostdeutschen Länder an den Sanierungskosten verlangt, wohl wissend, dass wir diese Kosten nicht übernehmen können. Darüber hinaus behindert Waigel direkt und durch die Bundesvermögensverwaltung unsere Aufbauanstrengungen. So hat er die Treuhand angewiesen, trotz notariellem Vertrag mit Sachsen die Flughafengrundstücke in Leipzig nicht zu übertragen. Auch in Dresden weigert er sich, uns das Flughafengelände zu überlassen, und verlangt, dass wir es dem Bund abkaufen. Den westdeutschen Ländern hat der Bund vergleichbare Grundstücke in den sechziger Jahren übertragen. Die Vermögensverwaltung verlangt von den Kommunen, aber auch von heimischen Investoren teilweise Fantasiepreise für Bundesgrundstücke. Die Beschwerden der ostdeutschen Länder gegen diese Praxis, die wir Kohl vorgetragen haben, haben bisher keine Wirkung gezeigt.
Das Verhältnis zu Waigel wird vor allem für die CDU-regierten Länder Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt noch dadurch erschwert, dass die CSU die DSU massiv unterstützt und damit unsere Mehrheitsfähigkeit gefährdet. In einem Gespräch mit dem sächsischen Bund der Vertriebenen habe ich gestern erfahren, dass die DSU dem Verband ihre Geschäftsstellen zur Verfügung stellt und bei den älteren Vertriebenen mit dem Versprechen wirbt, sie erhielten eine Entschädigung von 4000 DM. Diese Entschädigung hat Waigel jedoch abgelehnt. All diese Aktivitäten werden von der CSU bezahlt. Wir können uns im Grunde nicht dagegen wehren, denn wir sind vom Finanzminister abhängig. Aus dieser Situation kann uns nur ein Angriff auf Waigel mit dem Ziel befreien, ihn als Finanzminister zu stürzen – also durch Ablehnung seines Haushalts. Niemand weiß, ob die Koalition das überleben würde. Sicher ist jedoch, dass wir nicht zulassen können, um den Lohn unserer Arbeit in Sachsen durch Kräfte betrogen zu werden, die aus der Sicherheit der bayerischen Burg angreifen und sich auf unsere Bereitschaft verlassen, die Koalition in Bonn unter allen Umständen zu schützen.
Damit haben sich inzwischen drei Ebenen herausgebildet, auf denen wir gegen Waigel stehen: Der Haushalt, die vom Bundesfinanzministerium erzwungene Treuhandpraxis und die Unterstützung der DSU. Waigel ist nicht nur zum eigentlichen Hindernis der Einheit, sondern auch zur Gefahr für unsere Mehrheiten geworden.
Nachmittags erstes Zusammentreffen mit den Regierungspräsidenten. Der bei weitem fähigste unter ihnen ist Walter-Christian Steinbach, ein Mann aus Sachsen und vor der Wende Pfarrer. Er ist fantasievoll, kann improvisieren und setzt sich durch. Die beiden aus Westdeutschland stammenden Herren in Chemnitz und Dresden sind weit bürokratischer. Wir identifizieren drei Bereiche, in denen schnell gehandelt werden muss: die Wasserwirtschaft, den Wohnungsbau und Fragen der Koordination der Planung. Zur Wasserwirtschaft werde ich zu einem ressortübergreifenden Gespräch einladen. In der Wohnungswirtschaft überlegen Georg Milbradt und ich, ob wir nicht doch ein getrenntes Ministerium einrichten sollen, das sich nur mit diesem Bereich befasst – eine Forderung, die die SPD schon lange erhebt. Ich neige zunehmend dazu, dies zu tun. Im Organisationsbereich muss Bestrebungen, vor allem des Umweltressorts, entgegengetreten werden, sich immer stärker aus der allgemeinen Struktur zu lösen.
Noch ein Problem hat Kohl: Er versteht nicht, dass sich mit der deutschen Einheit auch die Machtstrukturen in Deutschland geändert haben. Für ihn ist, wie er es im letzten Bundesvorstand formulierte, die Partei das Zentrum der Macht. Doch dieses Zentrum existiert nicht mehr. Es ist nicht nur durch die wachsende Unfähigkeit der Partei beschädigt, sich Neuem zu öffnen: Dies hat Kohl selbst herbeigeführt. Das Zentrum ist auch durch die deutsche Einheit überholt. Denn die Ost-CDU wird sich diesem Zentrum nicht einordnen, auch wenn derzeit der Versuch gemacht wird, die Macht der Zentrale auf die ostdeutschen Verbände auszudehnen. Die Bundespartei wird die Ostverbände nicht verdauen, ohne sich selbst zu ändern. Die Reaktion der Partei auf die Kandidatur Heinz Eggerts ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Sie kann nicht verstehen, dass man eine Kandidatur anmelden kann, obwohl der Parteivorsitzende seine Wünsche zur Zusammensetzung seiner Stellvertreter doch bereits angemeldet hat.
Damit beginnt die Macht wieder dorthin zu wandern, wo sie hingehört: zu den staatlichen Institutionen. Bundestag und Bundesrat nehmen an Bedeutung zu und lösen sich aus der parteipolitischen Umklammerung. Das vollzieht sich bei der CDU ebenso wie bei der SPD.
15. September 1992
Auf dem Weg nach Bonn zum Gespräch der Ost-Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler. Gestern habe ich Kohl den folgenden Brief geschrieben:
»Lieber Helmut, seit Ende der Sommerpause zeichnen sich drei Bereiche ab, in denen es zu Konflikten mit dem Finanzminister und Vorsitzenden der CSU kommen kann. Ich möchte Dich von dieser Entwicklung unterrichten und vorschlagen, dass wir bald über die Frage sprechen, wie ein offener Konflikt vermieden werden kann.
1. Der erste Bereich betrifft die Finanzierung der Haushalte der ostdeutschen Bundesländer für 1993. In der Bundesvorstandssitzung vom 30. Juni, an der auch Waigel teilnahm, ist von Dir in Aussicht gestellt worden, dass wir über die Zuschüsse des Bundes für 1993 nach der Sommerpause noch einmal sprechen würden. Auf der Grundlage der Zahlen, die Waigel vorgelegt hatte, war offensichtlich, dass die ostdeutschen Länder ihre Haushalte 1993 nur würden finanzieren können, wenn sie ihre investiven Mittel kürzen und sich in einer Höhe verschulden, die mit dem Aufbau Ost unvereinbar wäre.
Alle Versuche nach der Sommerpause, zu einem solchen Gespräch zu kommen, sind bisher gescheitert. Stattdessen wächst der Druck, der auf ostdeutsche Abgeordnete ausgeübt wird, die sich für eine Verbesserung der unzureichenden Finanzausstattung ihrer Länder einsetzen. Von einer treuhänderischen Haltung der Westdeutschen zugunsten der Ostdeutschen, die noch nicht die Kraft haben können, sich im gesamtdeutschen Verteilungskampf zu behaupten, kann keine Rede sein.
Wichtigstes Argument für die ablehnende Haltung Waigels ist die Behauptung, der Bund transferiere im kommenden Jahr rund 92 Milliarden DM in die ostdeutschen Bundesländer. Dass die vorgesehenen Transferleistungen netto im für Waigel günstigsten Fall nur knapp 30 Milliarden DM betragen werden, weiß das BMF. Das hielt Waigel nicht davon ab, die Zahl auch in seiner Etatrede wieder zu verwenden. Wir sind dadurch gezwungen, die richtigen Zahlen im Bundesrat vorzulegen – auf der Grundlage der Daten des BMF –; eine Irritation, die ich lieber vermieden hätte.
Die irreführenden Angaben über die tatsächlichen Leistungen aus westdeutschen öffentlichen Haushalten sind umso bedauerlicher, als sie verschleiern, dass der Bund zur Finanzierung der Einheitskosten die Steuern erhöht hat, ein wesentlicher Teil der Last also nicht vom Bund, etwa durch Verzicht auf bisherige Programme oder Kürzungen an anderer Stelle, sondern von den Steuerzahlern getragen wird. Sie müssen zu Recht den Eindruck haben, dass sie in noch größerem Umfang zur Kasse gebeten werden müssen, wenn schon die gut 90 Milliarden DM nicht ausreichen.
Die überhöhten Angaben tragen weiter wesentlich zu den Spannungen bei, die in den letzten Wochen durch unvermeidliche Umverteilungen ausgelöst worden sind. Die Gefahr, dass wir politisch zwischen die Mühlsteine schnell zunehmender Verteilungskonflikte geraten und dabei erheblich Federn lassen müssen, wächst ohnehin. Es ist nicht zu verstehen, warum wir dieser Gefahr durch falsche Angaben über die tatsächliche Dimension der Last auch noch Vorschub leisten.
2. Am 30. Juni haben wir gemeinsam beschlossen, dass die Bewältigung der finanziellen Altlasten der DDR und der Treuhandschulden eine gesamtstaatliche Aufgabe sei. Diese politische Vorgabe, die ihre Glaubwürdigkeit vor allem Deiner Zustimmung verdankt, hat uns in Ostdeutschland sehr erleichtert. Mit ihr schien die Gefahr gebannt, dass die ostdeutschen Länder unter der finanziellen Erblast und den Kosten der Sanierung alter Unternehmen zusammenbrechen könnten.
Inzwischen geht Waigel jedoch dazu über, seine Zustimmung zu Sanierungsbeschlüssen der Treuhand davon abhängig zu machen, dass das betroffene Land sich in erheblichem Umfang an den Kosten der Sanierung beteiligt. Ein Teil der Last, die eigentlich gesamtstaatlich getragen werden sollte, wird so von vornherein auf die ostdeutschen Länder überwälzt. Damit wird zwar die zukünftige gesamtstaatliche Last geringer. Zugleich wird jedoch die Fähigkeit der ostdeutschen Länder eingeschränkt, ihren Wiederaufbau erfolgreich voranzubringen. Die späteren gesamtstaatlichen Kosten eines solchen Versagens werden ungleich größer sein, von den politischen Kosten ganz zu schweigen. Hier zeigt sich in besonders krasser Form, dass es an mittelfristigen Betrachtungen, die diesen Namen verdienen, im BMF fehlt.
Das BMF erschwert den Neubeginn im Osten darüber hinaus durch eine Grundstücks- und Bodenpolitik, die zwar in einer voll entwickelten Volkswirtschaft verständlich sein mag, in Ostdeutschland jedoch zunehmend zum Investitions- und Entwicklungshemmnis Nr. 1 wird. Statt Länder und Gemeinden mit Grund und Boden auszustatten und so die Entwicklung eines Grundstückmarktes zu unterstützen, der Grundstücke zu investitionsorientierten Preisen zur Verfügung stellt, müssen Länder und Kommunen um jedes Grundstück kämpfen. Der Freistaat Sachsen zum Beispiel bemüht sich schon seit mehr als einem Jahr, vom Bund die für den Bau der Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden notwendigen Grundstücke zu erhalten. Obwohl das Erfordernis von Investitionen in diesem Bereich offensichtlich ist, weigert sich Waigel, die Grundstücke zu übertragen. Die Startbahn in Dresden dürfen wir kaufen. Der Vollzug eines notariellen Vertrages zwischen Treuhand und Freistaat, Grundstücke in Leipzig betreffend, ist von Waigel untersagt worden. Investitionen, die dringend erforderlich sind, unterbleiben. Unsere Behauptung, wir wollten Investitionshemmnissse beseitigen, klingt angesichts solcher Sachverhalte nicht glaubwürdiger.
Werden Grundstücke angeboten, dann häufig zu Preisen, die jenseits jeglicher wirtschaftlichen Realität liegen. Die Bestimmung von Verkehrswerten ist häufig willkürlich, da es noch keine Marktpreise gibt. Vielfach liegen sie weit über den Preisen, die westdeutsche Städte mit vergleichbaren Bedingungen ihren Investoren anbieten – und die mit unseren Städten vielfach im Wettbewerb um Investitionen stehen. Bei der letzten Runde mit den Ost-Ministerpräsidenten haben wir dies bereits vorgetragen. Es hat sich nichts geändert.
Schließlich weigert sich Waigel, den Ländern die Grundstücke zurückzugeben, die ihnen früher gehörten und ihnen von den Nazis zugunsten des Reiches weggenommen wurden. Diese, wie die Beamten es nennen, »verreichlichten« Grundstücke wurden den westdeutschen Ländern nach dem Krieg zurückgewährt, ohne dass sie dafür hätten zahlen müssen. Uns wird die Rückgabe unter Hinweis auf den angeblich vorrangigen Einigungsvertrag verweigert. Land und Gemeinden sollen die Grundstücke abkaufen, was uns zwingt, vom Bund die notwendigen Mittel einzufordern. Tun wir es, können wir im Bayernkurier aus der Feder des CSU-Vorsitzenden lesen, dass wir maßlose, weltfremde Forderungen stellen, statt uns im Westen zu bedanken.
3. Damit bin ich beim dritten Bereich, der nicht das BMF, sondern die CSU betrifft. Waigel hat kürzlich wieder eine größere DSU-Veranstaltung in Sachsen durchgeführt. Man hatte aus allen Landesteilen Anhänger der DSU zur Kundgebung gebracht. Der »Bundesvorsitzende« der DSU, Keller – Bürgermeister in Dresden und ein vernünftiger Mann –, wurde praktisch in Pflicht genommen, die Selbstständigkeit der DSU weiter zu betreiben. Vielversprechende Gespräche über eine Aufnahme der DSU in die CDU sind damit vorerst auf Eis gelegt. Waigel erklärte auf der Kundgebung, die DSU könne die Probleme im Osten besser lösen als die CDU. Dort müsste man wohl erst lernen, dass das Geld, das man verlange, erst erarbeitet werden müsse etc. Derzeit wirbt die DSU in Kreisen der Vertriebenen mit dem Versprechen, 4000 DM Entschädigung werde gezahlt; dies, obwohl Waigel genau dies ablehnt. DSU-Geschäftsstellen werden dem Bund der Vertriebenen als Standorte angeboten usw.
Der ganze Spuk ist nur möglich, weil die CSU die DSU finanziert. Ohne finanzielle Unterstützung aus Bayern gäbe es die DSU nicht mehr. Offenbar will man mit der DSU in die nächsten Kommunal- und Landtagswahlen gehen. Anscheinend verspricht man sich Chancen, statt der Republikaner all diejenigen um sich zu scharen, die in der unzureichenden Aufarbeitung der Vergangenheit, in Asylfragen und in zu wenig Härte gegen Bonn die Ursachen für ihre Probleme sehen.
Durch das Verhalten Waigels werden vor allem Thüringen und Sachsen in eine unmögliche Lage gebracht. Als Finanzminister hat Waigel uns praktisch in der Hand und kann fehlendes Wohlverhalten bestrafen. Als CSU-Vorsitzender ist er Chef der Regierungspartei unseres Partnerlandes Bayern. Auf dessen Kooperation sind wir dringend angewiesen, nachdem Baden-Württemberg weniger berechenbar geworden ist. Gleichwohl hat Bayern gerade gefordert, wir müssten in Zukunft 60 Prozent der Kosten für Leihbeamte aus Bayern übernehmen; die mit Abstand höchste Forderung aller westlichen Bundesländer.
Mit Hilfe der Kombination Bundesfinanzminister und CSU-Vorsitzender, also nicht abhängig von der CDU-Entwicklung im Bund, kann Waigel sich die Möglichkeit sichern, in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt eine Konkurrenz zur CDU aufzubauen, ohne Sanktionen befürchten zu müssen. Mir raubt er damit die Chance, noch einmal eine echte CDU-Mehrheit zu erhalten. Die Folge wäre voraussichtlich eine große Koalition in Sachsen. Mit der DSU wäre eine Koalition kaum politisch möglich, angesichts des politischen Personals dieser Partei aber auch nicht zumutbar.
Für die Sächsische Union ist eine solche Politik nicht akzeptabel. Wenn es nicht zum offenen Bruch mit der CSU und zu politischen Aktivitäten in Bayern – etwa aus Anlass des nächsten CSU-Parteitages – kommen soll, muss hier so schnell wie möglich eine Änderung eintreten. Die finanzielle Unterstützung der DSU muss beendet werden. Die CSU muss uns in unseren Bestrebungen unterstützen, die DSU in die CDU aufzunehmen. Bereitschaft dazu besteht auf beiden Seiten, vor allem auch auf der kommunalen Ebene. Interventionen von außen, vor allem gestützt auf die Autorität des Bundesfinanzministers, machen alle Versuche zunichte, hier weiterzukommen. Ich kann nicht ausschließen, dass dieses Problem bereits den Bundesparteitag in Düsseldorf beschäftigen wird. Mit Sicherheit wird es auf unserem Landesparteitag angesprochen werden, der Anfang Oktober stattfindet. Ich halte es deshalb für wichtig, dass bald etwas unternommen wird. Sonst könnte die Auseinandersetzung sich verselbstständigen. Für die Rolle der Union im deutschen Einigungsprozess wäre dies angesichts der gemeinsamen Fraktion in Bonn verheerend.«
In Gesprächen mit Berndt Seite, Münch und Vogel habe ich unser Gespräch heute Morgen vorbereitet. Es geht mir vor allem darum, zu vermeiden, dass unsere im Sommer in Berlin festgelegte Linie unter Bonner Druck aufbricht und wir uns damit auseinanderdividieren lassen. Seite war zunächst unsicher, ob er auf Nachbesserungen des Haushalts 1993 bestehen solle. Ich konnte ihn von der Notwendigkeit überzeugen. Sein Haushalt, in erster Lesung dem Landtag bereits vorgestellt, wird 1993 eine Neuverschuldung von 27 Prozent aufweisen. Münch wird ein Defizit von 26 Prozent haben, wenn er nicht eine zusätzliche Milliarde DM aus Bundesmitteln erhält. Er erhofft sie sich als Zuschuss zur Sanierung der Großindustrie. Wir werden rund 14 Prozent Neuverschuldung in Kauf nehmen müssen, obwohl wir nicht übermäßig investieren können. Vogels Defizit soll rund 21 Prozent betragen. In keinem Fall ist dies zu verantworten, wenn man bedenkt, dass die westdeutschen Länder sich im Schnitt mit 5 Prozent neu verschulden werden.
Das Kabinett war heute einmütig der Ansicht, man könne dem Haushalt 1993 nicht zustimmen, wenn er nicht substantiell geändert werde. Auch die Mehrheit unserer Bundestagsabgeordneten hält noch an diesem Kurs fest, obwohl einige sich schon bei der Fraktionsführung gemeldet haben, um Zustimmung zum Haushalt zu signalisieren.
Die Treuhand hat heute zu ihren vielen Fehlentscheidungen eine weitere hinzugefügt: Sie hat, entgegen den noch in der letzten Woche sorfältig ausgehandelten Vereinbarungen im Umlaufverfahren, die Liquidation der Edelstahlwerke Freital beschlossen.
Gestern ein gutes Gespräch mit Bischof Hempel. Wir sind uns nähergekommen. Während des Abendessens in der Erholung stellte er plötzlich, fast verwundert, fest, es sei doch unglaublich, dass wir hier gemeinsam säßen und uns unterhielten. Niemals wäre so eine Begegnung früher möglich gewesen. Mein Ansehen in der Bevölkerung habe eher noch zugenommen, meinte er. Luther habe seine Kirche zwar nicht mit vielen Worten des Lobes ausgestattet. Aber er müsse nun auch einmal loben, was zu loben sei.
Vor allem sprachen wir über den Beitrag, den die Kirche in der kommenden Zeit leisten könnte. Hempel möchte seine Kirche vom Rückzug ins rein Kirchliche bewahren und ihre Möglichkeiten stärker nutzen, an der Wende mitzuwirken. Ich schlage ihm vor, er solle mit der Kirche ein Forum bieten, auf dem die Herausforderungen, Nöte und Chancen der Wende vermessen werden können. Wir, vor allem aber die Menschen, brauchten Weisungen. Die Kirche habe in der Schrift ein festes Fundament, von dem aus sie handeln und das Neuland erforschen könne, in das die Wende uns geführt habe.
Im Kabinett beschäftigten uns heute Morgen vor allem die Grundlagen der Jugendpolitik. Es kommt uns darauf an, im ersten Landesjugendplan eine Standortbestimmung zu versuchen. Nicht der Staat, sondern die Bürger sind für die Jugend verantwortlich. Familie, kleine Lebenskreise, Gemeinde, Region und schließlich Land lautet die Kette der Verantwortlichkeit. Wir handeln subsidiär, nicht primär. Vielen ist dies nicht bewusst. Sie sind im Denken der alten Verantwortlichkeiten verhaftet, das sich allerdings auch in Westdeutschland findet. Die Unterschiede sind oft kleiner, als man annehmen sollte.
Auch die mentalen Befindlichkeiten unserer Menschen müssen wir ansprechen: So die Tatsache, dass Arbeitsplatzsicherheit, Sicherheit der Wohnung und soziale Sicherheit von einer großen Mehrheit als Vorzüge der alten DDR gesehen werden. Die Frage, um welchen Preis man diese Vorteile genossen hat, ist lange nicht mehr so gegenwärtig wie die Erinnerung an die Überschaubarkeit und Verlässlichkeit der alten Ordnung in diesen Bereichen. Dennoch will niemand zurück in die alte Vormundschaft. Aber die Spannung, die zwischen der neuen Gegenwart und der nostalgischen Erinnerung besteht, muss angesprochen werden. Sonst können wir sie nicht überwinden.
20. September 1992
Eine bewegte Woche liegt hinter mir. Gerade habe ich Berndt Seite wieder verabschiedet.
Ich habe in ihm einen Mann kennengelernt, der Mut und Stehvermögen hat, sich der Grenzen seines Wissens bewusst ist, lernen will und vor allem seine Unabhängigkeit nicht preiszugeben bereit ist. Er werde sich weder für die West-CDU noch für Kohl verbiegen.
Beide sind wir der Ansicht, dass wir die Konfrontation in Bonn nicht suchen, aber auch nicht um jeden Preis vermeiden können. Der Aufbau der neuen Bundesländer liegt nicht nur im ostdeutschen, sondern auch im westdeutschen Interesse. Die westdeutsche Politik muss dies akzeptieren und umsetzen, wenn sie erfolgreich sein will. Deshalb werden wir in den Haushaltsverhandlungen noch einmal einen Anlauf machen, eine stärker zweckgebundene und über das Land geleitete Investitionspauschale von rund 5 Milliarden DM und einen Zuschuss zu den Sanierungs- und Strukturkosten bereits für 1993 zu erhalten. Seite schließt nicht aus, dass auch er den Haushalt ablehnt, wenn die weiteren Notwendigkeiten unberücksichtigt bleiben. Die ostdeutschen Haushalte können nicht in der gleichen Weise gesehen werden wie die westdeutschen. Eine übermäßig schnelle und hohe Verschuldung im Osten kann nicht im Interesse des Gesamtstaates liegen. Er darf sie deshalb auch nicht zulassen. Dieser Zusammenhang wird von der Bundesregierung nur unzureichend gesehen.
Beide halten wir es für notwendig, bis Ende dieses Jahres zu einer Aufbaukonzeption für Ostdeutschland zu kommen, die diesen Namen verdient. Seite sieht in Krause jemanden, der dies schon seit langem anstrebt, sich aber bisher nicht habe durchsetzen können. Schäuble habe sich mit Krause verbunden, weil er es ähnlich sehe. Kohl beginne, sich dem Gedanken zu öffnen. Aber zugleich wachse auch sein Misstrauen gegenüber beiden. Wie bisher immer nähert sich Kohl jedem mit Misstrauen, der Handlungsnotwendigkeiten formuliert, denen sich Kohl nicht beugen will oder die er nicht beherrscht. Er sieht in derartigen Aufforderungen stets den Versuch, ihn selbst in Frage zu stellen.
Die Konzentration des Bundesparteitages auf Europa halten wir nicht für sinnvoll. Bei aller Bedeutung, die der weiteren europäischen Entwicklung zukommt: Die deutsche Einheit ist noch nicht vollendet, wie die ursprüngliche Vorlage des Leitantrages das behauptete. Wir können nicht nur über Europa sprechen, wenn wir uns in Deutschland in der kritischsten Phase des Einigungsprozesses befinden. Seite sieht in der Themenwahl auch ein Indiz dafür, dass die Führung die eigentlichen Probleme verdrängt.
Die Kandidatur Eggerts wird Seite unterstützen. Wie andere ostdeutsche CDU-Politiker ist auch er abgestoßen von dem Versuch, bei der Wahl der Stellvertreter jede Alternative auszuschließen und die Stellvertreter mit einer Ausnahme aus dem Kreis der Kabinettsmitglieder zu wählen. Die ohnehin geringe Selbstständigkeit der Partei wird dadurch weiter verringert. Dass Kohl diese Strukturfrage überhaupt nicht mehr sieht, zeigt, in welchem Maße die Unselbständigkeit der Partei ihm selbstverständlich geworden ist.
Beim Tee und auf der Fahrt zum Flughafen sprechen wir über Deutschland und seine Rolle in Europa. Ich erläutere, ausgehend von meinem Buch »Zeitsignale«, meine Position. Verkürzt kann man sagen: Die Westdeutschen bringen in das geeinte Deutschland die soziale Marktwirtschaft, die Ostdeutschen die nationale Idee ein. Nur beides zusammen kann zu einer wirklichen Einheit führen.
Dieser These steht die Überzeugung vieler in Westdeutschland entgegen, Deutschland solle auf seine nationale Identität verzichten und sich stattdessen für die politische Union Europas offenhalten. So hat Helmut Schmidt in einem Interview mit dem Figaro vor dem französischen Referendum zu Maastricht die Ansicht vertreten, die Einheit Europas sei unabdingbar, um Deutschland fest zu verankern und Franzosen wie Deutsche vor einem »Irrweg Deutschlands« zu schützen. Deutschland sei gefährlich, meinte Schmidt, »nicht wegen seiner Kultur oder seines Volkscharakters, aber wegen unserer Geschichte und unserer geographischen Lage. […] Wenn das Chaos im Osten und auf dem Balkan schlimmer wird, dann werden wir als Erste von Flüchtlingen überlaufen. Wie würde Deutschland in diesem Falle reagieren, wenn es nicht in ein Europa integriert ist? Niemand kann das vorhersehen.«
Kohl teilt im Prinzip diese Haltung. Durch regionalen Patriotismus und europäische Identität will er die Entwicklung einer eigenständigen nationalen Identität Deutschlands vermeiden. Mit dem Gedanken, dass Deutschland nationale Interessen formulieren und seine Politik daran ausrichten könne, kann er sich nicht anfreunden. Die enge Verbindung mit Frankreich soll Deutschland auch vor sich selbst schützen. Für das französische Referendum, das offenbar heute knapp zugunsten der Verträge ausgegangen ist (um 21.00 Uhr 51,2 Prozent Ja-Stimmen) war dies ein entscheidendes Argument. Um dieses Ziel zu verwirklichen, ist Kohl auch bereit, die deutsche Währung in eine europäische Währung einzubringen, ohne dass eine einheitliche Haushalts- und Wirtschaftspolitik Europas gesichert wäre. Die Währung soll das Band sein, das die widerstrebenden Interessen und politischen Kräfte zusammenhält. Dass Kohl der Währung eine solche Leistung zutraut, dass er von der Bereitschaft der anderen EG-Staaten überzeugt ist, ihre nationalen Politiken und Ambitionen der Stabilität einer gemeinsamen Währung unterzuordnen, ist nur mit dem besonderen Stellenwert zu erklären, den ein Land seiner Währung zubilligt, dessen Leitidee die Wirtschaftsordnung ist und dessen nationale Idee sich in der Wohlstandssicherung erschöpft. Für Westdeutschland mag dies gegolten haben. Für unsere westeuropäischen Nachbarn gelten andere Prioritäten, für die sie auch eine Schwächung ihrer Währung in Kauf zu nehmen bereit sind.
Das eigentliche Problem einer Europapolitik, die sich mit dem Wunsch legitimiert, Deutschland vor sich selbst zu schützen, liegt jedoch in der Annahme, man könne die westdeutsche Legitimation des Staates als Wirtschafts- und Sozialgemeinschaft mit stetig wachsendem materiellen Lebensstandard auch im geeinten Deutschland beibehalten. Diese Annahme ist falsch.
Fazit: Unsere Europapolitik sollte sich nicht vom Verzicht auf nationalstaatliche Identität, sondern von ihrer europakompatiblen Ausformung leiten lassen. Wir müssen ein angemessenes, anderen wichtigen EG-Staaten, vor allem Frankreich, vergleichbares Gleichgewicht zwischen nationalen und europäischen Interessen entwickeln. Dabei müssen wir den Besonderheiten des Einigungsprozesses und seiner Erfordernisse Rechnung tragen. Zur europäischen Friedensordnung gibt es keine Alternative. Sie muss jedoch organisch wachsen. Eine deutsche Flucht nach Europa, um die Auseinandersetzung mit unserer eigenen nationalen Identität zu vermeiden oder uns vor uns selbst zu schützen, wird das politisch geeinte Europa nicht befördern, sondern gefährden.
21. September 1992