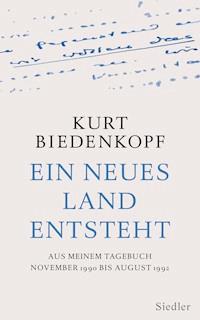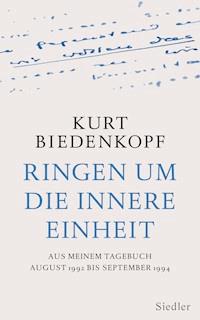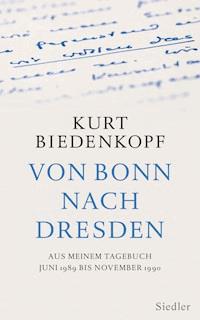
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Tagebuch Kurt Biedenkopfs - eines Politikers von großer Integrität, zupackender politischer Kraft und visionärem Intellekt
Kurt Biedenkopf, der 1990 zum Ministerpräsidenten des Freistaats Sachsen gewählt wurde, führte in den Neunziger Jahren ein Tagebuch: Es dokumentiert und kommentiert auf brillante Weise die Aufbruchzeit nach der Wiedervereinigung. Schonungslos offen und zugleich auf höchstem intellektuellen Niveau reflektiert Biedenkopf die großen politischen und gesellschaftlichen Themen der Zeit: die gerechte Verteilung der Lasten zwischen den alten Bundesbürgern und den Ex-DDR-Bürgern, die umstrittene Finanzierung des Aufbaus Ost, die Chancen der Modernisierung - und, immer wieder, die großen Mentalitätsunterschiede zwischen West- und Ostdeutschen. So entsteht das Bild eines Patrioten, der leidenschaftlich die Interessen der Menschen in Ostdeutschland vertritt - und dabei auch den Konflikt mit Kanzler Helmut Kohl nicht scheut.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 656
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Kurt H. Biedenkopf
Von Bonn nach Dresden
Aus meinem TagebuchJuni 1989 bis November 1990
Siedler
Das vorliegende Buch ist die aktualisierte Neuausgabe des Werkes, das unter dem Titel »1989–1990. Ein deutsches Tagebuch« im Jahre 2000 im Siedler Verlag erschienen ist.
Erste Auflage
September 2015
Copyright © Kurt H. Biedenkopf
Copyright © 2015 by Siedler Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany
ISBN 978-3-641-17911-3
www.siedler-verlag.de
Für Ingrid
Inhalt
Vorwort
Zur Einführung
Tagebuch
Personenregister
Sachregister
Vorwort
Seit 1974 führe ich ein Tagebuch. Es entwickelte sich aus Briefen, die ich an meine heutige Frau Ingrid zu schreiben begann. Wir kannten uns als Kinder. Unsere Eltern waren befreundet, ich nannte ihre Eltern Onkel und Tante. Ende 1943 verloren wir uns aus den Augen und jeder ging die nächsten Jahrzehnte seine eigenen Wege. Im März 1974 trafen wir uns in Frankenthal wieder. Man erwartete mich zu einer Parteiveranstaltung, ihr Vater hatte zu einem anschließenden Abendessen im »Kurfürsten« eingeladen. Es schien uns, als wären keine dreißig Jahre vergangen.
Wir wollten uns nicht wieder aus den Augen verlieren. Ich versprach ihr zu schreiben und über das zu berichten, was ich tue. Vielleicht entstehe ein Tagebuch oder ein Briefbuch aus diesen Berichten. Versprechen könne ich es nicht. Aber die nächsten Monate und Jahre würden interessant sein, gesehen von dem Ort aus, an dem ich arbeitete und sie lebte. Wollen wir es versuchen? So endete der kurze Brief.
Das Tagebuch – Chronik meiner Arbeit und meines Lebens
Wir haben es versucht. Und das Tagebuch wuchs. Schon bald lösten sich die Eintragungen von der Briefform. An ihre Stelle traten Texte zu dem, was mir wichtig erschien, was mich umtrieb, und zu den Erfahrungen, die ich als Generalsekretär der CDU sammelte. Das Tagebuch wurde zu einer Chronik meiner Arbeit und meines Lebens. Skizzen zu Ideen und Einfällen wechselten mit Ausarbeitungen zu bestimmten Fragen, für die ich Antworten suchte. Ausarbeitungen zu Reden, Aufsätzen oder Interviews entstanden, die zur Klärung politischer und wissenschaftlicher Fragen beitragen sollten.
Daneben schrieb ich bei allen Sitzungen, Beratungen, Diskussionen oder Gremientreffen mit, die ich nicht zu leiten hatte. Manch einen der Anwesenden irritierte meine Mitschrift. Aber bald gewöhnte man sich daran. Als mich Helmut Kohl einmal fragte, was ich denn da so fleißig schriebe, zerstreute ich sein sichtbares Misstrauen mit der Antwort, ich sammelte Material für eine Kohl-Biografie. Später hätte diese Erklärung wohl nicht mehr ausgereicht. Aber bis dahin hatte ich an meiner Praxis, mitzuschreiben, einen Besitzstand erworben.
So wurde mir das Tagebuch zur Selbstverständlichkeit. Wenn auch nicht immer täglich, so doch regelmäßig trug ich ein, was mir wichtig erschien. Die Einträge wurden nicht mehr verändert. Auch längere Exposés, von denen einige in das Tagebuch aufgenommen wurden, wurden jeweils zu dem angegebenen Datum verfasst und nicht mehr verändert. Das ist bis heute so geblieben. Lediglich die Technik änderte sich. Bis 1990 waren die Eintragungen handschriftlich. Der vorliegende Band, der Auszüge aus den Eintragungen von 1989 und 1990 enthält, war der letzte, den ich von Hand verfasste. Seit Ende 1990 benutze ich die ständig weiterentwickelten Computertechniken, von der 1,44-MB-Diskette bis zur heutigen praktisch grenzenlosen und mit Optionen, genannt Apps, überladenen Technik.
Das Tagebuch umfasst inzwischen mehr als 12 000 Seiten. Die Besonderheit des Tagebuchs 1989 bis 1990 besteht darin, dass es das gesamte Werk in der Mitte teilt. Der Abschnitt zwischen 1974 und Herbst 1989 ist den Ereignissen und Entwicklungen während der deutschen Teilung gewidmet. Ungekürzt umfassen sie rund 5000Seiten. Aus den Jahren von November 1990 bis April 2002, in denen ich Ministerpräsident des Freistaates Sachsen war, beinhalten sie rund 7200 digital erfasste Seiten.
Überlegungen zur Veröffentlichung
Die Anregung, auch den »gesamtdeutschen Teil« des Tagebuchs in Auszügen zu veröffentlichen, verdanke ich Professor Hans-Peter Schwarz. Während eines Gespräches im Rahmen der Arbeit an seiner Kohl-Biografie interessierte er sich auch für mein Tagebuch. Ich gab ihm den Datenträger mit den bereits ausgeschriebenen Bänden ab 1990 mit. Wenige Wochen später erhielt ich von ihm einen Brief, der sich eher wie ein Gutachten las. Er begründete die Notwendigkeit, das Tagebuch gedruckt der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dass dies natürlich nur in einer repräsentativen Auswahl aus dem gesamten Quellenbestand möglich sein würde, verstand sich von selbst. Seine Argumente waren unwiderstehlich. Sie überzeugten meine Frau und mich. Für seine fortdauernde Ermutigung und Bereitschaft, sich auch weiterhin in dem Vorhaben zu engagieren, sind wir ihm besonders dankbar.
Die Friedliche Revolution und der Mauerfall im Herbst 1989 haben das Zustandekommen der Wiedervereinigung 1990 ermöglicht. Ohne sie wäre der Freistaat Sachsen nicht wiedererstanden. Die ersten drei Bände dieser Tagebuchauszüge umfassen daher die entscheidenden Jahre 1989 bis 1994. Die Eintragungen aus meinem Tagebuch während der Schicksalsjahre, in denen sich die Wiedervereinigung vorbereitete, mit dem Fall der Mauer praktisch vollzog und schließlich durch die staatliche Einheit vollendet wurde, habe ich bereits im Jahre 2000 unter dem Titel »1989–1990. Ein deutsches Tagebuch« im Siedler Verlag publiziert. Es erfasste meine Erfahrungen in den entscheidenden Monaten der Wiedervereinigung Deutschlands vom 16. Juni 1989 bis 8. November 1990 und wird hier unter dem Titel »Von Bonn nach Dresden« mit Registern neu bearbeitet vorgelegt. So war es naheliegend, zeitlich und nach Möglichkeit auch formal daran anzuknüpfen und in weiteren Bänden Tagebuchauszüge aus den Jahren meiner Ministerpräsidentschaft zu veröffentlichen. Sie behandeln den Aufbau des Landes Sachsen, das Ringen um die Gestaltung der inneren Einheit des wiedervereinigten Deutschland und die Integration Europas nach dem Kalten Krieg.
Viel sprach deshalb dafür, das Gesamtwerk mit einer unveränderten Neuauflage der bereits veröffentlichten Tagebucheintragungen aus den Jahren 1989 und 1990 mit dem Titel »Von Bonn nach Dresden« zu beginnen. Parallel zu ihm werden zwei weitere Bände mit den Titeln »Ein neues Land entsteht« und »Ringen um die Einheit« erstmals im Siedler Verlag publiziert. Sie beinhalten die wesentlichen Einträge für die Zeit vom 9. November 1990 bis 30. August 1992 und vom 31. August 1992 bis 18. September 1994.
Für diese Reihe von Auswahlbänden wäre die Bezeichnung »Sächsisches Tagebuch« sicher gerechtfertigt. Sie würde zudem meiner tiefen Verbundenheit mit Sachsen entsprechen. Doch reicht die Thematik der Eintragungen vielfach über Sachsen hinaus. Somit erhält das Gesamtwerk für den Zeitraum von 1989 bis 2002 im Untertitel besser die Bezeichnung »Aus meinem Tagebuch« sowie die entsprechenden Jahresangaben.
Geplant sind drei weitere Bände für die Jahre von 1994 bis zum Ende meiner Zeit als Ministerpräsident im Jahre 2002.
Die Auswahl der Tagebucheinträge
Um einen Umfang von etwa 500 Druckseiten pro Band zu ermöglichen, konnten aus dem vorliegenden Textvolumen des Tagebuchs nur etwas mehr als ein Drittel ausgewählt werden. Da die Originaltagebücher jeweils umfangreiche Ausarbeitungen von Vorträgen, Aufsätzen, Beschlussvorlagen und Ähnliches enthalten, sind die Streichungen vor allem dort erfolgt, zugunsten der Tagebucheinträge im strengsten Sinne.
Schwerpunkte meiner Tagebucheintragungen aus der Zeit von 1990 bis 1994 sind vor allem: die Entwicklungen beim Aufbau des Freistaates Sachsen unter Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten, die unterschiedlichsten landespolitischen Problemfelder und Beschlüsse, überregionale Entscheidungsfragen bei der inneren Neuordnung des wiedervereinigten Deutschland, wichtige Kontroversen innerhalb der CDU auf allen Parteiebenen, meine Auslandskontakte, Reisen und Einschätzungen der internationalen Entwicklungen, die Bewertung längerfristiger gesellschaftspolitischer und europapolitischer Veränderungen und meine auf sie bezogenen Reformvorstellungen, dazu Zeitdiagnosen und zeitkritische Betrachtungen im weitesten Sinne. Nicht zuletzt finden sich unter den Eintragungen auch private Begebenheiten und Ereignisse.
Ziel der Edition war es, in einem repräsentativen Mix von Vorgängen, Impressionen und Reflexionen all das einigermaßen gleichgewichtig wiederzugeben, wie es im Original vorkommt, und Redundanz weitgehend zu vermeiden. Die Entwicklungen im Freistaat Sachsen sollten mit Priorität beleuchtet werden, aber auch meine Rolle als eine Art Interessenvertreter der neuen Länder gegenüber den Besitzstandswahrern der »alten« Bundesrepublik. Generell galt die Linie, bei politisch umstrittenen Vorgängen möglichst wenig zu kürzen.
Als Verfasser des Tagebuchs tue ich mich, selbst aus größerem zeitlichen Abstand, schwer, eigene Aufzeichnungen in größerem Umfang zu kürzen. Deshalb habe ich die Herren Professoren Hanns Jürgen Küsters und Hans-Peter Schwarz gebeten, im Rahmen der hier skizzierten Überlegungen und Akzentsetzung jeweils die gesamten Originaltexte im Umfang von etwa 2600 Seiten durchzusehen und eine entsprechende Vorauswahl zu treffen. Diese wurde durch die bei der Konrad-Adenauer-Stiftung angesiedelten Mitarbeiter, Frau Dr. Christine Bach und Herrn Dr. Ralf Thomas Baus, intern abgeglichen, redaktionell überprüft und der neuen Rechtschreibung angepasst. Den konsolidierten Vorschlagstext, der mir weitgehend einleuchtete, habe ich sodann am Originaltext Eintrag für Eintrag überprüft. Soll eine lesbare, aber doch fachkundig überprüfte Auswahl entstehen, lässt sich nicht anders verfahren.
Dank für Unterstützung
Dass die ersten drei Bände des Tagebuchs in der vorliegenden Form im Herbst 2015 und die weiteren in den folgenden Jahren erscheinen können, ist der Entscheidung des Freistaates Sachsen und seines Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich zu verdanken. Er machte die Publikation des Tagebuches zu seiner Sache und entschied, die Vorstellung der ersten Bände mit dem 25. Jubiläum des Freistaates zu verbinden. Über die damit verbundene Auszeichnung und Ermutigung haben meine Frau und ich uns besonders gefreut.
Nachdrücklicher Dank gilt auch der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie konnte zu meiner großen Freude für die Betreuung der anspruchsvollen Aufgabe gewonnen werden und die inhaltliche Substanz des Publikationsprojekts aus dem Gesamtkorpus der Tagebücher ableiten. Finanziert vom Freistaat Sachsen, betreute sie das Vorhaben von der Konzeptionsphase bis zum Erscheinen: die naturgemäß besonders schwierige Textauswahl, die Textüberprüfung, die Arbeiten an den Registern und zusammen mit dem Verlag den Produktionsprozess der drei Bände.
Ganz besonders danke ich Herrn Professor Küsters, dem Leiter der Hauptabteilung Wissenschaftliche Dienste/Archiv für Christlich-Demokratische Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er hat die Hauptlast der Arbeiten getragen. Ohne seinen unermüdlichen Einsatz und seine Geduld mit mir wäre es kaum gelungen. Für sein Engagement und die Zusammenarbeit mit ihm bin ich deshalb besonders dankbar. Auch dem Redaktionsteam, Frau Dr. Bach und Herrn Dr. Baus, gilt für ihre Arbeiten mein herzlicher Dank.
Dass der bewährte Siedler Verlag sich bereit fand, das Gesamtwerk der Tagebücher von 1989 bis 2002 zu verlegen, weiß ich wohl zu schätzen. Mein verbindlicher Dank gilt allen Beteiligten, namentlich Herrn Thomas Rathnow, dem Geschäftsführer der Verlagsgruppe Random House.
Zu diesen Helfern gesellten sich als weitere Begleiter des Projektes Herr Professor Thomas Bürger, der Chef der Staats-, Landes- und Universitätsbibliothek in Dresden, und Herr Professor Michael Göring, Vorsitzender des Vorstands der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, Hamburg. Mit ihren Erfahrungen und der Überzeugung, mit der sie das Projekt unterstützten, sind sie für mich eine wichtige Hilfe.
Ebenso dankbar sind wir einigen Freunden für ihre großzügige finanzielle Unterstützung der notwendigen Büroinfrastruktur. Sie machten es mir möglich, die Arbeit an der Aufbereitung des Tagebuches mit meinen im Wissenschaftszentrum Berlin angesiedelten Demokratieforschungen zu verbinden. Sie boten mir damit die seltene Gelegenheit, wissenschaftliche, wirtschaftliche, politische und langjährige Regierungserfahrungen auf eine Weise zu verbinden, die sie fruchtbar werden lässt für die ordnungspolitischen Prinzipien und Vorstellungen vom freiheitlichen, demokratischen und rechtsstaatlichen Regieren und Führen.
Unbeschadet meiner Dankbarkeit für alle Hilfe wird auch die vorliegende Textauswahl für die beiden Bände der Jahre 1990 bis 1994 wie schon für den Band 1989 bis 1990, »Von Bonn nach Dresden«, allein von mir verantwortet. Zu gegebener Zeit wird das gesamte Tagebuch der wissenschaftlichen Forschung in angemessener digitaler Form zur Verfügung stehen.
Dresden im Mai 2015
Kurt Biedenkopf
Zur Einführung
Blickt man zurück auf die Zeit zwischen Sommer 1989 und Juli 1990, dann lassen sich vor allem folgende Aspekte der Wiedervereinigung ausmachen:
1. Wir verdanken sie in erster Linie dem Mut der ostdeutschen Bevölkerung. Ermutigt durch Entwicklungen in Polen, in Ungarn und in der damaligen Tschechoslowakei zeigte auch sie sich im Herbst 1989 entschlossen, Widerstand zu leisten und sich dem bestehenden System auf die verschiedenste Weise zu verweigern. Sie erzeugte damit politischen Druck auf die Herrschenden innerhalb der DDR und wachsende Aufmerksamkeit außerhalb ihrer Grenzen. Gorbatschow fasste sie in seiner berühmt gewordenen Formulierung zusammen: »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.« Die Ostdeutschen besaßen den Mut zur Revolution und bewiesen – was in der deutschen Geschichte einmalig ist – die Kraft, die Klugheit und die Beherrschung, ohne die ihr die friedliche Eroberung der Freiheit nicht möglich gewesen wäre.
In wenigen Ereignissen wurde dies deutlicher als bei der Leipziger Demonstration vom 9. Oktober 1989, als Demonstranten Kerzen auf den Stufen des »Runden Ecks« aufstellten, um die im Gebäude versammelten Staatssicherheitskräfte vor Provokationen durch die Menge zu schützen. Es war der Beitrag – und wahrhaft kein einfacher – zum friedlichen Protest gegen Unfreiheit und Unterdrückung.
Im Frühjahr 1990 begann die ostdeutsche Bevölkerung erneut, Druck aufzubauen – diesmal um den Prozess der Wiedervereinigung durch die Drohung zu beschleunigen, die sich in dem Satz zusammenfassen ließ: Wenn die D-Mark nicht zu uns kommt, kommen wir zur D-Mark.
2. Als die Mauer fiel und die deutsche Einheit Realität geworden war, wurde zugleich ein kaum erklärbares Defizit deutlich: In Westdeutschland wusste man praktisch nichts über die DDR. Dabei hatte Jakob Kaiser als Minister für gesamtdeutsche Fragen im Kabinett Adenauers schon in den fünfziger Jahren mit der Gründung des »Forschungsbeirates für Fragen der Wiedervereinigung« eine Einrichtung geschaffen, die sich mit den sozial- und wirtschaftspolitischen Folgen einer deutschen Wiedervereinigung befasste. 1975 wurden ihre Forschungen auf Drängen der Ostberliner Regierung eingestellt. Die sah in ihnen eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der DDR. Von da an war man, was die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der ostdeutschen Wirtschaft anging, vor allem auf offizielle Daten angewiesen. Das Ergebnis war eine weitgehende Fehleinschätzung ihrer wirklichen Stärke.
Ihr fiel auch der Sachverständigenrat zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Lage zum Opfer, als er sich anschickte, in seinem Sondergutachten vom Januar 1990 Empfehlungen für den Umbau der DDR-Wirtschaft von einer sozialistischen Planwirtschaft zu einer sozialen Marktwirtschaft zu entwickeln. Die Arbeiten der 1950er bis 1970er Jahre waren damals weitgehend vergessen. Vor allem fehlte es an realistischen Erkenntnissen über die Auswirkungen einer jahrzehntelangen zentralplanwirtschaftlichen Politik auf die wirtschafts- und sozialpolitisch relevante Verhaltensweise der betroffenen Bevölkerung. Ihr war, rechnet man die unfreien Jahre ab 1939 mit ein, über 50 Jahre lang die Möglichkeit versagt geblieben, in einer offenen, freiheitlich gestalteten und privatrechtlich verfassten Wirtschaft zu leben und zu arbeiten. Nur durch die in der Zeit der Teilung entstandenen Wissenslücken lässt sich jedenfalls erklären, dass die Sachverständigen offenbar die planwirtschaftlich ausgebildete Bürokratie der DDR für fähig hielten, innerhalb der DDR eine marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung aufzubauen und zu lenken.
3. Die Gestaltung der friedlichen Wiedervereinigung zur politischen und nationalen Einheit – und dies mit Zustimmung der ehemaligen Siegermächte und aller weiteren europäischen Nachbarstaaten – ist die eigentliche historische Leistung Helmut Kohls. Mit der Bildung der parteipolitischen »Allianz« für die Volkskammerwahlen im März 1990 gelang es ihm, der CDU die Mehrheit und damit eine stabile politische Ausgangslage in der Volkskammer der damals noch bestehenden DDR zu sichern. Präsident Bush sicherte ihm die Voraussetzungen für eine Zustimmung der Sowjetunion zur Wiedervereinigung. Die Voraussetzungen für die Wiederherstellung der staatlichen Einheit waren geschaffen. Am 3. Oktober 1990 wurde sie vollzogen. Allerdings ist es Helmut Kohl nicht gelungen, die neu gewonnene Einheit als Grundlage für eine Erneuerung ganz Deutschlands zu begreifen. Er fiel vielmehr in die alte politische Strategie zurück, die Bevölkerung vor den anstehenden Bundestagswahlen nicht durch politische Zumutungen zu irritieren. Mit seiner Weigerung, für die Finanzierung des Wiederaufbaus des östlichen Teils Deutschlands auch die Steuern zu erhöhen, verlor seine politische Leistung an Momentum. Er konnte es danach nicht wieder zurückgewinnen.
4. Mit der Wiedervereinigung begann in Ostdeutschland eine Zeit der Improvisation. Sie wurde nicht nur möglich. Sie war auch notwendig. Denn die alte Ordnung wurde nicht mehr akzeptiert und den neuen Herausforderungen stand man hilflos gegenüber. Die politische, gesetzliche und gesellschaftliche Ordnung Westdeutschlands wiederum konnte sich nicht schnell genug auf den Osten des Landes ausdehnen. So entstand ein Vakuum, das durch Spontanität, Improvisationsbereitschaft und gesunden Menschenverstand ausgefüllt wurde. Unbeschadet aller Fehler, die gemacht wurden – und aus denen man lernen konnte –, konnten wir so für längere Zeit gestalten, ohne auf bürokratische, gesetzliche, politische, wirtschaftliche und soziale Besitzstände zu stoßen. Es war eine kreative Zeit.
5. In Sachsen waren es auch die Geschichte und die Kultur des Landes, die der Bevölkerung in den schwierigsten Phasen des Umbruchs Mut machten und ihr halfen, die Kraft für die großen Aufgaben zu mobilisieren, vor denen sie stand. Sachsen war besonders. Trotz aller politischen und gesellschaftlichen Unterdrückung und Beeinträchtigung waren die eigene historische Identität und kulturelle Bedeutung Sachsens nicht in Vergessenheit geraten. Die Bevölkerung war stolz auf ihr Land und seine Einzigartigkeit. Dieser Stolz und die Erinnerung an die Leistungen der Vorfahren während fast 1000 Jahren sächsischer Geschichte verliehen ihr auch die Kraft für den Wiederaufbau und Neubeginn.
Von allen Erfahrungen, die ich den ersten Jahren in Sachsen verdanke, bleibt diese die wichtigste. Sie hat meine Überzeugung bestätigt, dass den Menschen ohne ihre bewusste Verankerung in der Geschichte und der Kultur ihres Landes das für die wirtschaftliche und soziale Ordnung und ihre nachhaltige politische Gestaltung notwendige Fundament fehlt. Es sind die historischen und kulturellen Erfahrungen, aus denen sich die mit der Freiheit verbundenen Verantwortungen ebenso erklären wie die Notwendigkeit der Begrenzung.
Tagebuch
16. Juni 1989
Im Deutschen Bundestag: Regierungserklärung über den Gorbatschow-Besuch in der Bundesrepublik. Der Besuch wird allgemein als Erfolg gewertet. Gegen Ende wurde auch über die Mauer gesprochen. Gorbatschow schließt offenbar ihre Beseitigung nicht aus. Seine Berater sollen in internen Gesprächen angedeutet haben, dass man sich im Kreml zwei deutsche Staaten auch ohne Mauer vorstellen könne, falls sich das wirtschaftliche Gefälle zur DDR abbauen lasse.
Die Dinge sind in einer Weise in Bewegung geraten, die sich schon als historisch bezeichnen lässt. In Polen haben Wałęsa und seine Solidarność die Mehrheit errungen. Die Kommunisten akzeptieren das Ergebnis und suchen die Zusammenarbeit. Die Solidarność ist dazu bereit und hilft auch bei der Nachwahl der 35 Listenmandate der Kommunisten, die alle keine Mehrheit erlangt hatten.
In Ungarn wird heute Imre Nagy feierlich zum zweiten Mal beerdigt, nachdem er und seine Mitstreiter bereits politisch und juristisch rehabilitiert wurden. Auch hier verhandelt man am »Runden Tisch« über ein Mehrparteiensystem. Die Kommunistische Partei will sich der demokratischen Entscheidung stellen und das Wahlresultat respektieren.
In der DDR wächst die Nervosität. Während Gorbatschow vor Hoesch-Arbeitern in Dortmund über die Öffnung des Ostens spricht und sich für die Solidarität der Arbeiter mit den Anstrengungen in der Sowjetunion bedankt, erklärt Frau Honecker als Wissenschaftsministerin, die Jugend müsse den Sozialismus und seine Errungenschaften notfalls mit der Waffe verteidigen. Während die Menschen in der DDR am Fernsehschirm den Jubel miterleben, mit dem Gorbatschow bei uns von der Bevölkerung begrüßt wird, betont Honecker die Unverzichtbarkeit der Mauer und weist jede Diskussion darüber als Einmischung in die inneren Angelegenheiten der DDR zurück.
Kohl wiederholt noch einmal die Feststellung Gorbatschows, die Nachkriegszeit sei zu Ende. Er teile diese Ansicht.
19. Juni 1989
Die Europawahl ist verlorengegangen. Die Union hat 37,8 Prozent der Stimmen, 8,1 Prozent weniger als beim letzten Mal erzielt, Kohl sieht eine Niederlage für uns. Sie sei umso schmerzhafter in Anbetracht der hervorragenden Großwetterlage. Die Bundesrepublik stehe außen- und innenpolitisch ausgezeichnet da: Außenpolitisch sei die Lage so gut wie schon lange nicht mehr. Innenpolitisch könne man auf eine geringe Jugendarbeitslosigkeit verweisen. Selbst die Inflation bewege sich im Vergleich zu anderen europäischen Staaten noch im Bereich des Erträglichen.
Die Wahlprognosen allerdings hätten ein noch schlechteres Ergebnis vorausgesagt. Die Union habe es geschafft, entgegen allen Erwartungen, stärkste Partei zu bleiben. Besonders unbefriedigend habe die CSU abgeschnitten: minus 11,8 Prozent. Die Republikaner haben in Bayern 14,6 Prozent erzielt und sind in Teilen des Landes zweitstärkste Partei geworden. In München sind die Grünen auf 13, die Republikaner auf 15 Prozent gekommen. In einer Stadt mit der höchsten Lebensqualität, so Kohl, sei also ein Drittel der Wähler zu den Extremen gegangen.
Kohls Schlussfolgerung aus dem Europawahl-Ergebnis: Links- und rechtsextreme Gruppen nachhaltig bekämpfen. Die Grünen redeten über Rechtsextreme, als gehörten sie bereits zu den etablierten Kräften. Das könne man nicht zulassen. Bisher hätten die Grünen noch kein gesichertes Verhältnis zur Gewalt entwickelt.
Mit den Republikanern könne man nicht zusammenarbeiten. Man müsse sie bekämpfen. Das dürfe man aber nicht blind tun. Man müsse auch nachfragen, ob es bei uns Defizite gäbe: Die Themen Aussiedler, Ausländer, Asylanten seien von uns vernachlässigt worden. Die Wiedervereinigung dürfe man nicht aufgeben. In Umfragen sei sie heute hoch besetzt; so hoch wie selten.
Angesichts des Harmoniebedürfnisses der Bevölkerung dürfe die Koalition sich nicht streiten. Das gelte auch für an sich notwendige Diskussionen über Sachfragen. Wer nicht begriffen habe, dass man nur mit Sach- und Personalloyalität erfolgreich sein könne, der solle es sagen, damit die Frage ausgetragen werden könne – auch noch vor dem Parteitag. Zusammenfassend sei es wichtig, die Sommerpause nicht mit neuen Diskussionen zu belasten.
20. Juni 1989
Nachmittags war ich in der Fraktion, wenn auch erst eine Stunde nach Beginn der Sitzung. Kohls Wahlkampfanalyse entging mir deshalb ebenso wie der erste Teil der Äußerungen Geißlers. Was ich hörte, war von Dogmatismus, aber auch von der Sorge gekennzeichnet, dass man ihn und seine Strategie für das Desaster der Europawahl, vor allem für das Erstarken der Republikaner verantwortlich machen werde. Deshalb verstieg Geißler sich gegen Ende seiner Ausführungen zu persönlichen Angriffen auf Schönhuber, bis hin zur Beschreibung angeblicher sexueller Verfehlungen. Die Unruhe in der Fraktion wuchs ständig. Man merkte, dass es den Kollegen peinlich war, Derartiges vom Generalsekretär zu hören.
Da Geißler Czaja angesprochen hatte, konterte dieser mit einer fulminanten Rechtfertigungsrede, die sich auch mit Geißler auseinandersetzte. Kohl trennte die Streitenden schließlich mit der Versicherung, auch wenn sie sich übereinander ärgerten, seien doch beide Patrioten. Dann ging er. Ich meldete mich später zu Wort, als viele bereits gegangen waren. Es ging mir vor allem um die Erklärung für den Zuwachs der Republikaner. Meine Ausführungen führten zu einer außerordentlichen Reaktion: viel Beifall, schon während ich sprach, und am Schluss Lob von Dregger, Nachfragen der Kollegen nach dem Text.
24. Juni 1989
Konferenz in Wien zu Ost-West-Beziehungen, veranstaltet vom Institut für die Wissenschaften vom Menschen. Uns beschäftigt die Frage, was man tun kann, um die Entwicklungen im Osten zu unterstützen, und in welchem Umfang die fortdauernde Existenz der kommunistischen Parteien den westlichen Beistand beeinflusst. Die Befürchtung wird geäußert, die Hilfe des Westens könne die herrschenden Kräfte stabilisieren oder die bestehenden Konflikte aufrechterhalten. Deshalb müsse sie mit Bedingungen verbunden werden; sonst handle es sich nur um die Unterstützung eines »muddling through« ohne wirkliche Veränderung. Wenn man von der Diktatur zur Demokratie kommen wolle, müssten die Anstrengungen beider Seiten zusammenkommen: des Westens und des Ostens. Sowohl die Polen wie die Ungarn haben im Ergebnis darum gebeten, Wege zu suchen, wie die politischen Kosten der notwendigen Reformen externalisiert werden können.
30. Juni 1989
Mittwochmorgen besuchte mich Staatssekretär Schreiner (Rheinland-Pfalz). Wir frühstückten zusammen. Schreiner hatte um das Gespräch gebeten. Man sei ratlos, was die weitere politische Entwicklung angehe. Mit den Tagesfragen habe man keine Probleme, wohl aber mit langfristigen Perspektiven. Man komme mit den derzeitigen Entwicklungsvorstellungen nicht mehr weiter. Deshalb wolle man die Hilfe des IWG Bonn in Anspruch nehmen.
Späth wollte noch anrufen, hat sich aber bisher nicht gemeldet. Ich werde von mir aus auch nichts unternehmen. Meinhard Miegel erzählt, Späth sei sehr resigniert nach der verlorenen Europawahl. Nach Bayern hat die Union in Baden-Württemberg die größten Verluste erlitten. Die Republikaner sind hier besonders stark geworden. Späth wisse sich im Grunde auch keinen Rat mehr. Sein Haushalt verschulde sich immer stärker. Mit neuen Wegen komme man nicht weiter; man wisse nicht, wo sie zu finden und wie sie zu begehen seien. Auch in Bonn sehe er keine Möglichkeiten mehr, habe dazu auch keine große Lust. Kohl sehe er wieder gestärkt, obwohl er doch geschwächt sein müsste.
Wahrscheinlich ist die allgemeine Ratlosigkeit, die zurzeit überall zu beobachten ist, Ausdruck einer sehr erfolgreichen, aber inzwischen an ihre Grenzen gestoßenen Entwicklung. Die alten Wege haben sich erschöpft. Die neuen Aufgaben sind mit ihnen nicht zu bewältigen. Diese Entwicklung lässt sich wie folgt einteilen: Die erste industrielle Revolution befreite die Marktkräfte aus der spätfeudalen, merkantilistischen Ordnung und ihrem Zunftwesen. Ihre ungebundene Entfaltung führte zu großen sozialen Spannungen. Die sozialpolitische Revolution war die Folge. Sie führte zur Bindung der wirtschaftlichen Freiheiten durch die Ordnung der sozialen Marktwirtschaft. Die ständige Expansion der Wirtschaft bedrohte jedoch zunehmend die Umwelt und die endlichen Ressourcen. Wirtschaftswachstum und Umweltschutz gerieten in Widerspruch. Um ihn aufzulösen, erweiterte sich die soziale Marktwirtschaft zur ökologischen und sozialen Marktwirtschaft. Wir stehen am Beginn dieser Entwicklung und damit am Beginn eines Paradigmenwechsels. Noch tun wir das Gewohnte, aber mit zunehmend schlechtem Gewissen: Es geht uns so gut wie noch nie, aber deshalb geht es uns eben bereits nicht mehr so gut. Denn wir beginnen zu begreifen, dass der Preis für die gegenwärtige Lebensweise immer höher wird. Unser schlechtes Gewissen lässt uns nicht länger genießen!
31. August 1989
Morgen jährt sich der Tag des Beginns des Zweiten Weltkriegs zum fünfzigsten Mal. Vor wenigen Tagen ist mit Tadeusz Mazowiecki der erste nichtkommunistische Ministerpräsident Polens nach 1945 gewählt worden. In den baltischen Sowjetrepubliken verlangt man die Unabhängigkeit von Russland. In Moldawien fordern die Einheimischen die Gleichberechtigung ihrer Sprache und die Rückkehr zur lateinischen Schrift. Tausende von DDR-Bürgern kommen über Ungarn und Österreich zu uns. Man schickt sie aus Ungarn nicht mehr in die DDR zurück. Ungarn bemüht sich vielmehr um eine Revision der Vereinbarungen mit der DDR, die es verbieten, DDR-Bürger nach dem Westen ausreisen zu lassen.
Zu alldem gibt es in der CDU und ihrer Führung keine konstruktiven oder gar konzeptionellen Reaktionen. Zum fünfzigsten Jahrestag des Kriegsausbruchs ist uns praktisch nichts eingefallen. Kohl hatte Polen noch nicht besucht. Deshalb konnte von Weizsäcker nicht nach Warschau reisen. Eine wirklich überzeugende Geste, die auch eine nationale Dimension hätte zum Ausdruck bringen können, ist unterblieben. Damit ist gleichzeitig die großartige Möglichkeit vertan, den 50. Jahrestag des Kriegsbeginns für eine Vision zu nutzen, die ganz Europa umfasst und die Deutschen in dieses Gesamteuropa einordnet. Die Regierungserklärung Kohls wird eine solche Dimension mit Sicherheit nicht erreichen und außerdem durch parteiische Diskussionen wieder zerredet werden. Wir versinken immer tiefer im Provinzialismus. Es ist ein Jammer!
1. September 1989
Die »Feierstunde« heute Morgen im Bundestag war eine beschämende Veranstaltung. Kohls Rede war ohne Ausblick und weiterführende Gedanken. Rund eine Stunde lang Beschwörung der Vergangenheit, der Toten und Gequälten, Fragen von Schuld und Sühne. So wichtig dies ist: Unversehens ist die Regierungserklärung zu einer Rede zum Volkstrauertag geworden. Brandt war besser und bekam zwischendurch viel Beifall. Er sprach von den Menschen jenseits von Mauer und Stacheldraht. Sie hätten zwar das kürzere Los gezogen. Aber sie hätten den Krieg nicht mehr verloren als die Deutschen im Westen. Ich spreche den gleichen Gedanken in einem Interview im WDR zur Deutschlandpolitik an. Weil dies so ist, müssen wir in einer nationalen Anstrengung einen Lastenausgleich anbieten. Erst wenn wir dazu bereit sind, können wir Forderungen nach Reformen und Erleichterungen stellen, die sonst hohl und unehrlich klingen. Praktisch heißt das, dass wir in der Bundesrepublik keiner Bevölkerung eines anderen Staates mehr verpflichtet sind, unseren Wohlstand mit ihr zu teilen, als den Deutschen im anderen Teil Deutschlands. Wer die Freiheit für alle Deutschen will, der muss auch die wirtschaftliche Freiheit für alle Deutschen wollen.
Das Traurige ist, dass wir es am 1. September nicht einmal fertiggebracht haben, eine gemeinsame Erklärung im Bundestag zu verabschieden. Die Union lehnte eine Resolution, in der das Schreiben Richard von Weizsäckers zur deutsch-polnischen Grenze wiedergegeben war, ab. Man könne nicht über Äußerungen des Bundespräsidenten abstimmen. Unehrlichkeit allenthalben. Als ob man sich die Aussagen des Bundespräsidenten nicht in einem neu formulierten Text hätte zu eigen machen können!
So mussten wir am Ende in namentlicher Abstimmung einen Entschließungsantrag der SPD zur Grenzfrage ablehnen und dann unsere eigene Resolution abschnittsweise verabschieden, weil die SPD dem ersten, aber nicht dem zweiten Abschnitt zustimmen wollte. Ein trauriger Abschluss einer insgesamt missglückten Veranstaltung. Wir sind nicht mehr in der Lage, selbst historischen Ereignissen von einzigartiger Bedeutung zu entsprechen. Wie Mehltau legt sich Mittelmäßigkeit übers Land. Die Macht und die Pfründe sind zum alles bestimmenden Kriterium geworden.
Die Nachmittagssitzung der Vorsitzenden aus Nordrhein-Westfalen war ebenfalls deprimierend. Was ist aus der großen NRW-Partei geworden! Für Blüm war auch der 1. September nur ein Stichwort. Seine Äußerungen waren fahrig und unkonzentriert, ohne jede inhaltliche Strukturierung. Wenn NRW in diese Hände fällt, dann geht es dem Land um nichts besser als unter Rau. Der hat wenigstens Stil. Auch der fehlt Blüm. Man hat eine Wahlkampfkommission gebildet, der unter anderem Friedhelm Ost und Peter Boenisch, Coordt von Mannstein und Bernhard Worms angehören. Eine hervorragendere Ansammlung kann man sich kaum vorstellen. Unsere Landespartei wird geradewegs heruntergewirtschaftet. Angeblich sollen die demoskopischen Daten besser geworden sein. Die SPD verfüge derzeit nicht mehr über die absolute Mehrheit. Die CDU nähere sich den 40 Prozent. Wenn das in der Kommunalwahl hilft, soll es mir recht sein. Aber an einen Wahlsieg in NRW mit der FDP vermag ich nicht zu glauben. Eher an die Wiederholung des Ergebnisses von 1985. Die Stimmung in der Konferenz war schlecht. Viele verließen schon nach einer Stunde das Lokal. Von Motivation konnte keine Rede sein.
10. September 1989
Der Bundesvorstand beriet in Bremen vor dem Parteitag. Christa Thoben und ich sitzen wohl zum letzten Mal nebeneinander. Sie wird morgen für das Präsidium kandidieren, für die Nachfolge von Hanna-Renate Laurien.
Gestern Abend waren wir zu Gast bei Ronald Pofalla und seiner Frau Sabine. Wir sprachen auch über die Deutschlandpolitik. Der Zustrom von Flüchtlingen aus der DDR hält unvermindert an. Obwohl wir an diesem Abend noch nicht wissen, dass Tausende von meist jungen Menschen aus Ungarn über Österreich in die Bundesrepublik kommen werden, ist uns klar, dass wir für die DDR Mitverantwortung übernehmen müssen. Wir beschließen, dass ich zu dieser nationalen Verantwortung etwas auf dem Parteitag sagen sollte, und zwar in der Aussprache zum Bericht des Vorsitzenden. Stellungnahmen zum Personalstreit erscheinen uns nach der Entwicklung im Vorfeld des Parteitages nicht mehr sinnvoll.
Auf dem Parteitag selbst trage ich zur deutschen Verantwortung unter anderem Folgendes vor:
»Helmut Kohl hat in seiner Rede zu Recht festgestellt, dass unsere Kinder und unsere Enkel uns eines Tages fragen werden, was wir denn in dieser historischen Stunde getan haben. Er hat von einer historischen Verantwortung und von unserem Ziel gesprochen, die dynamische Entwicklung im Westen und die Reformen im Osten schöpferisch zu verbinden.
Lassen Sie uns einmal ganz praktisch werden. In den letzten Wochen habe ich in der Zeitung verschiedentlich gelesen, einer der Vorteile der Zuwanderung junger Menschen in die Bundesrepublik Deutschland sei, dass sie an der Schaffung unseres Wohlstandes mitwirken und die Überalterung unserer Bevölkerung korrigieren und das zukünftige Defizit in unseren Rentenkassen verringern könnten. Damit kann man sich natürlich zufriedengeben. Nur, meine Damen und Herren, eine solche Betrachtungsweise ist jedenfalls in Bezug auf die Zuwanderung aus der DDR keine gesamtdeutsche Betrachtungsweise, sondern sie geht davon aus, dass die jungen Menschen von dort, die, weil sie drüben verzweifeln, freiheitssuchend hierherkommen, für uns ganz sicherlich auch einen materiellen Beitrag leisten. Gesamtdeutsch gesehen ist das nicht das ganze Bild.
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass gerade mit diesem Vorgang, der heute um Mitternacht begonnen hat, eine politische Zäsur sichtbar wird: Zum ersten Mal lässt ein früherer Satellit der Sowjetunion, ein Ostblockland, Deutsche aus dem anderen Teil Deutschlands in die Bundesrepublik ausreisen und bricht damit die Kette, mit der die Unfreiheit gegen die Freiheit bisher gesichert wurde.
Für uns muss sich daraus eine langfristige Konsequenz ergeben. Auf diese kommt es mir hier an. Wir müssen in Zukunft alle unsere politischen Entscheidungen und Bewertungen immer auch an der Frage messen, wie die jeweils gefundene Antwort mit unserer gesamtdeutschen Verantwortung vereinbar ist. Wir müssen bei allem, was wir tun, die Einheit der Deutschen mitbedenken, und das heißt: praktizierte Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger in der DDR üben, die ja nach unserer richtigen Überzeugung genauso Deutsche sind wie wir.
Was heißt das für die Menschenrechte? Helmut Kohl hat gesagt, Freiheit einzufordern bedeute, Menschenrechte einzufordern. Aus der Bewegung der großen sozialen Frage des neunzehnten Jahrhunderts bis weit in das zwanzigste Jahrhundert hinein wissen wir, dass es keine politische Freiheit ohne wirtschaftliche Freiheit gibt. Ein Mensch, der wirtschaftlich abhängig ist, der nichts hat, kann nur schwer politisch frei sein. Unsere Pflicht, Menschenrechte zu verwirklichen, schließt deshalb ein, alle wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Menschenrechte sich verwirklichen können.
Unsere Bereitschaft, meine Freunde, zur wirtschaftlichen Mitwirkung in Polen, in Ungarn und vor allem in der DDR kann nicht das Ergebnis von Reformen sein. Für die DDR ist unsere Erklärung, dass wir bereit sind, wirtschaftlich mitzuwirken, die Voraussetzung für eine besser und wirkungsvoller vorgetragene Reformforderung in der DDR.
Und noch ein letzter Gedanke: Diese Verpflichtung erwächst uns, weil die Bürger im anderen Teil Deutschlands, in der DDR, nicht nur Bürger sind wie wir, sondern weil wir für sie Treuhänder sind. Wir haben für sie Freiheit gesichert und Wohlstand geschaffen. Die Menschen im anderen Teil Deutschlands sind durch die Kriegsfolgen und die ungleiche Art der Last daran gehindert worden, das Gleiche zu tun. Wir haben es treuhänderisch für sie getan. Wir haben die Talente vermehrt, die sie wegen Unfreiheit und Unterdrückung nicht vermehren konnten. Aus dieser Vermehrung haben sie heute einen Anspruch darauf, wenn sich Freiheit eröffnet, an der Arbeit, die wir geleistet haben, teilzuhaben.
Dieses ist eine Vision, und zwar eine nationale Vision, gerade für die Jüngeren. Sie können auf dem aufbauend weitermachen, was wir in den letzten Jahren geschaffen haben.«
Die Reaktion auf meine Rede war eher durch Überraschung und Verwunderung gekennzeichnet. Alle hatten erwartet, dass ich in der allgemeinen Aussprache kritisch zur Situation der Partei Stellung nehmen würde. Niemand konnte sich erklären, warum ich mich zur Deutschlandpolitik äußerte. Viele sahen darin den Versuch, der parteipolitischen Diskussion auszuweichen, nachdem Kohl seine Position in den letzten Tagen vor dem Bundesparteitag auch dank des Rückziehers Lothar Späths wieder gefestigt hatte. »Kohl hat gesiegt«, lautete die Überschrift eines Jubelkommentars der Frankfurter Allgemeinen wenige Tage vor dem Bundesparteitag.
Meine Wiederwahl in den Bundesvorstand bereitete keine Schwierigkeiten, wenngleich das Ergebnis nicht besonders berühmt ist. Aber das war nach der Auseinandersetzung der vergangenen Wochen über die Politik des Parteivorsitzenden auch nicht verwunderlich. Der Parteitag scharte sich hinter Kohl, reagierte ungehalten auf jeden, der einen kritischen Maßstab anlegte, und teilte auch Bestrafungen aus. Unter anderem wurde Ulf Fink nicht wieder in den Vorstand gewählt.
21. September 1989
Zunehmend beschäftigt mich die ost- und deutschlandpolitische Entwicklung. Genscher hat in einer Rede in Wien die Ansicht vertreten, die nationalen deutschen Interessen seien mit den europäischen Interessen identisch. Davon kann in Wirklichkeit keine Rede sein. Weder können unsere Interessen ganz mit denen der Europäischen Gemeinschaft noch deren Interessen ganz mit den unseren übereinstimmen. Vielmehr muss es spezifische deutsche Interessen geben, wie es französische, italienische oder britische Interessen gibt. Unsere zukünftige Politik kann jedenfalls nicht von einer solchen Interessenkongruenz ausgehen. Denn die Gesamtheit deutscher Interessen kann nie zugleich identisch mit europäischen Interessen sein.
Die Ereignisse der letzten Wochen machen es möglich, wieder über die deutsche Einheit nachzudenken und zu reden, nicht nur als Utopie, sondern als reale Chance. Dies stellt uns jedoch vor ein weiteres Problem: Wir müssen Abschied nehmen von der lieb gewordenen Vorstellung, die Bundesrepublik sei ein ökonomischer Riese und ein politischer Zwerg (Helmut Schmidt). Wenn es zur Verbindung der beiden deutschen Staaten kommt, dann werden wir nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch die dominierende Kraft in der EG sein. Daraus erwächst uns eine neue Verantwortung, die wir nicht mehr leugnen oder herunterspielen können. Niemand würde uns eine solche Haltung in Zukunft glauben. Wir würden mit ihr nur Misstrauen ernten.
Zu der neuen Verantwortung gehört, dass wir bei unseren politischen Maßnahmen die Interessen der Betroffenen mitbedenken. Dies verbietet es zum Beispiel, ständig in provinzieller Selbstgerechtigkeit davon zu sprechen, wir seien spitze, hätten die beste Regierung Europas und seien dessen treibende Kraft. Solche Sprüche sind abträglich, auch und gerade, wenn sie vom Bundeskanzler kommen. Sie belasten unser Verhältnis zu den Nachbarn und schaden unseren außenpolitischen Interessen.
Im Übrigen müssen wir, sobald die Wiedervereinigung Realität werden könnte, gesamtdeutsch denken. Unser politisches Handeln muss stets die Folgen mitbedenken, die es für die DDR und ihre Bewohner haben kann. So müssten die Übersiedler, wenn sie bei uns arbeiten, ihre Beiträge zur Rentenversicherung eigentlich für die Rentner in der DDR zahlen. Denn ihnen gegenüber sind sie aus dem Generationenvertrag verpflichtet. Da sie es nicht können, müssen ihre Beiträge treuhänderisch für diesen Zweck gehalten werden. Wir dürfen sie also nicht »vereinnahmen« und unsere Rentenkasse damit entlasten.
10. Oktober 1989
Zum vierzigsten Jahrestag der DDR war Gorbatschow in Ostberlin. Sein Ausspruch: »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben« wird schnell zum geflügelten Wort. Die Fackelzüge der FDJ stehen in krassem Widerspruch zur wirklichen Lage in der DDR. In den letzten Tagen kam es zu ersten großen Demonstrationen. Am 8. Oktober standen sich auf der Prager Straße in Dresden Tausende von Menschen und die Staatsgewalt gegenüber. Aber es kommt nicht zu blutigen Auseinandersetzungen, anders als am Tag zuvor in Berlin, sondern zum ersten Dialog mit der Staatsmacht. Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer ist bereit, eine »Gruppe der 20« zum Gespräch zu empfangen. Die Gruppe hat sich während der Demonstration spontan gebildet.
Am 9. Oktober kommt es zur ersten großen Demonstration in Leipzig. Auch hier überwinden die Menschen ihre Angst vor der Gewalt; auch hier kam es nicht zu einem Blutbad. Kurt Masur und dem Pfarrer der Nikolaikirche, Friedrich Magirius, soll es gelungen sein, in Gesprächen mit der Polizei und dem Militär einen Verzicht auf Gewaltanwendung zu erwirken.
29. Oktober 1989
Treffen der europäischen Gruppe der Trilateralen Kommission in London. Der Vormittag des zweiten Tages ist den Ost-West-Beziehungen gewidmet. Julian Bullard, der ehemalige britische Botschafter, führt in das Gespräch ein. Er wirkt wenig konzentriert. Aber es ist wohl auch zu viel verlangt, in der gegenwärtigen Umwälzung bereits Strukturen zu erkennen. Dietrich Stobbe spricht über die deutsche Frage und die Entwicklung in der DDR. Die Menschen dort befreiten sich von der Angst. Sie forderten »Demokratie jetzt!« Aber sie sprächen nicht über die Wiedervereinigung. Ihnen sei die Freiheit wichtiger. Freiheit vor Einheit gelte nun auch für die DDR-Bevölkerung.
In der Bundesrepublik gebe es einen breiten Konsens darüber, wie man mit der gegenwärtigen Entwicklung fertigwerden könne. Es sei unwahrscheinlich, dass Moskau militärisch intervenieren werde. Der sowjetische Tank habe seine drohende Rolle verloren.
Stobbes Ausführungen mögen interessant sein. Aber sie wirken auch in dem Kreis der Mitglieder der Trilateralen Kommission merkwürdig irrelevant. Ich habe nicht den Eindruck, dass er seine Zuhörer wirklich erreicht. Man macht sich Notizen, aber man weiß auch aus eigener Erfahrung, dass diese Notizen kaum wieder zur Hand genommen werden.
4. November 1989
In der Lufthansa-Lounge in München. Seit zwei Monaten habe ich nur noch sporadische Eintragungen gemacht. In dieser Zeit ist ein Sturm über Europa hinweggegangen. Eine beispiellose Fluchtbewegung aus dem Osten Deutschlands, gefördert durch die Öffnung des Eisernen Vorhanges in Ungarn, hat zu einem Regierungswechsel in der DDR geführt. Am 7. und 8. Oktober konnte man Demonstranten in Berlin noch niederknüppeln und die Festgenommenen misshandeln. Gegen 300 000 Demonstranten am 9. Oktober in Leipzig konnte auch die Gewaltherrschaft in der DDR nichts mehr unternehmen.
Drei Tage später war Honecker abgesetzt und Krenz als Nachfolger gewählt. Zahlreiche Rücktritte hat es seitdem gegeben. Karl-Eduard von Schnitzlers Schwarzer Kanal ist eingestellt, die Nachrichten im DDR-Fernsehen werden offener, Politiker stellen sich nun auch im Fernsehen der öffentlichen Diskussion. In einer neuen Nachrichtensendung bringt man ähnlich wie im heute journal Interviews und Reportagen vom Ort des Geschehens. Offizielle sprechen mit dem Neuen Forum und setzen sich für seine Anerkennung ein. Wolfgang Berghofer in Dresden erscheint immer häufiger in den Nachrichten.
Ungeachtet dieser Veränderungen hält der Strom der Übersiedler weiter an. Nachdem die DDR den Visumzwang zur ČSSR vor wenigen Tagen wieder aufgehoben hatte, strömten erneut Tausende in die deutsche Botschaft in Prag. Die Tschechen haben noch immer Schwierigkeiten, das Problem flexibel zu handhaben, anders als Ungarn und Polen. Aber die DDR versucht inzwischen, zu kooperieren und die Ausreise der Flüchtlinge zu erleichtern.
Seit zwei Monaten ist so die deutsche Wiedervereinigung, besser die Einheit der beiden deutschen Staaten, wieder zu einer greifbaren Möglichkeit geworden. Ein vom ungarischen und österreichischen Außenminister gemeinsam durchschnittener Stacheldrahtzaun an der Grenze zu Österreich hat den Zusammenbruch der Illusion der Eigenstaatlichkeit der DDR eingeleitet. Wie ein Kartenhaus sind die Fiktionen des realen Sozialismus zusammengebrochen, nachdem man offen über sie reden konnte. Der Ruf des Jungen im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern hat die Herrschenden als das vorgeführt, was sie sind: nackt, wenn es um eine politische Legitimation ihrer Macht geht.
Am 24. Oktober besuchte mich ein junger Pastor, Steffen Reiche, Gründungsmitglied der SDP in der DDR. Er wollte in meinem Büro mit RIAS-TV Aufnahmen machen. Anschließend trafen wir uns zu einem Gespräch. Ich gab ihm eine Reihe von Anregungen mit auf den Weg, die er aufnahm und sich sogleich zu eigen machte. Einmal den Gedanken vom Lastenausgleich zwischen den beiden deutschen Staaten, zum Zweiten die Überlegung, dass viele, die jetzt übersiedeln, später zurückgehen können und dann wertvolles Wissen mitnehmen, das sie bei uns erworben haben – gute und schlechte Erfahrungen! Er wollte im Bundeskanzleramt empfangen werden. Ich vermittelte ihm einen Termin mit Rudolf Seiters. Später sagte er ihn ab. Man habe ihm aus dem SDP-Vorstand in der DDR bedeutet, dass es besser sei, den Termin nicht wahrzunehmen.
Reiche und ich wollen Verbindung halten. Die jungen Politiker saugen alles Neue auf wie ein Schwamm. Erstaunlich, mit welcher Professionalität sie sich in ihrer neuen Rolle zurechtfinden. Reiches Auftritte im Fernsehen waren ausgezeichnet. Er wirkt sicher, macht klare Aussagen, hat eine erfrischende Offenheit, kurzum, er ist unverbraucht und unverdorben durch die politische Routine und inhaltliche Entleerung unserer Tage.
Am 31. Oktober war ich bei Georg Leber. Ich sprach von der Notwendigkeit, einen nationalen Fonds einzurichten, um einen Beitrag zum Lastenausgleich zu leisten. Die Tarifparteien und die Bevölkerung sollten Gelegenheit haben, sich daran zu beteiligen. Leber nahm den Gedanken mit großem Engagement auf. Schon am nächsten Tag rief er an, um mir seine Ideen dazu vorzutragen: Arbeit am 1. Mai und am 17. Juni und Überweisung des gesamten Betrages (circa 1 Prozent des Bruttosozialprodukts) an den Nationalfonds. Wir sollten uns Gedanken machen, wofür das Geld eingesetzt werden kann.
6. November 1989
Bundesvorstand in Köln: Kohl äußert sich in seinem Bericht zur Lage in Polen und zur DDR. Mit Krenz werde es keine Beruhigung geben, wenn er an seinem gegenwärtigen Kurs festhalte. Die Politik der Bundesregierung habe sich bewährt. Sie müsse in die europäische Entwicklung eingebunden werden. Dass sich Bush und Mitterrand für die Möglichkeit einer Wiedervereinigung ausgesprochen hätten, sei ein großer Erfolg. Die Presse in Frankreich und England sei anders. Dort würden wir wieder verdächtigt, aus dem Westen auszubrechen.
Teltschik berichtet über die geplante Polenreise. Elf Verhandlungsrunden zu ihrer Vorbereitung hätten bereits stattgefunden. Grundlage sei der Warschauer Vertrag von 1970. Man habe keine Veranlassung gesehen, die Rechtsfragen neu aufzugreifen. Kohl wolle in Warschau in seiner Tischrede wörtlich das Gleiche zur Oder-Neiße-Grenze sagen wie bei den Vertriebenen.
Kohl ergänzt den Bericht Teltschiks: Die polnische Wirtschaftsreform stehe vor ungeheuren Schwierigkeiten. Die Regierung sei über die bestehenden Verhältnisse gestülpt worden. Unterhalb des Regierungsniveaus hätte sich nichts geändert. Die polnische Regierung wolle, dass deutsche Banken und Unternehmen die Kontrolle über ihre Investitionen selbst übernähmen, weil man der polnischen Verwaltung nicht traue. Vor allem brauche Polen Menschen, die sich beteiligten. Er, Kohl, suche Personen, die in Polen mitarbeiteten, vor allem im Bankensystem. Die Kommunen sollten die polnischen Kommunalstrukturen mit aufbauen helfen. In der Landwirtschaft solle man prüfen, ob gebrauchtes Gerät geliefert werden könne. Die Kontakte zu den Universitäten sollten verstärkt werden. Im Bereich der Medizin und der Naturwissenschaften finde bereits eine umfangreiche Kooperation statt. Nun müssten auch die Geisteswissenschaften zusammenarbeiten, auch die Historiker.
Kohl wolle viele Orte besuchen, die man besuchen müsse. Zur Angelegenheit Annaberg: Der Bischof von Oppeln, Alfons Nossol, habe ihn im Sommer nach Annaberg eingeladen. Er sei deutschfreundlicher als die anderen polnischen Bischöfe. Teltschik habe dem Bischof die Annahme der Einladung mitgeteilt. Daraufhin sei auf kommunistischer Seite eine Hetze gegen uns losgegangen. Der Bischof habe deshalb dringend vom Besuch abgeraten. In den gemeinsamen Gesprächen sei dann der Gedanke geboren worden, nach Kreisau zu fahren. Kreisau liege ihm, Kohl, mehr. Denn dieser Ort zeige das andere Deutschland, das Deutschland des Widerstandes. Mitterrand habe die Idee gutgeheißen.
Die Reise werde auf einem schmalen Grat stattfinden und im Westen aufmerksam beobachtet. Das gelte insbesondere für Frankreich, aber auch für die USA, schon wegen der polnischstämmigen Bevölkerungsgruppe dort. Schließlich verfolge man die Reise natürlich auch in Moskau sehr genau. Dies umso mehr, als man in der DDR auf Polen blicke. Krenz habe es abgelehnt, sich am polnischen oder ungarischen Modell zu orientieren. Umso wichtiger sei der Erfolg der polnischen Entwicklung.
Wallmann dankt Kohl für seine Politik. Ohne sie wäre all das nicht möglich gewesen, was jetzt geschehe. Die Ereignisse im Osten seien das Ergebnis seiner Politik. Dafür wolle er ihm förmlich danken. Trotz zweimaliger Wiederholung dieser Feststellung rührt sich am Vorstandstisch keine Hand.
Seiters berichtet über die Entwicklung in der DDR. Bis zur Stunde seien rund 10 000 Pkws aus der DDR gekommen. Die Großdemonstrationen brächten Probleme mit sich, vor allem in der Nähe der Mauer. Der Prozess, der mit der Schließung der Ständigen Vertretung in Ostberlin begonnen habe, dauere nun genau drei Monate. Seitdem sei die DDR-Regierung ständig hinter der Entwicklung hergelaufen. Alles, was man bisher zugegeben habe, bewege sich in den bisherigen Strukturen. In der Bevölkerung sei kein neues Vertrauen in die Regierung entstanden.
Die Reformer gingen wesentlich weiter. Der Inhalt ihrer Forderungen entspreche dem, was die Synode der Evangelischen Kirchen in der DDR im September beschlossen habe. Aber noch habe sich kein politischer Führer oder eine Führung herausgebildet. Die Lage in der DDR verschärfe sich ständig, nicht zuletzt durch die Fluchtbewegung. Viel hänge nun von der Sitzung des Zentralkomitees der SED ab, die von Mittwoch bis Freitag stattfinden werde. Die Forderung nach Rücktritt des Politbüros sei gestellt worden. Selbst das aber sei nicht ausreichend. Notwendig seien freie Wahlen.
Auch uns stellten sich jetzt mit der Reisefreiheit und dem zu erwartenden großen Besucherstrom zentrale Fragen, zum Beispiel, wie man die Austeilung des Begrüßungsgelds und Ähnliches organisieren könne. Wir seien nicht in der Lage, die Reisen der DDR-Bürger zu finanzieren. Das sei Sache der DDR, die die Reisefreiheit gewährt habe.
Diepgen ist überzeugt, dass man sich in der DDR auf Dauer nicht gegen freie Wahlen werde wehren können. Die SED könne ihr verfassungsrechtlich anerkanntes Monopol nicht aufrechterhalten. Die neuen politischen Gruppierungen hätten bisher keine klaren Vorstellungen von dem, was der neue Sozialismus oder der Markt bedeute. Noch sei unklar, wie man sich die weitere Entwicklung vorzustellen habe.
Was könnten wir tun? Mit dem Begrüßungsgeld allein kämen wir nicht weiter. Man müsse den DDR-Bürgern in gewissem Umfange den Umtausch gestatten. Wir müssten in der DDR mindestens dasselbe tun wie die Polen. Auf die Zwischenfrage von Kohl, ob vor oder nach Reformen, erwidert Diepgen, man könne dies zeitlich kaum noch auseinanderhalten. Er sei sich sicher, dass die Behinderungen der Kleinhandwerker in der DDR bald fallen würden.
Was tun wir, wenn es zu freien Wahlen kommt? Wen sollen die Leute dann wählen? Kohl: In drei Jahren stehe eine Ost-CDU in der DDR. Darauf biete er eine Wette an. Diepgen selbst stimmt dem zu. Er stellt fest, dass die Führung der CDU in der DDR in wenigen Monaten ausgewechselt sein werde. Mit diesem Prozess werde man sich befassen müssen. Man müsse ihn auch beeinflussen. Die heutigen Reformer seien Träumer von einem neuen Sozialismus. Sie fänden in der Bundesrepublik Partner, die sie unterstützten. Man müsse auch offensiv über die Einheit sprechen und diejenigen in der Bundesrepublik bekämpfen, die von vornherein von der Zweistaatlichkeit ausgingen.
Kohl: Wenn es 1991 in der DDR zu freien Wahlen käme, dann seien wir in der Lage, dort innerhalb von drei Monaten eine politische Organisation aufzubauen. Es sei richtig gewesen, mit der Ost-CDU bisher keinen Kontakt aufzunehmen. Die innere Opposition achte genau darauf, mit wem wir in der DDR reden. Für ihn gebe es keinen Zweifel, dass mit Selbstbestimmung auch die Einheit gemeint sei.
Seiters betont noch einmal, dass übers Wochenende rund 18 000 Menschen aus der DDR gekommen seien. Die Zahl scheine derzeit rückläufig zu sein. Wenn die neue Reiseregelung in Kraft trete, könne man noch nicht absehen, wie die Finanzierung der Reisedevisen bewältigt werden könne. In der Bevölkerung seien noch immer Neidkomplexe virulent. Man müsse im Blick auf Weihnachten um Gastfreundschaft werben, um einen Teil der Probleme lösen zu können. Die Notwendigkeit, den Sozialismus in Frage zu stellen, werde zu wenig betont. Ihn öde es an, dass man in der DDR nach wie vor über den Sozialismus diskutieren wolle.
Wir müssten in der deutschlandpolitischen Diskussion stärker um die Führung werben, um zu verhindern, dass wir in dieser Frage durch SPD und FDP auf den zweiten Rang verwiesen würden. Die FDP dränge sich derzeit mit Mischnick und Bangemann in den Vordergrund.
Vom Vertreter der Exil-CDU wird die politische Leistung betont, die darin liege, dass die Revolution sich als Evolution vollziehe. Niemand habe bisher einem SED-Funktionär oder einem Stasimann ein Haar gekrümmt. Und das, obwohl viele der Reformer im Gefängnis gesessen hätten. Stoltenberg bezweifelt, dass die Sowjetunion einem Austritt der DDR aus dem Warschauer Pakt zustimmen werde. Die Sowjetunion wolle eine europäische Großmacht und in neuem Verständnis auch eine Weltmacht bleiben.
7. November 1989
Heute habe ich von Georg Leber den Text zu unserer gemeinsamen Erklärung erhalten. Ich habe ihn dem Leipziger Wirtschaftsprofessor Günter Nötzold vorgelesen, um seine Reaktion zu erhalten. Er stimmt dem Vorhaben zu, betont aber die Notwendigkeit, die Zweistaatlichkeit des deutschen Volkes nicht zu vernachlässigen. Die Zahl derer in der DDR, die auf der Grundlage der Eigenstaatlichkeit nach einem unabhängigen gesellschaftlichen und politischen Weg für die innere Ordnung suchten, sei groß. Man dürfe diese Suche nicht behindern. Nötzold ist davon überzeugt, dass viele in der DDR glauben, man könne einen neuen Sozialismus entwickeln. Nicht alle seien daran interessiert, dass sich die DDR in die Bundesrepublik integriere.
Heute Morgen waren schon um 7.40 Uhr zwei holländische Journalisten bei mir, die mich zu Europa und der deutschen Einheit befragen wollten. Das Gespräch war aufschlussreich. Die Sorge, die unsere Nachbarn ganz offensichtlich vor der Wiedervereinigung der Deutschen haben, war unverkennbar. Es dauerte lange, bis die beiden bereit waren, inhaltlichen Argumenten zu folgen. Noch weniger als bei uns hat man begriffen, dass ein ganz anderes Deutschland entsteht, wenn es zu einer Wiedervereinigung kommt: ein Deutschland, dessen Energien auf lange Zeit durch den Aufbau der DDR gebunden sein werden, das im Begriff ist zu vergreisen und dessen Bevölkerung wegen ihres inzwischen erlangten Wohlstandes wesentlich weniger belastbar ist, als sie es vor fünfzig oder gar fünfundsiebzig Jahren war. Wir werden viel Aufklärung betreiben müssen, denn der Prozess der Einigung und Integration wird weiter fortschreiten.
10. November 1989
Sitzung zu Fragen der DDR im Konrad-Adenauer-Haus unter dem Vorsitz von Rühe.
Heute Nacht ist der Krieg wirklich zu Ende gegangen. Die Menschen in Berlin haben die Mauer überwunden. Uns erreichte die Nachricht vom Fall der Mauer im Bundestag. Nach der Regierungserklärung zur Lage der Nation am 8. November ging das Hohe Haus am 9. November wie gewohnt seinen Geschäften nach. Gegen Abend standen die 2. und 3. Lesung des Vereinsförderungsgesetzes auf der Tagesordnung. Die SPD hatte namentliche Abstimmung verlangt. Das Plenum war deshalb voll besetzt.
Als der Abgeordnete Spilker als Berichterstatter das Wort erhielt, begann er seine Rede mit dem Satz: »Bevor ich zu meinem Thema komme, möchte ich Ihnen eine Meldung vorlesen, die ich im Moment erhalten habe.« Damit erntete er von der SPD den Zuruf: »Wir kennen sie schon!« Spilker fuhr fort: »Ich kannte sie nicht. – Ab sofort können DDR-Bürger direkt über alle Grenzstellen zwischen der DDR und der Bundesrepublik ausreisen.« Vom Beifall der CDU/CSU, der FDP und der SPD unterbrochen, fuhr er fort: »Ich dachte, dass es mir ausnahmsweise gestattet ist, das fernab vom Thema mitzuteilen«, worauf der Abgeordnete Dr. Penner (SPD) ihm zurief: »Darfst du!«
Spilker wandte sich sodann ohne weiteren Kommentar dem eigentlichen Gegenstand zu. Auch die folgenden Redner sahen keinen Anlass, auf das Ergebnis einzugehen, das Herr Spilker mitgeteilt hatte. Erst später fiel es dem Abgeordneten Tillmann auf, es könne »angesichts der sensationell wichtigen Meldung, die uns Herr Kollege Spilker soeben hier bekanntgegeben hat, dem einen oder anderen Zuhörer dieser Debatte als kleinkariert erscheinen, dass wir uns hier weiter, als ob nichts geschehen sei, über Pauschalen streiten und weiter über die Förderung des Sports reden«. Aber, so fuhr er fort, die Nachricht sei wichtig und erfreulich für alle Bürgerinnen und Bürger in beiden Teilen Deutschlands, die sich dem Sport verbunden fühlen und miteinander Sport treiben wollen. Es gebe uns Hoffnung, dass dies in Zukunft ohne größere Komplikationen möglich sein möge. Mit dieser Begründung wandte er sich wieder dem Vereinsförderungsgesetz zu.
Erst nach der namentlichen Abstimmung wurde die Sitzung unterbrochen, um den Fraktionsvorsitzenden Gelegenheit zu geben, sich zu dem Ereignis zu äußern. Nachdem Wolfgang Mischnick als letzter Redner geendet hatte, erhob sich der Abgeordnete Dr. Unland und stimmte die Nationalhymne an. Alle erhoben sich und sangen mit ihm. So begrüßte der Deutsche Bundestag die Wiedervereinigung der Deutschen.
Die Bilder, die man heute Morgen aus der letzten Nacht sehen konnte, waren so bewegend, dass mir die Tränen in die Augen stiegen. Tausende strömten ohne Kontrollen durch die Grenzübergänge nach Ost und West. Die Berliner feierten an allen Übergängen und schließlich in der ganzen Stadt die Wiedervereinigung. Der junge Mann aus Berlin, der über seine Erlebnisse in Berlin berichtet, wird ständig von seiner Rührung übermannt und kann unter Tränen nicht weiterreden. Der Nächste erzählt, er habe drüben im Gefängnis gesessen und sei freigekauft worden. Für ihn sei das alles ein Traum. Er könne das Ganze nicht fassen. Er fände es gut, wenn der Kanzler aus Polen zurückkehre. Er fände es gut, wenn er nach Berlin käme. Man könne dieses historische Ereignis nicht Momper überlassen.
Klaus Daweke erzählt, er sei gestern Abend zu einer Sitzung »40 Jahre politische Bildung« im Reichstag gewesen. Man habe abends darüber diskutiert, wie man die Menschen durch politische Bildung erreichen könne. Da sei einer in den Konferenzraum gekommen und habe gesagt, die Menschen seien da, man könne sie auf der Straße erreichen. Es sei unglaublich gewesen, was sich vor dem Reichstag abgespielt habe.
Worms berichtet sehr bewegend über das, was in der Nikolaikirche geschehen ist. Er schlägt die Gemeinde der Nikolaikirche für den Friedensnobelpreis vor. Der Pfarrer Christian Führer habe Großartiges geleistet. An einem Montag, Anfang Oktober, habe die Stasi mit ihren Leuten die Kirche besetzt. Der Pfarrer habe sie aufgefordert, mit ihm zu beten und sich zu erheben. Und alle hätten sich erhoben. Die Landtagsfraktion in Düsseldorf könne einen Teil der DDR abdecken, ohne in bestehende Zuständigkeiten einzugreifen.
Hannelore Rönsch plädiert ebenfalls für einen Besuch Kohls in Berlin. Ich unterstütze dies mit folgenden Argumenten:
1. Wir brauchen gute Bilder von Kohl in Berlin heute Abend. Denn die Bilder gestern Abend waren nicht gut. Er machte einen eher unwirschen Eindruck und zeigte nicht die Freude, die die Menschen in Berlin erfüllte.
2. Kohl muss als Kanzler sprechen, nicht als CDU-Vorsitzender. Er darf keinen Parteienstreit entfachen. Er muss Brandt in seine Aussagen einbeziehen und für alle Deutschen so sprechen, dass alle Deutschen zustimmen können. Fink ergänzt, dass auch die Bundesbürger angesprochen werden müssen, und zwar im Tenor der Chance, nicht des Appells an ihre Opfer- und Verzichtbereitschaft.
Es wird allgemein über die Möglichkeiten gesprochen, schnelle Kontakte mit der CDU in der DDR und anderen Organisationen aufzunehmen. Man solle nicht sofort über Wiedervereinigung reden. In der Ost-CDU bestehe die Sorge, im Sinne eines Anschlusses als Konkursmasse vereinnahmt zu werden.
Eben kommt die Nachricht, dass heute Abend in Berlin vor der Gedächtniskirche eine Kundgebung stattfinden wird. Ich melde mich für die Teilnahme an. Morgen werde ich in Berlin bleiben. Ich will diesen historischen Augenblick am Ort des Geschehens miterleben.
11. November 1989
Was hier in Berlin geschieht, ist unvorstellbar. »Unfassbar«, »Wahnsinn« sind die Begriffe, die man am häufigsten hört, wenn man die Menschen nach ihren Eindrücken und Gefühlen befragt. Das Volk hat die Teilung Deutschlands überwunden. Es hatte keine Geduld mehr und wollte nicht länger warten. »Die Deutschen sind heute das glücklichste Volk auf der Erde«, sagte Momper gestern vor dem Schöneberger Rathaus auf einer Kundgebung.
Gestern Nachmittag flogen wir mit einer Sondermaschine für die Fraktion nach Berlin. Viele waren nicht mehr in Bonn. Die meisten mussten oder wollten abends wieder zurück. Mit wenigen blieb ich in Berlin.
Zur Kundgebung kam ich etwas zu spät. Zu ihr hatten sich rund 150 000 Menschen an der Gedächtniskirche auf dem Breitscheidplatz versammelt. Als wir unsere Koffer im Interconti deponiert hatten und uns zu Fuß der Versammlung näherten, hörten wir bereits aus der Entfernung die Stimme Genschers. Warum Kohl ihn zur CDU-Kundgebung eingeladen hatte, ist mir unklar. Beide hatten auch schon vor dem Schöneberger Rathaus gesprochen. Genscher bekam viel Beifall. Ich mischte mich unter die Menge, zunächst in der Umgebung von Bierbuden (die sich eines reichlichen Zuspruchs erfreuten), dann in größerer Nähe zum Podium, auf dem Genscher, Landowsky, Waigel und Kohl ihre Reden hielten.
Der Eindruck aus der Sicht der Menge ist gänzlich anders als der von der Bühne, auch wenn man dort nur zuhört. Als Genscher sprach, waren die Menschen interessiert. Bei Waigel spürte man ihre Gleichgültigkeit. Er war in Erinnerung an Strauß eingeführt worden. Dessen Name scheidet selbst ein Jahr nach seinem Tod noch die Geister. Waigel ist kein guter Redner für Massenveranstaltungen. Ich habe ihn wohl überschätzt.
Zum Schluss dann Kohl. Sein Talent als Redner ist nicht größer. Was hätte man zu diesem Anlass alles sagen und bewegen können! Stattdessen eine überforderte Stimme, angestrengt und schon deshalb nicht überzeugend. Ohne wirklichen Kontakt zu den Menschen, die doch bereit sind, sich in Besitz nehmen zu lassen durch die Größe des Ereignisses, das sie zusammenführte. Kohl sprach zu lange, war voller Wiederholungen und Platitüden. Er verfehlte die Gefühle der Menschen und brachte den Staatsmann nicht rüber.
Die Störer waren hier kleiner an Zahl als vor dem Rathaus Schöneberg, wo Kohl auf ein andauerndes Pfeifkonzert getroffen war. Sie wurden von der großen Mehrheit auch abgelehnt. Als das Deutschlandlied gesungen war, das viele, auch junge Menschen mitsangen, zerstreute sich die Menge ohne Bewegung oder eine wirkliche Botschaft; dass sie handeln, war von ihnen nicht erwartet worden. Den konkreten Aufruf zur Solidarität hatte es nicht gegeben.
Ich ging zurück zum Schweizer Hof. Dort hatte die CDU einen Empfang vorbereitet. Man tat sich am Büfett gütlich und war Gott sei Dank wieder unter sich. Als Elmar Pieroth später ein Ehepaar aus der DDR mit Tochter vorstellte, konnte man den exotischen Charakter dieser Begegnung spüren. Man nahm sie als Besucher zur Kenntnis. Von der Gewalt der Ereignisse um uns herum war in diesem Raum kaum etwas zu spüren.
Ein junger Mann berichtete, ein Fackelzug zur Mauer sei vorbereitet, wir sollten uns anschließen. Mit einigen anderen ging ich mit, vom Hotel am Friedensengel vorbei, die Straße des 17. Juni entlang zum Brandenburger Tor. Auf halbem Weg wuchs die Menschenmenge an. Alle bewegten sich in eine Richtung. Gegen 20.30 Uhr erreichten wir die Mauer am Brandenburger Tor. Sie ist dort rund drei Meter dick und rund zwei Meter fünfzig hoch. Auf ihrer Krone standen dichtgedrängt die Menschen. Immer neue kletterten mit Hilfe anderer nach oben. So schoben und zogen sie einander auf das Bauwerk, das, durch Sprayer in kunstvoller Weise dekoriert, schon etwas von seiner drohenden Scheußlichkeit verloren hatte. Zehntausende drängten sich vor der Mauer. Immer wieder erhob sich der rhythmische Ruf: »Die Mauer muss weg!«, der uns schon unterwegs begleitet hatte.
An der Einmündung zur Straße des 17. Juni war eine kleine Fernsehstadt entstanden. Scheinwerfer tauchten Mauer und Menschen in helles Licht. Der Himmel war klar, der Mond fast voll. Aber es war nicht zu kalt. Auch Landowsky kletterte über eine einfache Leiter auf die Mauer; ein Bundestagskollege aus Berlin stand schon oben.
An den Flanken der Mauer, im Halbdunkel, wurde fleißig gehämmert. Junge Leute mit Hammer und Meißel schlugen Stücke aus der Betonkrone und verteilten sie an die Menge. Dutzende von Händen streckten sich ihnen entgegen, um ein Stück zu ergattern, fast so als handele es sich um eine Reliquie. Ein buntes, fröhliches Volk, ständig in Bewegung, mit einer merkwürdigen Mischung von Erstaunen, Ernst und Unbeschwertheit in den Gesichtern.