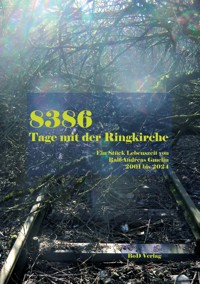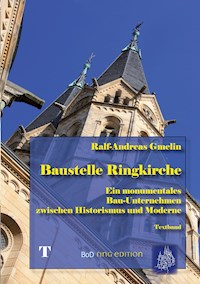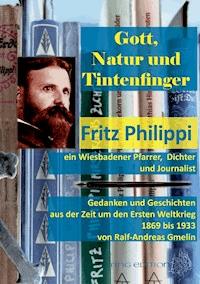Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: 1940.
- Sprache: Deutsch
Der Textband enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Lebensereignisse eines Hochschullehrers der Weimarer Zeit und dessen Untergang im Dritten Reich. Als Staatsrechtler veränderte sich 1933 alles, was Hans Gmelin lehrte, aber auch alles wofür er zuvor als liberaler Politiker und Hochschullehrer gestanden hat. Er hatte eine noch junge Familie und hatte nur die Möglichkeit in der inneren Emigration mit den Einkünften aus seinem Amt zu überdauern, bis ihn 1941 der Tod aus den Nöten der Diktatur befreite. Wie die drei umfangreichen Quellenbände wird hier eine mentalitätsgeschichtliche Studie vorgelegt, zu der auch ein Vergleich zu dem prominenten Kollegen Carl Schmitt gehört und ein Bibliographie der Werke Gmelins.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Zum Geleit
A. Einem Menschen auf der Spur
Nichts wie weg von Karlsruhe
Ein Manuskript und seine Rätsel
B. Die Biographie chronologisch
I. Die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg 1878- 1913
Das Studium
Von der Studienzeit zur Professur
Freiburg und der Schwarzwald
Der Katzenprofessor
Das Wandern und der Rennklub
Die Sprachen
Die Reisen
Die Reise nach Spanien 1902
Die Reise nach Rom 1905
II. Habilitationsschrift und letzte Freiburger Jahre
Probevorlesung: Belgien und das Sprachenrecht
Kolonialrecht
Kolonialrecht in Paris
Die Daily Telegraph Affaire
Belgien zum Vierten und Wintersemester 1909/10
Das Eigenheim in Günterstal
Der Gescheiterte Ruf nach Basel
Europäische Verfassungsgeschichte – ein Anlauf ohne Sprung
III. Professor in Kiel und Gießen
Neue Heimat Gießen
Fremdeln mit der neuen Heimat
Der Sonderklub
Der Rennklub
Gesellschaften
Junggesellen
Hochschullehrer in Gießen
Reise nach Vevey im April 1913
Mitglied des Verwaltungsgerichtshofs
Bosnische Kolonie im Auftrag des Schulvereins
IV. Der Erste Weltkrieg 1914-1918
Zum Lebensgefühl der Generation Weltkrieg
Aufklärungsarbeit mit Hindernissen
Aufklärung in der Schweiz
Kriegsalltag
Tagung der Vertreter der Rechtsfakultäten
Verwaltungsdienst 1917
Türkisches Seminar
Einsatz im Bereich des Belgischen Generalgouvernements
Bericht über flämische und französische Sprache
Rückblick auf den Krieg und die Arbeit in Belgien
Der Zusammenbruch
V. Nach dem Krieg: Die Zwischenkriegszeit beginnt
Die Revolution von 1918 / 1919
Parteipolitik
Die hessische Landesverfassung von 1919
Freikorpsfragen in Berlin. Weimar und Jena 1919
Neue Arbeitsschwerpunkte
Auf dem Weg zur hessischen Verfassung
Einfluss auf die hessen-darmstädtische Verfassung von 1919
Stadtverordneter ab Juni 1919
VI. Politischer und persönlicher Neuanfang ab 1920
Bevorstehende Reichstagswahl Januar 1920
Martha Meili
Das Kölner Abenteuer
Die Hochzeit in Rötteln am 27. November 1920
Geburt von Ulrich am 4. November 1921
Die Republik und die Wand der Universitätsaula
Kirchendotation und kein Ende
Vereinigung deutscher Staatsrechtslehrer 1922
Familienleben in Gießen und politische Lage 1922/23
Galoppierende Inflation
Geburt von Sohn Günter am 11. Juli 1923
Reise nach Günterstal August 1923
Wirtschaftliche Lage 1923
Sorge um die Universität Gießen
Reise nach Italien, März 1924
Reichstagswahl im Mai 1924
„Otto Eger Heim“
Zweite Italienreise im September 1924
Marthas Krankengeschichte und die Sache mit dem Mädchen
Vierte Reichstagswahl, Dezember 1924
Der Großherzog vom Nil
Staatsrechtlertagung in Leipzig 8-/9. März 1925
Reichspräsidentenwahl 1925
Unter den Talaren...
Staatsrechtlertagung in Münster im März 1925
Ausschuss für internationales Binnenschifffahrtsrecht
Sommersemester 1926
Rede zur Weimarer Reichsverfassung am 11. August 1926
Gutachten zum Volksbegehren im August 1926
Reise in den Orient im September 1926
Konstantinopel
Athen
Bauplatz und Hausbau in Gießen, Am Nahrungsberg 51
Auf der Baustelle
Staatsrechtliche Arbeiten
Innenausstattung des Hauses
Sorge um die Universität Gießen
Die unendliche Hundegeschichte
Einzug am Nahrungsberg. Ulrichs Schulbeginn, 1928
Neue Kriminalgeschichte, jetzt am Nahrungsberg
Reichsreform
Reform von Hessen-Darmstadt
Veröffentlichung über die Weimarer Reichsverfassung
Staatsrechtlertagung in Frankfurt am Main 1929
Zur Regelung der Kirchenfinanzierung
Juristische Fakultät im Sommersemester 1929
Das beginnende Ende vom Haus in Günterstal
Kriminalpsychiatrie, Rassismus und Strafvollzug
Gmelins Buch zur Weimarer Reichsverfassung
Von Otto Eger zu Mildred Harnack-Fish
Deutsche Politik 1929
Weihnachten am Nahrungsberg 1929
Verkauf des Günterstaler Hauses 1930
Hessisches Sparprogramm
Familiäres
Familientag Gmelin in Stuttgart 1930
Das Auto-Projekt
Auch 1931 magere Zeiten
Steuererhöhungen und Gehaltskürzungen im Sommer 1931
Erstarken der Nazis in Hessen-Darmstadt, November 1931
Gutachten zu Landtagswahl und Propaganda
Demontage der Fakultät als Prüfungsinstanz
Martha Gmelin geborene Meili
Reisen im Umbruchsjahr 1932
VII. Der Abstieg nach der Machtergreifung 1933
Dauernotstand der Juristenfakultät
Wehrpflicht und Machtpolitik
Reise in den Osten Deutschlands bis Ostpreußen 1936
Reise nach Berlin und an die See 1937
Wissenschaft im Nationalsozialismus
Kirche im Nationalsozialismus
VIII. Politischer Kommentar zum NS-Staat von Hans Gmelin
IX. Die letzten Jahre
Krankenstand im Jahr 1938
Sommerreise nach Anschluss Österreichs im Juli 1938
Krise am östlichen Grenzland des Reiches
Kurz vor Kriegsbeginn 1939
Zukunftsplanungen 1940
Verhältniswahl und Gelenkrheumatismus
Das Ende von Hans Gmelin
Historisches Völkerrecht am Ende
Ein Foto des Fotografen Uhl im Gießener Stadtarchiv, 1922
C. Ästhetische Bildung im Zeitalter der untergehenden Monarchie
D. Streit unter Juristen – vor der Entmachtung des Juristischen
E. Vergleich Hans Gmelin mit Carl Schmitt
F. Wer war Hans Gmelin?
G. Tabellarische Biographie
H. Bibliographie
Literatur
Verzeichnis der Jahreszahlen
Index ausgewählter Personen
Abbildungsverzeichnis
Vielen Dank den Wiesbadener Stadtteil-Historikern der Wiesbaden Stiftung und der Stiftung Polytechnische Gesellschaft und dem Kulturamt der Landeshauptstadt Wiesbaden und der Casino-Gesellschaft Wiesbaden.für die Unterstützung dieser Arbeit.
Vielen Dank an Manfred Gerber für das Probelesen, für Vorschläge und Korrekturen und für viele gute Gespräche – nicht nur über dieses Projekt...
Hans Gmelin mit seinem Malkoffer vor einer mediterranen Bergszenerie auf einem Platz mit gutem Überblick, um eine Ölskizze zu gestalten. Auch wenn er nie zur Künstlerexistenz geneigt hat, dies sind für ihn glückliche Momente seines Lebens gewesen.
Zum Geleit
Vom mir hochgeschätzten Ian Kershaw stammt der ermutigende Gedanke, dass er die meisten seiner historischen Werke geschaffen habe, um sich selbst Klarheit zu verschaffen. Ohne mich mit seinen Qualitäten messen zu wollen, folge ich ihm mit dieser Annäherung an die Lebensgeschichte eines Menschen, der lange vor meiner Geburt aus dem Leben gerufen worden ist. Die Beschäftigung mit Hans Gmelin vom Herbst 2021 bis heute, im Sommer 2024, ist ein wenig aus dem Ruder gelaufen: Ursprünglich war von mir geplant, mich etwa ein Jahr mit den spärlichen Resten des Manuskripts zu befassen, das mir in einer Pappkiste mitgeteilt worden war. Dabei erwies es sich, dass viele wichtige Fragen durch diese Auswahl unbeantwortet geblieben sind. Als ich dann erfuhr, dass es noch einen großen Bestand von handschriftlichem Quellenmaterial im Universitätsarchiv von Gießen gäbe, musste ich die damals bereits abgeschlossene Arbeit einstampfen und wieder von vorn beginnen. Nach drei Jahren konnte ich die Transskription der in einer ordentlichen Currentschrift niedergeschriebenen Erinnerungen meines Großvaters abschließen. Drei Quellenbände sind daraus geworden, obwohl einige Seiten nicht zuzuordnen waren und eine Reise nach Bosnien kurz vor dem Ersten Weltkrieg von mir willkürlich ausgesondert wurde. Leider bleiben auch nach der „Ergänzungslieferung“ etliche Fragen offen. Gerade die Jahre nach 1933 sind wenig ergiebig und mussten mit einigen privaten Briefen ergänzt werden. Hier ist sehr wahrscheinlich, dass die Frau von Hans Gmelin, Martha Gmelin geb. Meili, eine Auswahl von Seiten vernichtet hat, um einer befürchteten Kontrolle durch die Gestapo kein Material zu bieten, die ggf. eine Einstellung der Pensionszahlungen zur Folge hätte haben können.
Da es sich bei dem Gegenstand dieser Lebensbeschreibung um meinen Großvater handelt, ist nicht ganz auszuschließen, dass ich bei der Arbeit auch zu einem gewissen Grade nach einem Echo meiner Herkunft gesucht habe. Manche Ähnlichkeiten haben mich jedenfalls verblüfft – nicht immer zu meiner Freude. Wie meine beiden voraufgegangenen Arbeiten ist auch diese Arbeit gefördert worden von den Stadtteilhistorikern der Landeshauptstadt Wiesbaden. Der Verfasser bedankt sich in diesem Falle besonders herzlich, weil der Zusammenhang dieser Arbeit mit Wiesbaden nur darin besteht, dass Wiesbaden die juristische Nachfolgerin der ehedem großherzoglich hessischen Hauptstadt Darmstadt ist, deren Landesuniversität Gießen eine große Bedeutung für die Verfassung des Volksstaates Hessen und damit für deren demokratische Ausprägung in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts gehabt hat. Als dortiger Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht stand Hans Gmelin im Zentrum dieses Ringens um die hessen-darmstädtische Verfassung – nicht als politisch Verantwortlicher, sondern als überparteilicher sachkundiger Berater der hessendarmstädtischen Landesregierung.
Da Wiesbaden und Nassau – zusammen mit Kurhessen – zum insgesamt größeren ursprünglich preußischen Teil des späteren Hessenlandes zählt, gehört es zu den Wirkkräften, die bei der Formulierung einer neuen Verfassung für das neue Bundesland Hessen nach dem Zweiten Weltkrieg die preußische Verfassung als Vorlage nahelegten. Die von Hans Gmelin noch beschworene süddeutsche Tradition, die die alte hessen-darmstädtische Verfassung mit Baden, Württemberg, dem Elsaß und der Schweiz verband, ging bei der neuen hessischen Nachkriegs-Verfassung verloren.
Dennoch gehört diese Phase der Suche nach einer demokratischen, funktionierenden und dauerhaften Verfasstheit des kleinen süddeutschen Hessen zur Erinnerung unseres Landes und verbindet sich so auch mit dessen Hauptstadt, Wiesbaden. Wie schnell eine autokratische Regierung alle Grundlagen des Rechtsstaates beiseite räumen kann, ist eine erschreckende Lektion auf den Seiten über das Leben nach 1933. Sie vertiefen das Erschrecken, dass Menschen heute sich erneut diesem Wahnsinn zuwenden. Wiesbaden, im September 2024,
Ralf-Andreas Gmelin
A. Einem Menschen auf der Spur
Großvater ist mir von klein auf bekannt. Meine Großmutter, „Oma“ Martha, oder mein Vater Günter erzählten manchmal von ihm und von „früher“, aber es war, als wäre diese vergangene Welt von Hans Gmelin hinter einer Scheibe von grauem Mattglas verborgen. 1945 markierte in unserer Giessener Familie eine saubere Trennung der Geschichten davor und danach. Zu uns, zu unserem wirklichen Leben in der sechsköpfigen Familie mit drei Kindern samt Großmutter Martha, gehörte allein die Zeit danach. Was zuvor geschehen war, war nicht tabuisiert, aber es war wie das Märchen vom Dattelmütterchen, mit dem unsere Oma uns Kinder begeistert hat: Die Geschichten waren packend und spannend, aber sie gehörten nicht zu unserer Welt, zu unserer Nachkriegswirklichkeit. Aus der Zeit von vor unserer persönlichen Zeitrechnung ragten noch einige Kriegsruinen in der Gießener Innenstadt hervor, vor allem schräg gegenüber unserem Haus am Nahrungsberg, die Ruine des Stadthauses an Steins Garten, die wir Kinder gern erforscht hätten. Allerdings haben wir uns dem Verbot der Eltern gefügt, bis 1968 ein Hotelneubau unsere Neugier beendete. Da Hans Gmelin bereits 1941 gestorben ist, gehörte er zu dieser grauen fernen Welt, die es einmal gegeben hatte.
Diese Lebensbeschreibung will uns in die Welt dieses Hans Gmelin versetzen oder genauer: Sie soll uns helfen, uns sein Leben und seine Gedankenwelt vorzustellen und uns seine Zeit und Erinnerungen vermitteln. Die „Narrative“, Geschichtchen oder Sprachregelungen, in denen uns diese alte Zeit vermittelt wurde, werden dabei neu ausgeleuchtet und verlieren ihre zeitlose Gültigkeit, angesichts einer präziseren Schilderung dieser Zeit.
Ich glaube nicht, dass man einlinig einen Menschen als Produkt seiner Kindheit begreifen kann, weil allein die Kindheit alles prägen würde, was ihn später ausmachen wird. Aber wer das Leben eines Menschen nachzeichnet, der sucht nach biographischen Strängen, die einer gewissen Stringenz folgen. Wir werden solche Stränge entdecken, auch im Bewusstsein, dass sie spekulativ sind und uns die Welt von Hans Gmelin in der Rückschau vielleicht eher verzerren als erhellen.
Als Enkel schreibe ich über meinen Großvater, mein Interesse hat auch mit der Verwandtschaft zu tun. Was macht für Leserinnen und Leser dieses Leben von Hans Gmelin interessant? Er ist kein glänzender Held, der sich einsam dem Dritten Reich entgegengestellt hätte, weil er wusste, dass der NS-Staat für Deutschland eine Katastrophe bedeutete. Er war kein typischer Mitläufer, der für ein paar Sprossen auf der Karriereleiter fünfe hätte gerade sein lassen, oder Freunde oder Kollegen ans Messer geliefert hätte. Und schließlich ist er kein Gleichgültiger, dem egal gewesen wäre, wer immer Deutschland regiert oder was aus ihm wird. Schließlich und vor allem verstand er sich als Staatsrechtler und Politiker, aber auch als verantwortlicher Ehemann und Vater von zwei Söhnen, Hochschullehrer einer im Dritten Reich prekären Disziplin und Gegner des Nazi-Regimes, der allerdings zur offenen Gegnerschaft nicht bereit war. Hans Gmelin1 war ein politisch handelnder Mensch, der indessen wenig Einfluss gewann: Er wurde kein erfolgreicher Lenker unseres Landes in der Weimarer Zeit. Allerdings: Er gehörte 1919 zu den Vordenkern bei der Entwicklung eines demokratischen Deutschland als Mensch, als Jurist und als Spezialist für vergleichendes Verfassungsrecht. Er verlor im Zuge der „Daily-Telegraph Affäre“ im Oktober 1908 sein Vertrauen in die Monarchie, als sich zeigte, dass sich das unbedachte Gerede einer einzigen kaiserlichen Person zu einer außenpolitischen Katastrophe auswachsen konnte. Dem Juristen lieferte die Republik ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Rechtssicherheit. Hans Gmelinkann als ein typischer Mensch des 19. Jahrhunderts gelten, insofern er die bürgerliche Idee als Schlussstein eines Kulturgewölbes begreift, das von ästhetischer Bildung, aktiver Kunstkompetenz und kommunikativer Neugier für alle Welt zusammengehalten wird. –
Dabei ist nicht zu übersehen, dass sich in Folge der napoleonischen Kriege zu Beginn seines Geburtsjahrhunderts das völkische Denken zum Fundament dieser Generationen entwickelte hatte. Überall in der Welt hat diese nationale Orientierung die demokratischen Entwicklungen hervorgebracht und gefördert, in Deutschland jedoch versandete das liberale Denken in der Spaltung zwischen Nationalliberalen und Liberaldemokraten und wurde politisch zahnlos. Hans Gmelin folgte der gemäßigt nationalliberalen Richtung, weil er sich zu den politischen Freunden Bismarcks gezählt hatte. Das war in seiner badischen Frühzeit ohne große Bedeutung. Nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs, 1918, hätten indessen die Liberalen über ihren Schatten springen und eine gemeinsame Sammelpartei gründen müssen.
Die „Deutsche Demokratische Partei“ war ein solcher Versuch mit zahlreichen gebildeten Mitgliedern, in deren Reihen ich mir Hans Gmelin gut hätte vorstellen können. Doch ihm war die DDP zu radikal gerade in ihrem Urteil über die Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg und bei der Benennung von Verantwortlichen auch „zu demokratisch“ und er schloss sich der DVP an, der etwas nationaler liberalen „Deutschen Volkspartei“. Diese begann zwar mit dem Schielen nach der Monarchie, war aber zunächst ein verlässlicher Koalitionspartner von Koalitionsregierungen, die sich um die Aufrechterhaltung einer politischen Ordnung in der ersten deutschen Demokratie gekümmert haben. Sie war häufiger an Weimarer Reichsregierungen beteiligt als die SPD.2 All das hatte für Gmelin persönlich keine großen Folgen, die manifeste liberale Spaltung bedeutete indessen für Deutschland, dass die Liberalen verzwergten, während zuerst Sozialdemokraten und das Zentrum das Spiel machten, bevor sie von Kommunisten und Nationalsozialisten eingekesselt und von den letzteren de facto gleichgeschaltet wurden.
Nichts wie weg von Karlsruhe
Hans Gmelin, der spätere Professor für öffentliches Recht an der kleinen hessen-darmstädtischen Landesuniversität Ludoviciana in Gießen war keineswegs ein etwas zurückgebliebener Monarchist. Als solcher erschien er viel später seinem Sohn Günter, der seinen Vater als Siebzehnjähriger verloren hatte und dessen Positionen nur schwer einschätzen konnte. Hans Gmelin hat unter dem Eindruck des Meinungsterrors im „Dritten Reich“ wohl viele persönliche Einschätzungen nicht an seine Söhne weitergegeben, zumal bereits sein Versuch, sie der Hitlerjugend vorzuenthalten, dazu geführt hatte, dass die Schuldirektoren diese ihrer Schulen verweisen wollte. Meine spätere Deutschlehrerin, Ursula Koch, Tochter des Ethnologen und Forschungsreisenden Theodor Koch-Grünberg (1872-1924 – sie wurde geboren, als ihr Vater bereits tot war), erinnerte sich daran, dass sie und mein Onkel allein auf dem Pausenhof zurückblieben, während der Rest der Schule HJ-Unterricht bekam.
Als Staatsrechtslehrer wird Hans Gmelin bereits 1933 aus erster Hand mitbekommen, wie grundlegend und schnell der nationalsozialistische Staat das Recht und seine Rechtsgelehrten korrumpieren würde und für seine Machtspiele benutzte unter Kaltstellung des Rechtsstaates. Die Willkür als Ausdrucksmittel des überwunden geglaubten Feudalismus kehrt als „Führerprinzip“ ins öffentliche Leben zurück. Seine Söhne Ulrich und Günter haben von den Sorgen ihres Vaters nicht alles mitbekommen. Nach dem Tod des Vaters machte Günter sein Abitur und wurde kurze Zeit später zur Deutschen Wehrmacht eingezogen, um in einem mörderischen Krieg zu kämpfen. Welche Einstellung er damals persönlich dazu hatte, bleibt im Dunkeln.
Nach diesem Krieg wurden die politischen Verhältnisse grundlegend andere, als die, in denen Hans Gmelin gewirkt hatte. Sinnlos musste der Krieg jedem erscheinen, der nicht die Ideale eines nationalsozialistischen Großdeutschland teilte. Das Leben von Hans Gmelin endet 1941 während des „Dritten Reiches“ kurz nach Beginn des Krieges, der ja zunächst große militärische Erfolge zeigte. Die bizarr umfangreiche Autobiographie von Hans Gmelin enthält auch eine sorgfältige Analyse der nationalsozialistischen Staatsidee, die er als Ergebnis einer nationalen Revolution betrachtet, in genauer Parallele zur deutschen Räte - Revolution 1919, gegen die er mit allen Mitteln den Rechtsstaat zu entwickeln hilft, nach dem Grundsatz „Demokratische Rechtsordnung gegen willkürliche Arbeiter- und Bauernräte.“ Darin fuhrt er auch folgerichtig die Verfassungsgeschichte des 19. Jahrhunderts fort, die in erster Linie darauf zielte, die Willkürherrschaft der Monarchen in ein berechenbares Rechtssystem zu überführen.
Hans Gmelin hat mit seinem ausführlichen Manuskript ein detailreiches Kaleidoskop von Erinnerungen und Meinungen hinterlassen, die als mentalitätsgeschichtliches Werk durchaus nicht langweilig ist. – Er schreibt am Ende, dass diese gewaltige Menge ordentlich handgeschriebener Manuskriptseiten weniger für einen bestimmten Leser geschrieben worden sei, sondern als Ausgleich für die Zeit, die er vordem darauf verwendet habe, die literarische Produktion von juristischen Fachveröffentlichungen zu erstellen. Seit 1933 die Meinungsfreiheit zerstört wurde, wird er keinen Satz mehr veröffentlichen. Dennoch: Er hat seine Autobiographie offenbar mehrfach redigiert und überarbeitet, vielleicht in der vagen Hoffnung, dass einmal die Zeit käme, in der seine Söhne die Gedanken ihres Vaters veröffentlichen könnten. Der ältere Sohn, Ulrich, Geburtsjahrgang 1921, starb wenige Jahre nach seinem Vater als Sanitätssoldat und der jüngere Sohn, Günter, Jahrgang 1923, hätte die Arbeit mit diesen Gedanken gern einem Dritten überlassen. Der Zustand der Tausende von Blättern war indessen so von Unordnung, Entnahmen und Chaos entstellt, dass auch der Enkel sich immer wieder gut zureden musste, um an der Decodierung des Manuskripts weiter zu arbeiten. Mit Unterstützung der beiden Archivare im Universitätsarchiv Gießen, fand ich den gewaltigen Fundus von zusätzlichen Blättern, die mir mehr aus dem Leben meiner Großeltern erzählten, als ich Erinnerungen an mein eigenes Leben habe. Der Grund für diesen Detailreichtum liegt wohl im frühen Tod von Hans‘ Vater: Moriz hatte seinem Sohn kaum Erinnerungen an den lebenden Vater mitgeben können, aber einige Schriften, die durchweg historische Untersuchungen und Reiseberichte enthielten. Damit hat er zwei der vier Lebensthemen von Hans festgelegt: Geschichte und Reiselust. Die anderen beiden Themen sind die Juristerei und schließlich die Nähe zu seiner Mutter, die während seiner Kinderzeit auch noch den Tod der Tochter erleben musste und schließlich die Pflege ihres dementen Vaters, bevor dieser in eine „Irrenanstalt“ eingewiesen werden konnte.
Das überschattete die Kindheit von Hans, schmiedete ihn lebenslang eng mit seiner Mutter zusammen. Wenn sie nicht gerade unter einem Dach lebten, schrieb der Sohn seiner Mutter mindestens einmal pro Woche alles, was er erlebt hatte – das Geheimnis seines brillanten Gedächtnisses. Darum hat dieses gewaltige Manuskript überall dort dunkle Flecken, wo Johanna bei ihrem Sohn Hans lebte, entweder noch in der gemeinsamen Wohnung in Freiburg, oder im Günterstaler Haus oder in Gießen zunächst in der Wiesenstraße und dann im Haus des Sohnes, am Nahrungsberg.
Dem Hinweis von Rolf Eilers, Freiburg, habe ich den Hinweis zu verdanken, dass Hans Gmelin im Mitteilungsblatt des Familienverbandes Gmelin im Jahre 1938 eine Autobiographie verfasst hat, die eine weitere wertvolle Quelle bedeutet:
„Ich bin geboren am 13. August 1878 in Karlsruhe in Baden als Sohn von Archivrat Dr. Moriz Gmelin und Johanna Gmelin, geborene Gmelin. Da ich meinen Vater so frühe verlor, lag meine Erziehung in den Händen meiner Mutter. Ich wuchs in Karlsruhe im Hause ihrer Eltern auf, besuchte zunächst die zum Lehrerseminar gehörige Vorschule und dann das humanistische Gymnasium, So sehr sich meine Mutter bemühte, unsere Kindheit schön zu gestalten, so habe ich doch eine etwas freudlose Jugend durchlebt, einerseits weil meine begabte Schwester Elise, die Gefährtin meiner Kindertage, am 7. August 1894 durch Diphterie hinweggerafft wurde, andererseits, weil meine Mutter durch meinen Großvater, mit dem wir seit dem Tode meiner Großmutter 1890 zusammenlebten, sehr in Anspruch genommen wurde; dazu kam, daß ich selbst durch schwere Erkrankung (Blinddarmentzündung) sowohl in der Schule wie in jugendlichem Lebensgenuß behindert wurde, und daß ich einen Widerwillen gegen das nüchterne und gebirgiger Umgebung entbehrende Karlsruhe empfand. Ich lebte eigentlich erst auf, als ich nach Erlangung des Reifezeugnisses im Jahre 1897 an verschiedenen Universitäten: Tübingen, Heidelberg, München, Berlin, Bonn und Freiburg studierte. Überall verweilte ich nur ein Semester, nur in München und in Freiburg, wohin meine Mutter mit mir im Oktober 1900 übersiedelte, je zwei Semester.“
Hans Gmelin in der Zeit der Abfassung des zugrundliegenden Manuskripts. Das Bild von einer Kaffee-Gesellschaft zeigt ihn schon mit Spuren des Leids. Es ist 1939 entstanden und ist das letzte Bild, das von ihm überliefert ist.
Ein Manuskript aus der Zeit von 1934 bis 1940 und seine Rätsel
Als Hans Gmelin 1941 stirbt, erlebt Deutschland ein erfolgreiches nationalsozialistisches Regime zu Beginn des zweiten Weltkriegs. Er selbst ist ein Patriot alter Schule, orientiert an den dynastischen Epochen der europäischen Vergangenheit, seit jungen Jahren begeistert er sich für Geschichte, wirkt aktiv in nationalliberalen Verbänden und Parteien mit. Hans Gmelin erlebt Nationalsozialisten als Angriff auf sein bildungsorientiertes Lebensprogramm: Leute, die sich uniformiert auf den Straßen prügeln3 4, haben sein Vaterland usurpiert und alle Lebensbereiche mit dem Schlamm ihrer braunen Politik überzogen. Braun ist der Hintergrund von Rembrandtgemälden. Die werthaltigen Hauptsachen haben sich in leuchtenden Farben davor abzuspielen. Indessen: Der braune Schlamm wälzt sich eilig über Deutschland und dann im Zweiten Weltkrieg mit den ungeheuren Erfolgen des „Blitzkrieges“ über die deutschen Grenzen. Die militärischen Erfolge werden im deutschen Volk begrüßt. Dessen ungeachtet wächst zugleich der Fremdenhass, der Judenhass, die Propaganda gegen „Feindvölker“: Hans hatte bis zum Ersten Weltkrieg zahlreiche Freunde im Ausland, die nun wieder als öffentliche Feindbilder dienen. Die Propaganda engstirniger Ideologen, die Tyrannei der Mediokren und der Terror der Ungebildeten verletzen seinen Patriotismus. Die, die gegen den nationalsozialistischen Machtapparat anrennen gehen unter, ihnen wird ihre wirtschaftliche Lebensgrundlage entzogen, oft weitaus mehr. Davor fürchtet sich Hans Gmelin. Sein Studienfreund, Otto Moerike (1880-1965), Großneffe des schwäbischen Dichters Eduard,4 hatte Karriere in der Kommunalverwaltung gemacht und war zum Oberbürgermeister von Konstanz aufgestiegen. 1933, „nach der nationalen Revolution wurde er auf schmale Pension gesetzt.“5
Die parteipolitischen Ambitionen Gmelins endeten bereits 1919. Er gründet seine Familie in der kleinen Universitätsstadt Gießen. Zu seiner Vorstellung von Bildung gehörten weiterhin Reisen. Sie dienen der Begegnung mit fremden Menschen und Kulturen, der Einübung fremder Sprachen und – wo möglich – auch der Klärung juristischer Fachfragen, für die es dann im Dritten Reich bei dessen treudeutscher Nabelschauperspektive kaum noch ein Interesse geben wird.6 Er wird keinen Widerstand gegen die Nationalsozialisten leisten. Aber er erlebt unter ihnen den zweiten Untergang seiner Welt, die bereits nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr die Alte bleiben durfte, als die sozialistische Revolution alles in Frage stellte. Die Weimarer Republik hatte allerdings ein Mehr an Rechtssicherheit und juristischer Kultur gebracht, das das zivilisatorische Niveau des wilhelminischen Deutschland überstiegen hatte. Die Verfassungen des Weimarer Staates und seiner Länder von 1919 hatten sich an den Traditionen der anderen Demokratien in der Welt orientiert und nahmen Anteil an der verfassungsgeschichtlichen Entwicklung vieler Länder der Erde. Der Politikwissenschaftler Manfred Friedrich ist überzeugt, dass die Weimarer Verfassung in der kurzen Zeit ihres Bestehens auf die wissenschaftliche Arbeit „beispiellos befruchtend gewirkt“ hat.7
Da und dort eine ironische Bemerkung, offene Gespräche im kleinen privaten Kreis – entgegen der Angst seiner Ehefrau Martha8. Sie wird Politik auch noch nach dem Krieg als ein „schmutziges Geschäft“ bezeichnen und vielleicht fürchtet sie sich auch besonders, weil sie einen Schweizer Paß hatte, obwohl sie ein Leben lang in Deutschland gelebt hat. Hans sorgt dafür, dass die amerikanische Gesamtausgabe der Werke Heinrich Heines – die unzensierte – im Bücherschrank sichtbar bleibt, der in seinem Haus in einem Raum steht, der von Besuchern und Studierenden betreten wird. Die schwarzen Heinebändchen wurden 1941 unmittelbar nach dem Tod von Hans Gmelin von Witwe Martha auf den Dachboden verbannt, von wo sie erst dessen Enkel, der Verfasser dieser Zeilen, wieder herunterholte. Zu Lebzeiten war Hans Gmelin nicht bereit, auch nur ein Buch aus dem Blickfeld seiner Besucher zu entfernen.
Die juristische Fakultät Gießens diente in besseren Zeiten u. a. der Ausbildung von Beamten, die in Hessen-Darmstadt ihre Anstellung suchen würden. Als Hessen und seine Verfassung 1933 aufgehoben wird, konnten Studenten auch jede andere Universität besuchen. Die Gießener hatten das Nachsehen. Professoren, die noch vom Großherzog ihre Bestallung erfahren hatten, konnten im NS-Staat nur Misstrauen wecken, zumal, wenn sie Staatsrecht lehrten und sich ein Leben lang mit der Staatsrechtslehre anderer Völker befasst haben. Hans setzte der nationalsozialistischen Blut- und Bodeneinfalt kosmopolitische Sprach- und Kulturkenntnisse entgegen, für die diese keinerlei Sinn hatte. Er tritt für Rechtssicherheit durch verfasste Gesetze ein, die NS-Politik will Gesetze außer Kraft setzen, um der Willkür ihrer Usurpatoren Platz zu verschaffen. Was hätte Hans Gmelin zu dem protzigen Statement des Ministers ohne Geschäftsbereich, Hermann Göring gesagt; „Meine Maßnahmen werden nicht angekränkelt sein durch irgendwelche juristische Bedenken. Meine Maßnahmen werden nicht angekränkelt sein durch irgendeine Bürokratie. Hier habe ich keine Gerechtigkeit zu üben, hier habe ich nur zu vernichten und auszurotten, weiter nichts!“9 – Rechtliches Denken gerät unter die Stiefel des NS-Regimes. Und dennoch: Unter vielen Kollegen an den Universitäten machte sich Liebedienerei gegenüber dem NS-Regime breit.
Wie sehr – und wie schnell - die Rechtswissenschaft gerade im Hinblick auf das Staatsrecht bereits 1933 im nationalsozialistischen Sinne ausgehebelt wird, schockiert auch heute noch. Dass Juristen sich gegenseitig auszustechen versuchten, eine beherrschende Stellung nach der völkischen Revolution einzunehmen, war vielleicht für die anderen ein Glück, die sich vorsichtig in neutralen Nischen versteckt hielten. Auch Hans Gmelin verbarg sich in einer solchen Nische. Die Prüfungsbedingungen des Faches Rechtswissenschaft wurden bereits 1933 von den Nationalsozialisten diktiert. Hochschullehrer hatten kaum noch persönlichen Einfluss auf die fachliche Tendenz ihrer Lehre. Die Examina wurden nicht – wie früher in Gießen – von den angehörigen Professoren der Rechtsfakultät abgenommen, sondern schließlich in der Hauptstadt Darmstadt von Rechtspraktikern, unter denen sich rasch viele Anhänger des NS-Staats fanden. Eine gute Zeit hat Hans nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten 1933 nicht mehr gehabt, weder politisch noch gesundheitlich noch wirtschaftlich. Er spricht von der Zeit seines persönlichen „Abstiegs“10.
Auch wenn von ihm ein umfangreicheres systematisches Werk fehlt: Hans Gmelin erarbeitete neben einem großen Lehrdeputat in seinem Fach eine große Zahl von Veröffentlichungen, die im Anhang durch eine Bibliographie dokumentiert ist. Viele Aufsätze undankbarer Thematik, weil sie zeitraubender Vorbereitung und Recherche bedurften und nur wenige interessierte Leser finden würden.
Hans hat Erinnerungen zurückbekommen, die weitgehend aus seiner eigenen Hand stammten: Briefe und Karten, die er seiner Mutter Johanna geschrieben hatte. Sie war 1934 gestorben und die sorgsam gesammelten Zeugnisse seines eigenen Lebens waren wieder zu Hans zurückgekehrt. Zum anderen verfügte er auch über Photographien, Bleistiftskizzen und kleinformatige Ölgemälde, die er selbst aufbewahrt hatte. Hans Gmelin fragt nicht danach, was für einen späteren Leser von Interesse sein könnte, sondern wertet sie aus, weil nach ihm niemand mehr mit diesen Zeugnissen seines Lebens etwas anfangen wird.
Zum anderen wird der Historiker Hans Gmelin gewusst haben, dass zur Zeit Heines alle Werke über 20 Papierbögen von der Zensur frei blieben. Auch wenn der Nationalsozialismus mit seiner Reichsschrifttumskammer organisatorisch andere Wege ging, war nicht unwahrscheinlich, dass ein Werk mit tausenden von Seiten weniger gründlich auf seine Linientreue hin überprüft würde. Vielleicht rechnete er insgeheim doch damit, dass dieses umfangreiche Manuskript eines Tages einmal gedruckt werden könnte, ohne Lebensgefahr für den, der es in Auftrag gibt. Obwohl das Manuskript der drei Quellenbände noch ziemlich umfangreich ist, zeigen zahlreiche Textabrisse und fehlende Anschlüsse, dass es ursprünglich noch detaillierter - und umfangreicher – gewesen ist.
Das Manuskript enthält Stellen, bei denen Gmelin den damals modischen Ton des „Stürmers“ mit seinen nationalsozialistischen Sprachregelungen verwendet.11 Während dem Enkel der Schweiß auf die Stirn trat, zeigte aber die Weiterarbeit, dass er trotz seines Bekenntnisses zur Rassenlehre ambivalent bleibt. Liest man da und dort bei Hans Gmelin judenfeindliche Bemerkungen, so rühmt er im Fortgang die Warmherzigkeit und menschliche Qualität eines Juden und bekennt sich zur Freundschaft mit ihm. Wo keine nähere Bekanntschaft vorliegt, kann er indessen auch eine rassenästhetische Antipathie zum Ausdruck bringen, die mit nichts zu retten ist: Im Seebad Zopot mokiert er sich über „Judentypen“, die ihm ein ästhetisches Problem sind12. Hier hat seine Invektive Stürmerniveau.
Ein anderes Charakteristikum für die Niederschrift seines umfangreichen Werkes ist Eile. Als habe Hans Gmelin geahnt, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Trotz der vielen Korrekturen und einer nachträglich eingebauten Gliederung fehlen häufig Worte, sind Sätze nicht komplett oder werden unpassende Formulierungen nicht korrigiert. Warum eine Seitenzählung fehlt, bleibt ein Rätsel. – Bei der Wortwahl ist für Gmelin z.B. „Ausländer“ kein herabsetzender Begriff, sondern der sachliche Ausdruck für jemanden, der sein Vaterland woanders hat. Er bezeichnet sich in Italien ganz selbstverständlich als Ausländer und Angehörige anderer Nationen in Deutschland ebenso. Allerdings: Er geht auf solche Leute zu und macht sie zu Trainingspartnern bei seinem Sprachenstudium, was häufig zu Freundschaften mit ihnen führt. In den Quellenbänden haben wir weitgehend die Rechtschreibung von Hans Gmelin beibehalten, damit den Lesenden klar ist, dass sie einen Text aus den Jahren kurz vor dem Zweiten Weltkriegs lesen. Es war eine Zeit, die andere Sprachregelungen kannte, als die Jetztzeit, 2024, in der politische Korrektheiten die Grenze zwischen Sprache und Wirklichkeit aufzuheben drohen. Den Sprachzwängen der heutigen Kommunikationsgesellschaft konnte – und musste – sich Gmelin noch nicht unterziehen, mit den Sprachregelungen seiner Zeit hat er sich auseinandergesetzt und ist ihnen manchmal unterlegen.
Viele wichtige Romane über die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg entstehen erst nach 1918 und schildern eine Welt, die nicht mehr existiert. Wir wissen, dass Gmelin unter vielen anderen auch Manns Zauberberg oder die Buddenbrocks kannte. Und ein wenig versetzt uns die Prosa aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg über sein Leben in eine solche Lage, wie sie diese und viele andere Romane schildern. Noch einmal wird die untergegangene Welt Deutschlands und Europas vor dem Ersten Weltkrieg lebendig, noch einmal vollzieht Hans Gmelin in der Erinnerung die Höhepunkte seiner ästhetischen Erziehung, die sich um Kunstgeschichte, Malerei und Musik gedreht hat, auch wenn wir wissen, dass diese Welt ab 1933 so nicht mehr existiert hat.
Wenn wir Hans Gmelin bei seinen Aussichten und Begegnungen betrachten, dann merken wir da und dort seinen Kampf um sein eigenes Urteil: Immer wieder spüren wir seine harsche Bewertung von fremden Sitten und Gebräuchen, die auf denselben Ethnozentrismus schließen lassen, der dem Nationalsozialisten eigen ist. Aber dann wieder wird sich Gmelin dessen bewusst und er lässt erkennen, dass er diese Haltung zu überwinden sucht: „Insbesondere setzten sich die beiden Damen wacker zur Wehr, wenn ich gelegentlich ohne verletzende Absicht in der Selbstgefälligkeit des deutschen Kulturdünkels als in manchem Bereich zurückgebliebene Spanien etwas zu stramm beurteilte.“13 Das bekennt er von einem Gespräch in der Schweiz mit spanischstämmigen Frauen, mit denen er seine Spanienreise besprochen hatte. Zu solcher Selbstreflexion wird es der Nazi-Spuk nicht bringen!
Diese Geschichte Gmelins möchte ein Bild gewinnen von diesem Menschen, der in Seiner jugendzeit unter familiären Verwerfungen gelitten hat, der sich für die politische Gestaltung seines Vaterlandes einsetzte, dem es zunächst gelang, bei der Sicherung der demokratischen Ordnung in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg aktiv mitzuwirken, dem dann der Glaube an seine politische Mission 1933 geraubt wurde und sich als Ehemann und Familienvater in die Verantwortung hat rufen lassen.
Wie schonend geht der Enkel mit seinem Großvater um? Wie schon angedeutet, stünde der Enkel gern parteiisch auf der Seite seines Großvaters, aber ich hielte es für unredlich, ein anderes Bild von ihm zu zeichnen als das, was er von sich selbst wiedergibt. Mit großer Sicherheit hätte aber auch Hans Gmelin vor der Drucklegung in der Nachkriegszeit vieles verändert – wenn er diese erlebt hätte. Auch Ernst Jünger hat seine „Tagebücher“ entsprechend dem Zeitgeist angepasst... Dennoch: Die Herausgabe eines solchen Werkes wäre unsinnig, wenn ich geschönte „Narrative“ stricken würde. So wurden in den Quellenbänden auch die peinlichen Stellen beibehalten.
Da ich 17 Jahre nach dem Todestag meines Großvaters geboren wurde, gibt es keine sentimentale Nähe, die der Wahrheit gefährlich werden könnte. Da ich mich in zwei umfangreichen Arbeiten mit Personen aus der völkischen Epoche befasst habe, halte ich mich für gewappnet, mit dem Leben meines Großvaters auf die letzte Reise zu gehen, die ich mit ihm nach drei Jahren im September 2024 mit diesem Buch beende.
1 Wer Hans Gmelin nachschlägt, wird unweigerlich einem Hans Gmelin (1911 bis 1991) begegnen, der ebenfalls Jurist war, später SA und NSDAP-Mitglied wurde und an den Judendeportationen aus der Slowakei verantwortlich mitgewirkt hat. Mit diesem späteren Oberbürgermeister von Tübingen (1954 - 1975) hat der Hans Gmelin in dieser Arbeit nur den Namen gemein.
2 Vgl. Weimarer Koalition", Wikipedia, 6.1.2024.
3 Aus mündlich mitgeteilten Erinnerungen des Sohnes Günter.
4 Eduard Mörike, * 1804 in Ludwigsburg, † 1875 in Stuttgart.
5 1/ 102.
5 „Schon die Heranziehung fremdsprachiger oder gar jüdischer Autoren mochte auf einen unpassenden ,Relativismus', auf Pazifismus oder sonstwie ,undeutsches Denken' hindeuten. Mit diesem abschüssigen Gelände bewegten sich nun die völkerrechtlichen Autoren und die Institutionen." Michael Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Beck, München, 1999, Bd. Ill, 384.
7 Manfred Friedrich: Geschichte der deutschen Staatsrechtswissenschaft. Schriften zur Verfassungsgeschichte, Bd. 50. Duncker & Humblodt, Berlin, 1997, 320.
8 Hans nennt seine Frau in seinen Erinnerungen durchweg „Marthel", eine Namensversion, die die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nicht überstanden hat. So nannte sie niemand mehr.
9 Rede in Essen am 3. März 1933. Zitiert nach Jähner, Höhenrausch, a.a.O., 460.
10 3/877.
11 1/25 im Quellenband bezeichnet er den Chemiker Emil Fromm als kleines, etwas vorlautes Jüdchen. 1/26 jedoch: „Auch mit den Fromms freundeten wir uns an."
12 3/706: ... „erschraken nicht wenig ob der den Ort bevölkernden, recht polnisch anmutenden Judentypen mit enormen Nasen, assyrischen Bärten, Plattfüßen und Säbelbeinen."
13 1/258.
B. Die Biographie – chronologisch
I. Die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg 1878 bis 1913
Kindheit und Jugend – eine Spurensuche
In Hans ‘Selbstzeugnissen fehlen die Erinnerungen und Entscheidungen aus Kindheit, Jugend und Studium. Obige Autobiographie in dem Mitteilungsblatt des frisch gegründeten Familienverbands bezeichnet seine Kindheit als „freudlos“. Sein Sohn Günter hat dafür dessen Mutter Johanna verantwortlich gemacht, was allerdings im Kontrast steht zu der großen Nähe, mit der Hans seiner Mutter begegnet, vor allem in den Freiburger Tagen nach dem Tode des Großvaters, die zugleich auch die Befreiung der Mutter von der intensiven Fürsorge für ihren tyrannischen Vater und auch vom ungeliebten Karlsruhe bedeutet haben. Hans selber räumt seiner Mutter ein, dass sie sich sehr bemüht habe, die Kinderzeit schön zu gestalten. - Günter war 1934 elf Jahre alt, als er seine Großmutter verliert. Er hatte sie in- nicht allzu guter - kleinkindlicher Erinnerung, weil sie schon eine sehr betagte alte Dame war, obwohl er bei den Krankheiten seiner Mutter und den Reisen seiner Eltern viele Wochen und Monate bei seiner Großmutter gelebt hat. Von seinen Großeltern mütterlicherseits, die öfters im Sommer in Brombach bei Lörrach besucht wurden und ebenfalls die beiden Söhne öfter als Hausgäste betreuten, war in unserer späteren Familie fast nie die Rede. Obwohl das Leben im großbürgerlichen Haushalt des mütterlichen Groß-vaters Sicherheit und Wohlstand bot, war der Zustand des Großvaters etwa ab 1890 – und damit vor allem nach dem Tod von dessen Ehefrau Elisabeth problematisch. Johanna musste ihn zunehmend pflegen und wurde mit einer sich steigernden aggressiven Verwirrung konfrontiert. Ein großer Verlust für ihre beiden Kinder. Die progressive Senilität des Vaters verlangte von der Tochter sehr viel Aufmerksamkeit, die ihren Kindern abging. 1894 musste Hans das Leiden und Sterben seiner Schwester Elisabeth Luise (1879-1894) an der Diphterie (Croup) erleben. Zwar war dieses Jahrzehnt ein Durchbruch für die Impfung und Behandlung dieses „Würgeengels der Kinder“, aber für Elisabeth kamen diese Forschungsergebnisse zu spät.
Hans Gmelin, 1878-1941
Die gesundheitlichen Einschränkungen, denen Hans Gmelin selbst als Kind unterworfen war, bezeichnet er als Blinddarmentzündung. Erst nach 1910 wird die chirurgische Entfernung des Wurmfortsatzes zur medizinischen Regelleistung. Noch 1925 wird Reichspräsident Friedrich Ebert an einer Blinddarmentzündung sterben, weil er sich wegen eines Prozesses nicht rechtzeitig operieren ließ.14 Da Gmelin später, 1905, auf Reisen bei einer Erkrankung damit rechnet, dass es wiederum der Blinddarm sei,15 hat man auch seinen Appendix offenbar nicht herausgenommen. In einem Brief an seinen Großonkel, Adolf Mayer, schreibt er, dass der Zustand seines Herzens und Gefäßsystems nie in besonders gutem Zustand gewesen sei.16 Auch sein Abiturzeugnis, das ihm das Großherzogliche Gymnasium zu Karlsruhe am 14. Juli 1897 ausfertigt, bescheinigt ihm „ziemlich gute Leistungen“, aber unter „Besondere Bemerkungen“: „Er war ... viel leidend.“ Im gleichen Dokument erfahren wir zudem, dass sein Plan zu dieser Zeit war, Geschichte zu studieren. In diesem Fach hatte er auch die beste Note, ein „sehr gut“ in einem sonstigen Dreierzeugnis.
Das älteste Zeugnis, das Hans Gmelin aufgehoben hat, ist anderer Natur: Am 7. September 1888 hat er als Zehnjähriger in der Schwimmschule der Garnison Karlsruhe die „große Probe im Schwimmen“ abgelegt und dafür eine schmucke Urkunde erlangt. Wandern und Schwimmen wird sein Leben in jungen Jahren zur körperlichen Ertüchtigung begleiten. Bei den vielen Reisen, die er zunächst ohne und später mit seiner Familie unternehmen wird, wird ihm das zugutekommen.
Schwimmzeugnis 1888
Mit einem letzten Blick auf sein „Abiturienten-Zeugnis“ kommen wir zum Ende dieses Kapitels. Vielleicht ist es keine übertriebene Interpretation, wenn wir sagen, dass Hans Gmelin damit eine wenig geliebte Kindheit mit einem durchschnittlichen Zeugnis abschließt, auf das ihm als Gesamtzensur eine „III ziemlich gut“ erteilt wird. Erst danach wird er sich finden, wird moderne Sprachen erlernen und sich, sein Fach und seine Orientierung suchen. Im Abitur wurden Französisch-, aber keine Englischkenntnisse nachgewiesen, dafür aber Latein und Griechisch.
In Religion hatte er „im Ganzen gut“, seine besten Fächer waren, wie gesagt: Geschichte und Geographie, „sehr gut“. Gefolgt von der „Philosophischen Propädeutik“ mit „gut“. Dieses Zeugnis vom 14. Juli 1897 gewährt uns einen kleinen Eindruck von den Neigungen des jungen Hans Gmelin.
Werfen wir noch einen Blick in die von Hans aufgehobene Abiturzeitung „Miles“, die mit einem Gedicht beginnt, dessen Autor namentlich nicht gekennzeichnet ist, aber von ihm selbst stammen könnte:
Das Abiturzeugnis von 1897
In einem Traum sah in jüngster Nacht
Bergan ich mich auf sanftem Pfade schreiten.
Früh morgens war’s , vor Sonnenaufgang noch,
Vom unbekannten Weg ließ ich mich leiten.
Im grauen Nebelschleier lag die Welt,
In Dämmrungschatten undeutlich verzogen.
Kalt weht’s mich an, es nahte sich der Tag,
Im Osten rötet sich der Himmelsbogen.
Und plötzlich find ich mich auf freiem Platz,
Im Zauberglanze steigt empor die Sonne;
Die Nebel weichen ihrem Purpurschein,
Enthüllet lag vor mir ein Land der Wonne.
Ich stand und schaut! Ein Paradies erschien
Der Weg, den in der Dämmrung ich genommen.
Doch minder schön nicht war der weite Pfad,
Als der, den eben ich war hochgekommen.
Zwar steiler war er, wand sich durch Gestrüpp,
doch dehnt er sich vor mir in goldnem Strahle.
Drum auf zur Höhe, auf zur Sonne! Statt
Dort unten nur zu schleichen in dem Thale. -
Und heut auch fühl ich, wie auf jenem Platz,
Da ich’s Gymnasium verlassen habe:
Ein Stück der sonndurchglänzten Jugendzeit
Liegt hinter mir, auf ewig in dem Grabe.
Doch nur in Dämmrung wandelten wir hier,
Die Welt wir sahen nur durch trübe Brillen,
Der Freiheit Sonne steigt am Himmelsdom,
Mit Glanz den Lebensweg uns zu erfüllen.
Drum auf, und wenn auch rauher wird der Pfad,
Muthig voran und laßt’s Euch nicht verdrießen.
Nur, wer da ausharrt, wird den Gipfel schaun
Und von den Höh’n die Aussicht voll genießen.
Die letzte Seite der Abiturzeitung „Miles“ des Großherzoglichen Gymnasiums Karlsruhe, 1897.
Das Studium
„Während der ersten Semester beschäftigte ich mich mehr mit Geschichte, dann wandte ich mich der Rechtswissenschaft zu. Im November 1901 bestand ich in Karlsruhe die erste juristische Staatsprüfung und trat in Freiburg als Rechtspraktikant in den juristischen Vorbereitungsdienst ein, aus dem ich jedoch nach einem Jahr ausschied, um mich ausschließlich der Wissenschaft zu widmen."17
Nach dem Abitur beginnt Hans zielstrebig mit dem Jurastudium, bezieht als erstes die Universität Tübingen und wird in seinen Hochschulorten immer nur kurze Zeit verweilen. Obwohl er später in Freiburg auch korporative Festveranstaltungen besucht, ist nicht bekannt, dass er irgendwo einer Studentenverbindung angehört hätte.
Heinhard Steiger beklagt in seinem Lebensbild18, dass es keine Quellen dazu gäbe, wie Hans Gmelin zur Jurisprudenz gelangt sei – oder gar zum Staatsrecht unter besonderer Berücksichtigung internationaler Rechtsfragen. Im Jahr 1897 hatte dieser – wie angemerkt – bei seinem Abitur zu Protokoll gegeben, dass er das Studium der Geschichte aufnehmen wolle. Diesem Fach, das im Zentrum der Berufsarbeit seines früh verstorbenen Vaters Moriz gestanden hatte, hält er auch lebenslang die Treue, ebenso bewegt ihn die Kunst- und Kulturgeschichte. Sein Interesse an internationalen Verhältnissen lässt sich unschwer auf seine Reisebegeisterung zurückführen.
Unter den Hinterlassungen seines Vaters Moriz findet Hans den von diesem verfassten und gedruckten „Stammbaum der Familie Gmelin“19, 2 0der es ermöglicht, dass alle mit dem Namen „Gmelin“ feststellen können, wie sie miteinander verwandt sind. Unter diesen Hinterlassungen findet sich auch der Originalstammbaum von Isaak Gmelin, den dieser um 1750 während seines Studiums der Theologie in Tübingen gemalt hatte.
Das ist für den jungen Hans von besonderem Interesse, weil auch seine Mutter eine geborene Gmelin war, allerdings aus anderer Linie als Vater Moriz: Väterlicherseits bewegt man sich im Geäst der „Jüngeren Stuttgarter Linie“, wo Moriz verzeichnet ist, dessen Vater Friedrich August Gotthelf Gmelin (1785-1853) und Mutter Katharine Barbara, geborene Aickelin (1798-1841) hießen, die mit ihm und seinen 14 Geschwistern zusammen in Ludwigsburg gelebt
Das etwas dilettantisch kolorierte Couleurbild soll nach einer Aufschrift hinten „Großvater Moriz Gmelin“ (Bezeichnung durch Ulrich?) zeigen. Dafür spricht die Datierung, Tübingen, 1858, nicht aber die Übereignung an einen Dritten namens Bilfinger: „seinem Bilfinger zur freundlichen Erinnerung, Tübingen, 1858.“
Da August kein besonders erfolgreicher Kaufmann gewesen ist, wuchs Moriz in der kinderreichen Familie höchstwahrscheinlich unter ärmlichen Verhältnissen auf. Das wird eine Rolle bei seiner Berufswahl spielen. Da ihm seine Familie kein Studium bezahlen konnte, gab es nur die Möglichkeit, ein Stipendium der württembergischen Landeskirche zu erlangen, das verbunden war mit einem „Landexamen“, durch das junge Männer in ursprünglich vier Internate aufgenommen werden konnten, wo sie auf das geistliche Amt vorbereitet wurden: Maulbronn und Blaubeuren, die heute noch existieren, und damals noch Urach und Kloster Schöntal. Moriz kam nach Blaubeuren und wurde vier Jahre später im Tübinger Stift aufgenommen. Einer Zukunft als wohlversorgter Pfarrer stand hauptsächlich seine zarte Gesundheit entgegen, die den Belastungen des Landpfarrdienstes nicht standhielt, - wohl aber auch sein Interesse an historischer Arbeit, das mit diesem Dienst schwer vereinbar war. Das Couleurbild, das Moriz als Mitglied einer Verbindung zeigen soll, gibt Rätsel auf: Die Kolorierung des getragenen Bandes sieht heute – nach ca. 164 Jahren - wie rot-weiß-rot aus, eine Farbe, von deren Nutzung seitens Tübinger Verbindungen nichts bekannt ist. Denkbar wäre vielleicht eine Mitgliedschaft in der Stiftsverbindung Staufia, die von 1852 bis 1868 existiert hat und die Farben grün-weiß-rot getragen hat. Sie war von einem älteren Bruder von Moriz mitgegründet worden. Zu den großen Verbindungen, die in dieser Zeit beginnen, stattliche Häuser zu errichten, würde der weitgehend mittellose Student Moriz nicht gut passen. Der obere Teil des Zirkels, der unten zu erkennen ist, würde zur Verbindung „Roigel“ passen, die seit 1838 allerdings schwarz-gold-rot trägt.
Ob Hans die zahllosen Aufsätze seines Vaters insbesondere zur badischen Geschichte gelesen hat, wissen wir nicht, aber es ist wahrscheinlich. Zu den Erkenntnissen des historisch interessierten jungen Menschen könnte gehört haben, dass historische Entscheidungen von Menschen getroffen werden, die politische Verantwortung tragen. Von da aus ist es dann nicht mehr weit zum Staatsrecht. Wenn Hans Gmelin im Stammbaum seines Vaters geschmökert hat, hätte er auch in der Linie seiner Mutter, der „Jüngeren Tübinger Linie“ promovierte Juristen wie Eduard Gmelin (1786-1873) oder Christian Heinrich Gmelin (1780 – 1824) oder den Politiker Ludwig Friedrich Gmelin (1784-1847) gefunden, die zumindest nahe an den Entscheidungsstellen ihrer Zeit gewirkt haben, auch wenn in aufsteigender direkter Linie seine Herkunft auf den großen Naturwissenschaftler und Mitbegründer einer modernen Chemie, Leopold Gmelin (1788 – 1853), zurückzuführen ist, dessen Vater Johann Friedrich (1748-1804) ebenfalls naturwissenschaftlich orientiert war. Sein Fach „Naturgeschichte“ an der Universität Göttingen umfasste sowohl die Medizin als auch die Philosophie. Mit dem Schwiegersohn Leopolds, Adolf Mayer (1843-1942), seinem Patenonkel, blieb Hans bis in dessen sehr hohes Alter im Briefkontakt.
Barocker handgemalter Stammbaum von Isaak Gmelin (1734-1762) mit Wasserfarbe bunt ausgeführt um das Jahr 1750 aus dem Besitz von Moriz Gmelin.
Indem Leopold einem Ruf an die Universität Heidelberg folgt, wird er den Zweig der Gmelins, der bis zu Hans' Mutter Johanna fuhrt, in Baden einpflanzen, wo sich Hans zeitlebens heimisch fühlen wird. Auf einem eigenartigen handschriftlichen Zählblatt aus dem Jahr 1939 gibt er sich Rechenschaft, wieviel Monate er seit dem Jahr 1900 in Freiburg, in Gießen oder auf Reisen zugebracht hat. Die Jahre in Karlsruhe zuvor finden sich unten rechts mit 18 Jahren verzeichnet. Im Hinblick auf Gießen kommt er auf 26 Jahre, von denen er allerdings sechs Jahre und zwei Monate abzieht, in denen er reisebedingt nicht dort war, sodass es nur noch 20 Jahre sind. Auch nach dem Umzug nach Gießen wird es kein Jahr geben, in dem er nicht mindestens einen Monat in Freiburg lebt. So kommen zu den 10 1/2 Jahren in Freiburgnoch 5 1/3 Jahre hinzu, sodass er auf 16 Jahre kommt. Mit Punkten stellt Gmelin seine Urlaubsmonate dar, in denen er auf Reisen war: Seit 1883 kommt er auf 45 Wochen, beinahe ein Jahr ist er oder seine Familie auf Achse gewesen. Das Zählblatt zeigt: Hans wird sich auch nach 26 Jahren in Gießen, wo er mit seiner Frau Martha ein Zuhause hat und seine beiden Söhne geboren sind, noch immer als Freiburger fühlen und man spürt es der Tabelle ab, wie er jeden Monat bedauert, den er nicht in seiner Wahlheimat Freiburg – einschließlich später Hinterzarten – verbracht hat. Er hat unter dem Kapitel Freiburg als zweite Heimat ausführlich berichtet.21
Da Hans Gmelin kein technisches Studium beginnen wollte, brauchte er nicht zögern, Karlsruhe zu verlassen. Wie er später schrieb, mochte er seine Heimatstadt nicht, die ihm entweder zu heiß oder zu windig vorkam22 und keine bergige Umgebung hatte, die ihm schöne Ausblicke hätten bieten können. Dennoch hat man ihn 1941 auf dem dortigen Friedhof beigesetzt, bis das Grab aufgegeben wurde und die Familie ihn nach Gießen auf den Nordfriedhof überführen ließ. Der sepulchrale Umweg über Karlsruhe bleibt zunächst unverständlich.
Sein erster Studienort ist die Stadt seiner Vorfahren, die einst eng verbunden gewesen waren mit Tübingen und seiner Universität. Am 25. November 1897 schrieb er sich dort ein. Sehr juristisch ging es nicht zu: Sein Studienbuch verzeichnet Römisches Privatrecht und Römische Rechtsgeschichte, aber ansonsten widmet er sich der Kunst: Italienische Kunstgeschichte und italienische Dichtung. Und schließlich hörte er noch ein historisches Fach: Deutsche Geschichte der Reformation.
Offenbar hielt ihn nicht viel in der schwäbischen Universitätsstadt, denn schon zum Sommersemester 1898 schreibt er sich in Heidelberg ein, zurück in der badischen Heimat. Fachnah sind Lehrveranstaltungen wie Allgemeines Strafrecht, Kolonialgeschichte und allgemeine Nationalökonomie. Aber auch hier legt er sein Studium weit an und lernt über die Sprachen der Germanen, Geschichte des 19. Jahrhunderts und Deutsche Literaturgeschichte.
Seine Studienorte sind rasch getaktet, schon im darauffolgenden Wintersemester geht es in München weiter, wo er sich am 21.10.1898 einschreibt. Hier in der alpennahen bayrischen Hauptstadt fühlt er sich wohler und wird ein Jahr dort ausharren. Hier lebt er mit seinem Onkel Leopold23 und dessen Söhnen Erwin und Hermann und der Tochter Hedwig, jedenfalls musiziert er mit ihnen regelmäßig. Die Verbundenheit mit München wird bleiben, so vergleicht er die Lage Madrids mit der der bayrischen Metropole oder kauft in späteren Jahren (1938) für kurze Zeit dort ein Haus, von dem er sich aber bald wieder trennt, weil er Ärger mit dem Mieter hat und die Stadt München ihm den Vorgarten enteignet.24 In seinem Studienplan hat die Jurisprudenz Vorrang: Rechtsgeschichte und Privatrecht, Bürgerliches Recht, Deutsches Handelsrecht, Strafrecht und noch einmal Bürgerliches Recht. Neben diesen fachspezifischen Themen belegt er auch Malerei bei dem Kunsthistoriker Berthold Riehl (1858-1911), einem Spezialisten für regionale bayrische Kunstgeschichte. Zuletzt kam auch Geschichte vor, die er bei Karl Theodor von Heigel (1842-1915) belegt hatte.
Zum Wintersemester geht Hans Gmelin wieder auf Achse und bezieht am 3. 11. 1899 für ein Semester die Friedrich-Wilhelms-Universität25Berlin, die in dieser Zeit einen exzellenten Ruf genießt. Dort widmet er sich ausschließlich seinem Fach: Bei dem prominenten „Juraprofessor und Universalgelehrten“, dem Straf- und Zivilprozeßler Josef Kohler (18491919) studiert er Zivilprozeßrecht. Leider gibt es keine persönlichen Erinnerungen an diese Zeit, denn es ist wahrscheinlich, dass Kohler - abgesehen von dessen ungeheurer Eitelkeit – für Gmelin ein Seelenverwandter war: „Zeitzeugen beschrieben ihn als feurigen Badenser26 mit einer Löwenmähne, leuchtenden Augen und markanten Zügen, die an den Kopf des Großen Kurfürsten erinnern“. Man unterstellte ihm, dass er die Ähnlichkeit mit diesem nach Schlüters Bildnis anstrebe. Er gleiche mehr einem Künstler als einem Professor. Wohl kaum zufällig war er meist mit Kalabreser-Hut und Künstlermantel unterwegs. In einem Nachruf heißt es: „so gab er sich auch wohl mit einer nicht wegzuleugnenden Selbstgefälligkeit gern unter Professoren als Professor und unter Poeten aber als Poet“.27 Dazu hörte Gmelin noch Völkerrecht und Praktische Nationalökonomie. Doch schon zum Sommersemester 1900 schreibt sich Gmelin in Bonn ein, der einst bevorzugten Universität blaublütiger Kommilitonen, wo er neben Strafprozessrecht, Zivilprozess und Kirchenrecht noch die Entwicklung des französischen Romans im 19. Jahrhundert studiert. Doch hält ihn auch die Massenuniversität in Bonn nicht lange, denn jetzt geht es wieder ins heimatliche Baden, diesmal in dessen bergigen Süden.
Am 9. 11. 1900 meldet sich Gmelin zur Fortführung seines Jurastudiums in Freiburg im Breisgau. Hier wird er bis zum Abschluss studieren. Die entsprechenden Examina wurden den Juristen in der badischen Hauptstadt Karlsruhe abgenommen. Nach dem Studium wird er weiterhin in Freiburg leben, seiner zweiten Heimat. Hier wird er sich auch später noch zuhause fühlen, als er längst in Gießen an der Lahn lebte. Als Grund für diese Anhänglichgkeit gibt er sowohl seine dort lebende Mutter Johanna als auch die Landschaft am Schwarzwald an. Seine Promotion „Studien zur Spanischen Verfassungsgeschichte des 19. Jahrhunderts“ wird auf einer riesigen lateinischen Urkunde die Note: „Summa cum laude superato“ bekommen.
Von der Studienzeit zur Professur
Zwar beginnen die uns vorliegenden Annalen Gmelins erst mit der Zeit nach seinem Studium, aber da die Personen an der juristischen Fakultät in Freiburg die gleichen waren, mit denen er auch als Dozent zu tun hat, kommen wir im Quellenbuch in den Genuß von persönlichen Charakterskizzen seiner Freiburger Lehrer.28
Einer der großen seines Faches, den Michael Stolleis als „eigentlichen Begründer eines wissenschaftlich systematisierten Sozialversicherungsrechts“29 nennt, war der Verwaltungsrechtler Heinrich Rosin (1855-1927). Bei dessen Schilderung musste der Nachgeborene zunächst die Luft anhalten: „Rosin war Volljude, ein kleiner, untersetzter mit hängendem Schnurrbart und schiefsitzendem Zwicker. Ich erlebte es, daß ein Bekannter, den ich Rosin zeigte, ihn für einen Viehhändler hielt; aber dabei handelte es sich nur um einen ganz oberflächlichen Eindruck, denn wer ihn aufmerksam betrachtete, dem konnte nicht verborgen bleiben, daß seine Züge durch Wissen und Verstehen veredelt waren.“30
Durchatmen, Hans Gmelin hat die Kurve gekriegt, aus dem negativen Vorurteil ein positives Urteil zu wenden. Gott sei Dank. Von den anderen Universitätslehrern sei hier Konrad Beyerle (1872—1933) genannt, den Gmelin bei seinem Aufenthalt im Generalgouvernement im Brüssel des Ersten Weltkriegs und bei einem Treffen in Würzburgwiedersehen wird. Am Ende von dessen Portrait findet sich Gmelins Bewertung des Nationalsozialismus: „Die Schwenkung zum Nationalsozialismus hätte er als überzeugter Anhänger des politischen Katholizismus sicher nicht über sich bringen können; insofern war es ein Glück für ihn, daß er kurz nach Hitlers Machtübernahme gestorben ist.“
Großen Respekt bezeugt er dem Schweizer Rechtsgeschichtler und Kirchenrechtler Ulrich Stutz (1868-1938), dessen Vermächtnis später eine große Rolle spielen wird bei der Neudefinition des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat nach dem Zweiten Weltkrieg. Dessen Bildwort von der „hinkenden Trennung“ von Kirche und Staat wurde später dem Göttinger Kollegen Rudolf Smend untergeschoben. Dessen vermeintliche Verfasserschaft wurde mir in meinem Studium des Kirchenrechts um 1980 mitgeteilt.
Viel wichtiger für Hans Gmelin wurde der gebürtige Sachse Richard Schmidt (1862-1944), zu dem er sich hingezogen fühlte. Als Student hörte er bei Schmidt Zivilprozess und Allgemeine Rechtslehre. Gmelin rühmt an ihm ein ungeheures Redetalent, zumal man ihm seine sprachliche Heimat nicht angehört hat: „Seine Vorlesungen, die er vollständig frei sprach, stellten rhetorische Meisterleistungen dar.“31 Dass sich Schmidt in vielen Rechtsgebieten zuhause fühlte, sah Gmelin nicht als Vorteil; ihm war es lieber, wenn sich Juristen nur in einem Fachgebiet profilierten. Das Werk Schmidts zur „Allgemeinen Staatslehre“ rühmt Gmelin dennoch, zumal es in den Bänden zwei und drei „die ganze Weltgeschichte bis zur Französischen Revolution vorüberziehen ließ, so eröffnete die Staatslehre Richard Schmidts mir, dem Historiker, einen viel gangbareren Weg, um in diesem Wissenschaftszweig einzudringen, als die mehr dogmatische Rechtslehre von Georg Jellinek“ (1851-1911). Dessen Sohn, Walter Jellinek (1885-1955) wird gegen Gmelin bei der Berufung zum Ordinarius für Öffentliches Recht an der Gießener Ludoviciana unterliegen. Er wird nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 einer der Väter der (groß-)hessischen Verfassung. - „Die staatsphilosophischen Lehren der einzelnen Denker haben auch einen historische Wert, - nämlich insoweit sie Glieder der praktisch-politischen Entwicklung sind: Sie sind Spiegelbilder der staatlichen Zustände ihrer Zeit oder der Wünsche dieser Zeit nach politischen Veränderungen und Verbesserungen, - häufig werden sie umgekehrt ein mächtiger Hebel für das thatsächliche Wachsen oder Werden solcher Umgestaltungen selbst.“32 Im Gegensatz zu den positivistischen Vorstellungen Georg Jellineks entspricht diese Haltung Schmidts den Vorstellungen Gmelins.
Da Schmidt sowohl die Doktorarbeit als auch die Habilitation von Hans Gmelin betreut hat, gilt dessen Satz: „Wenn ich überhaupt jemandes Schüler genannt werden darf, dann kann ich als Schüler von Richard Schmidt gelten.“ Auch nach dessen Rückkehr nach Leipzig bleiben die Kontakte rege, Schmidt wird 1921 der Patenonkel des erstgeborenen Sohnes Ulrich werden.33 Ursprünglich waren Gmelin und Schmidt auch politisch sehr nah bei einander als Nationalliberale. Ob die Freundschaft beider den Wechsel Schmidts 1933 in die NS-Akademie für Deutsches Recht Hans Frank überstanden hat, hat sich nicht feststellen lassen. Es ist denkbar, dass ein ursprünglich vorhandener Briefwechsel vernichtet wurde, weil er gerade die unterschiedliche Haltung der beiden zum NS-Staat thematisiert hat. - Wiederum eine Spekulation.
Richard Schmidt hatte indessen nicht nur positiven Einfluss auf die Karriere seines Schülers. Hans Gmelin berichtet: „Im Jahr 1912 wurde ich an der Universität Basel für die dortige staatsrechtliche Professur an erster Stelle vorgeschlagen, der Ruf zerschlug sich jedoch aus politischen Gründen.“ Was dahinter steckt berichtet die „Geschichte der Basler juristischen Fakultät“34:
Demnach ärgerte sich das Erziehungsministerium über den zuvor von Richard Schmidt an Basel empfohlenen Vorgänger auf dem Lehrstuhl, Hans von Frisch. Der gebürtige Wiener war durch Arroganz und Hochmut gegen das eidgenössische Rechtswesen aufgefallen, bevor er sich später dem Nationalsozialismus zuwendete. Darum empfahl das Erziehungsministerium, Gmelin den Tübinger Dozenten Erwin Ruck vorzuziehen, der dann auch 40 Jahre die öffentlich rechtliche Professur in Basel vertreten wird.
Die Bestallung Hans Gmelins zum außerordentlichen Professor in Freiburg durch den Großherzog von Baden, 1912
Freiburg und der Schwarzwald
Hans Gmelin hatte das Gefühl, seine Kindheit verpasst zu haben: Früh verlor er seinen Vater Moriz (1839-1879), dann später, 1894, die noch kindliche Schwester Elisabeth (1879-1894) an Diphterie. Großvater Konrad Adolf wurde immer despotischer und debiler, bis er in die „Irrenanstalt“ Illenau eingeliefert wurde. So können wir nachvollziehen, dass es Hans von Karlsruhe weggezogen hat. Nach seinem unsteten Studium fand er in Freiburg seine zweite Heimat: „In Freiburg verlebte ich die für mein Leben wichtigsten Jahre: Den Abschluß der Berufsausbildung, und den Eintritt in den Beruf, genoß die Freiheit des Studenten und trotz der trüben Erfahrungen35 die Ungebundenheit des Privatdozenten; holte im gemütlichen Zusammenleben mit meiner Mutter ein gut Stück versäumten Familienglücks nach und sog immer Lebensfreude aus dem landschaftlichen Reichtum der Umgegend.“36 Als nicht besonders karriereförderlich erwiesen sich die Forschungsschwerpunkte Gmelins: Seiner Reiselust geschuldet spezialisierte er sich auf Internationales Verfassungsrecht. Seiner nationalen Begeisterung entsprach die Neigung zum Kolonialrecht, das als Rechtsgebiet mit dem Verlust der Kolonien nach dem Ersten Weltkrieg unterging – und damit waren auch die Vorarbeiten, die Gmelin dafür geleistet hatte, obsolet.
Wie es seine Art war, hatte sich Hans Gmelin mit kunsthistorischer Literatur auf seine neue Heimat vorbereitet, wobei er besonders dem Freiburger Münster große Aufmerksamkeit widmete, bis er Freunde und Gäste mit entsprechenden Führungen durch das Münster und die Stadt erfreuen konnte.37
Wer den virtuellen Stadtrundgang durch das Freiburg der Zeit nach der Jahrhundertwende38 mit dem späteren satirischen Spaziergang durch Gießen39 vergleicht, wird eine große emotionale Differenz feststellen: Für die Exzellenz Freiburgs und seiner Bauten wirbt er mit jedem Wort, während es ihm offenbar Freude macht, alle Aspekte Gießens durch den Kakao zu ziehen. Objektiv hat Gießen unabhängig von persönlichem Geschmack kunsthistorisch gegen Freiburg nur wenig Chancen; zum Vergleich steht dabei das Vorkriegs-Gießen, das am 6.12.1944 unter dem Bombenhagel der Alliierten endgültig vernichtet wurde und dessen Innenstadt nach dem Zweiten Weltkrieg schnell und ohne Genie aufgebaut worden ist. Das heutige Gießen hätte bei Hans noch weitaus weniger Gnade gefunden. - Auch wenn die Genres dieser beiden Texte zu Freiburg und Gießen schwer vergleichbar sind: Umgekehrt hätte man sich die beiden Stadtbetrachtungen aus Gmelins Feder nicht vorstellen können.
Nicht allein die Stadt Freiburg mit ihrer altehrwürdigen Architektur, sondern vor allem ihr Hinterland, eingebettet in den Südschwarzwald und umgeben von „lohnenden“ Bergen, verbinden ihn mit dem Breisgau. Er schreibt sogar, dass ihn mehr die landschaftliche Einbettung interessiere, als Freundschaften im Hinblick auf die Menschen dort. Zahlreiche Bilder zeigen, dass er auch als Zeichner und Maler in dieser Landschaft jahrzehntelang unterwegs gewesen ist.
Die Menschen, mit denen er in Freiburg zu tun hat, unterscheiden sich erheblich: Die katholische Urbevölkerung, die mehr nach Österreich als nach Preußen orientiert gewesen war - und zum Teil damals noch ist, blieb Gmelin fremd, zumal sie auch politisch ein klerikalgehorsames Zentrumsmilieu bilden, das er politisch bekämpft, auch durch Koalitionen mit den sonst nicht besonders geliebten Sozialdemokraten.
Wichtiger sind für ihn die durch die Universität nach Freiburg Zugewanderten, die zu seiner Zeit eine eigene Schicht in der Stadt Freiburg bilden. In dieser Gruppe des akademischen Freiburg gewannen Mutter und Sohn einen größeren Bekanntenkreis.
Zuletzt findet er einige wenige weitläufige Verwandte vor, die es schon früher nach Freiburg verschlagen hatte, wie den Bruder Karl seines eingeheirateten Onkels Gustav Döll (1843-1920), der Luise Gmelin (1846-1930), die Schwester seiner Mutter Johanna geheiratet hatte. Ihn hatte sein Beruf als Postdirektor nach Freiburg gespült, den er hier „seufzend“ ausführte. Abgesehen von seinem Galgenhumor, der in Worten wie „Ewig währt am längsten!“ zum Ausdruck kam, verrät die Beschreibung eine gewisse Distanz: Im Hinblick auf die Auswahl seiner zweiten Frau, Minna, geborene Schumacher, sei die hauspaschamäßige Haltung von dessen Vater wieder zum Ausdruck gekommen, der es um „bereitstehende Pantoffeln, Schlafrock, Hauskäppchen, Bettflasche“ gegangen sei.40 Die Beschreibung erinnert an Wilhelm Buschs Onkel Fritz, von dem es in „Max und Moritz“41 heißt:
„Oder kommt er spät nach Haus,
Zieht man ihm die Stiefel aus,
Holt Pantoffel, Schlafrock, Mütze,
Daß er nicht im Kalten sitze.
Kurz, man ist darauf bedacht,
Was dem Onkel Freude macht.“
Auch die drei Kinder von Karl Döll gehören zum näheren Umgang: Elisabeth, die von der Natur „stiefmütterlich behandelt“ worden sei, die hübsche Minna, die Hans Gmelins Freund, den späteren Oberbürgermeister von Konstanz, Otto Möricke heiraten wird, aber auch ihm selbst gut gefallen habe und schließlich Georg, der als Theologe nach Bosnien und Böhmen ging und nach seiner Rückkehr nach Baden seiner „Frau berechtigten Grund zur Eifersucht“ gegeben habe.
Der Sohn von Gustav Döll, Adolf Döll, wird ebenfalls in Freiburg studieren und bei Gmelins wohnen. Hans und Adolf42 verbindet eine lebenslange Freundschaft. Adolf wird später in Bern wohnen und regelmäßig von Hans besucht werden. Wohl von Gustav Döll stammte ein unübersehbarer Fundus von Glasplatten-Negativen mit Alpenblumen und Bergszenen, die unbearbeitet jahrzehntelang auf dem Dachboden des Gießener Hauses Nahrungsberg 51 schlummerten, bevor sie samt vielem anderen entrümpelt wurden.
Ein Eindruck vom Schwarzwald bei Günterstal im Süden von Freiburg – vor dem Bauboom. Aus dem Skizzenbuch von Hans Gmelin, 1901.
Der Katzenprofessor
Zu den wenigen außerfamiliären Menschen, die Erinnerungen an die Vorkriegszeit mit Hans Gmelin hatten, gehörte in meiner Kinderzeit neben unserem Milchmann Schmabeck und einer Eierfrau, Lotte Stöhr, eine Freundin meiner Großmutter Martha, dann eine Schneiderin, das Fräulein Rahn, das meine Oma mit „Frau Professor“ titulierte und ein lebendiges Zeugnis aus einer vergangenen Zeit darstellte. Schließlich lernte ich während meiner Studienzeit in Tübingen die damals schon sehr betagte „Tante“ Lina Gmelin kennen, eine weitläufige Verwandte aus Heilbronn, deren Vater Jeremias Pfarrer in Schwäbisch Hall gewesen war und,- wie das „Fräulein“ Rahn - Wert darauf legte, mit „Fräulein“ angeredet zu werden: „Ich hab halt keinen abgekriegt!“ Tante Lina hatte noch eigene Erinnerungen an Hans Gmelin und dass man in ihrem Familienkreis von ihm als dem „Katzenprofessor“ gesprochen habe, der wohl nie heiraten werde, weil ihm seine Katzen genug gewesen seien.
Es kam dann anders, aber es hat mich nicht überrascht, in den Annalen meines Großvaters ein eigenes Kapitel über die Katzen zu finden, denn beim Thema „Hausgenossen“ dürften „auch die Katzen nicht übergangen werden.“43 Bereits in Karlsruhe lebte eine Katze namens „Müs“ in der Familie, die allerdings den Umzug nach Freiburg nicht lange überlebt hatte. Und so kam der Name Müs