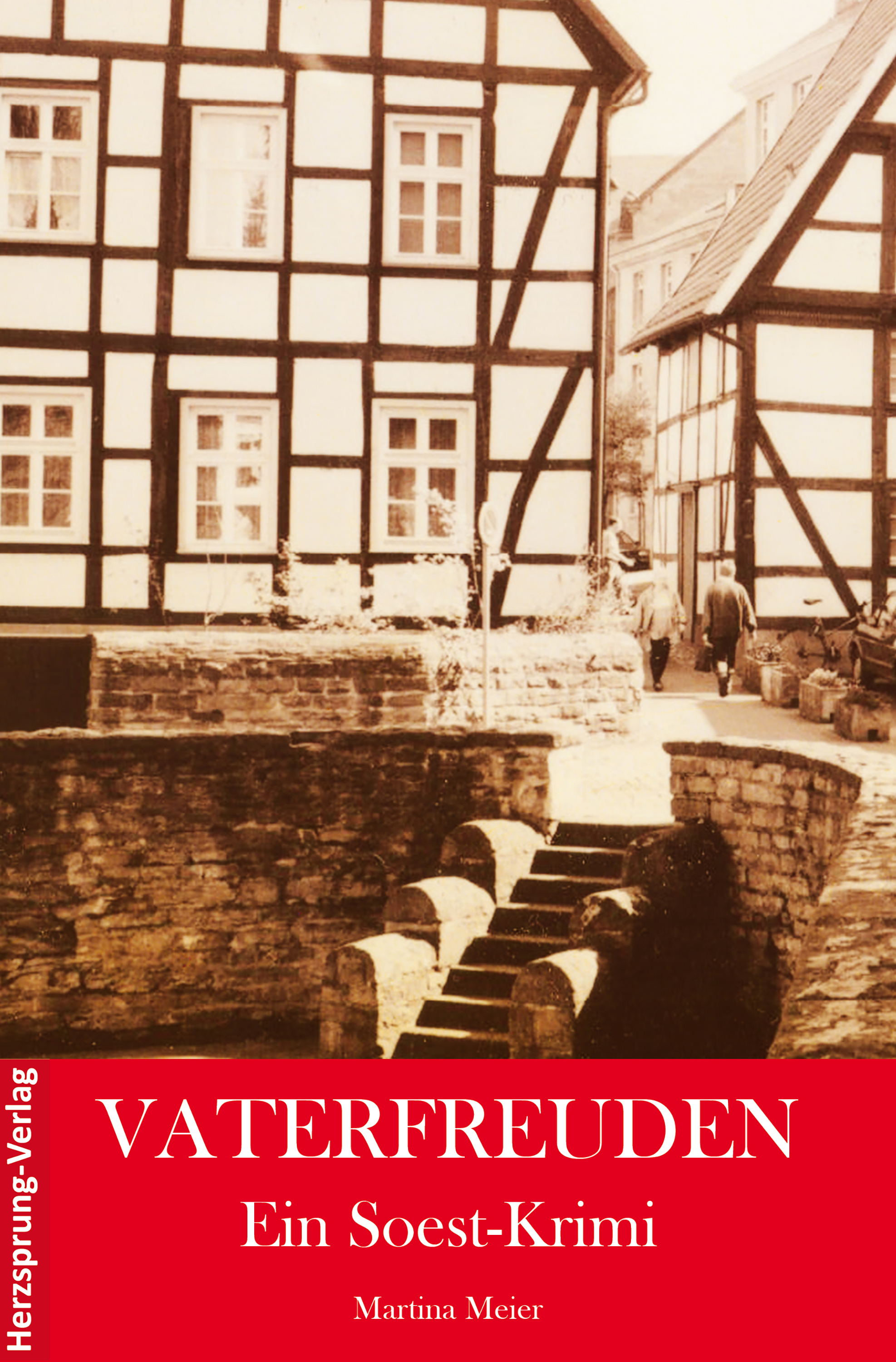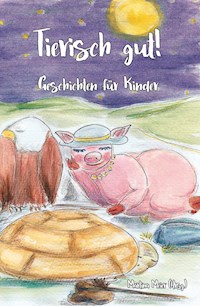9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Papierfresserchens MTM-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Früher, als Lampertheim noch lange keine Stadt war, gab es in der Umgebung viel mehr kleine Dörfer als heute. Dort lebten Menschen, die gehörten anderen Menschen. Das waren Fürsten und Grafen und Bischöfe. Denen mussten die Dorfleute gehorchen und ihnen die Felder bestellen. Und sie fügten sich drein, weil sie es nicht anders kannten. So war es auch in Besenheim. Aber einer lebte dort, das war der starke Hans. Der war fast zwei Meter groß und hatte so viel Kraft, dass er allein einen Ochsenkarren ziehen und Bäume mit den Händen fällen konnte statt mit einer Axt. Hans wollte nicht immer für die Pfaffen schuften und schimpfte den lieben langen Tag. Er schimpfte über die Abgaben an Mainz, über die hohen Herren, denen er das Vieh hüten musste, und über die Gauner in den Nachbardörfern, die alle in dem See fischten, an dem er groß geworden war. Und weil seine Stimme so kräftig war wie seine Arme, hörte ihn eines Tages der Teufel, der in einer riesigen Höhle unter der Bergstraße hauste. „Was für ein respektloser Bauer“, dachte der sich. „Mit dem will ich meinen Spaß haben.“ ... Ob der Teufel wirklich seinen Spaß mit Hans hatte? Wir verraten es in diesem Buch ... und dazu noch vieles mehr aus der Sagenwelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
o
Sagenhaftes
Alte Sagen neu erzählt Band 2
Martina Meier (Hrsg.)
o
Impressum
Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet - www.papierfresserchen.de
© 2023 – Papierfresserchens MTM-Verlag GbR
Mühlstr. 10, 88085 Langenargen
Alle Rechte vorbehalten. Taschenbuchauflage erschienen 2023
Herstellung und Lektorat: CAT creativ - www.cat-creativ.at
Illustrationen Cover: © LauraHelena - Adobe Stock lizenziert
ISBN: 978-3-99051-127-5 - Taschenbuch
ISBN: 978-3-99051-128-2 - E-Book.
*
Inhalt
Teuflisches von der Luneplate
St. Gangolf und die Milseburg
Der fromme Einsiedler Johannes
Der Kölner Dom
Alle sieben Jahre wieder
A Souls Last Dance
Damals auf dem alten Friedhof
Die Verführung eines Losensteiner Burgfräuleins
Oder wie man in eine wohlhabende Familie einheiratet
Das Schreierbächlein
Wie der Teufel ein Dorf klaute
Die Meerjungfrau von Warschau
Das goldene Kegelspiel
Ich, der Dschinn
Von den Ambeditchen in den Elsava-Auen
Von de Oambedidsche in de Elsava-Aue
König Arthur
Der Drache vom Drachenberg
Im Nebel
Alle Wege führen nach Rom
Oisin und Niamh
Loreley
Die Puppe von Brand
Das Kloster der verwunschenen Nonnen
Der dumme Junge zu Meißen
Die Barther und der Ritter Alkun
Die Geschichte eines Mordes
So könnte es gewesen sein
Rübezahl – Der sagenhafte Berggeist aus Schlesien
Die Sage von Sedna
Nebelsaga
Das Bruderloch
Der Laternenmann von Alberoda
Die Sage um Burg Eppstein
Ach, Allmächtiger!
Ein unheimlicher Mitfahrer
Der Wind über dem Montserrat
Schinderhannes – ein böser Räuber mit gutem Herz
Roswitha von Blankenstein
Der Eingang zur Unterwelt
Der Edelacker bei Freyburg
Die Prinzessin des Schlossberges bei Biesenthal
Das Donauweibchen
Sie, die nicht genannt werden
Zschorlauer Mondputzer
Die Barbarine
Der Bau des Aachener Doms
Die Kinder zu Hameln
Das Wunder von Suffolk
Hexenbier
Die Seewichte
Die Loreley und der Teufel
Die gute Alte
Ein ungleicher Handel
Philemon und Baucis
Die Riesen vom Bodensee
Die Tränenquelle
Vineta
Die Zeitalter des Hesiod
Die weiße Frau auf der Mulde bei Aue
Die Martinswand
*
Teuflisches von der Luneplate
Eine Sage aus Bremerhaven
Im Naturschutzgebiet Luneplate im Süden Bremerhavens grasen heute Wasserbüffel friedlich auf der Weide hinter dem Weserdeich. Weite Wiesen und ausgedehnte Wasserflächen durchziehen das offene Land. Abertausende Zugvögel übertönen sich dort gegenseitig auf ihrer Rast zwischen den Flügen aus dem hohen Norden nach Afrika und wieder zurück in die angestammten Brutgebiete. Im hohen Mittelalter war diese Landschaft Bauernland, so weit das Auge reichte. Einen Deich am Weserstrom gab es nicht. Zum Schutz vor Hochwasser und Sturmfluten hatten die Bauern in mühsamer Arbeit Erdhügel aufgeworfen, Wurten oder Warften genannt. Eng aneinandergedrängt, als müssten sie sich gegenseitig stützen, wurden darauf die Bauernhäuser errichtet. Das Leben auf der Luneplate war hart. Und manchmal ging es mit dem Teufel zu ...
Heumahd auf der Luneplate. Hahnenfuß und Schafgarbe stehen hoch in Blüte. Zehn Bauern lassen die Sensen sirren. Zehn Bauern und das Mädchen Luna. Mädchen können bei der Ernte einen Unterschied machen, mehr Leichtigkeit in die harte Arbeit einbringen. Das hat der alte Vater seiner Tochter, die gerade im besten Jugendalter ist, mit auf den Weg gegeben. Heute hilft sie beim Heuen an seiner Stelle. Es geht zügig zur Sache. Es sieht nach Wettmähen aus. Aber das Heu soll in der Frühsommersonne trocknen und noch am gleichen Tag eingebracht werden. Am Abend stehen zehn Leiterwagen bereit. Die Sonne sticht, dunkle Wolken ziehen auf, Donner rollt von Ferne. Sturm treibt Flut vom Weserstrom in das offene Land, füllt den Fluss, Bäche und Gräben. Eile tut not. Pferde jagen im Galopp mit den Leiterwagen zwischen Wiesen und Wurten hin und her. Das Wasser läuft höher auf und Wasserläufe sind bis zum Rand gefüllt.
Vom Weserstrom her treibt ein Boot auf die Wiesen zu, tanzt im Wind, reitet auf Wellen, durchpflügt Fluss, Bäche und Gräben, mit Segeln rot und schwarz. Dem Kahn entspringt ein Mann, er trägt einen roten Rock, unverkennbar ist leichtes Hinken. Ihm folgt eine spindeldürre Frau in pechschwarzer Kleidung. Deren weißes, lichtes Haar flattert im Wind wie eine in langen Jahren verschlissene Fahne. Die Augen lodern wie Feuerkugeln in einem scharfkantigen Gesicht.
„He, ho, biete Hilfe beim Bergen, wenn jemand mir hilft. Zum Austausch für vier starke Arme, ein bisschen Erde, eine Handvoll nur … also besser gesagt, ein kleines Boot voll nur.“
„In Gottes Namen“, stimmt der Vorsteher der Bauernschaft zu.
„Den lasst für immer aus dem Spiel!“, antwortet der Mann aus dem Boot.
Zehn Heugarben spießt er auf einmal auf die Forke und wirft diese auf die Leiterwagen. Seine Begleiterin tut es ihm nach. Ehe das Wasser das offene Land überflutet, ist alles Heu von den Wiesen geräumt.
„Zu Allerseelen komm ich wieder und hol mir den versprochenen Lohn“, ruft der Mann, springt in den Kahn, die spindeldürre Frau folgt ihm auf dem Fuße. Mit gesetztem Segel dreht das Boot gegen den Wind. Und schon werden die seltsamen Besucher nicht mehr gesehen.
„Mir ist unheimlich. Da ist etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen“, jammert der fromme August, der dem Priester sonntags das Wasser reicht, damit der seine Hände in Unschuld waschen kann, und ihm süßen Messwein einschenkt, den der Priester in Blut Christi verwandelt. „Der Teufel wars … und seine Großmutter!“
„Das denken sich Priester aus, um Furcht für die Ewigkeit zu schüren“, ruft das Mädchen Luna, das immer alles besser weiß.
„Warten wir ab, ob die Leute vom Boot sich überhaupt noch einmal melden“, beruhigt der Vorsteher der Bauerschaft.
Der Sommer geht ins Land. Herbststürme kommen auf und Weserwellen lecken an der Wurt. In der Nacht zu Allerseelen werden die Bauernfamilien durch beständiges Kratzen und Klatschen geweckt. Ratsch, platsch! Ratsch platsch! Es genügte ein Blick durch die Fensterluke: Das gesamte offene Land steht unter Wasser. Dunkle Gestalten werfen Schatten. Mit Schaufel und Gabel sind sie am Werk.
„Sturmflut! Wir sind in Gefahr“, rief Luna.
Den frommen August hat das Kratzen und Klatschen aus dem Bett geworfen. „Der Teufel und seine Großmutter stechen die Wurt an! Und schaufeln kostbares Erdreich in ihr Boot, das ragt riesig wie ein Schiff. Rette sich, wer kann!“, ruft er.
Frauen rennen in die Küche, um ihre Habseligkeiten – Geschirr, Töpfe und Pfannen – zu retten. Männer rennen in die Ställe und binden das Vieh los. Aber es gibt kein Entkommen. Die Flut hat die Menschen auf der Wurt eingekesselt.
„Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn die Höllengeister sich nicht durch geweihte Gegenstände vertreiben ließen“, ruft der fromme August. Ungewaschen und ungekämmt, immer noch in Nachtkleidung, eilt er in die Kapelle und reißt das Altarkreuz aus der Verankerung. Mit dem Kreuz als Hebel bricht er den Tabernakel auf und entnimmt eine geweihte Hostie aus dem Heiligen Schrein. Das ist zwar dem Priester vorbehalten. „Aber die Not der Stunde heiligt die Mittel“, sagt sich der fromme August. So ausgestattet, drängt er durch die Tür der Kapelle und wirft sich mit einem Vaterunser auf den Lippen gegen den Sturm. Mit der einen Hand schwenkt er das Kreuz wie eine Kriegsfahne, mit der anderen Hand hält er die Hostie in Augenhöhe wie ein Priester vor der gläubigen Gemeinde. „Möge die von Bosheit zerfressene Teufelsfratze im Zeichen des Kreuzes erbleichen und auf ewig in der Hölle schmoren.“
Die Nachtmütze wird ihm vom Kopf gefegt. Er hörte ein Keckern und Meckern. „Machen sich die Höllengeister über mich lustig?“, geht ihm durch den Kopf:
Jemand klopft ihm von hinten auf die Schulter. Der fromme August spürte, wie ihm Schweiß den Rücken hinunterläuft und sich seine Nackenhaare sträuben. Er fällt in sich zusammen wie ein nasser Sack und macht sich bereit, sein letztes Gebet zu aufzusagen. Aber hinter ihm steht nicht der Teufel. Es ist das Mädchen Luna.
Auf dem Dachboden ihres Elternhauses hatte sie eine Teufelsmaske gefunden. Die trug ihr Großvater einst zum Hexensabbat, um jungen Frauen einen höllischen Spaß einzujagen. Die Frauen verkleideten sich als Hexen und führten Tänze auf, frech und wild wie Frauen es zu allen Zeiten lieben, wenn man sie lässt.
„Fauler Zauber. Priestermärchen. Damit erschreckst du vielleicht Gespenster. Aber den Teufel juckt das nicht. Der bleibt standhaft und setzt sein zerstörerisches Werk ungehindert fort. Nur mit Beelzebub lässt sich der Teufel austreiben“, sagt das Mädchen Luna zu dem frommen August.
Sie setzt Großvaters Teufelsmaske auf. „Hu, hu“, ruft sie gegen den Sturm. „Hu, hu.“
Dann tanzt sie, frech und wild, wie Frauen es zu allen Zeiten lieben. Es tanzen die Wellen, es rollt die Flut. Dann legt sich der Sturm. Nach und nach läuft das Wasser zurück in den Weserstrom. Die Gezeiten haben sich geändert. Ebbe setzt ein.
„Der Teufel und seine Großmutter sind ausgetrieben und durch eine Erdspalte in die Hölle eingefahren“, behauptet der fromme August.
Frühjahr nach der Sturmflut. Der Vorsteher der Bauernschaft hat befohlen, die beschädigte Wurt abzutragen und aus dem gewonnenen Erdreich einen Deich am Weserstrom aufzuschichten. Hinter dem Deich wären Mensch und Tier zukünftig vor Sturmfluten sicher. Die Bauernhöfe werden auf dem offenen Land wieder errichtet. Offenwarden heißt die neue Ansiedlung.
Deichabschnitt und der Weiler stehen noch heute. Über die Heldentat des Mädchens Luna berichtet eine in Stein gemeißelte Geschichte. Und wer es glaubt oder nicht, nach dem tapferen Mädchen sind der Fluss Lune und das anliegende offene Land Luneplate benannt.
Volkmar Trepte, geboren 1947, hat Psychologie studiert, lebt in der Seestadt Bremerhaven und in Thiéfosse (Vogesen, Frankreich), schreibt Gedichte und Kurzgeschichten, hat in Anthologien und literarischen Zeitschriften veröffentlicht, mag den salzigen Duft und den unerbittlichen Gegenwind am Deich an der Nordseeküste, wie auch die unzähligen unterschiedlichen Ansichten, die sich bei Bergwanderungen eröffnen.
*
St. Gangolf und die Milseburg
Eine Sage aus der Rhön
Hallo und guten Tag, liebe Leserinnen und Leser. Ich weiß, dass ihr Geschichten und Märchen mögt. Aber wie wäre es einmal mit einer Sage. Ihr wollt wissen, was eine Sage ist? Das erkläre ich gerne.
Geschichten und Märchen sind erfunden, während Sagen von Vergangenem berichten. Sie wurden von Mund zu Mund weitergegeben und beinhalten meist etwas Wahres. Und Sagen können auch sehr spannend sein. Wenn ihr wollt, erzähle ich euch eine.
Es war schönes Wetter und so dachte ich mir, wieder einmal wandern zu gehen. Gesagt, getan. In der Nähe meines Heimatortes gibt es einen Berg, die Milseburg. Sie ist 835 Meter hoch und liegt in der hessischen Rhön. Wegen ihrer eigentümlichen Form ist sie schon von Weitem zu sehen. Sie ähnelt einem hoch aufgetürmten Heuwagen, den man früher Heufuder nannte. Aber er gleicht auch einem Sarg, sodass er auch oft als Totenlade bezeichnet wird. Der Weg auf die Bergkuppe ist beschwerlich, aber durch einen sagenhaften Panoramablick wird man belohnt. Deshalb bezeichnet man die Milseburg auch als die Perle der Rhön.
Auf dem Berg befinden sich die Kapelle, eine Kreuzigungsgruppe und Überreste einer keltischen Ringwallanlage. In der Milseburghütte kann man seinen Durst und Hunger stillen. An einem Weg zur Bergspitze sehe ich ein Hinweisschild mit einem Bild. Sofort erinnere ich mich an die Milseburgsage, die euch jetzt erzählen möchte.
Der Sage nach verdankt der Berg seinen Namen dem Riesen Mils. Dieser hauste auf der Bergkuppe in seiner Burg. Er stand mit dem Teufel im Bunde und trieb sein Unwesen. Die Menschen am Fuße des Bergmassivs hatten Angst vor ihm. Er und seine Unholde raubten das Vieh aus den Ställen, wüteten und plünderten. Sie schändeten Frauen und Mädchen und machten auch vor einem Mord nicht halt. Jeden Abend wurde auf der Burg gefeiert und Wein floss in Strömen. Unterhalb des Berges gibt es eine Wiese. Man erzählt sich, dass der Riese und seine Kumpane auf der Danzwiese oft nachts mit den Hexen getanzt haben.
Es war die Zeit, als sich das Christentum verbreitete. Mils wollte nicht, dass die Menschen sich taufen ließen. Der Riese erschwerte den heiligen Gottesmännern ihre Bekehrungsarbeit, verfolgte und quälte die Neugetauften.
Da machte sich der heilige Gangolf als Heerführer im Auftrag des Kaisers mit seinen Rittern auf, um den bösen Riesen in seiner Felsenburg zu bezwingen. Aber das war nicht so einfach. Die Burg war kaum einnehmbar, da diese auf von Natur aus nicht besteigbaren Klippen errichtet wurde, sodass der Riese bei seiner Verteidigung im Vorteil war. Dem Heer blieb nur die Belagerung.
Des Weiteren stand den Belagerern nur eine einzige Quelle zur Verfügung. Sie gehörte einem geizigen Bauern, der sich die Not der christlichen Kämpfer zunutze machen wollte. Er verlangte für die Benutzung seines Brunnens einen so hohen Preis, dass die frommen Gottesmänner die Summe nicht aufbringen konnten. Und ohne Wasser war die weitere Belagerung nicht möglich.
Der Bauer erlaubte es ihnen, nur einmal von seinem Wasser zu trinken. So ging Gangolf zu ihm, nahm seinen Helm, füllte ihn an der Quelle und bezahlte für das wenige Quellwasser. Vorsichtig ging er zu seinen Gefährten ins Lager zurück. Er goss das kostbare Nass über einen Felsblock, worauf der Felsbrocken aufsprang und aus ihm entsprang eine neue Quelle. Der Brunnen des geizigen Bauern jedoch versiegte für immer. Die neue entstandene Quelle besteht heute noch unter den Namen Gangolfbrunnen.
Diese Wunder, als nichts anderes kann man das Geschehen nennen, bestärkte Gangolf und seine Männer. Von Neuem begann der Sturm auf die Festung.
Der Riese Mils hatte nichts entgegenzusetzen. Er sah, dass es für ihn keine Rettung gab, so tötete er sich selbst aus Verzweiflung. Der Teufel warf den Mils, der ihm ein Leben lang gedient hatte, in einen Graben und schüttete über den Selbstmörder so viel Basaltstein auf, dass heute die Milseburg weit über die Landschaft schaut. Deshalb sagt man auch, dass die Milseburg einem Sarg ähnelt.
Das christliche Kreuz aber siegte auch in diesem Teil des Landes. Heute triumphiert eine Kreuzigungsgruppe auf dem Gipfel und ist weithin zu sehen.
Das, meine lieben Freunde, ist die Sage, die man sich von diesem Berg erzählt.
Dieter Geißler, geboren 1954 in Weimar. Als ausgebildeter Koch arbeitete er als Küchen- und Produktionsleiter. Heute lebt der Rentner in Frankenheim/Rhön, in der „Hohen Rhön“. Durch eine Krankheit kam er zum Schreiben. Seine Gedichte und Kindergeschichten wurden in verschiedenen Verlagen veröffentlicht.
*
Der fromme Einsiedler Johannes
Eine Sage aus der Rhön
Es gibt noch eine zweite Sage, die in der Rhön spielt. Diese handelt von dem frommen Einsiedler Johannes. Er lebte wahrscheinlich einige Jahrhunderte später im Wald der Milseburg. Die Bauern und Handwerker aus der Umgebung kamen häufig zu ihm auf den Berg. Sie suchten seinen Segen und seinen Rat. Aber auch heilsame Kräuter, die er sammelte, wollten sie von ihm erwerben. Das Volk nannte ihn nur den Milsehans.
Er war es, der als Erster auf dem einsamen Gipfel des Berges aus rauem Stein und Basalttrümmern eine kleine Kapelle nahe dem Brunnen baute. Seine Arbeit war mühsam.
War ein Felsstück zu schwer, dann rief er munter: „Hopp! Gangolf! Hopp!“, und dann hoppelte und hüpfte der Fels von selbst empor.
Als die Steinkapelle fertig war, beschloss der Einsiedler, auch ein mächtiges und hohes Kreuz zu errichten. Dies ließ er in Fulda zimmern und den steilen Berg hinauffahren. Vierundzwanzig Stiere waren erforderlich, um den Wagen mit dem schweren Kruzifix auf die Bergspitze zu bringen.
Am Fuße der Milseburg verlor der Wagen einen Felgnagel, was jedoch von niemanden bemerkt wurde, erst in der Höhe wurde das festgestellt. Und dennoch hatte man den Wagen mit dem schweren Kreuz auf den Berg gefahren. Dieses Wunder wurden dem heiligen Gangolf zugeschrieben als Dank und Liebe für den frommen Waldbruder, damit das Kreuz keinen Schaden erleide.
Als die Kapelle fertig war und das Kreuz errichtet, starb der Einsiedler. Aber bis heute weiß niemand, wo dessen Grab ist.
Das, liebe Leserinnen und Leser, ist die Sage der Milseburg. Lasst sie euch nochmals durch den Kopf gehen und schaut euch dazu auf dem Gipfel um. Was seht ihr da?
Richtig. Die Gangolfkapelle, das mächtige Kreuz, den Gangolfbrunnen und auch die Reste einer Burg kann man noch sehen. Und von Weitem gleicht der Berg einem Sarg. Also alles das, was in den beiden Sagen beschrieben wurde. Was jedoch Wahrheit und was dazu gedichtet wurde, wer weiß das schon.
Ihr seht, Sagen können genauso spannend und interessant sein wie Märchen und Geschichten. Es gibt Tausende von Sagen auf der Welt. Und sicher gibt es auch in der Umgebung euers Wohnortes Sagenhaftes zu berichten. Hört euch mal um.
Dieter Geißler, geboren 1954 in Weimar. Als ausgebildeter Koch arbeitete er als Küchen- und Produktionsleiter. Heute lebt der Rentner in Frankenheim/Rhön, in der „Hohen Rhön“. Durch eine Krankheit kam er zum Schreiben. Seine Gedichte und Kindergeschichten wurden in verschiedenen Verlagen veröffentlicht.
*
Der Kölner Dom
Eine Sage aus Köln
Vor langer, langer Zeit war die Stadt Köln von Kirchen geradezu übersäht. Darinnen dienten die Frommen Gott. Doch die bisherigen Kirchen reichten nicht aus. Man wollte dem Herrn ein übergroßes Haus errichten. So beauftragte man Meister Gerhard mit dem Bau des heutigen Kölner Doms. Dämonische Späher des Teufels trugen die Nachricht über den Bau an ihren Herren heran. Ging es bisher friedlich und ruhig im Inneren der Erde, dem Reich des Dunkeln, Sitz des Teufels, zu, so wurde es nun durch die Wut des Teufels erschüttert. Einige Dämonen wichen schnell auseinander und verließen fluchtartig den Thronsaal des Teufels, um Schutz vor den Steinen zu suchen, die von der Höhlendecke herabstürzten. Eine Wolke aus Staub und Sand wirbelte auf. Als sich der Staub langsam legte, näherte sich ein einziger übrig gebliebener Dämon einem Felsbrocken, vor dem irrlichterne Flämmchen flackerten. Dieser drehte sich nun um die eigene Achse, sodass der Teufel sichtbar wurde. Er saß umringt im Schein der brennenden Flammen. Er trug ein glänzendes, rotes Gewand, das bis auf den Boden reichte. Unter dem Gewand lugten Bocksfüße hervor. Die stechend glühenden Augen wurden von dichten, schräg stehenden Brauen gesäumt, die den diabolischen Ausdruck vom Teufel unterstrichen.
„Wenn es wahr ist, was du mir berichtest“, schmetterte der Teufel seinem Untergebenen entgegen, „sind die Menschen, vor allem dieser Bauherr hier, zu weit gegangen. Ich muss dringend etwas gegen die Fertigstellung dieser Kirche tun. Für Gott sind bereits genug Kirchen in Köln errichtet worden. Mir reicht es langsam.“ Der Teufel erhob sich von seinem Thron zu seiner vollen Größe.
Der Dämon wich einen Meter zurück. Das Flammenhaar des Teufels konnte eine noch unangenehmere Hitze verbreiten als das Höllenfeuer selber. Auch roch der Teufel penetrant nach Schwefel. Keiner seiner Gefolgsleute konnte den Geruch lange ertragen. So blieb man lieber auf Abstand. Nur die Fliegen schienen den Geruch zu mögen. Sie umkreisten den Teufel. Mit kühlem Blick betrachtete er seinen Diener, der verängstigt vor ihm niederkniete. Der Teufel lachte laut auf. Von dieser Angst ernährte er sich.
„Du kannst gehen. Auch wenn du meine Ruhe gestört hast, so hast du mir von diesem verachtenswerten Bauwerk berichtet. Ich mache mich nun auf den Weg in die Menschenwelt. Bewache meinen Thronsaal, bis ich zurückkomme.“ Mit diesen Worten verschwand der Teufel.
Im Licht des hellen Morgens schritt Meister Gerhard an der Großbaustelle entlang, die rund um den Kölner Dom errichtet worden war. Die Handwerker waren bereits fleißig dabei, am Dom zu arbeiten. Zufrieden betrachtete Meister Gerhard das seit einigen Wochen angefangene Werk. Die Arbeiten schritten gut voran. Gleichzeitig war Meister Gerhard jedoch auch bewusst, dass noch einiges zu tun war. Ein Wagen näherte sich in rasantem Tempo, der von einer seltsamen berittenen Eskorte begleitet wurde. Sobald der Wagen vor Meister Gerhard stehen blieb, stieg ein Mann aus der Kutsche. Meister Gerhard grüßte den Fremden, den er, dem reich verzierten Gewand nach zu urteilen, als Kaufmann einschätzte.
An dieser Stelle will erwähnt sein, dass der Teufel verschiedene Gestalten annehmen konnte, wodurch er nicht leicht für die Menschen zu erkennen war.
Das Einzige, was Gerhard etwas störte, war ein eigenartiger Geruch, der von dem Kaufmann ausging. Meister Gerhard überlegte die ganze Zeit, woran ihn der Geruch erinnerte. Doch er kam nicht darauf.
Der fremde Kaufmann lächelte Meister Gerhard freundlich an. „Wissen Sie, wer die Aufsicht für den prachtvollen Bau hat? Ich komme aus der Trierer Gegend und wollte eigentlich kaufmännischen Geschäften auf dem Markt nachgehen, als ich von einigen Markthändlern von dem gewaltigen Bau eines Domes hörte, der alles bisher Errichtete in den Schatten stellen soll. Ich dachte, es wären Gerüchte, und wollte mich selbst überzeugen. Doch was ich sehe, übertrifft die Erzählungen der Händler“, schleimte der Teufel.
Die warmherzigen Worte gingen bei Meister Gerhard herunter wie Öl. So verlor er auch jede Skepsis dem Fremden gegenüber. „Dieser Dom soll in der Tat größer werden als alle anderen Kirchen zuvor. Ich war extra in anderen Ländern unterwegs, um mich inspirieren zu lassen. Der Bau soll unseren mächtigen Gott ehren. Er kann gar nicht groß genug sein.“
„Du übernimmst ein schweres Werk. Ich würde annehmen, dass eher ein Kanal von Trier nach Köln fließt, als dass du die höchste Spitze fertig hast. Wie siehst du das?“
Gerhard überlegte kurz. Er kannte die ganze Gegend wie seine Westentasche. Trier war ziemlich weit weg. Es würde Jahre dauern, bis ein Fluss, noch dazu einer aus Trier, herüberwachsen würde.
„Ich glaube, du erlaubst dir einen Scherz, guter Kaufmann“, lachte Gerhard. „Kein Fluss kann von Trier nach Köln reichen.“
„Wir könnten doch eine Wette eingehen. Wenn ich gewinne, kann ich mir wünschen, was ich will. Wenn du gewinnst, werde ich dir so viel Gold geben, dass du für dein Leben lang ausgesorgt hast.“
Gerhard wurde nun doch etwas skeptisch. „So viel Geld kannst du gar nicht besitzen“, überlegte Gerhard offen.
Der Kaufmann holte einen großen Klumpen Gold hervor. Gerhard war sprachlos. „Davon habe ich noch reichlich“, lächelte der Kaufmann.
„Einverstanden. Der Pakt gilt.“
Gerhard und der Kaufmann reichten einander die Hände. Das war damals ein Brauch, um ein Geschäft zu besiegeln. Ehe sich Gerhard versah, stieg der Kaufmann wieder in seine Kutsche und verließ die Baustelle.
Die Jahre vergingen. Eines Tages stieg Meister Gerhard auf den Turm, der schon so hoch war, als er heutzutage ist, und das Erste, was er von oben wahrnahm, waren Enten, die schnatternd von dem Bach, den der Teufel herbeigeleitet hatte, aufflogen. Er wunderte sich. Woher war dieser Kanal so plötzlich von heut auf morgen gekommen? Gestern war an der Stelle noch keiner gewesen. Das konnte nicht mit rechten Dingen zu gehen.
„Das gibt es doch nicht“, sagte der Baumeister zu seinem Hund, der ihm auf das Gerüst gefolgt war.
Innerhalb von Sekunden zogen dunkle Wolken auf. Nacht fiel am helllichten Tag über die Gegend herein. Winde umstreiften das Gerüst. In diesem Moment fuhr ein mächtiger Blitz vom Himmel, der in den Hund einschlug. Der Schreck stand Meister Gerhard ins Gesicht geschrieben. Vor ihm stand nun in ein rotes, wehendes Gewand gehüllt der Teufel persönlich. Meister Gerhard erkannte ihn an seinen Hörnern.
„Ich bin gekommen, um unseren Pakt einzulösen. Ich erschien dir damals als Kaufmann. Du hast versprochen, mir zu geben, was ich wünsche. Ich möchte nichts mehr und nichts weniger als deine Seele.“
Meister Gerhard begriff den fatalen Fehler, den er gemacht hatte. Er hätte nie und nimmer mit einem wildfremden Menschen ein derart seltsames Geschäft eingehen sollen. Warum war ihn dieser Kaufmann nicht vorher seltsam aufgefallen? Der strenge Geruch, den Meister Gerhard damals wahrgenommen hatte, drang erneut zu seiner Nase. Schwefel. Nun bemerkte er auch einen Schwarm Fliegen, die den Teufel umkreisten. Mit einem Mal überkam Meister Gerhard so viel Panik, dass er aus lauter Angst beschloss, sich eher in die Tiefe zu stürzen, statt dem Teufel sein Leben zu geben.
Bis heute konnte der Dom nicht vollendet werden. Immer wieder fielen vereinzelte Steine herab oder es kam zu aufwendigen Restaurationen. Was man bis heute nicht wissen konnte – der Teufel hatte das Bauwerk verflucht. Es sollte nie vollendet werden.
Weitere Jahre verstrichen. Womit der Teufel nicht gerechnet hatte: Die Gebete der gläubigen Menschen erreichten seinen Gegenspieler – Gott. Gott beobachtete von seinem Himmelsthron aus das Geschehen um den Kölner Dom bereits seit Jahrhunderten.
Ihm gefiel nicht, dass der Teufel den Bauherrn verführt hatte. Auch gefiel ihm nicht, mit anzusehen, dass die Kirche, die man ihm zu Ehren errichtet hatte, mit einem Fluch belegt worden war und immer wieder einzelne Teile herabstürzten. Das Bauwerk schien wirklich nie zu Ende zu kommen.
Gott grübelte. Eigentlich wollte er nicht in das Geschehen der Menschen eingreifen. Doch dieses Mal war der Teufel endgültig zu weit gegangen. Des Weiteren erreichten die Gebete der Menschen über die Jahrhunderte hinweg in diesem Moment gesammelt sein Herz. Diese bewegten ihn dazu, seinen Himmelsthron zu verlassen und zur Erde herabzusteigen.
Keiner – außer einem betrunkenen Mann – bekam mit, wie aus dem Nichts ein Mann in einem weiten, weißen Gewand auf der Domplatte erschien. Der betrunkene Mann lehnte an einer der Ecksäulen des Domes. Er schlief seinen Rausch aus, als er eine merkwürdige Lichterscheinung wahrnahm, die obendrein noch von einem weiteren seltsamen Mann in einem weißen Gewand begleitet wurde. Der betrunkene Mann rieb sich die Augen. Waren das Flügel auf dem Rücken des wesentlich kleineren Mannes?
„Ich glaub, ich halluziniere“, sagte der betrunkene Mann zu seinem Hund, der als einziger treuer Gefährte neben ihm lag. Der Hund reagierte nicht. Er schlief.
„Du hast recht, Lupo. Ich sollte besser auch wieder schlafen. Ich muss geträumt haben.“ Der betrunkene Mann beschloss, sich wieder auf die kalten Steinplatten zu legen.
Gott beobachtete den Mann. Er hatte Mitleid.
„Eigentlich hätte mich der Mann nie sehen dürfen“, sagte Gott zu seinem Beraterengel Michael.
Michael nickte zustimmend. „Er ist angetrunken. Er glaubt, er habe geträumt.“
„Ich werde ihn verschonen“, überlegte Gott. „Sorge bitte dafür, dass er vergisst, was er gesehen hat. Ich kümmere mich in der Zwischenzeit um die Aufhebung des Fluches.“
Während Gott einen uralten Spruch aufsagte, der den Fluch aufheben sollte, näherte sich der Engel dem betrunkenen Mann. Dieser schlief inzwischen tief und fest. Der Engel legte seine Hand auf die Stirn des Mannes. Für einen Moment wurde es warm und hell um den Mann herum. Lächelnd gesellte sich Michael zu Gott zurück. Die Erinnerung an den heutigen Abend war gelöscht worden.
„Es ist gut, dass der Mann betrunken war. Er wird morgen glauben, er habe einen Filmriss“, erklärte Michael.
Gott nickte zufrieden.
„Ich bin hier mittlerweile auch fertig. Lass uns zum Himmel zurückkehren.“
So wie Gott und sein Engel aus dem Nichts erschienen sind, so verschwanden sie auch wieder. Nachdem Gott den Fluch des Teufels aufgehoben hatte, wurde der Dom fertiggestellt. Es fiel kein einziger Stein mehr herunter. Warum? Das konnte sich keiner erklären.
Vanessa Boecking:Autorin verschiedener Genres, erste Wettbewerbsauszeichnungen, „Damian, der Zauberer“, Fantasybuch, „Osiris, die Supermumie“, Fantasybuch.
*
Alle sieben Jahre wieder
Eine Sage aus Bayern
Der Schäfflertanz, nun ja, wird man ihm als Zuschauer teilhaftig, lässt er einen so schnell nicht wieder los. Alle sieben Jahre treten die Schäffler auf – Schäffler meint übrigens Fassküfer und Fasshersteller. Seit 1760 in diesem Zyklus.
Zur Faschingszeit tanzen sie auf privaten Geburtstagen und werden einbestellt zu amtlichen Gebäuden, wo sie dann mit ihren einstudierten Choreografien Station machen. Mittlerweile sind die Zugangsvoraussetzungen gelockert. Um Schäffler zu werden, musste man früher unverheiratet sein, von tadellosem Leumund sowieso. Schäfflermeister und ihre Söhne kamen für eine Beteiligung nicht infrage.
Die Zeiten ändern sich, mit ihnen die Gepflogenheiten. Man hat um Traditionen zu kämpfen, ein über Jahrhunderte etabliertes Kulturgut gilt es aufrechtzuerhalten. Dieser Entwicklung ist es zu verdanken, dass Verheiratete und Menschen aus ganz anderen Berufssparten seit den 60ern des abgelaufenen Jahrhunderts Zugang erhalten zu den durchaus fröhlich gemeinten Tänzen.
Angeblich, das jedenfalls behauptet eine Legende, sollen die ersten Fährten des Zunfttanzes auf 1517 verweisen. Während eine Pestepidemie das Volk in ungebührlicher Menge dezimiert haben soll, wurden Schäfflertänze zum Schauplatz sozialer Kontakte, zum Ablenkungsmanöver vom schwarzen Alltag, so lautete der Antrieb. Jene Legende darf getrost bezweifelt werden, nimmt sie doch ihren Ausgang vermutlich im 19. Jahrhundert.
Tatsächlich sind die Todeszahlen laut Statistik für 1517 keineswegs hervorstechend. Eine verlässlichere Datierung fällt aufs Jahr 1702. Der Münchner Schäfflertanz wurde da erstmalig dokumentiert. Nach 1830 florierte das Brauchtum. Wandernde Schäfflergesellen haben den Tanz verbreitet, aber auch Turnvereine sind vermehrt entstanden, und insbesondere in den altbayerischen Regierungsbezirken fand er Anklang.
Kasperle, die vorzugsweise regionale Berühmtheiten aufs Korn nehmen, deren Gesichter in ihrer Buntheit den Gestalten renommierter Karnevalsumzüge in nichts nachstehen, tummeln sich im Bad der Vortragenden. Da hat es Vortänzer, mit Hämmern wird auf Fässer gehauen und die Augen der Zuschauer beginnen zu leuchten, sobald der Reifenschwinger einen Holzreifen kreisen lässt. Auf einer eingearbeiteten Stelle, die etwas breiter ist, steht ein Stamper gefüllt mit Schnaps oder alternativ ein Weinglas. Es wird geschwungen, ausbalanciert, gelegentlich kommt es vor, dass zwei oder sogar drei Gläser mit alkoholischen Getränken positioniert sind, und gelingt es, was überraschend häufig der Fall ist, dass bis zur finalen Drehung kein Tropfen verschüttet wird, ist der Jubel groß.
Kinder am Rande der Tanzfläche, in der Obhut ihrer Eltern, ahmen die Schrittabfolgen der Tänzer nach und rasch ist vereinbart, dass ausgerechnet sie die nächsten Schäffler werden wollen.
In roten Jacken kostümierte Herren hieven ihre Beine in die Höhe und wippen mit ihren an beiden Abschlüssen festgehaltenen Tanzreifen. Beim letzten Auftritt der Saison, mit Fackeln in nächtlicher Dunkelheit findet er statt, werden diese Reifen zerschmettert und ins Publikum geworfen. Mit ihren grünen Kappen, ein weißer Federbusch befindet sich obenauf, grüßen die Tänzer dann und wann, zumeist unbestimmt, in die Schar der Zuseher.
Eine athletische Herausforderung. 20 Vorstellungen, wohlgemerkt täglich, überschreiten sie nicht selten. Jene gebündelte Betriebsamkeit geht an die Substanz.
Wegen der Covid-19-Pandemie erfolgten im Mai 2022 außertourliche Auftritte. Bitte vormerken: 2026 geht’s in die nächste Runde. Pfaffenhofen an der Ilm, Geisenfeld, Eichstätt und Ingolstadt, um nur einige beispielhafte Plätze zu nennen, gehören zu den Austragungsorten.
Wer außerhalb der interaktiven Shows die Tanzkünste der Schäffler nicht missen möchte, dem sei die untere Etage des Glockenspiels am Münchner Neuen Rathaus angeraten, denn hier wird der Tanz mithilfe von Figuren dargestellt, anschaulich und noch dazu ganzjährig. Auch in einem der Reliefs am so bezeichneten Wurmeck ist er verkörpert, der Schäfflertanz. Schäfflerbrunnen gibt es in Augsburg und Geiselhöring.
Kaum ein Landstrich bleibt unbehelligt von dem Spektakel. Ausflüge zu den Tänzen, und seien sie verknüpft mit einer kilometerreichen Anfahrt, sind gerade mit Kindern ein Vergnügen. Sie bekommen ihre Münder gar nicht mehr zu, ihre Gesichter spiegeln das unbeschwerte Glück, das die Tänzer vermitteln.
Oliver Fahn wurde 1980 in Pfaffenhofen an der Ilm im Herzen Oberbayerns geboren. Der Heilerziehungspfleger lebt bis heute zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in der Kreisstadt. Fahn veröffentlicht regelmäßig Beiträge in Kulturmagazinen und verfasst Texte für Anthologien.
*
A Souls Last Dance
Eine Sage aus Korea
Seit Tagen durchstreifte er die Wälder, den Spuren des Tigers folgend. Die Nacht war erneut hereingebrochen.
Es war gefährlich, nachts durch den Wald zu wandern. Die wilden Tiere, einschließlich der Tiger, waren ihm bei Nacht überlegen. Auch die Geister hatten bei Nacht leichtes Spiel mit verirrten Seelen. Doch er konnte nicht kehrtmachen. Sein Wille und sein Hass trieben ihn stetig voran.
Es war vor drei Tagen gewesen. Hana hatte Wasser geholt, wie jeden Tag. Doch sie war nicht wieder ins Dorf zurückgekehrt. Am Fluss hatte ihr Krug gelegen, zerbrochen, die Scherben mit Blut bedeckt. Und Spuren des Tigers im Uferschlamm. Der Junge hatte keine Zeit an einem weiteren Gedanken verschwendet und war mit seinem Messer aufgebrochen. Heiße Wut kochte in seinem Inneren. Er war fest entschlossen, den Tiger zu finden. Er würde ihn töten und seine kleine Schwester rächen.
Er war ihm dicht auf den Fersen, das spürte er. Seine Hand hielt das Messer fest umklammert, bereit, dem Tiger jeden Augenblick gegenüber zu stehen.
Plötzlich vernahm er hinter sich ein Fauchen und fuhr herum. Gestreiftes Fell war in der Dunkelheit zu erahnen. Auf einem bemoosten Felsbrocken lauerte der König des Waldes. Das Tier hob majestätisch den Kopf und bleckte die Zähne. Entschlossen hob der Junge das Messer. Doch als der Junge ausholte, sprang der Tiger ab und riss seinen Jäger mit gewaltiger Kraft zu Boden. Das Messer glitt aus dem Griff des Jungen, prallte klirrend auf dem felsigen Untergrund auf. Panisch versuchte der Junge, auf die Beine zu kommen und sein Messer zu schnappen.
Doch die Fänge des Tigers bohrten sich bereits in seine Seite. Ein dumpfes Knacken ertönte, als der Kiefer des Tigers Knochen zertrennte. Vor Entsetzen kochendes Blut sprudelte aus der Wunde hervor, färbte die Kleidung rot.
Der Tiger bleckte die Zähne und sah auf seinen besiegten Gegner herab. Dann sprang er davon und überließ ihn seinem Schicksal.
Der Junge stöhnte vor Schmerz und verfluchte seine Dummheit. Wie hatte er glauben können, einen Tiger töten zu können? Es gab niemanden, der es mit ihm aufnehmen konnte. Es war töricht gewesen, den König des Berges zu jagen, und dieser wusste ihn für seine Dummheit zu bestrafen.
Der Körper des Jungen lag bereits in einer Lache aus seinem eigenen Blut. Er blinzelte in das Licht des Vollmondes. Es schien plötzlich dunkler zu werden. Immer dunkler, bis schließlich alles um ihn herum in Dunkelheit versank. Die Klänge des Waldes wurden leiser und der Junge spürte, wie seine Seele in eine verschlingende Finsternis davon trieb.
Als die Welt eine neue Gestalt annahm, fand sich der Junge am Rande einer Lichtung wieder. Ein voller Mond schien vom sternenklaren Himmel auf ihn herab. Zu seiner Überraschung konnte er keinen Schmerz verspüren. Die Bisswunde war verschwunden. Bevor er sich jedoch überhaupt fragen konnte, was geschehen war, bemerkte er am anderen Ende der Lichtung eine Bewegung. Das kleine Mädchen trug ein schwarzes Gewand mit goldenen Rändern. Sein Haar schien wie heißes Pech darunter hervorzufließen. Die Haut des Mädchens war bleich und schimmerte im hellen Mondlicht. Am auffälligsten waren jedoch seine blauen Augen, die wie die einer Katze leuchten.
Der Junge meinte, diese Augen schon einmal gesehen zu haben. An einem Mädchen, das ihm sehr viel bedeutet hatte, für das er bereit gewesen war zu sterben. Doch er konnte sich nicht mehr erinnern.
Das Mädchen kam immer weiter auf ihn zu, seine Füße schienen den Boden kaum zu berühren. Gleichzeitig bemerkte der Junge weitere Gestalten, die zwischen die Bäumen traten und dort regungslos verharrten. Sie waren wie dunkle Umrisse, in weite Umhänge gehüllt, die Gesichter in der Dunkelheit verborgen. In den Händen hielten sie Trommeln aus Holz und Tierfellen.
Als das Mädchen nur noch wenige Schritte von ihm entfernt war, begannen die Gestalten, leise auf die Trommel zu schlagen.
Die blassen Lippen des Mädchens formten ein geheimnisvolles Lächeln und langsam breitete es die Arme aus. Erst jetzt bemerkte der Junge den Tigerzahn, der an einem roten Band um den dünnen Hals des Mädchens hing.
Der Klang der Trommel verschmolz mit der Nacht und dem entfernten Heulen der Bergwölfe. Fremde Worte erklangen, die Gestalten begannen, eine Melodie zu singen, älter als die Gezeiten, aus dem Herzen des Berges. Das Mädchen begann zu tanzen, wiegte seinen Körper im Rhythmus der Trommeln, warf den Kopf in den Nacken und hob die Arme in den nächtlichen Himmel.
Tief in sich verspürte der Junge Angst. Er wusste, dass er wegrennen sollte. Doch etwas hielt ihn fest, verzauberte ihn, sodass er seine Augen nicht von dem Tanz des Mädchens lösen konnte. Er spürte, dass er dieses Mädchen einmal gekannt hatte. Er hatte das unbestimmte Gefühl, nach Hause zu kommen.
Die Trommeln schienen näher zu kommen, das Mädchen schritt auf ihm zu und hielt ihm ihre bleichen Hände entgegen.
„Komm mit.“
Sein Lächeln war voller Wärme, die geflüsterten Worte klangen so unheimlich vertraut. Wie in Trance griff er danach und ließ sich von dem Mädchen von der Lichtung führen, tiefer in die Nacht. Die Gestalten folgten ihnen, ihre Stimmen und Trommel hallten geisterhaft durch die Luft.
„Wohin führst du mich?“
Das Mädchen lächelte, als hatte es seine Gedanken gehört. Es hob die Hand und deutete nach vorne. Dort erhob sich ein Felsen, der wie der Kopf eines Tigers geformt war. Das Maul war weit aufgerissen, in seinen steinernen Rachen führte ein in den Fels gehauener Pfad hinab in die Tiefe.
Als sie den Felsen erreicht hatten, blieb das Mädchen stehen. Fast feierlich trat es zur Seite, um dem Jungen den Weg in das steinerne Tigermaul frei zu geben. Sein schmaler Körper wiegte sanft im Takt der Trommeln hin und her. Seine Augen leuchteten freudig und ermutigten ihn, einzutreten. Zögerlich trat der Junge einen Schritt vor. Noch immer fühlte er sich von der fremden Macht angezogen, spürte, wie das Mädchen ihn in das Maul des Tigers zog. Die Trommeln und die Stimmen wurden immer lauter, bis selbst der steinerne Boden zu erzittern schien. Als er in das Maul eingetreten war, öffnete das Mädchen die Augen und begann wieder zu tanzen. Er schritt langsam in Tiefe, in eine Dunkelheit, die selbst seinen Atem verschlang.
Kaum dass der Junge nicht mehr zu sehen war, verstummte die Musik abrupt. Auch das Mädchen hatte aufgehört zu tanzen. Langsam griff es in die Tasche ihres Gewandes und holte eine weiße Blume hervor.
Ein glückliches Lächeln lag auf ihren Zügen, als sie in die Knie ging und die Blume vor das Maul des Tigers legte.
Anmerkung: Ein Changgwi ist in der koreanischen Mythologie der Geist eines Menschen, der von einem Tiger getötet wurde. Er kann nicht sterben und muss dem Tiger bis in alle Ewigkeit dienen. Um diesem Schicksal zu entkommen, lockt der Changgwi andere Opfer an, meist Mitglieder seiner Familie, damit sie seinen Platz einnehmen.
Emma Bätzel, geboren 2006, lebt in Eisenach. Ihre Leidenschaften sind das Schreiben, die Natur und fremde Sprachen und Kulturen. Zu ihren bevorzugt dramatischen Geschichten lässt sie sich oft von Musik inspirieren.
*
Damals auf dem alten Friedhof
Eine Sage aus Lampertheim
Der Friedel war ein stolzer junger Mann. Deshalb nagte es lange an ihm, dass er den zwei Bauernmädchen Lisette und Annemarie aus dem Kirchenchor so aufgesessen war. Auf dem alten Sedansplatz-Friedhof hatten sie ihm abends aufgelauert, und Lisette, mit einem weißen Betttuch als Gespenst verkleidet, hatte ihm einen gehörigen Schrecken eingejagt. Wochenlang ging er danach kaum aus dem Haus, mied das Wirtshaus und die Chorprobe, weil er das Gefühl hatte, dass ganz Lampertheim über ihn lachte.
Irgendwann aber fiel ihm zu Hause die Decke auf den Kopf und er wollte unter Leute. Dummerweise waren seine Eltern jedoch auf Verwandtenbesuch im Odenwald, sodass er Opa Friedrich versorgen musste, der schon recht gebrechlich war. Als nun der Abend kam, packte er den Alten kurzerhand auf den bequemen Ohrensessel, stellte ihm eine große Tasse Tee an die Seite und machte sich auf zur Chorprobe. Nur mal vorbeischauen, nahm er sich vor, ein paar Worte mit den Kameraden tauschen und dann gleich wieder heim.
Er wurde mit großem Hallo begrüßt. Es wurde Bier getrunken und gescherzt und irgendwann stellte Friedel erschrocken fest, dass die Uhr schon halb elf zeigte. Hastig verabschiedete er sich von den Freunden und eilte nach Hause. Kurz entschlossen wählte er dabei die Abkürzung über den alten Friedhof.
Keine gute Idee, wie sich herausstellte, denn es war ziemlich düster, der Mond hinter Wolken verborgen. Also war Friedel gezwungen, langsam zu gehen, um nicht über ein Grab zu stolpern und zu stürzen. Vorsichtig setzte er einen Fuß vor den anderen, als er plötzlich im Dickicht ein Geräusch hörte. Ihm war, als hätten Äste geknackt, gefolgt von einem leisen Knurren.
Das konnten doch nicht wieder die Mädels sein, dachte er. Wie sollten die auch wissen, dass er heute hier gehen würde?
Nun raschelte welkes Laub unter schleichenden Schritten.
Gewiss waren ihm ein paar Spaßvögel vom Chor gefolgt, um ihm erneut einen Streich zu spielen, so nahm er an. Deshalb blieb er forsch stehen und forderte sie auf, sich zu erkennen zu geben.
Da sprang plötzlich eine weiße Gestalt hinter einem Grabdenkmal hervor und kam auf ihn zu.
„Genug der Scherze“, rief er verärgert, doch schon stürzte sich der Angreifer auf ihn und riss ihn zu Boden. Sogleich saß er auf Friedels Brust und aus dem modrigen Leichentuch, das er trug, zog er seine Arme hervor und fuhr dem armen Burschen mit der Rechten an die Kehle. Seinem linken Arm fehlte die Hand, doch mit dem Stumpf versuchte er, Friedel am Kopf zu treffen. Der schaute hoch ins Gesicht des Unholds, einer im Dunkel kaum erkennbaren Fratze mit einer Lederklappe über dem linken Auge.
„Wo haben die Scherzbolde nur solche Masken her?“, fragte er sich noch. Dann aber wurde ihm klar, dass der Kerl ernsthaft versuchte, ihn zu würgen. Das wurde ihm dann doch zu bunt. Mit aller Kraft stieß er den unter dem Tuch ziemlich mageren Burschen von sich, wobei dieser ihm die goldene Kette mit seinem Kruzifix vom Hals riss. Behände sprang er auf, packte sich ein verwittertes Holzkreuz von einem nahen Grab und schlug damit auf den Unbekannten ein, bis dieser kreischend das Weite suchte und in der Nacht verschwand.
In den nächsten Tagen erzählte Friedel jedem, der es hören wollte, von seiner Heldentat. Auch in der nächsten Chorprobe lieferte er den Kameraden einen Bericht, in dem sein Mut und seine Geistesgegenwart besonders hervorstachen. Er hoffte, dass der Angreifer unter seinen Zuhörern stand und sich ordentlich über den Spott ärgerte, mit dem Friedel das Möchte-gern-Gespenst überzog.
Beim anschließenden Umtrunk aber nahm ihn der alte Bernhard zur Seite. „Sag mal, Junge“, sprach er ihn an. „Hast du eigentlich schon mal vom bösen Gehrmann gehört?“ Und als Friedel verneinte, fuhr er fort: „Der Gehrmann war ein schlimmer Tunichtgut. Wenn er besoffen war, fing er mit allen Leuten Streit an. Und er war immer besoffen. So manche Wirtshausschlägerei ging auf sein Konto. Und wenn er dabei Prügel bezog, torkelte er anschließend heim und riss die Gartenzäune der Nachbarn um. Niemand hat getrauert, als er endlich starb.“
„Ein wirklich übler Bursche offenbar“, stellte Friedel fest. „Aber warum erzählst du mir das, Bernhard?“
Der Alte machte ein sehr ernstes Gesicht. Bedächtig legte er Friedel eine Hand auf die Schulter, um seine ganze Aufmerksamkeit zu erhalten. Schließlich sagte er: „Der böse Gehrmann war als junger Kerl im Krieg gewesen. Da hat er ein Auge verloren. Auch seine linke Hand ist damals auf dem Schlachtfeld geblieben, verstehst du?“
Friedel lachte ungläubig auf. „Willst du behaupten, dass ich einen Geist verhauen habe? Das war doch nur ein dummer Schabernack von einem der Kameraden. Lass gut sein, Bernhard, aber an Geister glaube ich wirklich nicht.“
Da sagte der alte Chorbruder nichts mehr.
Aus dem Friedel ist später ein guter Ehemann und respektabler Herr Schullehrer geworden. Von Gespenstern auf dem Sedansplatz-Friedhof wurde nie wieder berichtet. Als man aber Ende der 1870er-Jahre den mittlerweile wild bewachsenen Platz rodete, fand man auch das Grab vom bösen Gehrmann. Der war längst zu Staub verfallen. Aber als man sein fadenscheiniges Leichentuch aus der Erde zog, fiel aus seinen Falten eine goldene Kette mit einem Kruzifix.
Helmut Blepp,geboren 1959 in Mannheim, Trainer und Berater (Arbeitsrecht). Vier Lyrikbände, zahlreich in Anthologien und Magazinen vertreten. Er lebt in Lampertheim.
*
Die Verführung eines Losensteiner Burgfräuleins
Oder wie man in eine wohlhabende Familie einheiratet.
Eine Sage aus Losenstein
Die Losensteiner Burg ist ein sicherer Ort. Bereits im frühen Mittelalter schützten Pech und schwefelige Firewalls die dort ansässigen Burgbewohner vor zudringlichen Eindringlingen. Vor Räubern und Hausierern. Vor Zahlungseintreibern des Kaisers. Vor lästiger Verwandtschaft und vor Mitgiftjägern, denn immer auch befanden sich ein paar Täubchen auf der Burg. Die Täubchen in dieser Geschichte sind von hochwohlgeborener Gestalt und überbehütet. Heute würde man ihre Eltern als Helikoptereltern bezeichnen. Damals gab es diese Bezeichnung noch nicht. Was es dagegen gab: Anstandsdamen, die in dieser Erzählung zu sorglos mit ihren Verpflichtungen umgehen.
Weil also den beiden Täubchen langweilig ist und die Anstandsdamen nachlässig sind, kommen die beiden hübschen Weibsbilder – Apollonia (17) und Agatha (16) – zuweilen auf ungewöhnliche Eingebungen. Aber seien wir doch ehrlich: Begehen wir nicht alle ab und zu übermütige Taten, wenn wir nicht wissen, wie wir uns sinnvoll beschäftigen sollen?
Manche wenden sich übermäßigem Alkoholgenuss zu. Andere stricken einen dicken Wollschal um den nächsten. Einfallsreiche neigen dazu, den Garten mit Grünzeug zu bepflanzen. Grünzeug, das Frau als Tee genießen oder rauchen kann oder zumindest dazu verwenden, um jemanden ins Gras beißen zu lassen. Männer dagegen lieben es, ihr Lieblingsauto im Minutentakt zu putzen. Sie polieren es auf Hochglanz. So lange, bis der Lack ab ist und sie ein neues Auto erwerben müssen. Auch im Mittelalter verfuhr man zur Bekämpfung von Eintönigkeit ähnlich. Man wandte sich übermäßigem Alkoholkonsum zu.
Man stickte und nähte an irgendwelchen Stofffetzen herum, bis niemand mehr wusste, was der Lappen ursprünglich hätte werden sollen. Als Schlossherrin ließ man interessantes Grünzeug im Schlossgarten pflanzen, um es später zum Wohle aller zu verwenden. Oder um die Verwandtschaft zu informieren, dass ein lieber Angehöriger nach kurzer, jedoch schwerer Krankheit unerwartet verstorben sei. Mann begutachtete Keuschheitsgürtel, vor allem jenen der Ehefrau, striegelte liebevoll die blonde Mähne seines Pferdchens und die der Geliebten.
Doch zurück zu Apollonia und Agatha. Den beiden Fräuleins ist Kreuzsticheln, Gobelinsticken und das nach unverheirateten Rittern Ausschauhalten längst zu alltäglich geworden. Auch der wiederkehrende Drang, im zugigen Plumpsklo menschliche Bedürfnisse zu erledigen, kann kaum als fröhliche Abwechslung im Tagesablauf bezeichnet werden.
Agatha scheiterte erst kürzlich daran, den berühmten Wandteppich von Bayeux nachzusticken. Die aus Frankreich erhaltene Vorlage war optisch von minderer Qualität. Dennoch bearbeitet sie auch jetzt wieder ein Stück grobes Leinen. Sie verziert es geschickt mit Flößen und Booten, mit muskulösen Männern, die die Wasserfahrzeuge auf der Enns steuern, mit hübschen Marktfrauen, Händlern, Dieben und fantasievoll aussehenden Tieren.
Apollonia dagegen liest gerne. Die burgeigene Bibliothek ist beachtenswert. Kochbücher, die Apollonia als uninteressant abgetan hat, sind längst entfernt worden, damit die Küchenangestellten nach darin befindlichen Rezepten ihre Kochkünste erproben können. Dass kaum ein Küchenbediensteter lesen kann, Apollonia und Agatha in dieser Hinsicht privilegiert sind, kommt keiner der beiden Frauen in den Sinn. Sich eine Beschäftigung zu suchen, zum Beispiel den Abtritt zu reinigen, wäre den hübschen Maiden ebenso wenig eingefallen. Was daran liegt, um die Jungfrauen in Schutz zu nehmen, dass der Abtritt wahrlich ein Selbstläufer ist. Eine echte Selbstreinigungsanlage, die sich schon jahrzehntelang bewährt hat und wohl noch Jahrhunderte bewähren wird. Frei nach dem Motto: Rauf, raus, runter. Rauf auf den Sitz. Raus mit allem Überflüssigen. Runter damit nach Losenstein. Der Schwerkraft, die bereits von Galileo Galilei beschrieben worden war, sei Dank.
Toilettenpapier ist noch nicht erfunden, kann daher auch nicht zur Neige gehen. Handhygiene ist in gewissem Ausmaß Selbstverständlichkeit, wenn es auch bisweilen der Überwindung bedarf, seine Gebrauchshand im bereitgestellten Eimer mit kaltem Frischwasser abzuspülen. Vor allem dann, wenn man weiß, dass zuvor der halbe Hofstaat seine Pfoten in diesem Eimer hatte, das Frischwasser also nicht mehr frisch ist. Dann doch lieber den Saum des Kleides für die dringlich notwendige Reinigung verwenden. Oder die dicken, recht unerotischen Wollstrümpfe, die immer ein wenig nach Schafmist müffeln. Außerdem: Man sollte es mit übermäßiger Hygiene ohnehin nicht übertreiben, denn‚ wisset: Noch nie ist ein Adelsgeschlecht ausgestorben, weil es sich die Hände nicht gewaschen hat. In Schlachten wird gestorben, an überaus lästigen Seuchen wird gestorben oder weil man sich überfressen hat oder zu durstig und nicht trinkfest genug war. Aber nicht wegen schmutziger Hände.
Apollonia und Agatha wissen wohl, dass früher die Zeiten weitaus abenteuerlicher waren. Der Fluss, die reißende Enns, die von Losensteiner Recken auch heute noch streng kontrolliert wird, war immer schon Tummelplatz wilder Gesellen. Die gibt es immer noch. Die kann man von der Burg aus in Augenschein nehmen. Aus distanzierter Sicherheit. Recht appetitliche Exemplare befinden sich unter diesen Männern. Unerreichbar fern sind sie, was Sehnsüchte nährt, denn Apollonia und Agatha leben fern jeglicher Versuchungen, wären da nicht jene attraktiven Flößer, die für delikate Tagträume und nächtliche Seufzer sorgen. Seit ein Kerl namens Swarovski in Losenstein Zwischenstopp gemacht hatte, nehmen die Sehnsüchte der beiden Frauen überdies gut erkennbare Formen an.
Wie das kam?
Swarovski hatte in der Schlosstaverne zu viel konsumiert, konnte seine Zeche nicht begleichen und musste als Pfand ein Novum zurücklassen. Unfreiwillig und unter messerscharfem Zwang. Ritter Dietmar von Losenstein, der Apollonia verehrt, hatte das tolle Teil ausgelöst und der jungen Frau geschenkt. Dietmar sieht umwerfend aus, ist aber einer, der sich gerne und häufig dem Zweikampf Mann gegen Mann stellt. So einen will Apollonia nicht. Ihr Mann soll älter als 25 werden. Vielleicht 28 oder zumindest 27.
Agatha denkt diesbezüglich praktisch. Jung verheiratet, womöglich rasch Witwe. Das bietet Chancen. Insgeheim beneidet sie Apollonia allerdings um Dietmars Geschenk: ein Spekuliereisen. Mit diesem Ding schrumpfen Distanzen. Weit Entferntes erscheint bei Durchsicht furchtbar nah.
In praktischer Anwendung versuchen sich also die beiden Frauen nun im scharfsichtigen Stalking interessanter Männer. Und wenn das Aufblitzen der Objektive erst einmal unten am Fluss bemerkt worden ist, ziehen die Damen an den Burgfenstern prompt jegliche Aufmerksamkeit auf sich. Social Distancing ist wahrhaftig nicht ihr Ding. Und so macht es den beiden Jungfrauen tatsächlich Riesenspaß, ihre blanken Hintern aus den Fensteröffnungen zu strecken, um den Transporteuren am Fluss ihre üppigen Werte intensiv zu verdeutlichen. Seither verzeichnet die regionale Unfallhäufungsstatistik übrigens beachtliche Zunahmen.
Im selben Ausmaß, in dem die Verkehrsfrequenz steigt, wächst jedoch auch der Stresspegel beider Täubchen. Es ist nicht einfach, den hübschen Hintern freizulegen, ihn formvollendet zu präsentieren, sich hernach wieder schicklich herzurichten, nur für den Fall, dass die Anstandsdamen unerwartet in die Kemenate stürmen. Kaum, dass man angekleidet ist, beginnt das Spiel von vorne. Viele Lagen Röcke wollen hochgezerrt werden. Es gilt das Gleichgewicht zu suchen, sich im Rückwärtsgang an die recht schmalen Fenster anzunähern, und den Hintern … Hinzu kommt, dass kalter Wind regelmäßig die empfindlichen Kehrseiten umweht. Eine der beiden Maiden hat ihr Tun bereits bereut. Die dabei zugezogene Blasenentzündung ist heftig. Schmerzhaft ohnehin. Spott, den sie von der anderen deswegen ertragen muss, ist der Heilung nicht zuträglich. Weil aber die menschliche Leidenschaft eine energische ist, ist jegliches Leid bald vergessen und Keckheit kommt wieder zum Vorschein.
Apollonia und Agatha besitzen also Lust in rauen Mengen, Frust ebenso, bedienen sich einer winzige Portion Übermut sowie hauchfeiner Prisen Erotik und wissen instinktiv: Das alles muss raus, sonst drohen hysterische Anfälle, gefolgt von schwermütigen Phasen. Daher lüften sie auch ohne Empfehlung des Medicus regelmäßig ihre Kehrseiten.
Kommen wir zu Claus mit C wie Cäsar. Er ist einfacher Flößer. Viele Male im Monat befährt er die Enns, fürchtet sich vor Strudeln und Wirbeln, die den Fluss wild und unberechenbar machen. Freut sich, dass er bei der Bewerbung zum Flößer unter den Tisch hat fallen lassen, dass er ein sehr guter Schwimmer ist. Er hätte den Job gar nicht erst bekommen. Claus erwähnte auch seine hervorragenden Kletterkünste nicht. Klettern ist ihm zu einer lieben Freizeitbeschäftigung geworden. Überwiegend aus Not, denn immer wieder kommt Claus in die Verlegenheit, bei Gesetzesbrüchen erwischt zu werden. Genauso regelmäßig darf er ob seiner Vergehen den jeweils örtlichen Kerker für eine Weile besuchen.
Manchmal, wenn der Kerker nicht in den Tiefen einer Festung, sondern hoch oben liegt, flieht Claus aus dem Kerkerfenster und klettert – jede Ritze und jeden uneben gesetzten Stein nutzend –, hinab oder hinauf oder hinüber. Je nachdem, welche Fluchtrichtung am sinnigsten erscheint. Claus, dies soll noch erwähnt werden, wäre lieber Ritter. Er findet den Beruf des Ritters nicht nur erstrebenswerter, sondern auch romantischer als die Flößerei. Doch weil er eben Flößer und nicht Ritter ist, geschieht es, dass Claus wiederkehrend jene Stelle unter einem Felsen passiert, an dem er genauso wiederkehrend diesen wunderbar weißen, sehr runden und sinnlichen Hintern eines Edelfräuleins bewundern darf.
In diesem Fall kann es geschehen, dass er sich ablenken lässt, einen Strudel übersieht und – wie zuletzt – sein Floß gegen ein anderes Floß lenkt. Das Resultat? Eine gebrochene Nase, die Claus ein verwegenes Aussehen verleiht. Claus war spontan auf des Kontrahenten Faust aufgeprallt, um im Anschluss schwimmend ans Ufer zu gelangen, was ihm prompt seinen Arbeitsplatz gekostet hatte. Denn schwimmen hätte er nicht dürfen. Ersaufen, ja, das wäre eine Alternative gewesen. Das Floß und dessen Ladung in Stich zu lassen, war keine perfekte Entscheidung gewesen, befand sein Boss.
Seit diesem Vorfall war Claus arbeitslos. Ohne finanzielle Absicherung. Abgesehen von einer Packung exotischer Früchte – Datteln – die er beim Marktbesuch hatte mitgehen lassen. Diese süßen, goldbraunen Dinger packte Claus sorgfältig in zwei hübsche Leinensäckchen, begab sich damit vor das große Burgtor und erbat sich von einem Bediensteten eine Vorsprache beim Chef. Er sei wegen einer Fixanstellung hier, könne im Prinzip alles, was man ihm anschaffe, zur vollen Zufriedenheit erledigen und sei außerdem Rettungsschwimmer, was hier oben auf der Burg – wurde ihm mitgeteilt – eine unnötige Fertigkeit sei.
Doch in Claus’ Kopf spukt ein alabasterweißer Hintern herum. Diese Sehnsucht lässt er beim Vorstellungsgespräch klugerweise unerwähnt. Aber Claus hält ein bestechendes Argument in Händen. Er bittet darum, die gestohlenen Datteln als Geschenk für die holden Damen hinterlassen zu dürfen, was ihm gnädig erlaubt wird. Danach darf er dann allerdings einen Abgang machen, denn aktuell sei keine freie Stelle verfügbar. Er sei schlicht überqualifiziert.
Seufzend tritt Claus also den Rückzug an, wirft sehnsüchtige Blicke hinauf zu den schmalen Fenstern. Er weiß, wäre er ein kampfstarker und tapferer Ritter, hätte sich bestimmt einer der sinnlichen Damen in romantischer Liebe nach ihm verzehrt.
Während Claus noch mit seinem Schicksal hadert, vernimmt er das Klappern von Pferdehufen auf den Pflastersteinen der Burgstraße. Er tritt zur Seite, presst sich an die hohe Mauer der stattlichen Burg und begreift im wahrsten Sinne des Wortes, während eine dieser herrlichen Blechbüchsen an ihm vorüberreitet, dass die Mauer kein Hindernis für ihn darstellt.
Claus grinst.
Claus blickt nach oben.
Claus hört ein Platschen.
Neben ihm, keine drei Beinlängen entfernt, landen die Reste eines Verdauungsvorganges. Darin befinden sich Kerne, die er kennt. Dattelkerne. Verwirrt blickt er nach oben. Hin zu jenem Fenster, das die Kehrseite seines Begehrens schon mehrfach herausragend in Szene gesetzt hatte. Und genau in diesem Augenblick geschieht, was sonst nur in Kinofilmen – die noch nicht erfunden sind – vorkommt. Der Mond geht auf. Weiß und rund und begehrenswert.
Claus’ Finger finden die vorstehenden Steinbrocken in der Burgmauer wie von selbst. Seine Füße setzen sich in Ritzen, die kaum zu sehen sind. Die ersten Meter nimmt er beinahe im Flug. Die nächsten Meter immerhin noch in Windeseile. Die letzten Meter, er befindet sich bereits hoch über der Ortschaft Losenstein, sind zäh. Die Aussicht jedoch wird mit jedem zurückgelegten Schritt besser. Offenbar plagt sich dort oben eine der lieblichen Töchter des Grafen. Die Verdauung. Hätte Claus auch nur ansatzweise geahnt, dass die von ihm großzügig verschenkten Datteln für eine allergische Reaktion sorgen, die einen wundervollen Frauenkörper gerade flott anschwellen lässt, hätte er sich vielleicht geschämt.
Währenddessen: Burgfräulein Apollonia ist es gelungen, ihren entzückenden Hinterleib durch den Fensterrahmen zu schieben. Mit Genuss verspeist sie Datteln. Gleichzeitig bemerkt sie verblüfft, dass die unbeschadete Rückkehr ihres Hinterns ins Zimmer nicht möglich ist. Sie steckt fest. So fest wie ein Korkstopfen in einer Weinflasche.
Inzwischen an anderer Stelle: Eine Handbreite entfernt, liebevoll eingerahmt von dicken Efeuranken, an denen sich Claus festhält, befindet sich nun jenes Fleisch, das Claus nur zu gern mit seinen Händen kneten möchte. Doch Claus ist ein anständiger Mensch. Er weiß, dass es unabdingbar ist, sich einer edlen Dame vorzustellen. Zumindest dann, wenn einem daran liegt, die Dame im Anschluss betatschen zu dürfen.
„Edles Fräulein“, säuselt Claus, dessen Stimme gedämpft das dicke Mauerwerk durchdringt, worauf das edle Fräulein erschrickt und das Säckchen mit den verbliebenen Datteln fallen lässt.
Apollonia schimpft sich im selben Augenblick naiv und unglückselig, denn nicht nur ist sie gestraft mit einer unerklärlichen Gewichtszunahme. Nein, ihr Popo befindet sich auch noch im Freien, ist Wind und Wetter ausgesetzt. Sie kann nicht vor und nicht zurück. Und dann war da auch noch das Flüstern des Windes, das beinahe so klang, als ob …
Apollonia seufzt und lauscht. Sie hat sich sicherlich verhört. Da ist niemand. Wie auch? Sie jammert leise vor sich hin, bereut das ganze Theater bereits, das eigentlich nur dazu hätte dienen sollen, die Flößer dort unten zu necken und ihnen das zu zeigen, was sie niemals genauer würden betrachten dürfen. Schon gar nicht berühren. Und nun? Nun steckt sie hier fest. Echt peinlich. Einer Losensteiner Edelfrau absolut unwürdig. Das einzig Gute an der Situation ist, dass niemand ihr Gesicht erkennen kann, eine Identifizierung anhand ihres Hinterteils ist also ein Ding der Unmöglichkeit.
„Edles Fräulein“, hört sie wieder ein Rufen.
Eindeutig. Eine Männerstimme. Aber wie sollte ein Mann diesen steilen Felsen erklimmen können? Sie erschrickt heftig, weil jemand ihren Popo berührt.
Ihr verärgertes: „Ich furz dir in den Bart“, nötigt Claus verhaltenes Gelächter ab, während er seine Beine sicher in eine Felsnische setzt, mit einer Hand einen dicken Efeustrang ergreift und mit der anderen Hand beherzt tätschelt.
„Edles Fräulein“, kommt es drängend, „ich helfe dir gern aus deiner misslichen Lage. Dafür ist aber ein beherzter Stoß notwendig oder vielleicht“, sie spürt wieder, wie eine Hand liebkosend über ihren Hintern streicht, „vielleicht sind auch siebzehn oder zweiundzwanzig Stöße nötig. Wer weiß das schon. Ich jedenfalls nicht. Ich bin nicht gut im Rechnen. Aber ich bin hilfsbereit und fang jetzt einfach mal an, dich aus deiner echt blöden Lage zu befreien. Wir beide werden uns gegenseitig helfen, und danach“, Claus grinste in seinen Bart hinein und weiß, dass er gerade seinem Leben einen Ruck in die richtige Richtung verpasst, „wird geheiratet.“
Astrid Miglar,geboren in Steyr (Österreich), lebt im oberösterreichischen Reichraming. Sie diskutiert regelmäßig mit ihrem Mann, einem Polizisten, über den perfekten Mord, um ihren Geschichten das besondere Etwas zu verleihen. Hie und da jedoch verirrt sie sich in die Welt der Romantik, der Märchen und Sagen. www.astridmiglar.at.
*
Das Schreierbächlein
Eine Sage aus Graubünden
Im schweizerischen Graubünden, unweit der berühmten Skiorte Klosters und Davos, fließt seit vielen Jahrhunderten ein kleines Bächlein mit dem seltsamen Namen Schreier. An seinen Ufern soll man in schwülen Sommernächten bisweilen so markerschütternde Schreie hören, dass selbst den modernen Touristen mit ihren Air-Pods in den Ohren das Blut in den Adern gefriert. Die ortsansässigen Bauern scheuen sich noch heute davor, ihr Vieh über diesen Bach zu treiben, obwohl die Weide auf der anderen Seite selbst ohne chemischen Dünger vor saftigem, grünem Gras nur so strotzt.
In alten Zeiten sollen sich an diesem Ort aber gar schaurige Szenen zugetragen haben, die jedem aktuellen Horrorfilm zur Ehre gereichen würden. Bevor schwere Maschinen ins Tal kamen und einen Großteil der Wälder rodeten, waren die Bauern und ihr Vieh nämlich auf diesen zusätzlichen Futterplatz angewiesen. Doch es verging keine Woche, ohne dass mindestens zwei Kühe oder drei Ziegen auf dieser Weide von einer giftigen Schlange gebissen wurden und eines qualvollen Todes sterben mussten. Auch kam es oft vor, dass die Milch der Muttertiere von einem Tag auf den anderen so sauer wurde, dass ihre armen Kälber und Geißlein sie nicht mehr trinken konnten und bald verhungerten.
Die Not der Bauern in der Umgebung war groß und ihre Verzweiflung wuchs mit jedem toten Tier. Da kam einem von ihnen plötzlich die Idee, man könnte den ehemaligen Dorfschullehrer um Rat fragen, denn er sei ein weiser und weit gereister Mann.
Die Bauern schickten also eine Delegation von drei kräftigen Burschen zur abgelegenen Hütte des gebildeten Mannes. Dieser bot seinen jungen Besuchern nach örtlichem Brauch erst einen starken Kaffee mit Zwetschgenschnaps an und hörte dann ihren Ausführungen geduldig zu, wobei er sich ab und an nachdenklich über sein greises Haupt strich und seine dicke Nase mit leichtem Schnauben hochzog.
Schließlich fragte er die Bauernsöhne: „Habt ihr jemals unter all den Giftschlangen eine lange, weiße Boa mit goldenem Krönchen gesehen?“
Die jungen Männer schüttelten unsicher den Kopf, doch sie warfen sich auch heimlich belustigte Blicke zu, denn sie dachten wohl, der Alte habe zu tief ins Glas geguckt oder sei nicht mehr ganz bei Verstand. Der betagte Lehrer aber ließ nicht von seiner Idee ab und bestand darauf, dass die Jünglinge auch ihre Väter und Nachbarn befragen sollten. Er bat sie auch, in drei Tagen wiederzukommen. Bis dahin wolle er sich überlegt haben, wie er ihnen helfen könne.
Also verabschiedeten sich die Bauernsöhne schnell und zogen zufrieden von dannen, aber sie dachten gar nicht daran, der inständigen Bitte des alten Mannes nachzukommen. Jugendlicher Übermut und eine gewisse naive Sorglosigkeit verführten die Menschen damals wie heute zu manch unvorsichtiger Handlung. Außerdem spürten die Jünglinge wohl, dass ihr alter Lehrer eine Lösung für das Problem im Köcher trug, aber diese nur bei einer klaren Verneinung seiner seltsamen Frage zücken würde.
So kehrten sie drei Tage später unverrichteter Dinge zurück, behaupteten aber standhaft, das ganze Dorf befragt zu haben. Niemand habe je eine gekrönte Riesenschlange zu Gesicht bekommen, egal in welcher Farbe.
Der Greis betrachtete sie eine Weile scharf, rieb sich dann nachdenklich das Kinn und meinte: „Nun gut, dann kann ich euch helfen! Schafft mir bis zum nächsten Vollmond drei mittelgroße Scheiterhaufen aus Zweigen auf die Schlangen-Weide.