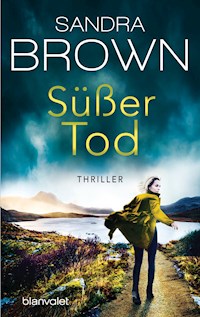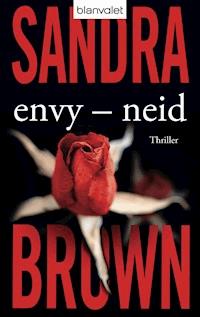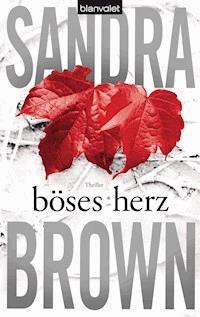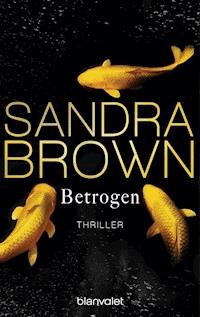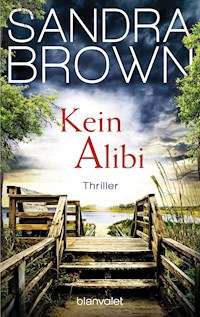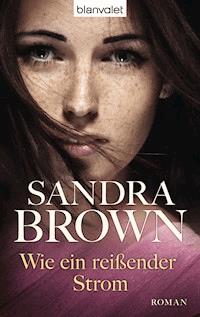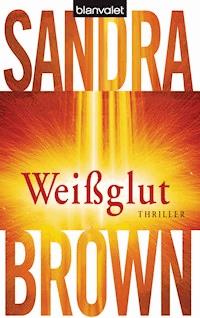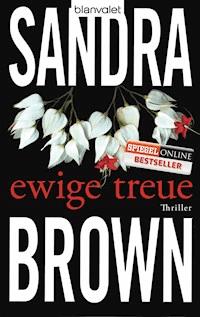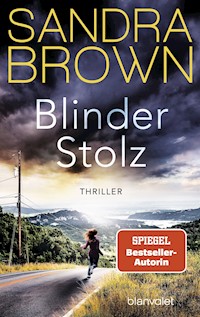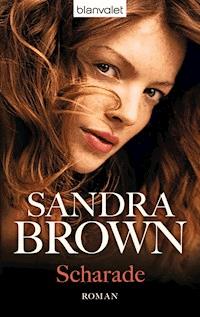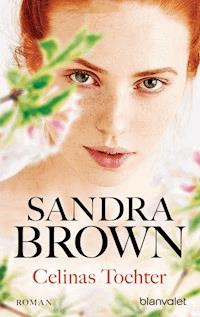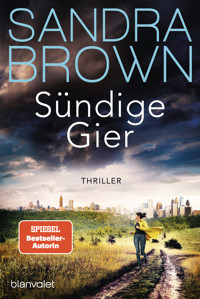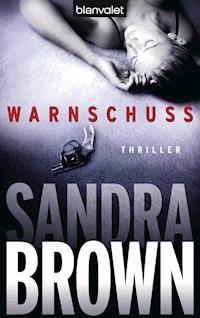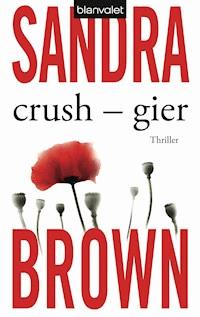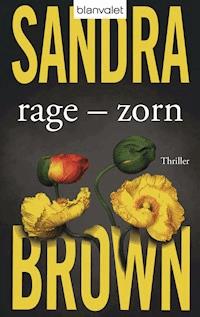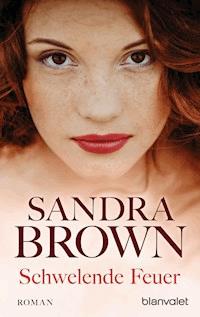
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als junges Mädchen verließ Schyler Crandall, die Adoptivtochter des mächtigsten Mannes in Heaven, die Stadt mit gebrochenem Herzen. Als attraktive, erfolgreiche Frau, die genau weiß, was sie will, kehrt sie zurück. Schon nach kurzer Zeit hat sie das Gefühl, sie sticht in ein Wespennest: dunkle Affären, hinterhältige Intrigen, bei denen offenbar ihre durchtriebene kleine Schwester Tricia die Finger im Spiel hat. Das Imperium ihres Vaters steht kurz vor dem Ruin. Auch Cash, ebenso verführerisch wie undurchschaubar, ist in die Sache verwickelt. Doch kein Mann hat Schyler bisher so um den Verstand gebracht und konnte ihr so gefährlich werden wie er …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 744
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Heaven - ein kleiner verträumter Ort im Süden von Louisiana, doch unter der trügerischen Idylle brodeln die dunklen Geheimnisse seiner Bewohner heißer als die Hölle.
Als junges Mädchen verließ Schyler Crandall, die Adoptivtochter des mächtigsten Mannes in Heaven, die Stadt mit gebrochenem Herzen. Als attraktive, erfolgreiche Frau, die genau weiß, was sie will, kehrt sie zurück. Schon nach kurzer Zeit hat sie das Gefühl, sie sticht in ein Wespennest: dunkle Affären, hinterhältige Intrigen, bei denen offenbar ihre durchtriebene kleine Schwester Tricia die Finger im Spiel hat. Das Imperium ihres Vaters steht kurz vor dem Ruin. Auch Cash, ebenso verführerisch wie undurchschaubar, ist in die Sache verwickelt. Doch kein Mann hat Schyler bisher so um den Verstand gebracht und konnte ihr so gefährlich werden wie er …
Autorin
Sandra Brown arbeitete als Schauspielerin und TV-Journalistin, bevor sie mit ihrem RomanTrügerischer Spiegel auf Anhieb einen großen Erfolg landete. Inzwischen ist sie eine der erfolgreichsten internationalen Autorinnen, die mit jedem ihrer Bücher weltweit Spitzenplätze der Bestsellerlisten erreicht. Sandra Brown lebt mit ihrer Familie abwechselnd in Texas und South Carolina.
Von Sandra Brown bei Blanvalet bereits erschienen (Auswahl)
Verliebt in einen Fremden, Glut unter der Haut, Wie ein Ruf in der Stille, Schöne Lügen, Ein skandalöses Angebot, Eine unmoralische Affäre, Gefährliche Sünden, Ein Kuss für die Ewigkeit, Zum Glück verführt, Heißer als Feuer, Lockruf des Glücks, Unschuldiges Begehren, Eine sündige Nacht, Zur Sünde verführt, Wie ein reißender Strom, Verruchte Begierde, Jenseits aller Vernunft, Schwelende Feuer, Celinas Tochter, Trügerischer Spiegel, Ein Hauch von Skandal, Tanz im Feuer, Sündige Seide, Feuer in Eden, Scharade, Nacht ohne Ende, In einer heißen SommernachtBesuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Sandra Brown
Schwelende Feuer
Roman
Deutsch von Gabriela Prahm
1. Auflage
Taschenbuchausgabe November 2015 bei Blanvalet,
einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright der Originalausgabe © 1988 by Sandra Brown
Translated from the English »Slow Heat in Heaven«.
First published in the United States by Warner Books, Inc., New York.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2014 by Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung eines Motivs von Versta/Schutterstock.com
Redaktion: Erna Tom
wr · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-10185-5www.blanvalet.de
1. Kapitel
Im ersten Moment war sie nicht sicher, ob er wirklich dort stand.
Sie hatte gedöst; den Kopf auf dem Arm, der eingeschlafen war und anfing zu kribbeln. Sie schlug die Augen auf, streckte sich wohlig und schaute zur Seite. Da sah sie ihn. Und mit einem Schlag war das lästige Kribbeln im Arm vergessen.
Zunächst glaubte sie, ihre Augen würden ihr einen Streich spielen; vielleicht lag es auch nur an ihrer Schläfrigkeit und der Trägheit dieses heißen Sommernachmittags. Sie zwinkerte mehrmals. Doch er stand immer noch dort.
Die Umrisse seines Körpers waren so detailliert zu erkennen, als wären sie aus schwarzem Karton mit einer Nagelschere ausgeschnitten. Deutlich zeichnete er sich vor der untergehenden Sonne ab, die in einer wahren Lichtkaskade von Zinnoberrot bis Gold am Horizont versank.
Reglos stand er dort, wie die Kiefern, die aussahen wie majestätische und hoch aufgeschossene Wächter. Kein Windhauch rührte in ihren Zweigen. Schyler selbst lag unter einer Lebenseiche, von deren Ästen Spanisches Moos herabhing, trauriger als sonst wegen der unerbittlichen Hitze.
Die regungslose Gestalt war eindeutig männlich. Ebenso die Pose. O ja, seine Pose war aufreizend und arrogant männlich; das Knie leicht gebeugt, die Hüfte herausgestellt.
Es war ein höchst unbehagliches Gefühl, aus einem Nickerchen zu erwachen und festzustellen, dass keine 20 Meter entfernt jemand stand und einen schweigend und lauernd wie ein Raubtier beobachtete. Und noch beunruhigender war es, dass dieser Jemand ein selbstsicheres männliches Wesen war, in dessen Augen sie selbst der Eindringling war.
Doch was Schyler am meisten beunruhigte, war die große Hacke, die er auf den Schultern trug. Ein an sich harmloses Bild. Seine Handgelenke lagen über dem Stiel, die Hände baumelten herab. In London hätte ein Mann mit einer Hacke über der Schulter sicher einiges Aufsehen erregt. Im ländlichen Louisiana dagegen war das während des Sommers ein vertrauterAnblick.
Nur, dass es in diesem Teil von Belle Terre nicht mal mehr ein Zwiebelbeet gab. Die Felder hier waren Stoppelfelder, das Gemüse wurde Meilen entfernt angebaut. Also hatte Schyler allen Grund, beunruhigt zu sein. Die Sonne ging bereits unter, und sie war ein gutes Stück von zu Hause entfernt.
Sie hätte ihn zur Rede stellen und verlangen können, dass er ihr sagte, wer er war und was er hier auf ihrem Grund und Boden zu suchen hatte. Doch sie sagte nichts; vielleicht weil er so aussah, als würde er viel eher als sie selbst hierher nach Belle Terre gehören. Er verschmolz mit der Umgebung, war eins mit ihr. ImVergleich dazu schien sie völlig fehl am Platz und auffällig.
Sie konnte nicht sagen, wie lange sie einander angestarrt hatten. Zumindest nahm sie an, dass auch er sie anstarrte, denn sie konnte sein Gesicht nicht klar erkennen und noch weniger ausmachen, was er sich so eindringlich besah. Doch ihr Instinkt sagte ihr, dass er sie beobachtete, und zwar schon eine ganz Weile. Diese entnervende Tatsache ließ sie schließlich handeln. Sie setzte sich auf.
Er kam auf sie zu.
Seine Schritte verursachten kaum ein Rascheln im knöchelhohen Gras. Er bewegte sich geräuschlos und geschmeidig, ließ die Hacke von der Schulter gleiten und hielt den langen Stiel mit beiden Händen.
Alle Ratschläge zur Selbstverteidigung, die Schyler jemals gehört hatte, verzogen sich nun feige in den hintersten Winkel ihres Bewusstseins. Sie konnte sich nicht bewegen, brachte keinen Ton heraus. Sie versuchte, nach Luft zu schnappen, um schreien zu können, doch die Luft war so zäh wie Treibsand.
Instinktiv ließ sie sich gegen den massigen Baumstamm sinken und schloss die Augen. Das Letzte, was sie sah, war die scharfe Klinge der Hacke, die in der Sonne aufblitzte, während sie in hohem Bogen herabzischte und dumpf aufschlug. Schyler wartete auf den betäubenden Schmerz, der den Tod bringen würde. Doch nichts dergleichen geschah.
»Nickerchen beendet, pichouette?«
Zwinkernd öffnete Schyler die Augen, verwundert, dass sie noch am Leben war. »Was?«
»Haben Sie Ihr Nickerchen beendet, Miss Schyler?«
Sie schirmte die Augen gegen die blendende Sonne ab, aber sie konnte sein Gesicht noch immer nicht erkennen. Er kannte ihren Namen. Und er hatte im Cajun-Dialekt gesprochen. Doch davon abgesehen hatte sie noch immer keinen Schimmer, wer er war.
Das dumpfe Geräusch war von der scharfen Klinge verursacht worden, als sie in das Gras drang. Der Mann stützte sich jetzt auf die Hacke auf, die Hände harmlos über dem stumpfen Ende des Stiels gefaltet. Sein Kinn ruhte auf den Händen. Doch diese gutmütige Geste machte ihn nicht weniger gefährlich.
»Woher kennen Sie mich?«, fragte Schyler.
Verschlossene Lippen öffneten sich für einen kurzen Moment. Doch es war kein echtes Lächeln. Dazu war es zu sardonisch.
»Weiß doch jeder in Laurent, dass Miss Schyler Crandall aus London zurück ist.«
»Nur vorübergehend und auch nur, weil mein Vater einen Herzanfall erlitten hat.«
Er zuckte die Achseln; offensichtlich war es ihm egal, woher sie kam und wohin sie ging. Er wandte den Kopf und schaute in die untergehende Sonne. Seine Augen reflektierten das Licht wie die reglosen Wasser der Bayous, wenn die Sonnenstrahlen im rechten Winkel darauffielen. Um diese Tageszeit sah das Wasser so glatt und undurchdringlich aus wie Metall. Ebenso wie seine Augen.
»Ich beteilige mich nicht am Tratsch der Leute, Miss Schyler. Ich hör mir an, was sie so erzählen. Und wenn’s mich nichts angeht, hör ich gar nicht hin.«
»Was machen Sie hier?«
Er wandte sich wieder ihr zu. »Ihnen beim Schlafen zusehen.«
»Und vorher?«, fragte sie scharf.
»Hab ich Wurzeln gesammelt.« Er klopfte gegen den kleinen Lederbeutel an seinem Gürtel.
»Wurzeln?« Seine Antwort ergab überhaupt keinen Sinn, und seine arrogante Haltung ärgerte sie. »Was denn für Wurzeln?«
»Ist doch egal. Kennen Sie ohnehin nicht.«
»Sie sind hier auf Privatbesitz. Sie haben nichts auf Belle Terre verloren.«
Insekten summten laut in der folgenden Stille. Seine Augen ließen nicht einen Moment von ihrem Gesicht ab. Als er antwortete, war seine Stimme so sanft und unerreichbar wie die so sehr ersehnte kühle Brise. »O doch, pichouette. Ich wohne nämlich auf Belle Terre.«
Schyler schaute zu ihm hoch. »Wer sind Sie?«
»Erinnern Sie sich nicht mehr an mich?«
Eine Ahnung stieg in ihr auf. »Boudreaux?«, flüsterte sie. Dann schluckte sie, nicht gerade erleichtert, nun zu wissen, mit wem sie sprach. »Cash Boudreaux?«
»Bien! Haben Sie mich also erkannt.«
»Nein. Nein, habe ich nicht. Die Sonne blendet mich. Und es ist Jahre her, seit ich Sie zuletzt gesehen habe.«
»Und Sie hatten allen Grund, sich nicht an mich zu erinnern.« Er grinste amüsiert, als sie verlegen zur Seite schaute. »Wenn Sie mich nicht erkannt haben, woher wissen Sie dann, wer ich bin?«
»Sie sind der Einzige, der auf Belle Terre lebt und kein …«
»Kein Crandall ist.«
Sie duckte sich leicht; es machte sie nervös, allein mit Cash Boudreaux zu sein. Soweit sie zurückdenken konnte, hatte ihr Vater ihr und ihrer Schwester Tricia verboten, auch nur mit ihm zu sprechen.
Seine Mutter war die geheimnisumwitterte Monique Boudreaux, die in einer Hütte am Laurent Bayou lebte, der sich um und durch die bewaldeten Ländereien von Belle Terre wand. Als Junge hatte Cash Zugang zu den Ländereien gehabt, durfte sich aber nie dem Haus nähern. Weil sie in diesem Moment nicht darüber reden wollte, fragte Schyler höflich: »Wie geht es Ihrer Mutter?«
»Sie ist gestorben.«
Seine unverblümte Antwort verblüffte sie. Boudreaux’ Gesicht war im aufsteigenden Zwielicht nicht zu erkennen. Aber selbst im hellen Mittagslicht hätte seine Miene nicht verraten, was er dachte. Er war nie redselig gewesen. Dieselbe geheimnisvolle Aura, die seine Mutter umgeben hatte, umgab auch ihn.
»Das wusste ich nicht.«
»Ist schon einige Jahre her.«
Schyler verscheuchte einen Moskito, der auf ihrem Nacken gelandet war. »Das tut mir leid.«
»Sie sollten besser heimgehen. Sonst fressen die Moskitos Sie noch mit Haut und Haaren auf.«
Er reichte ihr die Hand. Sie hielt das für zu gefährlich und scheute sich davor, sie zu berühren, so, wie sie sich gescheut hätte, eine Wasserschlange zu streicheln. Aber andererseits wäre es unsagbar unhöflich gewesen, sich nicht von ihm aufhelfen zu lassen. Bis jetzt war ihr ja noch nichts zugestoßen.
Sie legte ihre Hand in die seine. Seine Handfläche fühlte sich rau wie Leder an, und als sich seine Finger um ihre Hand schlossen, spürte Schyler die Schwielen. Kaum war sie auf den Beinen, zog sie die Hand weg.
Heftig klopfte sie ihr Kleid aus und sagte, um den peinlichen Moment zu überbrücken: »Das letzte Mal, als ich von Ihnen gehört habe, waren Sie gerade aus Fort Polk entlassen worden und auf dem Weg nach Vietnam.« Er sagte nichts. Sie schaute auf zu ihm. »Sind Sie dort gewesen?«
»Oui. «
»Das ist jetzt lange her.«
»Nicht lange genug.«
»Nun, ich … ich bin froh, dass Sie wieder hier sind. Die Gemeinde hat viele Söhne dort drüben verloren.«
Er zuckte die Achseln. »Schätze, ich war wohl ein besserer Kämpfer.« Sein Mund verzog sich zu der Andeutung eines Lächelns. »Aber das habe ich ja schon immer sein müssen.«
Sie hatte nicht vor, darauf zu antworten. Eigentlich suchte sie nach einer Möglichkeit, dieses unbehagliche Gespräch behutsam in eine andere Richtung zu lenken. Doch ehe ihr etwas einfiel, hob Cash Boudreaux eine Hand an ihren Nacken und wischte einen Moskito fort, der sich dort zum Abendessen niedergelassen hatte.
Seine Fingerkuppen waren rau, doch es war ein seltsam aufregendes Gefühl, als sie über ihren bloßen Hals und ihre Brust strichen. Ernst und neugierig schaute er sie dabei an, und in seinem Blick lag etwas Anzügliches. Er wusste genau, was er tat. Ganz dreist hatte er das Unentschuldbare getan – Cash Boudreaux hatte Schyler Crandall berührt … und ließ es darauf ankommen, dass sie protestierte.
»Die Biester kennen die besten Stellen«, erklärte er.
Schyler tat, als bemerkte sie seinen anzüglichen Blick gar nicht. »Sie sind so unverschämt wie eh und je, was?«
»Ich wollte Sie nicht enttäuschen, indem ich mich ändere.«
»Das wäre mir völlig egal gewesen.«
»War es doch immer.«
Ernstlich eingeschnappt richtete sich Schyler auf. »Ich muss jetzt zurück zum Haus. Es ist Zeit zumAbendessen. War nett, Sie getroffen zu haben, Mr. Boudreaux.«
»Wie geht es ihm?«
»Wem? Meinem Vater?«
Er nickte ergeben. Schylers Schultern entspannten sich etwas. »Ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Nach dem Essen werde ich zu ihm fahren. Heute Morgen habe ich mit einer der Schwestern im Krankenhaus gesprochen, und sie sagte, er habe eine ruhige Nacht gehabt.« Ihre Gefühle senkten ihre Stimme zu einem heiseren Flüstern. »Im Moment muss man selbst dafür schon dankbar sein.« Und dann sagte sie in ihrem besten Sonntagsgesellschaftston: »Ich werde ihm ausrichten, dass Sie sich nach seinem Befinden erkundigt haben, Mr. Boudreaux.«
Sein Lachen war plötzlich und harsch. Ein Vogel flatterte erschrocken auf und flüchtete in die Spitze der Lebenseiche. »Das halte ich für keine gute Idee. Es sei denn, Sie wollen, dass der alte Herr abkratzt.«
Wenn sie sich nicht irrte, war Cash Boudreaux knapp vierzig und hätte also seine Zunge im Zaum halten können, aber er war anscheinend immer noch so ungehobelt, rüde und unbeherrscht wie in seiner Jugend. Seine Mutter hatte ihn verwildern lassen. Cash Boudreaux war der schlimmste Rabauke gewesen, den Louisiana jemals hervorgebracht hatte.
»Einen schönen Abend noch, Mr. Boudreaux.«
Er verbeugte sich leicht. »Ebenfalls, Miss Schyler.«
Sie antwortete ihm mit einem kühlen Nicken, das mehr ihrer Schwester ähnlich sah als ihr, und ging in Richtung Haus. Sie war sich bewusst, dass er ihr nachsah. Kaum war sie in sicherer Entfernung und im tiefen Schatten der Bäume, drehte sie sich zu ihm um.
Er stand gegen den Stamm der Lebenseiche gelehnt, den ein halbes Dutzend Männer nicht hätte umspannen können. Sie sah, wie ein Streichholz in der Dunkelheit aufflammte. Boudreaux’ nach vorn gebeugtes Gesicht wurde kurz erleuchtet, als er das brennende Streichholz an die Zigarette hielt. Er wedelte das Streichholz aus. Schyler nahm den Geruch von Schwefel wahr.
Boudreaux inhalierte tief. Die Zigarette leuchtete glühend rot auf, wie ein einzelnes Auge, das ihr aus der Tiefe der Hölle zuzwinkerte.
2. Kapitel
Schyler wollte so schnell wie möglich zum sicheren Haus kommen; sie lief durch den Wald, stolperte über dichtes Gestrüpp. Ein Schwarm Moskitos schwirrte um ihren Kopf, als sie die wackelige Fußgängerbrücke über den schmalen Bach überquerte, der den Wald von den rings um das Haus angelegten Rasenflächen trennte.
Als sie den smaragdgrünen weichen Rasenteppich erreichte, blieb sie stehen, um kurz zu verschnaufen. Die Abendluft war so schwer wie das Parfüm einer Prostituierten auf der Bourbon Street. Geißblatt säumte das Bachufer. Gardenien blühten in der Nähe, ebenso wie wilde Rosen und Magnolien.
Schyler nahm jeden einzelnen Duft wahr. Alle waren mit einer ganz besonderen Erinnerung aus ihrer Kindheit verbunden. Und auch wenn sie schon lange kein Kind mehr war und seit sechs Jahren keinen Fuß mehr auf Belle Terre gesetzt hatte, so waren sie ihr doch noch immer schmerzlich vertraut.
Kein Garten Englands duftete so wie ihr Zuhause, wie Belle Terre. Selbst wenn sie mit verbundenen Augen hierhergebracht worden wäre, hätte sie es sofort an den Geräuschen und Düften erkannt.
Der abendliche Chor der Frösche und Grillen stimmte sich ein. Die Bässe drangen aus dem sumpfigen Bachgrund, der Sopran aus den mannshohen Büschen. In der Ferne war das traurige Pfeifen eines Güterzuges zu hören.
Schyler lehnte sich an den rauen Stamm einer Kiefer und schloss die Augen. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und wiegte sich selbst, so als fürchtete sie, aus einem Traum zu erwachen, wenn sie die Augen wieder öffnete; als hätte sie Angst, zu erwachen und feststellen zu müssen, dass sie gar nicht auf Belle Terre war, wo der Sommer in voller Blüte stand, sondern im grauen winterlichen London.
Doch als sie die Augen aufschlug, sah sie das Haus. So rein und weiß wie ein Zuckerwürfel stand es gelassen im Herzen der Lichtung und prangte in der Landschaft wie das Herzstück einer Tiara.
Gelbliches, von den Fliegengittern gedämpftes Licht ergoss sich aus den Fenstern auf die hohe Veranda. Sechs Säulen säumten die Vorderfront, drei zu jeder Seite des Eingangs. Sie stützten einen Balkon im zweiten Stock. Es war jedoch kein echter Balkon, sondern diente nur als Fassade. Tricia betonte das regelmäßig und gereizt. Doch Schyler mochte diesen Balkon. Ihrer Meinung nach war diese Attrappe notwendig für die Symmetrie der Architektur.
Die Veranda verlief rings um das Haus. Sie war einst als Schlafraum genutzt worden und auf der Rückseite mit Fliegenfenstern abgeschlossen. Schyler erinnerte sich noch, wie ihre Mutter immer von den guten alten Zeiten gesprochen hatte, wenn bei den Familientreffen all ihre Cousins und Cousinen aus Laurent Parish dort auf Pritschen geschlafen hatten.
Schyler dagegen hatte stets die offene Veranda vorgezogen. Passend zum Haus weiß gestrichene Korbstühle waren so aufgestellt, dass man, egal in welchem man saß, einen besonderen Blick auf die Grünanlagen genießen konnte. Jeder Anblick glich einem Motiv einer Ansichtskarte.
Die Schaukel, die Cotton damals für Tricia und Schyler unter dem Portal hatte anbringen lassen, hing in einer Ecke der Veranda. Zu beiden Seiten der Tür wuchs aus passenden Kübeln Farnkraut, so bauschig wie ein Dutzend zusammengebundener Staubwedel. Veda war so stolz auf diesen Bostoner Zwillingsfarn gewesen; hatte ihn unermüdlich gepflegt und jeden ausgeschimpft, der zu schnell und zu nahe daran vorbeilief. Sie hatte es als persönliche Kränkung betrachtet, wenn ein geliebter Farnwedel aus Versehen umgeknickt wurde.
Macy lebte nicht mehr. Und Cottons Leben hing an einem seidenen Faden. Das Einzige, was unverändert und für die Ewigkeit schien, war das Haus selbst. Belle Terre.
Schyler flüsterte den Namen wie ein Gebet, als sie sich vom Baum abstieß. Einer Laune nachgebend, schlüpfte sie aus ihren Sandalen und lief barfuß über das kühle, feuchte Gras, das der automatische Sprenkler am Nachmittag gewässert hatte.
Als sie vom Rasen auf den Kieselweg trat, zuckte sie vor Schmerz zusammen. Doch es war eine willkommene Pein und rief Erinnerungen an die Kindheit in ihr wach. Es war ein alljährliches Ritual gewesen, zu Beginn des Frühlings den Kiesweg barfuß entlangzulaufen. Da sie den ganzen Winter über Strümpfe und Schuhe getragen hatte, waren ihre Füße empfindlich. Wenn es warm genug war und Veda es erlaubt hatte, wurden die Strümpfe und Schuhe abgelegt. Es dauerte immer einige Tage, bis ihre Fußsohlen so abgehärtet waren, dass sie den ganzen Weg bis zur Straße hinunter laufen konnte, ohne zwischendurch stehen bleiben zu müssen.
Der Klang und das Gefühl des Kieswegs waren vertraut. Ebenso wie das Quietschen der Tür, als sie sie öffnete. Gleich hinter ihr fiel sie, wie Schyler es nicht anders kannte, wieder ins Schloss. Belle Terre änderte sich nie. Es war ihr Zuhause.
Aber andererseits auch wieder nicht. Nicht mehr. Nicht, seit Ken und Tricia es zu ihrem Zuhause gemacht hatten.
Die beiden saßen bereits am langen Tisch im Esszimmer. Ihre Schwester Tricia stellte ihr Glas mit Bourbon und Wasser ab. »Wir haben schon gewartet«, grüßte sie vorwurfsvoll.
»Entschuldigt bitte. Ich bin spazieren gegangen und habe die Zeit ganz vergessen.«
»Halb so schlimm, Schyler«, sagte Ken Howell. »Wir haben ja nicht lange gewartet.« Ihr Schwager lächelte ihr von der Vitrine aus zu, wo er sein Glas aus einer kristallenen Karaffe mit Bourbon nachfüllte. »Möchtest du etwas trinken?«
»Einen Gin Tonic, bitte. Mit viel Eis. Es ist heiß draußen.«
»Es ist zum Ersticken.« Verärgert fächerte sich Tricia mit ihrer steifen Serviette Luft zu. »Ich habe Ken gebeten, dass er den Thermostat an der Klimaanlage neu einstellt. Daddy ist ja so knauserig wegen der Stromrechnung. Er lässt uns den ganzen Sommer über vor Hitze vergehen. Solange er nicht hier ist, sollten wir es uns so angenehm wie möglich machen. Aber es dauert ewig, bis es sich in diesem alten Haus abkühlt. Prost.« Sie hielt ihr Glas in Schylers Richtung, als Ken ihr den gewünschten Drink reichte.
»Ist alles in Ordnung?«
Schyler nippte an ihrem Drink, sah Ken aber nicht offen in die Augen, als sie antwortete: »Bestens. Danke.«
»Ken, ehe du dich wieder setzt, sag doch bitte Mrs. Graves, dass Schyler doch noch gekommen ist, und sie nun servieren soll.«
Tricia winkte ihn zur Tür, die das formelle Esszimmer mit der Küche verband. Er warf ihr einen verächtlichen Blick zu, tat aber wie geheißen. Als Schyler ihre Sandalen neben dem Stuhl abstreifte, sagteTricia: »Also ehrlich, Schyler, du bist erst ein paar Tage wieder hier und hast schon wieder deine schlechten Manieren, die Mama bis zuletzt fast in den Wahnsinn getrieben haben. Du willst doch nicht etwa barfuß am Tisch sitzen, oder?«
Da Tricia bereits schmollte, dass sie ihretwegen mit dem Abendessen hatte warten müssen, zog Schyler um des lieben Friedens willen ihre Sandalen wieder an. »Ich kann nicht verstehen, warum du nicht gerne barfuß läufst.«
»Und ich kann nicht verstehen, warum du es tust.« Auch wenn Tricias engelsgleiches Lächeln von Michelangelo hätte gemalt sein können, war sie dennoch garstig. »Gut möglich, dass in meinen Adern das aristokratische Blut meiner Vorfahren fließt, woran es dir völlig mangelt.«
»Gut möglich«, entgegnete Schyler ohne Bitterkeit. Sie nippte an ihrem Drink und genoss den eiskalten Gin und die herbe Limone.
»Ist dir das eigentlich gleichgültig?«, fragte Tricia.
»Was?«
»Dass du deine Vorfahren nicht kennst. Manchmal legst du Manieren an den Tag wie das letzte Pack. Das kann nur bedeuten, dass deine Leute so jämmerlich waren, wie der Tag lang ist.«
»Wirklich, Tricia, ich bitte dich«, unterbrach Ken peinlich berührt. Er war aus der Küche zurückgekehrt und setzte sich gegenüber seiner Frau an den Tisch. »Lass es gut sein. Was macht es denn schon für einen Unterschied?«
»Es macht einen großen Unterschied.«
»Wichtig ist doch, was man aus seinem Leben macht, und nicht, woher man kommt. Stimmt’s, Schyler?«
»Ich denke nie über meine leiblichen Eltern nach«, antwortete Schyler. »Na ja, als ich noch klein war, habe ich es hin und wieder getan, wenn man mir wehgetan hatte oder wenn mich jemand beschimpft hat oder …«
»Beschimpft?«, wiederholte Tricia ungläubig. »Daran kann ich mich überhaupt nicht entsinnen. Wann genau soll das denn jemals passiert sein, Schyler?«
Schyler ignorierte die Bemerkung und fuhr fort. »Ich habe mir selber leidgetan und gedacht, wenn meine leiblichen Eltern mich nicht zur Adoption freigegeben hätten, wäre mein Leben schöner gewesen.« Sie lächelte wehmütig. »Was natürlich nicht stimmt.«
»Woher willst du das so genau wissen?« Müßig ließ Tricia mit ihrem manikürten Zeigefinger einen Eiswürfel in ihrem Glas kreisen, dann leckte sie die Fingerspitze ab. »Ich bin sicher, dass meine Mutter ein wohlhabendes Mädchen der feinen Gesellschaft war. Ihre fiesen alten Eltern haben sie aus Eifersucht und reiner Boshaftigkeit dazu gezwungen, mich wegzugeben. Mein Vater war bestimmt jemand, der meine Mutter geliebt und leidenschaftlich verehrt hat; aber er hat sie nicht heiraten können, weil sein giftiges Weib sich nicht scheiden lassen wollte.«
»Du hast zu viele Kitschfilme gesehen«, lästerte Ken mit einem amüsierten Lächeln in Schylers Richtung. Schyler nickte.
Tricia kniff die Augen zusammen. »Mach dich nicht über mich lustig, Ken.«
»Wenn du derart überzeugt bist, dass deine leiblichen Eltern so wundervoll waren, warum hast du dann nie den Versuch unternommen herauszufinden, wer sie sind?«, fragte er sie. »Wenn ich mich recht erinnere, hat Cotton dich sogar dazu ermuntert.«
Tricia strich die Serviette auf ihrem Schoß glatt. »Weil ich ihr Leben nicht durcheinanderbringen und ihnen die Verlegenheit ersparen wollte.«
»Vielleicht wolltest du dir nur ersparen rauszufinden, dass sie gar nicht so wunderbar sind.« Ken nahm einen letzten Schluck aus seinem Glas und stellte es mit der Lässigkeit eines Spielers ab, der sein Trumpf-Ass auf den Tisch legt.
»Selbst wenn sie nicht reich waren«, schnappte Tricia, »dann weiß ich aber genau, dass sie nicht so ärmlich waren wie Schylers Eltern.« Zuckersüß lächelnd langte sie über den Tisch nach Schylers Hand. »Ich hoffe, ich habe deine Gefühle nicht verletzt, Schyler.«
»Nein, hast du nicht. Woher ich komme, war mir schon immer egal. Ich bin nicht so wie du. Ich bin froh, dass ich durch die Adoption eine Crandall geworden bin.«
»Du bist sogar so grauenhaft dankbar gewesen, dass du Cotton Crandalls Ein und Alles geworden bist, hab ich recht?«
Mrs. Graves’ Eintreten führte dazu, dass Schyler Tricias schneidende Bemerkung nicht beachtete. Die Haushälterin war, wie Schyler fand, die traurigste Person auf der ganzen Welt. Bis jetzt hatte sie diese hagere Frau nicht ein einziges Mal lächeln sehen. Sie war das genaue Gegenteil von Veda.
Als die wortkarge Haushälterin um den Tisch ging und aus einer Terrine Suppe servierte, verspürte Schyler plötzliche Sehnsucht nach Veda. Ihr strahlendes Gesicht, so schwarz wie Kaffee, war Teil ihrer Erinnerung, soweit sie zurückdenken konnte. Vedas üppiger Busen war so weich gewesen wie ein Gänsedaunenkissen, so beschützend wie eine Burg und so aufmunternd wie ein Gang in die Kapelle. Sie duftete immer nach Stärke und Zitrone, nach Vanille und Lavendelkissen.
Schyler hatte sich darauf gefreut, bei ihrer Rückkehr von Vedas bärenstarken Armen an der Tür begrüßt zu werden. Umso bitterer war ihre Enttäuschung gewesen, als sie erfahren hatte, dass Veda durch Mrs. Graves ersetzt worden war, deren flache Brust so hart und kalt und wenig einladend wirkte wie ein Grabstein aus Granit.
Die Suppe war dünn und seelenlos wie die Frau, die sie zubereitet und serviert hatte und dann durch die Tür wieder in der Küche verschwunden war. Nach einer Kostprobe von der eisgekühlten Suppe griff Schyler zum Salzstreuer.
Tricia sprang sofort für die Köchin in die Bresche. »Ich hatte Mrs. Graves angewiesen, beim Kochen kein Salz mehr zu verwenden, als Daddys Blutdruck so sehr angestiegen war. Wir haben uns inzwischen daran gewöhnt.«
Schyler gab noch mehr Salz in ihre Suppe. »Ich aber nicht.« Erneut probierte sie, fand die Suppe aber gänzlich ungenießbar. Sie legte den Löffel auf den Unterteller und schob alles beiseite. »Ich erinnere mich noch zu gut an Vedas Vichyssois. Die war so dick und köstlich, dass der Löffel drin stecken blieb.«
Sich bewusst zurückhaltend, betupfte sich Tricia die Lippen mit der Serviette und faltete diese dann wieder sorgfältig auf ihrem Schoß aus. »Hab ich doch gewusst, dass du mir das ankreidest.«
»So habe ich das nicht gemeint …«
»Sie war alt, Schyler. Du hast sie einige Jahre nicht gesehen, also hast du kein Recht, meine Entscheidung zu kritisieren. Veda war am Schluss schluderig und tatterig, hab ich recht, Ken?« Es war nur eine rhetorische Frage, und er hatte keine Gelegenheit, seine Meinung kundzutun. »Ich hatte keine andere Wahl, als sie zu entlassen. Wir konnten sie doch nicht weiterhin bezahlen, wo sie ihre Arbeit nicht mehr tat. Es hat mir schrecklich leidgetan«, sagte Tricia und presste eine Hand auf ihre volle Brust. »Ich habe sie doch auch geliebt, wie du weißt.«
»Ich weiß«, sagte Schyler. »Ich wollte dich auch nicht kritisieren. Es ist nur so, dass sie mir fehlt. Sie hat eben immer zu Belle Terre gehört.« Da sie zu der Zeit in Übersee gelebt hatte, konnte sie Tricias Entscheidung nicht rückgängig machen. Aber eine schludrige und tatterige Veda … das konnte sie sich einfach nicht vorstellen.
Tricia gab sich zwar alle Mühe zu betonen, ihre ehemalige Haushälterin auch gemocht zu haben, aber Schyler fragte sich unweigerlich, ob sie Veda aus reiner Boshaftigkeit vor die Tür gesetzt hatte. Bei zahllosen Anlässen war ihre Schwester alles andere als liebevoll zu Veda gewesen. Einmal hatte Tricia Veda so beleidigend getadelt, dass Cotton der Geduldsfaden gerissen war. Es hatte einen fürchterlichen Streit gegeben. Tricia musste zur Strafe den ganzen Tag auf ihrem Zimmer bleiben und durfte nicht zur Party gehen, auf die sie sich schon wochenlang gefreut hatte. Und da Tricia es fertigbrachte, ihren Groll bis in alle Ewigkeit mit sich herumzutragen, war Schyler sicher, dass es einen viel ernsteren Grund fürVedas Entlassung gegeben hatte als den genannten.
Kein Salz und Pfeffer konnte das Huhn, das der kalten Suppe folgte, schmackhaft für Schyler machen. Sie versuchte es sogar mit Tabascosauce, die in Cotton Crandalls Haus immer auf den Tisch gehörte. Aber auch die rote Pfeffersoße half nicht.
Dennoch kritisierte sie Mrs. Graves’ Kochkünste nicht. Sie hatte keinen sonderlichen Appetit mehr verspürt, seit sie durch Kens Anruf in London von Cottons Herzinfarkt erfahren hatte.
»Wie geht es ihm?«, hatte sie zaghaft gefragt.
»Schlecht, Schyler. Auf dem Weg ins Krankenhaus hat sein Herz vollständig ausgesetzt. Die Notärzte haben ihn künstlich wiederbeleben müssen. Ich will dir nichts vormachen. Es steht auf der Kippe.«
Dann hatte er Schyler gedrängt, so schnell wie möglich heimzukommen. Aber dazu hätte man sie nicht extra auffordern müssen. Als sie zu Hause eintraf, lag ihr Vater ohne Bewusstsein auf der Intensivstation des St. John’s Hospital, wo er auch die nächste Zeit bleiben sollte. Sein Zustand war zwar unverändert, aber nach wie vor kritisch.
Das Schlimmste für Schyler war, dass sie nicht sicher war, ob er überhaupt wusste, dass sie nach Hause gekommen war, um ihn zu sehen. Obwohl er während einer ihrer kurzen Besuche in seinem Zimmer die Augen geöffnet und sie angesehen hatte, war seine Miene reglos geblieben. Er hatte die Augen geschlossen ohne ein Zeichen, ob er Schyler erkannt hatte. Sein leerer Blick, der geradewegs durch sie hindurchzugehen schien, brach ihr fast das Herz. Sie fürchtete, Cotton könnte sterben, ehe sie Gelegenheit hatte, mit ihm zu sprechen.
»Schyler?«
Verdutzt schaute sie zu Ken, der sie angesprochen hatte. »Oh, entschuldigt bitte. Ja, Mrs. Graves, Sie können meinen Teller auch abräumen«, sagte sie zu der Frau, die vorwurfsvoll auf den buchstäblich unberührten Teller starrte. Sie nahm ihn weg und ersetzte ihn durch einen Teller mit überbackenem Brombeerkuchen, der vielversprechend aussah. Hoffentlich war die Zuckerdose nicht zusammen mit dem Salzstreuer abgeräumt worden.
»Hast du immer noch vor, nach dem Essen zum Krankenhaus zu fahren, Schyler?«
»Ja. Willst du mitkommen?«
»Heute Abend nicht«, sagte Tricia. »Ich bin müde.«
»Aber ja. Den ganzen Tag Bridge zu spielen ist wirklich anstrengend.«
Kens Lästerei wurde ohne viel Federlesens ignoriert. »Daddy hat eine Karte mit Genesungswünschen von der Sonntagsschulgemeinde bekommen. Wir wurden gebeten, sie ihm zu geben. Der Dekan meinte, es sei eine Schande, dass Cotton in einem katholischen Krankenhaus liegen müsse.«
Schyler schmunzelte über den religiösen Snobismus des Dekans, auch wenn er typisch für die Gegend war. Macy war katholisch gewesen und hatte ihre Töchter entsprechend erzogen. Cotton aber war Baptist. »In Heaven gibt es kein Baptistenkrankenhaus. Uns bleibt gar keine andere Wahl.«
»In der Stadt machen sich alle Sorgen um Cotton.« Kens Hüftumfang hatte beträchtlich zugenommen, seit Schyler ihn das letzte Mal gesehen hatte, aber das hielt ihn nicht davon ab, sich reichlich Sahne auf seinen Kuchen zu tun. »Ich kann keine zwei Schritte machen, ohne dass mich ein Dutzend Leute auf dem Bürgersteig anhalten und sich nach Cotton erkundigen.«
»Natürlich machen sich alle Sorgen«, sagte Tricia. »Weil er so ziemlich der bedeutendste Mann in der Stadt ist.«
»Heute Nachmittag hat sich auch bei mir jemand nach Daddys Befinden erkundigt«, fügte Schyler hinzu.
»Ja? Wer denn?«, wollte Tricia wissen.
Ken und sie ließen von ihrem Kuchen ab und schauten erwartungsvoll zu Schyler.
»Cash Boudreaux.«
3. Kapitel
»So, so. Cash Boudreaux.« Genüsslich leckte Tricia ihren Löffel ab. »War sein Hosenstall zu?«
»Tricia!«
»Ach komm, Ken, denkst du etwa, anständige Frauen wie ich wüssten nicht, wer er ist?« Sie klimperte ihrem Ehemann flirtend zu. »Jeder in der Stadt weiß von Cashs Weibergeschichten. Als er mit diesem Wallace-Mädchen Schluss gemacht hat, hat sie am Samstagvormittag die ganze Kundschaft im Schönheitssalon mit ihrer armseligen kleinen Affäre unterhalten.« Tricia senkte geheimnisvoll die Stimme. »Und ich will sagen … im Detail. Uns war das schrecklich peinlich, aber wir haben jedes Wort fasziniert aufgesogen. Wenn er auch nur halb so gut ist, wie sie behauptet hat, na ja …«, schloss Tricia mit einem schlüpfrigen Zwinkern.
»Ich habe schon begriffen, dass Mr. Boudreaux der Sexprotz der Stadt ist«, sagte Schyler.
»Er bumst alles, was einen Rock trägt.«
»Da täuschst du dich aber, Liebling«, widersprach Tricia ihrem Mann. »Soweit ich gehört habe, ist er sehr wählerisch. Und warum auch nicht? Er kann es sich leisten. Es gibt Frauen, die sich ihm praktisch zu Füßen und an den Hals werfen.«
»Du liebe Güte, der Don Juan von Louisiana.« Ken widmete sich wieder seinem Kuchen, um das Thema ruhen zu lassen.
Doch Tricia war noch nicht fertig. »Nun sei mal bloß nicht eingeschnappt. Du bist ja nur neidisch.«
»Neidisch? Ich soll neidisch sein auf einen nichtsnutzigen Bastard, der keinen Pfennig in der Tasche hat?«
»Liebling, wenn es darum geht, was einer in seiner Jeans hat, dann reden die Frauen bestimmt nicht von Geld. Und das, was er in seiner Jeans hat, macht ihn kostbarer als pures Gold.« Tricia bedachte ihren Mann mit einem katzenhaften Lächeln. »Aber du musst dir keine Sorgen machen. Der raue Typ hat mich noch nie sonderlich angemacht. Obgleich ich zugeben muss, dass Cash äußerst faszinierend ist.« Sie wandte sich an Schyler: »Wo bist du ihm denn begegnet?«
»Hier bei uns.«
»Hier?« Kens Löffel hing auf halbem Weg zwischen Kuchen und Mund. »Auf Belle Terre?«
»Er sagte, er hätte Wurzeln gesammelt.«
»Für sein Zaubergebräu.«
Schyler starrte fragend zu Tricia hinüber. »Zaubergebräu?«
»Er macht da weiter, wo Monique aufgehört hat.« Schyler schaute noch immer verwirrt ihre Schwester an. »Nun sag bloß, du hast nicht gewusst, dass Monique Boudreaux eine Hexe war?«
»Natürlich habe ich die Gerüchte mitgekriegt. Aber das ist doch absolut albern gewesen.«
»Eben nicht! Warum hat Daddy wohl sonst solchen Abschaum all die Jahre auf Belle Terre wohnen lassen? Er hatte Angst, sie würde ihn verhexen, wenn er sie davonjagt.«
»Du übertreibst mal wieder, Tricia«, sagte Ken. »In Wahrheit, Schyler, war Monique das, was man eine traiteur nennt, eine Heilerin. Sie hat Menschen geheilt, so hat man es sich jedenfalls erzählt. Bis zu ihrem Tode konnte man bei ihr allerlei Arzneien bekommen.«
»Heiler sind für gewöhnlich Linkshänder und meistens Frauen, aber die Menschen hier glauben anscheinend, dass Cash die magischen Kräfte seiner Ma geerbt hat.«
»Sie hatte keine magischen Kräfte, Tricia.« Ken klang gereizt.
»Hör zu.« Aufgebracht schlug Tricia auf die Tischkante. »Ich weiß ganz sicher, dass Monique Boudreaux eine Hexe war.«
»Bösartiger Tratsch.«
Tricia starrte ihren Mann an. »Ich weiß es aus erster Hand. Sie hat mich einmal mit ihren großen, dunklen bösen Augen angesehen, und am Nachmittag habe ich meine Periode bekommen. Zwei Wochen zu früh und mit den schlimmsten Krämpfen, die ich jemals hatte.«
»Wenn Monique tatsächlich magische Kräfte besessen hat, dann hat sie sie dazu benutzt, die Menschen gesund zu machen und nicht krank«, widersprach Ken. »Ihre Arzneien sind uralt und stammen von den Akadiern. Alles völlig harmlos, genau wie sie selbst.«
»Wohl kaum. Die Akadier haben sich auch noch Voodoopraktiken zunutze gemacht, und herausgekommen ist schwarze Magie.«
Ken runzelte die Stirn. »Monique Boudreaux hatte nichts mit Voodoo zu tun. Und sie war nicht böse. Nur anders. Und sehr hübsch. Genau deshalb nämlich wollen die meisten Frauen in der Stadt, und auch du, glauben, dass sie eine Hexe war.«
»Wer kennt sie denn – du oder ich? Du warst doch noch gar nicht lange hier, als sie starb.«
»Ich hab’s eben so gehört.«
»Tja, da hast du aber was Falsches gehört.Außerdem war sie schon alt, und all ihre frühere Schönheit war verblichen.«
»Das ist ein weiblicher Standpunkt. Ich sage dir – sie war noch immer eine attraktive Frau.«
»Und was ist mit Cash?« Schyler mischte sich ein, weil sie sah, dass sich zwischen den beiden ein ernsthafter Streit anbahnte. Es hatte nicht lange gedauert, bis sie nach ihrer Rückkehr aus London erkannt hatte, dass die Howells nicht gerade eine Bilderbuchehe führten. Aber sie gab sich alle Mühe, keine Schadenfreude zu empfinden.
»Wovon lebt Cash?« Schyler sah, dass ihre Frage die beiden überraschte. Sie starrten sie eine Weile an, ehe Ken antwortete.
»Er arbeitet für uns, für die Crandall-Holzfabrik.«
Schyler brauchte etwas Zeit, um das zu verdauen. Cash Boudreaux stand also auf der Gehaltsliste ihrer Familie. Respektvoll hatte er sich vorhin aber nicht gerade verhalten. Seine Art und sein Auftreten hatten kaum dem eines Angestellten entsprochen, der vor seinem Brötchengeber stand. »Und was macht er da?«
»Er ist Holzfäller. Schlicht und einfach.« Ken hatte seinen Kuchen vertilgt, wischte sich den Mund ab und legte seine Serviette beiseite.
»Ganz so einfach ist es nun auch wieder nicht, Schyler«, widersprach Tricia. »Er arbeitet an der Säge, er hilft beim Verladen, er fährt den Schlepper. Er wählt die Bäume zum Fällen aus. Eigentlich macht er alles.«
»Eine Schande, nicht wahr?«, meinte Ken. »Dass ein Mann in seinem Alter und so clever, wie er anscheinend ist, keine größeren Ambitionen hat …«
»Lebt er noch immer in dieser Hütte am Bayou?«
»Aber ja. Es ist so: Er lässt uns in Ruhe, wir lassen ihn in Ruhe. Cotton hatte mit ihm zu tun, bei der Arbeit, aber sonst gehen wir uns völlig aus dem Weg. Kann mir gar nicht vorstellen, dass er heute in der Nähe des Hauses gewesen sein soll. Er und Cotton hatten Streit, als Monique starb. Cotton wollte, dass Cash auszieht. Aber irgendwie hat er sich dann von ihm breitschlagen lassen. Cottons Vertrauensseligkeit ist wirklich bewundernswert.«
»Und nicht ganz uneigennützig«, sagte Tricia. »Er braucht Cash.«
»Möglich, aber es gefällt ihm gar nicht. Ich denke, er macht da einen Fehler. Ich an seiner Stelle würde Cash Boudreaux nicht über den Weg trauen.« Ken lehnte sich auf den Tisch und sah Schyler mit ernstem Blick an. »Er hat dich doch nicht etwa beleidigt, oder?«
»Nein, nein. Wir haben uns nur kurz unterhalten.« Und berührt. Und in die Augen gesehen. Beides war ebenso ungebührend wie sinnlich gewesen. Schyler konnte nicht sagen, was sie am meisten verwirrt hatte – seine Neugier oder seine Feindseligkeit. »Ich war neugierig, mehr nicht. Ich hab ja schon seit Jahren nichts mehr von ihm gehört. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass er überhaupt noch hier ist.«
»Also, wenn er jemals unverschämt werden sollte, sagst du mir Bescheid, ja?«
»Und was willst du dann tun? Ihn verprügeln?« Tricias Lachen ließ die kristallenen Tränen des Leuchters über ihren Köpfen klirren. »Manche Leute meinen, dass Cash ein bisschen zu lange im Dschungel von Vietnam gewesen sei und dass er bei den Marines geblieben sei, weil er das Kämpfen und Töten so sehr liebt. Als er zurückkam, war er noch bösartiger als vorher, und er war schon schlimmer als die Sünde selbst. Ich glaube kaum, dass du ihm Angst einjagen kannst, Liebling.«
Schyler konnte die schwelende Feindseligkeit zwischen Ehemann und Ehefrau wieder aufsteigen spüren. »Ich bin sicher, dass ich Mr. Boudreaux nicht mehr sehen werde.« Sie schob ihren Stuhl zurück. »Und jetzt entschuldigt mich bitte. Ich möchte mich noch ein bisschen frisch machen, ehe ich ins Krankenhaus fahre.«
Sie schlief wieder in dem Zimmer, das sie auch als Kind schon gehabt hatte. Drei hohe rechteckige Fenster gingen zum rückwärtigen Teil des Anwesens hinaus, wo das Gewächshaus stand, das eine Zeit lang ein Räucherhaus gewesen war und nun als Werkzeugschuppen diente; dann die Scheune, in der mehrere Pferde untergebracht waren, und die freistehende Garage. Hinter den Nebengebäuden, die, passend zum Haupthaus, weiß gestrichen waren, lagen die Wälder, und dahinter der Bayou.
Schyler schloss die Zimmertür und lehnte sich mit dem Rücken dagegen. Sie hielt inne, um den Raum auf sich wirken zu lassen, den sie so sehr vermisst hatte. Der Holzboden war ausgelegt mit kleinen Teppichen, die ausgeblichen und ausgetreten waren und einen Höchstpreis erzielen würden, sollten sie jemals verkauft werden, was aber natürlich niemals der Fall sein würde. Schyler würde sich niemals von etwas trennen, das nach oder zu Belle Terre gehörte.
Sämtliche Möbel im Zimmer waren aus Eichenholz; das Alter hatte sie mit einer goldenen Patina versehen, die den Stücken den schweren und maskulinen Eindruck nahmen. Die Wände waren safrangelb gestrichen, alle Holzteile weiß. Die Bettdecke, die Kissen auf den Sesseln und die Vorhänge – alles war weiß. Sie hatte darauf bestanden, als das Zimmer zuletzt renoviert worden war. Alles im Zimmer sollte der schlichten Schönheit des Raumes entsprechen.
Der einzige moderne Touch war das Bücherregal. Darin standen noch immer die Erinnerungsstücke aus ihrer Kindheit und Teenagerzeit. Sie hatte sich schon oft vorgenommen, alles einmal auszusortieren und die Jahrbücher, die ausgetrockneten Bänder und vergilbten Partyeinladungen wegzuschmeißen. Doch die Nostalgie hatte stets über ihren Pragmatismus gesiegt. Und dennoch beschloss sie, vor ihrer Abreise nach London dieses Zimmer von Grund auf sauberzumachen und sich endgültig von all dem Krimskrams zu trennen.
Das kleine angrenzende Bad war noch so wie früher. Es hatte noch immer ein weißes Porzellanwaschbecken und eine Badewanne mit Klauenfüßen. Sie wusch sich das Gesicht und die Hände im Becken, frischte vor dem eingerahmten Spiegel ihr Make-up auf und bürstete sich das Haar. Als sie die dunkelblonden Locken aus ihrem Nacken hob, bemerkte sie den rosa Hubbel an ihrem Hals. Ein Moskitobiss.
Die Biester kennen die besten Stellen, hatte Cash gesagt.
Ungeduldig legte sie die Bürste beiseite, nahm ihre Geldbörse und die Wagenschlüssel vom Schreibtisch im Schlafzimmer und ging nach unten. Tricia telefonierte gerade angeregt im Salon. Neben dem formellen Salon lag hinter Holzschiebetüren der Privatsalon. Die Türen standen ständig offen und machten die beiden aneinandergrenzenden Räume zu einem einzigen großen, doch jeder der beiden Salons hatte noch immer die traditionelle Bezeichnung.
Die Adoptivschwestern winkten einander zum Abschied zu. Schyler durchquerte die weitläufige Eingangshalle und ging hinaus auf die Veranda. Sie war gerade auf der zweiten Treppenstufe, als Ken sie ansprach. Er stemmte sich aus dem Schaukelstuhl und gesellte sich zu ihr auf die Treppe. Bei ihr untergehakt, begleitete er sie zum Wagen, der an der Auffahrt geparkt war, einem Halbkreis vor dem Haus, der dann nach hinten zur Garage weiterlief.
»Ich fahre dich zum Krankenhaus«, bot Ken an.
»Nein, danke. Du und Tricia, ihr seid doch heute Morgen schon dort gewesen. Jetzt bin ich dran.«
»Aber es macht mir nichts aus.«
»Ich weiß. Aber es ist wirklich nicht nötig.«
Er drehte sie zu sich. »Ich hab dir das auch nicht angeboten, weil ich annehme, dass du einen Chauffeur brauchst. Aber seit du wieder hier bist, haben wir nicht mal eine Sekunde nur für uns gehabt.«
Es gefiel Schyler nicht, in welche Richtung sich das Gespräch entwickelte, und Kens selbstbewusster Ton gefiel ihr noch weniger. Höflich, aber bestimmt machte sie ihren Arm frei. »Das stimmt, Ken, das hatten wir nicht. Und ich finde, das ist auch besser so, meinst du nicht auch?«
»Besser für wen?«
»Für uns alle.«
»Für mich nicht.«
»Ken, bitte.« Schyler wollte an ihm vorbei, aber er hielt sie fest. Wieder sah er sie an und strich ihr über die Wange.
»Schyler, Schyler, ich habe dich so schrecklich vermisst. Meine Güte, kannst du dir eigentlich vorstellen, was es für mich bedeutet, dich wiederzusehen?«
»Nein. Wie ist es denn?« Ihre Stimme klang so barsch, wie ihr Blick vorwurfsvoll war.
Ken runzelte verärgert die Stirn und zog die Hand zurück. »Ich kann ja verstehen, wie du dich gefühlt haben musst, als wir herausfanden, dass Tricia schwanger ist.«
Schyler lachte bitter. »Nein, das kannst du nicht. Nicht, solange du nicht auf dieselbe Weise betrogen worden bist oder dir der Boden unter den Füßen weggezogen worden ist. Nein, du kannst wirklich nicht wissen, welch ein Gefühl das für mich war.« Sie benetzte die Lippen und schüttelte den Kopf, als wollte sie den Anflug einer unüberwindlichen Depression abwehren. »Ich muss jetzt los.«
Wieder versuchte sie an ihm vorbeizugehen, und wieder stellte er sich ihr in den Weg. »Schyler, lass uns darüber reden.«
»Nein.«
»Du bist nach London verschwunden, ohne mir auch nur die geringste Chance zu geben, es dir zu erklären.«
»Was hätte es denn da zu erklären gegeben? Wir wollten gerade unsere Verlobung bekanntgeben, als Tricia uns zuvorkam und verkündete, dass sie ein Kind von dir erwartet. Von dir, Ken«, wiederholte sie und betonte jedes einzelne Wort.
Er biss sich auf die Unterlippe, die einzige Andeutung eines schlechten Gewissens. »Wir beide hatten uns gestritten, weißt du noch?«
»Ein Streit, na gut. Ein dummer Streit unter Liebenden. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, worum es dabei überhaupt ging. Aber dich muss es ja wirklich getroffen haben. Du hast keine Zeit vergeudet, mit meiner Schwester ins Bett zu hüpfen.«
»Ich wusste doch nicht, dass sie schwanger werden würde.«
Schyler war sprachlos. Konnte Ken tatsächlich derart begriffsstutzig sein? Sechs Jahre waren eine lange Zeit. Sie hatte sich verändert. Ken offensichtlich auch. Und dennoch war es doch einfach unmöglich, dass er nicht begriff, worum es ging.
»Ken, nicht ihre Schwangerschaft allein war das Entscheidende. Was mich mindestens genauso sehr verletzt hat, war, dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie ein Kind von dir erwartet hat.«
Er kam einen Schritt näher und ergriff ihre Schultern. »Schyler, du gibst dem Falschen die Schuld. Tricia hat es wirklich darauf angelegt. Mein Gott, ich bin auch nur ein Mann. Ich war niedergeschlagen. Zuerst habe ich gedacht, sie will mich nur trösten, weißt du, mir ihr Mitgefühl zeigen, aber dann …«
»Verschon mich damit.«
»Aber du musst mir zuhören.« Er schüttelte sie leicht. »Ich will, dass du mich verstehst. Sie, na ja, sie fing dann an, mit mir zu flirten, hat mir Komplimente gemacht. Und eines führte zum anderen. Sie hat mich geküsst. Und das Nächste, was ich weiß, ist, dass wir im Bett lagen. Es ist nur einmal passiert.« Schyler schaute ihn ungläubig an. »Okay, vielleicht ein paarmal, aber es hat mir nie etwas bedeutet. Ich habe sie gebumst, ja, aber geliebt habe ich nur dich.« Er fasste sie fest bei den Schultern. »Und das tue ich noch immer.«
Wütend stieß Schyler seine Hände fort. »Wie kannst du es wagen, mir das zu sagen? Damit beleidigst du uns beide. Du bist der Ehemann meiner Schwester.«
»Aber wir sind nicht glücklich.«
»Bitter für dich. Ich bin’s.«
»Mit diesem Mark, für den du arbeitest?«
»Ja. Ja, mit diesem Mark. Mark Houghton war sehr, sehr gut zu mir. Ich liebe ihn, und er liebt mich.«
»Nicht so, wie wir uns geliebt haben.«
Sie lachte kurz auf. »Nicht so, wie wir einander geliebt haben. Mark und mich verbindet eine Liebe, die du nie verstehen würdest. Aber egal, wie meine Beziehung zu Mark ist, es spielt keine Rolle. Du bist mit Tricia verheiratet, und ob eure Ehe nun glücklich ist oder nicht, ist mir völlig egal.«
»Das nehme ich dir nicht ab.«
Blitzartig zog er sie an sich und küsste sie. Heftig. Sie fuhr zusammen und gab ein kleines würgendes Geräusch von sich, als seine Zunge in ihren Mund drang. Doch er ließ nicht von ihr ab.
Für einen Moment erlaubte sie es, weil sie wissen wollte, wie sie darauf reagierte. Und sie stellte reichlich überrascht fest, dass Kens Kuss nichts weiter als Abscheu in ihr hervorrief. Sie stemmte die Fäuste gegen seine Brust und stieß ihn weg. Rasch und ohne ein Wort stieg sie in ihren gemieteten Cougar und ließ den Motor an. Sie trat das Gaspedal durch und schoss davon, dass der Kies hochspritzte.
4. Kapitel
Hinter einem Baum versteckt, beobachtete Cash, wie Schyler davonfuhr und Ken ihr wehmütig nachschaute. Er wartete, bis Howell widerwillig die Treppe hinauf und ins Haus gegangen war, ehe er in die dunkleren Schatten des Waldes tauchte und sich in Richtung Bayou aufmachte.
»Daher weht also der Wind«, sagte er zu sich.
In Heaven wusste jeder über jeden Bescheid. Der Skandal um die Crandall-Schwestern vor sechs Jahren hatte eine Menge Wirbel verursacht. Noch Monate nach Schylers unfreiwilliger Abreise nach London hatte das Städtchen vor Klatsch und Tratsch gebrummt; die wildesten Spekulationen waren angestellt worden, wann sie wohl wieder zurückkehren würde. Manche meinten, nach wenigen Wochen. Andere meinten, sie würde ein oder zwei Monate schmollen. Doch niemand wettete darauf, dass es Jahre dauern würde, ehe sie zurückkehrte, und das auch nur, weil das Leben ihres Vaters in Gefahr war.
Doch nun war Schyler Crandall zurück auf Belle Terre und augenscheinlich zurück in den Armen ihres alten Liebhabers. Wenn dieser Kuss etwas besagte, dann, dass es ihr egal war, ob Howell mit ihrer Schwester verheiratet war. Vielleicht war ihr endgültig klar geworden, dass sie ihn zuerst gehabt hatte, und betrachtete das nun nur als fair.
Allerdings konnte Cash nicht verstehen, weshalb beide Frauen auf Ken Howell scharf waren. Er musste wohl mehr draufhaben, als ihm anzusehen war. Howell war als regelmäßiger Kunde in den einschlägigen Etablissements und Bordellen in der Gegend bekannt, aber das war nichts Besonderes. Doch darüber hinaus war er kein Schürzenjäger odereiberheld.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!