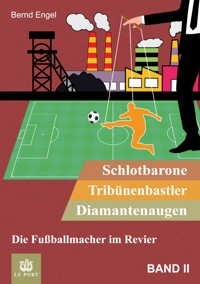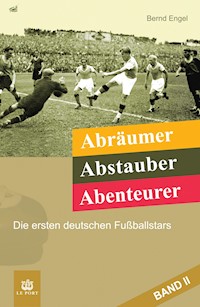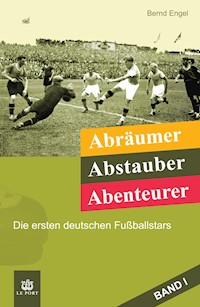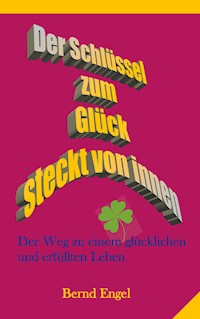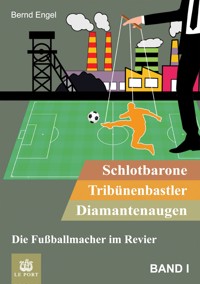
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Schlotbarone, Tribünenbastler, Diamantenaugen.
- Sprache: Deutsch
Geht man der Frage nach, wer die Fußballvereine im Ruhrgebiet in den letzten 100 Jahren groß gemacht hat, kommt man an diesen zwölf Männern kaum vorbei. Es sind Männer mit Sachverstand, Ehrgeiz, aber auch mit Charisma und Selbstbewusstsein. Letzteres war nicht unwichtig, denn die spezifische, mitunter raue Fußballkultur des Reviers erforderte ein dickes Fell und Nehmerqualitäten. Die hier porträtierten Vereinslenker bieten in Sachen Temperament und Selbstverständnis eine ordentliche Bandbreite an. Vom fröhlichen Daueroptimisten über den beinharten Krisenmanager, den smarten, umsichtigen Socializer bis hin zum Patriarchen alter Schule – alles ist dabei. Auch die Wege ins Amt waren unterschiedlich. So gab es ehemalige Aktive, die ihrem Verein verbunden blieben und schließlich an die Spitze rückten, ortsansässiges Bürgertum, das gegen mehr Bekanntheit, mehr Renommee, mehr Kundschaft nichts einzuwenden hatte, oder auch klassische Selfmade-Mittelständler, die mit dem Erreichen und Sichern ihrer ökonomischen Ziele ihrem emotionalen Haushalt etwas Gutes tun wollten Sie alle verstanden die Seele der Vereine; beherrschten instinktiv die Gefühlswelt der Mitglieder und Fans. Ihre Arbeit zeichnete sich durch Ideen, Eloquenz, Hartnäckigkeit, Bauernschläue aus. Ihre Pläne und Projekte, egal ob es um Aufstieg, Meisterschaft, Stadionbau oder Nachwuchsförderung ging, wurden zu Quantensprüngen. Oder zu Rohrkrepierern. Mit Mittelmaß gaben sie sich nur selten zufrieden. Dafür war zu viel Herzblut und manchmal auch ein wenig Eitelkeit im Spiel. Porträts in Band I: Fritz "Papa" Unkel (Schalke 04) Peter Maaßen (Rot-Weiß Oberhausen) Ottokar Wüst (VfL Bochum) Günter Siebert (Schalke 04) Walter Hellmich (MSV Duisburg) Dr. Reinhard Rauball (Borussia Dortmund)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Bernd Engel
Schlotbarone, Tribünenbastler, Diamantenaugen.
Die Fußballmacher im Revier
Band I
© 2023 Bernd Engel | Le Port
ISBN Softcover: 978-3-347-94026-0
ISBN Hardcover: 978-3-347-94027-7
ISBN E-Book: 978-3-347-94028-4
Druck und Distribution im Auftrag :
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Bild auf dem Umschlag:
©OpenClipart−vectors / pixabay.com (149241, 154904, 2023250, 157930), ©Clker−Free−Vector−Images / pixabay.com (40620), ©Mohammed−hassan / pixabay.com (5926178, 4254951)
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Charismatische Führung
Die vorliegenden zwölf Porträts…
Ein Dankeschön
Fritz “Papa” Unkel (FC Schalke 04)
Der Papa macht das gut: Arbeit am Schalker Fundament
Eine kinderreiche Familie im Ruhrgebiet
Der Turner und Sänger Fritz Unkel
Die Leushackes
Über 50 Jahre auf Consol
Schalker Straße 143
Der Schalker Kreisel bittet zum Tanz
Das berühmte Schwagerpaar39 betritt die Bühne
Meilenstein Glückauf-Kampfbahn
Unkels Organisations- und Führungsqualitäten
Die WSV-Attacke
Immer näher an die Meisterschaft heran
Einflussnahme des NS-Regimes
Erneute Enttäuschung
Endlich die Meisterschaft
Prophylaktischer Kampf gegen Diskreditierung
Eine Dekade voller sportlicher Erfolge
Wiederholungen gefallen
Reisen – Reden – Repräsentieren
Mit dem Club im Dauerclinch
Die Hochzeit von 1937 bis 1942
Weitere Erfolge, weitere Ehrungen
Wiener Schule vs. Schalker Kreisel
Unkels Rückzug
Mit Routine gegen den DSC
Arbeiterverein trifft Arbeiterverein
First Vienna als dritter Wiener Verein
Luftangriffe gegen die Rüstungsindustrie
Dramatische letzte Tage
Peter Maaßen (Rot-Weiß Oberhausen)
Kobluhn, Krauthausen, Karneval: Der Macher unter dem Gasometer
Industriewiege Oberhausen
Gründungsgeschichte OSpV
Boom nach dem Ersten Weltkrieg
1933 wird es Rot-Weiß
Maaßen kommt nach Oberhausen
Wechsel zur Jürissen-Elf
Nach oben weggelobt
Glänzender Start
Höhen und Tiefen in der Nachkriegszeit
1957: Rückkehr in die Oberliga
Sundermann, Siemensmeyer, Traska verstärken RWO
Sehnsuchtsort Bundesliga
Der lange Marsch durch die Regionalliga
Dauerthemen Bundesliga und 2. Liga
Entwicklung einer Aufstiegsmannschaft
Aufstiegssaison 1968/69
Der Bundesliga-Skandal – ein Drama in mehreren Akten
Kindermann sorgt für Wechselbäder
„Maaßen freut sich zu früh“
„Wenn die Sonne versinkt über der A3…“ (Missfits)
Maaßen übergibt an Schulz
Schlussakkord
Ottokar Wüst (VfL Bochum)
Vater und Sohn in Bochum: Unaufhörlich unabsteigbar
Ein Franke kommt nach Bochum
Nimmermüder Einsatz für die Germania
Die Germania in der Gauliga
Otto Wüst – eine zentrale Figur der Germanen
Die Gründung des VfL
Aus dem TuS-Stadion wird das VfL-Stadion
Drei Vereine raufen sich zusammen
Der VfL in der Gauliga
Neuanfang mit Höhen und Tiefen – und mit Otto Wüst
Ottokar Wüst übernimmt
Gelungener Start in der Regionalliga
Gentleman Wüst holt Gentleman Eppenhoff
Wüst formt den VfL
Westmeister und im zweiten Anlauf auch Aufsteiger
Endlich in der Bundesliga
Über zwei Jahrzehnte Bundesliga mit Ottokar Wüst
Transferstrategie mit Prinzipien
Transfererlöse als Teil der Budgetplanung
Treue zu den Trainern
Der unkonventionelle Ideengeber
Die VfL-Familie
Legendäre Winterbälle
Vertragsverhandlungen mit Ottokar Wüst
Der Zauber verblasst
Abschied vom Fußball-Oberhaus
Der VfL nach Ottokar Wüst
Letzte Ehrungen
Günter Siebert (FC Schalke 04)
Das Diamantenauge: Wohnhaft im Herzen aller Schalker
Kassel – Stadt der Lokalderbys
„Was ist schon Olympia…“
Siebert auf Schalke, die Erste
Siebert auf Schalke, die Zweite
Der Weg zur Meisterschaft
Ein glattes 3:0 im Finale
Ein Meniskusschaden beendet die Spielerlaufbahn
Der Familienvater
Der Selfmademan
Der Vereinsfunktionär
Siebert auf Schalke, die Dritte
Sieberts Nachwuchsstrategie
Glücksgriff Klaus Fischer
Wer ist der richtige Trainer?
Erfolgsjahr 1972
17. April 1971 – der schwärzeste Tag der Vereinsgeschichte
Erste interne Widerstände
Rückkehr zur sportlichen Stabilität
Unfreiwilliger Rückzug
Neuer Anlauf
Siebert auf Schalke, die Vierte
Erneut kein Manager
Der Vorhang fällt, die weiße Weste bleibt
Stehaufmännchen Oskar
Reif für die Insel
Siebert auf Schalke, die Fünfte
Rüssmann soll das Wunder vollbringen
Thon trifft Toni
Forelle königsblau
Abgesang und endgültiger Rückzug
Königsblaue Nachwehen
Deutsch-spanischer Lebensabend
Walter Hellmich (MSV Duisburg)
Unterwegs in allen Gassen: Ein Hamborner für Meiderich
Die Anfänge des Duisburger Vereinsfußballs
Die Hamborner Jahre der Hellmichs
Die Nachkriegskarriere des MSV
Hellmich junior übernimmt
Langsamer Abstieg des MSV
Walter Hellmich in Ost und West
Neue Geschäftsfelder
Rendezvous mit dem MSV
Arena in Rekordzeit
Festhalten an Norbert Meier
Aufstieg und Aufbruch
Meier sucht Streit
Bommer bleibt cool
Der Aufzug hält wieder in der Bundesliga
Fluktuationsrekorde an der Wedau
Hellmich will nicht mehr
Ein Leben ohne die Zebras
Marktnische Sportstättenbau
Wachstumsmarkt Seniorenheime
Innovationsfeld Logistik
Der MSV ohne Hellmich
Licht am Ende des Tunnels
Heimspiel in Dinslaken
Die vielen Facetten des Walter Hellmich
Dr. Reinhard Rauball (Borussia Dortmund)
Der „kleine Doktor“ mit den großen Verdiensten: Echte schwarz-gelbe Liebe in drei Akten
Nachkriegsnöte und -hoffnungen
Göttingen und Northeim
Abitur in Dortmund
Jura-Studium, Promotion, erste berufliche Schritte
Schwarz-gelbe Liebe – I. Akt
Lattek sorgt für Euphorie
Zebec kommt
Ein Bruder ist wie eine Schulter (Somalisches Sprichwort)
Investoren-Ausflüge in die Minen- und Modebranche
Leder statt ÖL
Schwarz-gelbe Liebe – II. Akt
Über acht Millionen DM Schulden brutto
Borussia mit PAL-System
Die Wiedergeburt des BVB
Rauball verabschiedet sich erneut
Die Fälle des Dr. Reinhard Rauball – ein Streifzug
Im Clinch mit den Verbänden
Spieler und Trainer gegen den Verein
Krabbe und Rocchigiani
Ausflug in die Landespolitik
Das EuroGas-Abenteuer – in Kurzform
Das Autoren-Kollektiv Rauball
Brüderliche Stippvisiten bei Union Berlin und Fortuna Köln
Schwarz-gelbe Liebe – III. Akt
Stabwechsel im Präsidentenamt
Absicherung durch die Politik
Kon: ter, sportliche Stabilisierung und ein Befreiungsschlag
Ein Stadion wird zum Park
Van Marwijk, Röber, Doll in schwierigen Jahren
„Nebenjobs“ bei DFL und DFB
Raus mit Applaus
Ein „Pöhler“ macht den BVB wieder zum Schwergewicht
Double, Trubel, Heiterkeit
Bye, bye Bayern
Stabilitätsanker Rauball
Mit ruhiger Hand
Der Privatmann Rauball
Literaturangaben/Bildverzeichnis
Sie Möchten die Dosis erhöhen?
Schlotbarone, Tribünenbastler, Diamantenaugen.
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Sie Möchten die Dosis erhöhen?
Schlotbarone, Tribünenbastler, Diamantenaugen.
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
Vorwort
Superlative müssen nicht bemüht werden, aber es gibt ihn schon, den spezifischen Charme des Revierfußballs. Ein Charme, der sich aus verschiedenen Quellen speist. In den Anfangsjahrzehnten war es die identitätsstiftende Funktion der Vereine – speziell für die zugewanderten Arbeitskräfte im Ruhrgebiet. Das damit aufkommende Wir-Gefühl wurde verstärkt durch die gemeinsame Errichtung der ersten Fußballplätze, unterstützt von den Arbeitgebern, den Zechen und Hüttenwerken vor Ort. Die „Straßenbahnnähe“ der Konkurrenz sorgte zudem für Trennschärfe gegenüber anderen Vereinen.
In der Nachkriegszeit war es der auffällige Kontrast zwischen der Flutlicht-Glitzerwelt Profifußball und dem grauen Industriealltag, der den Revierfußball zu etwas Besonderem machte. Und gegen Ende des 20. Jahrhunderts sorgte ein gewisser Underdog-Trotz für den Unterschied. Es war der robuste und entschlossene Trotz einer Region, die sich in einem tiefgreifenden Strukturwandel befand und sich mit Haut und Haaren gegen den gleichzeitigen Niedergang ihrer Traditionsvereine wehrte – meist mit Erfolg.
Schließlich gibt es noch als zeitlose Eigenheit die tradierte Liebe zum Verein, frei nach der „Borussia“-Liederzeile „als Kind bin ich mit meinem Vater gekommen, und der wurd' auch schon von seinem mitgenommen…“ (Bruno Knust). Damit wird der von Fußball-Hipstern häufig zitierten Theorie Nick Hornbys, „Du suchst Dir nicht Deinen Verein aus, sondern Dein Verein sucht sich Dich aus“, doch gleich mal ein Riegel vorgeschoben. Denn solche elementaren, den Familienfrieden nachhaltig beeinflussenden Richtungsentscheidungen überlässt der Fan zwischen Duisburg und Dortmund nur ungern dem Zufall. So entstanden über die Jahrzehnte im Revier äußerst stabile, belastbare Beziehungen zu den jeweiligen Klubs. Beziehungen, die noch eine Spur intensiver und humorloser gelebt werden als anderswo in der Republik.
Charismatische Führung
Zu den Präsidentenämtern zog es markante, selbstbewusste Persönlichkeiten, die es sich zutrauten, ihre Vereine mutig durch die Fährnisse eines oft rasanten Liga-Alltags zu steuern. Es waren durchsetzungsstarke Männer mit ehrgeizigen Zielen. Sie verstanden die Seele ihrer Vereine, beherrschten die Tastatur der Fan-Emotionen. Dabei waren sie bestens vernetzt und besetzten auch rasch und ohne falsche Koketterie die Entscheiderebene. Ihre Arbeit zeichnete sich durch Ideen, Volksnähe, Eloquenz, Hartnäckigkeit und auch einen Schuss Bauernschläue aus. Ihre Pläne und Projekte, egal ob Aufstiege, Meisterschaften, Stadionbau oder Nachwuchsförderung, wurden zu Quantensprüngen. Oder zu Rohrkrepierern. Mit Mittelmaß gaben sie sich nur selten zufrieden. Dafür war zu viel Herzblut, zu viel Ambition und bisweilen auch etwas zu viel Eitelkeit im Spiel.
In Sachen Temperament oder auch Selbstverständnis gab es eine ordentliche Bandbreite. Vom fröhlichen Daueroptimisten über den beinharten Krisenmanager, den smarten, umsichtigen Socializer bis hin zum Patriarchen alter Schule. Der letztgenannte Typ dominierte in den Nachkriegsjahrzehnten, als sich die Bundesrepublik von einer aufstiegswilligen „das Brot der frühen Jahre“-Gesellschaft in eine anspruchsvolle Wohlstandsgesellschaft wandelte. In dieser Zeit waren die Vereine noch eingetragene Vereine, bildeten eine reine Männerdomäne und wurden ehrenamtlich geführt. Wahl und Inauguration erfolgten in temperamentvollen, alkoholschwangeren Versammlungen. Wer mit frisch geschmiedeten Allianzen und Bierzelt-kompatibler Rhetorik aufwarten konnte, der hatte gute Karten. Denn von einem Präsidenten wurden Kreativität, Kontaktfreude, Robustheit und Macherqualitäten erwartet. Später, mit steigenden Ablösesummen und Gehältern, galt auch eine dicke Brieftasche als willkommene Begleiterscheinung.
Die Vorleben der in diesem Buch porträtierten Männer fallen sehr unterschiedlich aus. Es gab ehemalige Aktive, die ihrem Verein verbunden blieben und schließlich auf der Vorstandsetage ankamen. Es gab ortsansässiges Bürgertum, das gegen mehr Bekanntheit, mehr Renommee, mehr Kundschaft nur wenig einzuwenden hatte. Und es gab klassische Selfmade-Mittelständler, die nach Erreichen und Sichern ihrer ökonomischen Ziele ihrem emotionalen Haushalt etwas Gutes tun wollten. Egal, welcher Weg ins Amt führte, einen geordneten Rückzug schafften am Ende nur wenige – was schade ist. Denn die meisten haben unter dem Strich enorme Verdienste, die oft erst Jahre später (an)erkannt wurden. Zu dieser Anerkennung möchte auch dieses Buch einen kleinen Beitrag leisten.
In den Neunziger- und Nullerjahren änderten sich vielerorts die Vereinsstrukturen. Die meisten Vereine verwandelten sich in Kapitalgesellschaften mit entsprechenden Aufsichtsgremien. Ein rapides Umsatzwachstum und ein damit einhergehendes breiteres Aufgabenspektrum sorgten für arbeitsteilige Strukturen mit neuen starken „Mitspielern“ im Management oder in den Aufsichtsräten. Für einen charismatischen oder gar patriarchalischen Führungsstil blieb da nur noch wenig Spielraum. Romantiker beklagen eine Technokratisierung des Fußballs. Das mag teilweise stimmen. Doch der Autor ist sich sicher: Solange grüner Rasen, ausverkaufte Stadien und gleißendes Flutlicht vor Industriekulisse für ein faszinierendes Flair sorgen, wird es auch weiterhin schillernde Persönlichkeiten, Männer wie Frauen, geben, die es zu den Traditionsvereinen an der Ruhr drängt.
Die vorliegenden zwölf Porträts…
…beschränken sich auf Präsidenten und Personen, die von Vereinsversammlungen gewählt wurden; Angestellte bleiben außen vor.
…sind eingebettete Geschichten, die den Hauptscheinwerfer auf die Amtszeit der jeweiligen Hauptperson richten, gleichzeitig aber auch das Vor- und Nachleben, das berufliche Umfeld, den Verein, die Stadt, die Zeit, die familiäre Situation so weit ausleuchten, dass es zu einem besseren Verständnis der Person beiträgt.
…erheben keinen wissenschaftlichen Anspruch im Sinne formaler Akkuratesse. Die Lesefreundlichkeit genießt Priorität. Trotzdem gibt es zu den neuralgischen Passagen und direkten Zitaten – diese werden durch Anführungszeichen und Einrückung kenntlich gemacht und stets eins zu eins inklusive eventueller Fehler wiedergegeben – konkrete Quellenangaben. Entweder unmittelbar im Text oder als Fußnote. Auch Erläuterungen und „sachdienliche“ Hintergrundinformationen werden, wenn es als notwendig erachtet wird, als Fußnote angeführt. Literaturverzeichnisse und Bildnachweise im Anhang sind selbstverständlich.
…könnten visuell vielleicht etwas opulenter ausfallen. Doch die Bild- und Fotobeschaffung ist bei einem low-budget-Rahmen und einem recht rigiden Urheberrechtsgesetz in Deutschland nicht so einfach. Bilder mit CC-Lizenz, Digitalisate von historischen Zeitungen, eigene Fotos und einzelne, private Sondergenehmigungen ließen am Ende eine einigermaßen befriedigende Bildauswahl zu.
…sind in ihrem Hauptstrang im historischen Präsens geschrieben, was sie, so die Hoffnung, einen Tick frischer, unmittelbarer macht.
…folgen weitgehend einem chronologischen Faden, trotz gelegentlicher Lasso-Einstiege und kleinerer Exkurs-Einschübe.
Ein Dankeschön
Zu einigen Porträts tauchte bei den Recherchen doch noch die eine oder andere Frage auf. Zumeist erhielt der Autor von den Hauptpersonen selbst, von Familienmitgliedern oder Fachleuten bereitwillig Auskunft, so dass an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön gehen soll an
• Heinrich Hellmich (Hellmich Transporte GmbH) und Walter Hellmich (Hellmich-Gruppe), die mir Einblicke in die durchaus komplexe Familiengeschichte der Hellmichs in Hamborn gewährten,
• Michael Wüst, Bernd Kreienbaum, Dr. Henry Wahlig, die äußerst interessante Text-, Bild- und auch Audio-Materialien zu Ottokar Wüst zur Verfügung stellten,
• Reiner Keith, den Urenkel von Fritz Unkel, und Natalie Pöschke für ihre Prüfung und Ergänzung meiner Recherche-Ergebnisse zum Elternhaus und zur Familie von Fritz Unkel,
• Ute, Cornelia und Ingrid Steilmann für wichtige Hinweise, Korrekturen zum Porträt von Klaus Steilmann und eine sehr geduldige und angenehme Kommunikation,
• Wolfgang Schubert von der Website www.minister-achenbach.de für interessante Hintergrundinformationen zu Lünen-Brambauer und zur Zeche Minister Achenbach im Niebaum-Kapitel,
• einige andere Personen, die mir beim Probe- und Korrekturlesen (Sebastian Thürmer, Sabine Engel) bzw. bei gestalterischen Fragen (Ralf Skiba) hilfreich zur Seite standen.
Fritz “Papa” Unkel
* 28. August 1865 in Schalke
† 4. November 1944 in Gelsenkirchen
Abb. 1: Fritz „Papa“ Unkel. // Bild: be - eigenes Werk; CC BY-SA 4.0
Der Papa macht das gut
Arbeit am Schalker Fundament
Das 20. Jahrhundert hat begonnen, als der Vorsitzende eines etablierten Turnvereins jungen Straßenfußballern unter die Arme greift und sich sogar bereit erklärt, den Turnverein für den Fußballklub zu verlassen. Das ist für die damalige Zeit mehr als ungewöhnlich, aber auch schon bald sehr erfolgreich. Denn die hochveranlagten Talente bringen in Kombination mit der erfahrenen, fürsorglichen Vereinsführung den jungen Fußballverein in kürzester Zeit nach ganz oben. Am Ende stehen unter der Leitung des alten „Turnvaters“ mehrere Deutsche Meisterschaften, ein Pokalsieg und ein unverwechselbarer Spielstil auf der Habenseite. Ein Spielstil, der in ganz Deutschland Bewunderer findet. Es ist ein modernes Märchen.
Das Ruhrgebiet erlebt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine extreme Boomphase. Die Förderung hochwertiger Steinkohle schafft unablässig neue Arbeitsplätze, für die stets neue Arbeitskräfte benötigt werden. Nur wenige Jahrzehnte zuvor, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zählte das damals noch selbständige Dorf Schalke gerade einmal 250 Einwohner. Doch der Bergbau, die Anbindung an die Köln-Mindener Eisenbahn und die bald folgende Ansiedlung von Hüttenwerken und metallverarbeitenden Betrieben lassen die Bevölkerungszahl auf 8.000 (1875), 28.000 (19031) und 33.710 Menschen (1910) emporschnellen. Kamen zu Beginn des Booms die Arbeitskräfte noch vorwiegend aus dem Rheinland, dem Münsterland, dem Sauerland oder aus Ostwestfalen, so kann gegen Ende des 19. Jahrhunderts das Wachstum nur noch mit Arbeitskräften aus Pommern, Schlesien, Ostpreußen, Masuren und Polen gesichert werden. Das Ruhrgebiet wird zum Schmelztiegel. 1890 sind ca. 80 Prozent der Einwohner Gelsenkirchens Zuwanderer der ersten oder zweiten Generation. In der Mehrzahl Masuren und Polen. Diese Migranten gehörten in ihrer alten Heimat überwiegend zur Schicht der mittellosen Landbevölkerung (Knechte, Landarbeiter, Tagelöhner), die mit sicheren Löhnen, später auch Arbeitersiedlungen und anderen Vergünstigungen ins Ruhrgebiet gelockt wurden.
Eine kinderreiche Familie im Ruhrgebiet
Fritz Unkel kommt am 20. August 1865 in Schalke als siebtes Kind von Wilhelm und Anna Wilhelmine Unkel zur Welt. Vater Wilhelm wurde am 6. Juli 1825 in Eppinghofen, heute Mülheim, geboren. Mutter Wilhelmine ist etwa vier Jahre jünger als ihr Mann. Sie erblickt am 8. Oktober 1829 in Werden, heute ein Stadtteil von Essen, als Anna Wilhelmine Loosen das Licht der Welt. Die Eltern heiraten am 2. November 1851 in Duisburg.
In den nächsten Jahrzehnten erlebt die Familie Unkel, die kurz vor Fritz‘ Geburt von Essen nach Schalke zieht, diverse Ereignisse und Entwicklungen, die hinreichend Stoff für eine interessante Familiensaga bieten würden. Diese Schlussfolgerung lassen verschiedene Zeitungsmeldungen, Zeitungsanzeigen, Mitteilungen der örtlichen Standesämter und Recherchen auf genealogischen Plattformen zu, die punktuelle, fragmentarische, manchmal auch recht tiefe Einblicke in das Unkel’sche Familienleben erlauben. Ein Familienleben, bei dem sich erfreuliche Anlässe wie Geburten, Hochzeiten, berufliche Erfolge mit Krankheiten, Unglücken und (frühen) Todesfällen abwechseln. In diesem Sinne steht die Familie Unkel auch exemplarisch für viele Familien gegen Ende des 19. Jahrhunderts, im Ruhrgebiet: Eine hohe Kinderzahl geht oft einher mit wohnlicher Enge und bescheidenem Wohlstand oder gar Pauperität. Ungesunde, unfallträchtige Arbeitsbedingungen, unausgewogene Ernährung und mangelhafte medizinische Versorgung sorgen für eine reduzierte Lebenserwartung.
Vor Fritz Unkel bringt Mutter Wilhelmine bereits vier Söhne und zwei Töchter zur Welt. Der älteste Sohn bzw. Fritz‘ ältester Bruder, Johann Wilhelm Unkel, kommt in Essen am 10. November 1852 zur Welt. Am Weihnachtstag 1854, am 25. Dezember, folgt Schwester Anna Wilhelmine; knapp ein Jahr später, am 5. Januar 1856, Schwester Aletta Catharina Wilhelmine.
Es folgen drei weitere Brüder, nämlich am 21. November 1858 Johann August, am 13. Dezember 1860 Max Gerhard, am 16. März 1863 Ernst Wilhelm, bevor am 20. August 1865 Fritz als siebtes Kind der Unkels zur Welt kommt. Fritz wird bereits in Schalke geboren, aber die Taufe findet noch einmal in Essen statt.
Fritz bleibt für zehn Jahre das Nesthäkchen der Familie. Dann kündigt sich erneut Nachwuchs an. Es lässt sich nur mutmaßen, ob es sich um ein Wunschkind oder um einen – im zeitgenössischen Sprachgebrauch – „Unfall“ handelt. Immerhin ist Mutter Wilhelmine bereits 45 Jahre alt und Schwangerschaften im hohen Alter sind im 19. Jahrhundert keineswegs risikofrei. Aber es gibt keine Komplikationen. Am 11. Juli 1875 kommt Hedwig Ida Wilhelmine in Gelsenkirchen zur Welt. Am 29. Juli erfolgt die Taufe.
Tragischerweise verunglückt Vater Wilhelm im Alter von 50 Jahren vier Wochen vor der Geburt tödlich. Der Betriebsführer der Zeche Consolidation, kurz Consol, verletzt sich am 14. Juni 1875 bei Abteufarbeiten. Vermutlich waren es Arbeiten am Wetterschacht, Schacht 4, später Schacht 5 genannt2. Trotz der Geburt von Hedwig Ida Wilhelmine sind es für die Unkels schwere Tage.
Abb. 2: Fritz Unkels Elternhaus // Bild: be - eigenes Werk; CC BY-SA 4.0
+++ Exkurs: Fritz Unkels Elternhaus +++
Bruder Wilhelm
Fritz‘ ältester Bruder Wilhelm ist 23 Jahre alt, als Vater Wilhelm tödlich verunglückt. Er übernimmt jetzt mehr und mehr die Rolle des Familienoberhauptes. Etwa zwei Jahre später, am 28. Juni 1877, heiratet er die zwei Jahre jüngere Elise Bast aus Schalke. Am 22. Oktober 1979 kommt Tochter Leonore Aletta Christine zur Welt, die am 11. Juli 1901 den Drogisten Albert Heinrich Stränger heiraten wird. Am 20. November 1881 folgt Sohn August Wilhelm, der am 29. Januar 1913 heiratet und im Ersten Weltkrieg Karriere macht (Eisernes Kreuz (EK), Vizewachtmeister). Am 27. Juli 1884 Sohn Ernst Max. Ernst Max stirbt kurz vor Vollendung des zweiten Lebensjahres, am 11. Juli 1886. Am 29. August 1886 wird Tochter Martha Elfriede Wilhelmine geboren, die am 31. Juli 1915 einen Walter Achenbach ehelicht.
Wie das Standesamt Gelsenkirchen anlässlich der Hochzeit in der „Emscher-Zeitung“ mitteilt arbeitet Wilhelm im Sommer 1877 bereits als Bäcker. Auch eine Anzeige aus dem Jahre 1884 belegt den „Bäcker und Colonialwarenhändler Wilhelm Unkel zu Schalke, Wilhelminenstraße Nr. 234“. Der Anlass der Anzeige ist weniger erfreulich, denn der von Wilhelm beauftragte Rechtsanwalt Greve aus Gelsenkirchen klagt gegen den Fabrikarbeiter Friedrich Schulz aufgrund nicht beglichener Forderungen von 29 Mark und 37 Pfennig. Da Schulz sich wohl nicht mehr in Schalke aufhält, wird die Anzeige von einem gewissen Hovestadt, Gerichtsschreiber des Königlichen Amtsgerichts, in Form einer „Öffentlichen Zustellung“ bekannt gemacht. Und das gleich mehrmals. So gehen Abschreckung und Werbung eine ungewöhnliche Symbiose ein.
Auch sonst scheint Wilhelm das Licht der Öffentlichkeit nicht zu scheuen. Sein Name taucht oft in den Gelsenkirchener Zeitungen auf – nicht nur im Anzeigenteil. Er betätigt sich als Hauptschöffe am Königlichen Amtsgericht, engagiert sich bei den „Gemeinde-Verordnetenwahlen“ in vorderer Wahlabteilung, spendet für den Schalker Wohltätigkeitsverein, lässt seine Stimme im Männerchor erklingen. Kurz, Wilhelm Unkel wohnt in der Wilhelmstraße3 12, ist in Schalke ein bekannter Mann und im öffentlichen Leben bestens integriert.
Am 30. April 1924 endet das erfüllte Leben Wilhelms im 72. Lebensjahr. Zuletzt wohnt der ehemalige Bäcker in der Gewerkenstraße 18 in unmittelbarer Nähe zu den ersten Schächten der Zeche Consolidation. Seine Frau Elise ist bereits verstorben; das genaue Datum ließ sich nicht ermitteln.
Schwestern Anna Wilhelmine und Aletta
Komplett im Dunkeln liegt das Leben der am 1. Weihnachtstag 1854 geborenen Anna Wilhelmine, Fritz‘ ältester Schwester. Weder Adressbücher noch Zeitungsarchive liefern Hinweise zu ihrem Leben.
Anders verhält es sich mit der zweitältesten Tochter Aletta. Ihre Lebensstationen zeigen, dass das Leben der Unkels nach dem Unfalltod des Familienoberhauptes weitergehen musste und auch weiterging. Sie bestellt im November 1876, also etwa achtzehn Monate nach dem Tod von Vater Wilhelm, das Aufgebot mit dem Schalker Steiger Karl4 Diedrich Höstermann, geboren 1851. Höstermann kommt ursprünglich aus Überruhr-Hinsel, heute ein Stadtteil von Essen, südlich der Ruhr gelegen. Die Hochzeit findet am 28. November statt; zweieinhalb Monate später, am 23. Februar 1877, kommt das erste Kind zur Welt, August Wilhelm Höstermann.
Zwei Jahre später freuen sich die beiden über die Geburt von Tochter Aletta. Doch schon am 27. November 1879, beklagen die Eltern den Tod des kleinen Mädchens. Zehn Jahre später, 1889, kommt Tochter Hildegard Elisabeth zur Welt. Auch sie wird nur 19 Jahre alt und verstirbt am 6. Mai 1908.
Ebenfalls von Tragik umweht ist das Leben des Sohnes Erich Friedrich Höstermann, Jahrgang 1890, der aus dem Ersten Weltkrieg nicht zurückkehrt. Am 17. Mai 1915 stirbt der 25jährige Erich im nordfranzösischen Richebourg, Pasde-Calais, auf dem Schlachtfeld. Höstermann ist Unteroffizier der Reserve im Infanterieregiment 55. Er liegt auf dem deutschen Soldatenfriedhof Illies, 23 Rue du Cimetière, Illies, Nord-Pas-de-Calais begraben. Der Eintrag ins Sterberegister erfolgt in Bielefeld.
Die frühen Tode ihrer Kinder Hildegard und Erich erlebt Mutter Aletta nicht mehr. Denn auch ihr ist nur ein kurzes Leben beschieden. Am 1. August 1904 wird sie, so steht es in der Traueranzeige, von „einem langen schweren Leiden“ erlöst. Der Witwer Karl Höstermann bittet um stille Teilnahme; der Trauerzug führt am 4. August vom „Sterbehause, Bismarckstraße 230“ zum Friedhof. Am 6. August spricht der Witwer über eine weitere Anzeige seinen „innigsten Dank“ für die „vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Verluste meiner teuren entschlafenen Gattin, unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, Schwester, Schwägerin und Tante“ aus. Es gibt zu dieser Zeit also auch schon Schwiegersöhne, -töchter und Enkel.
Karl Höstermann heiratet später ein zweites Mal, eine Johanna Schulze. Am 21. August 1923 geht der Lebensweg des Fahrsteigers5 dann zu Ende. Er wurde 72 Jahre alt.
Brüder August, Max und Ernst
Die drei Brüder August, Max und Ernst liegen zwischen Schwester Aletta und Fritz Unkel. Sie sind sieben, fünf und zwei Jahre älter als Fritz und dürften seine Kindheit am engsten begleitet haben.
Johann August Unkel, kurz August Unkel, ist der zweitälteste Sohn der Familie. Er kommt am 21. November 1858 in Essen zur Welt und heiratet am 25. Juni 1885 Mathilde Oligmüller, die am 31. Oktober 1890 den Sohn Victor Albert zur Welt bringt. Beruflich ist August als Wohnungsverwalter für die Bergwerks-AG Consolidation tätig. Im „Haus- und Grundbesitzerverein für den Kreis Gelsenkirchen“ engagiert er sich in Fachkommissionen. August ist ein aktiver, sportlicher Typ. Er begeistert sich früh für den Turnsport und den Gelsenkirchener Turnerclub 1874, für den er im Dezember 1876 den Vorverkauf für das 2. Stiftungsfest mitorganisiert und als „2. Gauvertreter“ auch auf Turngauebene aktiv wird. Er nimmt aber auch – meist gemeinsam mit seinen Brüdern Wilhelm und Fritz sowie Mutter Wilhelmine – an Aktivitäten des Schalker Wohltätigkeitsvereins teil.
Im Juli 1895 und im August 1896 weilt August Unkel mit angegriffener Gesundheit zur Kur in Bad Lippspringe. Doch es ist anscheinend schon zu spät. Das junge Leben endet bereits am 5. Februar 1898 mit 39 Jahren. Laut Traueranzeige stirbt „mein „innigstgeliebter Gatte, unser guter Vater, Schwiegersohn, Bruder, Schwager und Onkel […] nach längerem und mit grösster Geduld ertragenem Leiden“. Zuletzt wohnte die Familie in der Friedrichstraße 26a. Mathilde Unkel zieht später in die Schalker Straße 170, wo sie gemeinsam mit ihrer Mutter, Witwe Ohligmüller, geb. Wirsel, wohnt, die am 24. August 1914 im Alter von 89 Jahren verstirbt. Sohn Albert macht im Ersten Weltkrieg Karriere beim Militär (u.a. Unteroffizier, Vizefeldwebel, EK 2. Klasse, Leutnant der Reserve).
Max, der drittälteste Sohn, wird am 13. Dezember 1860 geboren. Er heiratet am 4. November 1887 die fast acht Jahre jüngere Clara Ida Hedwig Felgenhauer, eine gebürtige Schlesierin. Max Unkel arbeitet als Schuhmachermeister und wohnt mit seiner Familie in der Blumenstraße 6, später Blumendelle. Eine Straße, in der ab 1905 auch Ernst Kuzorra groß werden wird.
Die Ehe bringt zehn Kinder hervor – in chronologischer Reihenfolge: Tochter Klara Cordes (1888-1959), Sohn Max Wilhelm Richard (1890-1968), Sohn Reinhold Friedrich (1891-1894), Tochter Lydia Berta Auguste Wendt und in zweiter Ehe Wilger (1893-1981), Tochter Emma (Emmi) Franziska Schwabe (1895-1988), Sohn Karl Reinhold (1897-1921), Tochter Erna Karolina Sander (1900-2002), Sohn Reinhold August (1902-1977), die früh an TBC verstorbene Tochter Hedwig Frieda (1904-1923), Tochter Elisabeth (Elli) Karola Jenzen (1906-1988)6. Die große Familie kennt sich, schätzt sich, wohnt nah zusammen und hält auch zusammen. Das setzt sich in der nächsten Generation fort. Beispielhaft sei hier Sohn Reinhold August Unkel (1902-1977) genannt. Es ist der zweite Reinhold, dessen Name wohl auch an den ersten Reinhold (1891-1894), der früh verstarb, erinnern soll. Er heiratet Anna (Änne) Neumann (1900-1977), arbeitet als Werkmeister auf „Gutehoffnunghütte“7 und wohnt mit seiner Frau und sechs Kindern ebenfalls in der Blumendelle 18. Doch auch Nachwuchs und Nähe schützen am Ende nicht vor Hühnerdieben, wie die „Emscher-Zeitung“ am 22. Februar 1899 zu berichten weiß:
„Schuhmachermeister Max Unkel ist am Sonntag abend der Hühnerbestand bis auf zwei abgemurkst worden und zwar von einem Arbeiter aus Rotthausen, der in der Nähe des Thatortes zu Besuch war. Glücklicherweise erfaßte Herr U. denselben, als er mit dem Einsacken der gestohlenen Objekte beschäftigt war und [so] konnte der Dieb bald darauf der Polizei überliefert werden.“
Max Unkel stirbt im Alter von 60 Jahren am 1. März 1921 in Schalke. Seine Frau Ida wohnt weiterhin in der Blumendelle, wird 74 Jahre alt und stirbt am 18. Januar 1943.
Ernst, viertältester Sohn der Unkel-Familie, ein Wiegemeister, kommt am 16. März 1863 zur Welt. Er heiratet im April 1887 Berta8 Kemper, geboren am 7. Juni 1867. Am 3. Januar 1888 wird mit Ernst Hermann Wilhelm das erste Kind geboren. Ernst wird später Friseur und heiratet am 16. Oktober 1910 eine gewisse Anna Jansen. Am 13. Februar 1894 erblickt Tochter Bertha das Licht der Welt, die schon nach vierzehn Tagen, am 27. Februar, verstirbt. Am 8. September 1895, wird der zweite Sohn Hermann Gustav geboren. Auch er stirbt nach nur wenigen Monaten, am 17. März 1896.
Ernst arbeitet als „Kontrolleur“. So lautet die abstrakte Berufsangabe, die in Standesamt-Verlautbarungen oder Adressbüchern zu finden ist. Das Schalker Adressbuch 1898, das seinerzeit nur Männer aufführt, verortet die Familie in der Blumenstraße 2, wo auch Bruder Max wohnt. Das Todesdatum von Ernst und Berta Unkel ist nicht bekannt.
Schwester Hedwig
Nachzüglerin ist Fritz‘ jüngste Schwester Hedwig Ida Wilhelmine. Diese wird Ende Mai 1895 mit neunzehn Jahren einen gewissen Gustav Reichenbach aus Ruhrort9 ehelichen. Männer wie Reichenbach gelten als „gute Partie“. Er besitzt seit zwei Jahren die Drogerie „Zum roten Kreuz“, später „Kaiser-Drogerie“, noch später „Reichenbachs Drogerie“, in der Landwehrstraße 17 in Ruhrort. Reichenbach muss ein recht fleißiger Netzwerker gewesen sein, denn er ist aktives Mitglied im Ruhrorter Kaufmanns-Verein, im Duisburger Drogisten-Verein und im Kleinhandelsausschuss der Handelskammer Duisburg. Am 1. Februar 1911 vermeldet der „General-Anzeiger“ den frühen Tod Reichenbachs einen Tag zuvor. Er wird nur 44 Jahre alt. Die Drogerie übernimmt im Februar 1912 ein Karl Müller, der den eingeführten Namen „Reichenbach“ beibehält. Die Drogerie, später auch Parfümerie Reichenbach, wird bis 2011 in Duisburg-Ruhrort ansässig sein.10
Über Hedwigs weiteren Lebensweg ist so gut wie nichts bekannt, was zu Anfang des 20. Jahrhunderts leider nicht selten vorkommt. Den Frauen werden die „drei K“, Kinder, Küche, Kirche, zugeteilt. In Zeitungen und Annoncen werden sie selten genannt, in Adressbüchern des 19. Jahrhunderts sogar gar nicht.
Abb. 3: Anzeige von Wilhelmine Unkel in der „Emscher Zeitung“. // Bild: „Emscher Zeitung“, 12. Juni 1880 - zeit.punktNRW; CC BY-SA 4.0
Mutter Wilhelmine
Fritz‘ Mutter Wilhelmine überlebt ihren Mann um fast 20 Jahre. Im Juni 1880 bietet sie als „Witwe Unkel“ recht plakativ ein Haus bzw. Teile des Hauses in der Viktoriastraße zur Vermietung an. Ansonsten taucht ihr Name nur noch bei Aktionen des Schalker Wohltätigkeitsvereins auf. Am 6. Februar 1894 verlässt Wilhelmine Unkel ihre Kinder und Enkelkinder für immer.
Der Turner und Sänger Fritz Unkel
Die Jugendjahre Fritz Unkels verlaufen recht ruhig und unaufgeregt. Bereits mit vierzehn Jahren erfolgt sein Berufseinstieg bei der Zeche Consolidation – darüber wird noch zu berichten sein. In seiner Freizeit beteiligt sich der junge Fritz gelegentlich an Aktivitäten des Schalker Wohltätigkeitsvereins – gemeinsam mit seinen Brüdern August und Wilhelm. Doch sein Interesse gilt vor allem dem Turnsport. Bereits als junger Mann wird er aktives Mitglied im Schalker Turnverein 1877 – mit Erfolg, wie die „Emscher Zeitung“ ab und an berichtet. Am 31. Juli 1884 heißt es beispielsweise vom ersten Stiftungsfest des TV Röhlinghausen:
„Beim Turnfest in Röhlinghausen errang der Schalker Turnverein 4 Preise und zwar durch Mich. Kalinowsky 1. und Max Zimmermann 2. Preis im Springen, Fritz Unkel 1. und J. Kalinowsky 2. Preis am Reck.“
Zwar führt der Turnsport nur unregelmäßig Wettbewerbe durch, so dass Turnen keine durchgängige Berichterstattung erfährt. Aber gelegentlich finden Unkel und andere Namen des Schalker Turnvereins ihren Platz in den Lokalblättern, wie z.B. am 13. Juli 1886 erneut in der „Emscher Zeitung“:
„Schalke 12. Juli, [Preisturnen] Bei dem gestrigen Preisturnen des Bochumer Turngaues, welches von ca. 20 Vereinen besucht war, errangen Genossen des Schalker Turnvereins folgende Preise:
Mich. Kalinowsky den 1. Preis mit 53 ½ Punkten
Fritz Unkel den 2. Preis mit 43 Punkten
Josef Böhm den 3. Preis mit 41 ½ Punkten
Ernst Dittmar mit 35 Punkten.
[…] Wir wünschen den Siegern ein kräftiges ‚Gut Heil!‘“
Fritz Unkel wird dem Turnsport und besonders dem Turnverein Schalke 1877 einige Jahrzehnte treu bleiben. Von 190311 an bis ins Kriegsjahr 1915 steht er dem Verein sogar als Vorsitzender vor, dessen Festivitäten oft preußischwilhelminisch geprägt sind. Die „Schalker Zeitung“ vom 21. September 1908 berichtet zum Beispiel vom 31. Stiftungsfest:
„Seit einigen Monaten hat der Verein eine Damenriege gegründet, die in einem kleidsamen Matrosenkostüm gut geschulte Stabübungen ausführte. Der ungeteilte Beifall, den die Damenriege erntete war ein wohlverdienter. Der Vorsitzende des Vereins, Herr Fritz Unkel hieß die Erschienen herzlich willkommen, ging auf die Entstehung des Turnvereins Schalke ein und brachte zum Schluß seiner Ausführungen ein dreifaches ‚Gut Heil‘ auf Se. Maj. den deutschen Kaiser auf.“
Auch den später um die Westfalia-Fußballer erweiterten Turn- und Sportverein Schalke 1877 führt er vom 25. Juli 1919 bis zum 24. Januar 1924 an.
Um die Jahrhundertwende herum findet Fritz Unkel, seit 1886 verheiratet und Familienvater, wohl auch Freude am Gesang. Er tritt als Solist bei Liederabenden auf, die mal kommerziellen, mal karitativen Charakter haben. Unkel präsentiert zumeist Volks- und Soldatenlieder. So kündigt am 16. März 1900 die „Emscher Zeitung“ für den 18. März den einzigen „Volks-Unterhaltungs-Abend in diesem Winter“ im “schönen Saale der Gelsenkirchener Stadthalle“ an, der „dem herrlichen deutschen Volksliede gewidmet“ sei. Es stehe ein „ganz ungewöhnlich genußreicher und erhebender Unterhaltungs-Abend“ bevor:
„Das deutsche Volkslied selbst, in seiner Entstehung, seinem Wesen, seinem tiefen Gehalte und seiner noch immer nicht genug gewürdigten Bedeutung auch für unsere Zeit zu schildern, ist die Aufgabe, die Gymnasialoberlehrer Kummer übernommen hat. Einen passenden Prolog wird Frl. Flora Schmidt aus Bulmke sprechen, während Herr Fritz Unkel aus Schalke das ergreifende Volkslied ‚Zu Straßburg auf der Schanz‘ als Solo singen wird.“
Unkel tritt aber auch bisweilen in einem Gesangsquartett auf, wie beispielsweise beim „Wohltätigkeits Concert zum Besten notdürftiger Konfirmanden“ in Ueckendorf. Die „Emscher-Zeitung“ vom 28. März 1901 schreibt:
„Auch wollen wir dankend des Männerquartetts aus Schalke, bestehend aus Fritz Unkel, Daniel Ern, Karl Oppenberg und Aug. Oppenberg gedenken. Auch diese Herren thaten ihr Bestes, um zum Gelingen des guten Werkes beizutragen.“
Fritz Unkel wird bis weit in die Zehnerjahre aktives Mitglied im Männergesangsverein (MGV) Concordia bleiben, der gelegentlich auch in der Gaststätte Thiemeyer tagt. Auch hier engagiert er sich viele Jahre als 1. Schriftführer und ab März 1914 sogar als 1. Vorsitzender.
Die Leushackes
Zurück in die Achtzigerjahre des 19. Jahrhunderts. Der junge Fritz Unkel, auf Freiersfüßen wandelnd, lernt Wilhelmine Franziska Leushacke kennen und alsbald auch lieben. Kurz darauf läuten die Hochzeitsglocken12. Franziska gehört wie Fritz zum 65er-Jahrgang. Sie wurde in Rellinghausen, das ab 1910 zu Essen gehört, geboren. Doch ihre Familie zieht es in den nächsten Jahren nach Schalke, denn Vater Joseph Leushacke arbeitet künftig als Obersteiger auf Zeche Consol. Fritz Unkel und Joseph Leushacke sind also in der gleichen Branche und für den gleichen Arbeitgeber tätig.
Schwiegervater Joseph Leushacke, 1838 in Suderwich, heute Recklinghausen, geboren, kommt 1886 zu regionaler Berühmtheit, als er zu den dreizehn Bergleuten gehört, die beim Grubenunglück am 24. September, ausgelöst durch eine Schlagwetterexplosion auf Schacht II der Zeche Consolidation, mit Mut und Tatkraft mehrere Menschenleben retten. Dafür erhalten sie auf Geheiß des deutschen Kaisers im Februar 1888 von der Zechenverwaltung das „Verdienst-Ehrenzeichen für Rettung aus Gefahr“13.
Anfang Mai 1897 meldet das Standesamt in seinen „Familien-Nachrichten“ den Tod Joseph Leushackes (7. Mai), wohnhaft in der Schalker Viktoriastraße 19, der Adresse Fritz Unkels. Der Schalker Bergmann wird 59 Jahre alt. Fritz‘ Schwiegermutter Anna Leushacke, 1836 in Rellinghausen als Anna Hagemann geboren, überlebt ihren Mann um sieben Jahre und stirbt am 20. Juli 1904 in Gelsenkirchen.
Über 50 Jahre auf Consol
Über die ersten beruflichen Erfahrungen Fritz Unkels ist wenig bekannt. Warum sollte auch die Lokalpresse über ihn berichten? Der junge Fritz ist einer unter vielen Jugendlichen auf Schalke, die ihre ersten Schritte ins Berufsleben unternehmen. Im Falle Unkels geschieht dies bei der Zeche Consolidation.
Abb. 4: Ehemalige Gebäude der Zeche Consolidation („Zeche Consol 1/6“) in der Gewerkenstraße 28-32 heute. // Bild: Dr. W. Strickling; CC BY-SA 4.0
Am 30. September 1904 schreibt die „Schalker Zeitung“:
„Auf eine 25jährige Tätigkeit als Beamter der Bergwerk-Aktien-Gesellschaft Consolidation konnte am gestrigen Tage Herr Fritz Unkel zurückblicken. Herr Direktor Wimmelmann überreichte gestern Morgen dem Jubilar im Namen der Gesellschaft einen Brief mit Inhalt, sowie im Namen des Vorstandes und der kaufmännischen Beamten eine goldene Uhr mit Kette.“
25 Jahre später, am 8. November 1929, vermeldet die „Dortmunder Zeitung“ in einer Kurzmitteilung:
Gelsenkirchen, 7. November, 50jähriges Arbeitsjubiläum: Der preußische Handelsminister sprach dem Hauptmaterialienverwalter Fritz Unkel zu seinem 50jährigem Arbeitsjubiläum bei den Steinkohlenbergwerken „Consolidation“ nachträgliche Glückwünsche und seine Anerkennung aus.“
Folglich muss Unkel bereits im September 1879, also mit vierzehn Jahren, auf Consol angefangen haben, was anderslautenden Quellen widerspricht, er habe zunächst als Kohlenhändler gearbeitet.
Die Zeche Consolidation, kurz Consol, zählt zu den mächtigsten Bergbaubetrieben Deutschlands in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ausschlaggebend für die Gründung der Zeche sind mehrere Mutungsbohrungen14 nach 1848 in der Schalker Mark, die reichhaltige Steinkohlevorkommen versprechen. Industriepionier Friedrich Grillo führt 1861 verschiedene Gewerke15 zur „Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks Consolidation“ zusammen. Der Zechenname ist also vom ersten Tag an auch Programm.
Ab 1863 wird nahe des Schalker Markts der erste Schacht, Schacht Gertrud, abgeteuft und zur Förderung eingerichtet. Ab 1865 fördert Consolidation dann hochwertige Fett- und Gaskohle, die in den Kokereien und anderen Unternehmungen Grillos weiterverarbeitet wird. In den Siebzigerjahren des 19. Jahrhunderts ist Consol für einige Jahre sogar die größte Zeche im Ruhrgebiet. Die geförderte Menge beträgt 366.000 Tonnen Kohle, die Belegschaft wächst auf über 2.000 Mitarbeiter (1873) an. Und der Ausbau geht in den nächsten Jahrzehnten unvermindert weiter. Neue Schächte werden eingerichtet, ältere ausgebaut. Direkt an den Schachtanlagen entstehen zecheneigene Kokereien. Neue Wetterschächte sollen die Schlagwettergefahr mindern. Die Ausstoßmenge steigt 1913 auf 1,95 Millionen Tonnen Kohle; die Kokereien erzeugen 600.000 Tonnen Koks im Jahr.
Die einzelnen Stationen Unkels im Großbetrieb Consolidation kann dieses Buch nicht rekonstruieren. Doch als Fritz Unkel zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Sportfunktionär in Erscheinung tritt, wird er stets als leitender Mitarbeiter der Consol-Materialverwaltung vorgestellt. Unter den verwalteten Materialien darf man sich Güter des Anlagevermögens (Ersatzteile, einfache Werkzeuge usw.) wie auch Güter des Umlaufvermögens (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, allgemeine Verbrauchsgüter) vorstellen.
Schalker Straße 143
Leider gibt es zur Familie von Fritz Unkel nicht nur gesicherte Puzzlestücke. Die belegbaren Stücke finden hier natürlich Erwähnung. Anderes, was sich nicht eindeutig oder mehrfach verifizieren ließ, wird außen vor gelassen oder im Konjunktiv benannt.
Fritz Unkel, der zunächst viele Jahre in der Viktoriastraße16 und in der Grillostraße 100 wohnte, lässt später in der Schalker Straße 143 ein großes Haus bauen, das zum Mittelpunkt seiner Familie werden soll. Aus der Ehe mit Franziska Leushacke gehen mindestens acht Kinder hervor. Darunter so einige, denen nur ein kurzes Leben beschieden ist, was in dieser Zeit nicht selten vorkommt.
Abb. 5: Fritz Unkels Familie // Bild: be - eigenes Werk; CC BY-SA 4.0
+++ Exkurs: Fritz Unkels Familie +++
Erstgeborener ist im Jahr 1886 Friedrich Wilhelm Joseph Unkel, der wie sein Onkel Wilhelm den Bäckerberuf ergreift. Er startet als Lehrling unter dem Schalker Bäckermeister Schubeus, bekannt für seine „täglich frischen Speculatius“ (Werbeanzeige), wird dort am 29. Oktober 1903 zum Gesellen und – kurz nach Eröffnung seines eigenen Geschäfts am 3. April 1909 in der Schalker Str. 143 – von der Dortmunder Handwerkskammer zum Meister ernannt (4. Juli 1910). In den Folgejahren sucht Joseph für seine Backstube in der Schalker Straße 143 des Öfteren Lehrlinge und „Gehülfen“. Und in den Zwanzigerjahren wird Joseph die Fußballer von Schalke 04 mit frischen Backwaren verwöhnen, was den Königsblauen zeitweise den Beinamen „Streuselkuchen-Klub“ einträgt.
1927 führt das Adressbuch von Gelsenkirchen unter Josephs Namen auch eine Kohlenhandlung auf dem Nachbargrundstück Schalker Straße 145 an.
Diese Kohlenhandlung hat er bereits zehn Jahre zuvor, im August 1917, von seinem Onkel Wilhelm übernommen. Das Geschäft existiert auch noch in der Nachkriegszeit unter „Kohlen und Transporte Fritz Josef Unkel, Inhaber Hans Unkel“ in der Schalker Straße 143/145. Die Einfahrt auf das Hinterhausgrundstück erfolgte stets über die Hausnummer 145.
Joseph Unkel ist mit Olga Gertrud Josephine, geborene Kuhlmann, seit dem 14. August 1912 verlobt und seit dem 19. Mai 1913 verheiratet. Am 27. März 1918 bringt Olga die Zwillinge Herta Franziska und Joseph Lorenz zur Welt, doch diese überleben nur einen halben Tag. Ob weitere Kinder folgen, konnte nicht ermittelt werden. Auch Joseph selbst ist kein langes Leben beschieden. Am 10. März 1928 stirbt er mit gerade einmal 41 Jahren. Olga führt die Geschäfte weiter. Im Adressbuch 1939 geht es unter ihrem Namen und unter der Adresse Schalker Straße 143 offiziell um „Fuhrgeschäfte“.
Ein zweiter Sohn, Friedrich Wilhelm Unkel, kommt Ende September 1888 zur Welt. Er wird nur fünf Monate und 21 Tage alt und stirbt am 19. März 1889. Ähnlich verhält es sich mit Philipp Friedrich Unkel, der am 7. Februar 1896 in Schalke zur Welt kommt. Sein Leben endet am 2. Februar 1900 mit knapp vier Jahren. Zum Leben des drittgeborenen Sohns, August Unkel (1890-1973), ließ sich nur wenig ermitteln.
Am 18. Juli 1898 wird Paul Ernst Felix Unkel geboren. Er wird von 1915 bis 1917 für Schalke spielen; ist zeitweise auch als Obmann tätig. Verheiratet ist er mit Emilie Rosa, geborene Hackenberg. Felix Unkel ist kein langes Leben beschieden. Im Adressbuch von 1927 wird er noch als Bürobeamter, wohnhaft in der Kaiserstraße 29, angeführt. Doch er stirbt am 8. August 1930 mit nur 32 Jahren. Das Adressbuch führt 1939 eine „Witwe Emilie Unkel“ in der Franz-Seldte-Straße 108, früher Viktoriastraße, und 1966 in der Kurt-Schumacher-Str. 61 an, was seine Frau sein könnte. Ihr Todesdatum ist nicht bekannt.
Neben den genannten Söhnen gab es wenigstens drei Töchter in der Familie von Fritz Unkel. Zum einen Franziska (Berta) Wilhelmine, geboren am 20. November 1892. Ihre Verlobung mit einem Josef Thomas aus Meiderich wird am 27. Juni 1914 in der „Schalker Zeitung“ von Fritz und Franziska Unkel bekannt gegeben. Doch in den Kriegsjahren muss sich etwas verändert haben. Denn am 14. Mai 1918 heiratet sie den Verwaltungsangestellten Reiner Lütterforst. In der Vermählungsanzeige in der „Schalker Zeitung“ vom 15. Mai wird sie „Mimi“, eine Kurz- und Koseform von Wilhelmine, genannt.
Lütterforst wurde am 30. Juni 1890 in Hochneukirch geboren. Er verbringt seine Kindheit, Schulzeit in München-Gladbach (Mönchengladbach) und zieht später ins Ruhrgebiet. Hier arbeitet Unkels Schwiegersohn in der Stadtverwaltung Gelsenkirchen und zählt auch viele Jahre in unterschiedlichen Funktionen zur Schalker Vereinsführung. In der Nachkriegszeit steigt Lütterforst – nach Einstufung in die Kategorie V (Entlasteter im Rahmen des Entnazifizierungsverfahrens17) – zum Leiter des Straßenverkehrsamtes auf. Laut Gelsenkirchener Adressbuch wohnten die Lütterforsts 1927 in der Essener Str. 107. Doch 1939 und auch nach dem Krieg, 1951 und 1966, sind sie ebenfalls unter der Adresse Schalker Str. 143 gemeldet. Am 3. September 1968 stirbt Lütterforst in Gelsenkirchen-Schalke mit 78 Jahren.
Abb. 6: Traueranzeige für Franziska Unkel im Dezember 1915. // Bild: „Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung“, 31. Dezember 1915 - zeit.punktNRW; CC BY-SA 4.0
Eine zweite Tochter, Anna Josephine Unkel, wird nur siebzehn Tage alt. Sie kommt am 19. März 1895 zur Welt und stirbt bereits am 5. April. Eine dritte Tochter wird Ende Februar 1904 geboren. Die Standesamt-Nachrichten in der „Emscher-Zeitung“ vom 2. März 1904 geben bekannt, dass „Mag.-Verw. Friedrich Unkel“ eine „T“ (= Tochter) angemeldet hat. Laut Standesamt-Unterlagen dürfte es sich um Anna Beate (*20. Februar 1904) handeln.
Fritz Unkel überlebt fast alle seine Kinder, was für ihn sicherlich ein schmerzhafter Weg war. Zumal auch Ehefrau Franziska viele Jahre vor ihm geht. Ihr Leben endet am 29. Dezember 1915 nach „langem, schwerem, mit großer Geduld ertragenem Leiden“. Franziska Unkel18 wurde 50 Jahre alt.
Heute gehört das Haus in der Schalker Straße 143 unzweideutig zum Schalker Geschichtsinventar. Denn auch in der Nachkriegszeit bleibt das Haus ein wichtiger Knotenpunkt des Schalker Vereinslebens. Die Backstube übernimmt in der Nachkriegszeit Schalkes Original und späterer Mannschaftsbetreuer Karl-Heinz „Charly“ Neumann, gelernter Bäcker und Konditor. Laut Fritz Unkels Urenkel Reiner Keith, der seine Jugend in der Schalker Straße 143 verbrachte, hat Charly die Backstube wohl bis Anfang der Sechzigerjahre betrieben. Außerdem wohnten im Haus 143 in den Nachkriegsjahren auch Fritz Szepan und seine Frau Elise. Die Adressbücher listen zwar einen Friedrich Sczepan mit „c“ mit seiner Frau Ruth auf, doch könnte es sein, dass diese originalen und dadurch leicht verfremdeten Angaben zum Schutz der Privatsphäre vorgenommen wurden19. Das Textilgeschäft der Szepans am Schalker Markt wurde in den Kriegsjahren ausgebombt. Nach dem Krieg logierte das Geschäft zeitweise ebenfalls in der Schalker Straße, so dass das Haus Nr. 143 für die Szepans eine angenehme Wohnlage darstellte. Außerdem betrieb in den Sechzigerjahren Günter Siebert, Mittelstürmer der 58er-Meistermannschaft und späterer Vereinspräsident, im Haus einen Kiosk. Diesen Kiosk übernahm er von Elfriede Unkel, der Ehefrau von Hans Unkel (Kohlenhandlung, s.o.).
Seit 1987 betreibt die Familie Heinz van Haarens20, Schalke-Profi von 1968 bis 1972, ihre Physiotherapiepraxis im Haus. Es ist also über verschiedene Generationen hinweg ein königsblaues Haus, auch wenn es viele Jahre eher grau und inzwischen grün daherkommt.
Die Genese des Dreiecks Unkel – Schalke 04 – Consol
Mitte der Zwanzigerjahre entwickeln sich feste und stabile Verbindungen zwischen Fritz Unkel, dem FC Schalke 04 und der Zeche Consolidation. Consol steigt mit etwa 8.000 Beschäftigten zum größten Arbeitgeber vor Ort auf. 1923 geht die Kuxen21-Mehrheit an die Mannesmannröhren-Werke AG. Die Schächte 3/4/9 in Gelsenkirchen-Bismarck werden zum neuen Zentralschacht der Zeche, die Expansion setzt sich etwas verlagert fort. Schon bald entwickelt sich Consol zum wichtigsten Förderer des Vereins FC Schalke 04, der gerade seine ersten Erfolge einfährt. Diese Förderung kommt vor allen Dingen durch die Vermittlungskünste des umtriebigen Hauptmaterialienverwalters Fritz „Papa“ Unkel zustande, der nach der Neugründung unter dem Namen FC Schalke 04 im Januar 1924 zum ersten Vereinspräsidenten der Königsblauen gewählt wird.
Doch Unkel und der FC Schalke 04 kennen sich schon länger, denn die Geschichte des FC Schalke 04 beginnt zwanzig Jahre früher unter anderem Namen. 1904 gründen fußballverrückte Jugendliche aus dem Umfeld der Hauergasse22 den Verein Westfalia Schalke. Zum Anführer und Kapitän steigt der Schlosserlehrling Wilhelm „Willy“ Gies23 auf. Die Vereinsfarben sind Rot und Gelb.
Abb. 7: Haus Goor: Erster Treffpunkt der Westfalia-Fußballer. // Bild: „General-Anzeiger (Dortmund und Westfalen)“, 6. Dezember 1911 - zeit.punktNRW; CC BY-SA 4.0
In den nächsten Jahren bedarf es eines enormen Durchhaltewillens, um sich im Rahmen des bürgerlich geprägten Rheinisch-Westfälischen Spiel-Verbandes (RWSV) bzw. des Westdeutschen Spiel-Verbandes (WSV)24 ab 1907 als eigenständiger Fußballverein zu etablieren. Denn dort werden Mitgliedschaften, so scheint es, nach großbürgerlichem Gutdünken vergeben. Gerade wenn es um jugendliche „Proletenmannschaften“ geht, denen man mit Misstrauen begegnet. Viele wilde Vereine dieser Zeit verzweifeln an der Arroganz des Verbandes.
In den ersten Jahren bolzt die „wilde“ Westfalia auf einer Wiese vor dem heruntergekommenen Haus Goor, einem alten Herrenhaus nördlich der heutigen Lockhofstraße, das 1930 abgerissen wird25. Nach einem Abstecher auf den städtisehen Sportpatz an der Taubenstraße, später Kanzlerstraße, geht es schließlich 1909 auf Empfehlung des Gastwirts Wilhelm Heining in der Gewerkenstraße26 auf die Rubens'sche Wiese an der Grenzstraße27, die sich nach Anpachtung und Herrichtung zu einer ersten sportlichen Heimat entwickelt. Erste Komplimente für das flüssige Kombinationsspiel der Westfalia gibt es in dieser Zeit auch schon. So schreibt die „Wattenscheider Zeitung“ am 11. März 1908:
„Der hiesige ‚Ballspielverein‘28 veranstaltete am Sonntag ein Wettspiel, und zwar spielte die erste Mannschaft des genannten Vereins gegen die 1. Mannschaft des Fußballklubs ‚Westfalia‘-Schalke. Trotz der guten Verteidigung seitens des ‚Ballspielvereins‘ mußte er dem kombinierten Spiel der ‚Westfalia‘ unterliegen: das Ergebnis der 1. Halbzeit war 3:0 zu Gunsten der ‚Westfalia‘. Während der 2. Halbzeit konnte der „Ballspielverein“ 1 Tor wiedererringen, womit das Spiel im Verhältnis von 3:1 zu Gunsten der ‚Westfalia‘ beendet war.“
Allerdings verbleibt die Westfalia nur bis 1909 auf der Rubens’schen Wiese, da sich diese auf Dauer doch als wenig wettkampfgeeignet zeigt29. Doch an der Grenzstraße, der alten Demarkationslinie zwischen Schalke und Gelsenkirchen, liegt noch ein weiterer Platz, den der Turnverein Schalke 1877 von der Zeche Consolidation angepachtet hat. Nach ersten Gesprächen kommt es zu einer Vereinbarung, so dass auch die Westfalia diesen künftig nutzen darf. „Kommt zu uns, dann haben wir beide den Platz“, soll Fritz Unkel, Mitglied des Turnvereins, den Westfalia-Fußballern angeboten haben. Doch für einen Anschluss an den Turnverein ist die Zeit noch nicht reif.
Erst als das Bemühen um eine Verbandsaufnahme weiter erfolglos bleibt, obwohl die Westfalia mit Heinrich Hilgert30, Wiegemeister auf Consol, inzwischen einen gutbürgerlichen, respektablen Vorsitzenden installiert hat, schließen sich die Fußballer im Januar/Februar 1912 organisatorisch dem Schalker Turnverein 1877 an31, einem nach damaligem Wertekanon seriösen, mit dem WSV kompatiblen Verein. Zum Wegbereiter der Eingliederung steigt Fritz Unkel auf, den die Fußballer als verlässlichen Ansprechpartner kennen und schätzen lernen. Trotzdem bleibt die Fußballabteilung unter Leitung des Zechenschlossers Gerhard Klopp, einem alten Haudegen der Westfalia, im Gesamtverein weitgehend isoliert und autonom.
Im September 1912 startet die Fußballabteilung des Schalker TV 1877 in ihre erste Meisterschaftssaison. Natürlich ist es zunächst die unterste, die C-Klasse im Bezirk Mark, an deren Spielrunde in diesem Jahr auch Westfalia Herne teilnimmt. Doch im Fußball gibt es zu dieser Zeit noch recht flache Hierarchien. Zwei Aufstiege reichen, um erstklassig zu werden. Dass das nicht im Vorbeigehen funktioniert, zeigt die erste Saison. Am Ende freut sich die junge Mannschaft über den 6. Platz und ein ausgeglichenes Punktekonto.
Ein Jahr später, im Sommer 1914, wird der Ligabetrieb durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen. Viele junge Fußballer wechseln nun in die graue Soldatenuniform. Nicht wenige mit lautem Hurra-Patriotismus, befeuert von servilen Fußballverbänden, die im Ersten Weltkrieg eine Gelegenheit sehen, sich als patriotisch zuverlässig zu beweisen, was ihnen von der Deutschen Turnerschaft (DT) jahrelang abgesprochen wurde.
Fritz Unkel kämpft im Oktober 1914 privat an anderen Fronten. Unter anderem geht es um eine Steuerzahlung, die Unkel an die Stadt Gelsenkirchen leisten soll. Im Zuge eines Grundstückskaufs, das Grundstück wurde von einer Witwe Hoffmann erworben, erhebt Unkel gegen die seiner Meinung nach zu Unrecht eingezogene Umsatzsteuer Einspruch. Es handelt sich immerhin um 2.080 Mark. Gemäß der bestehenden Gesetzeslage müsste eigentlich die Verkäuferin die Steuer tragen. So wird dem Einspruch auch zunächst stattgegeben. Allerdings kann die Witwe die Steuer nicht aufbringen. Sie gilt, wie die „Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung“ am 23. Oktober 1914 berichtet, als „unpfändbar“. So versucht sich die Kommune bei Fritz Unkel gütlich zu halten und verweigert die Rückzahlung der Steuer.
Unkel kann und will das nicht akzeptieren. Als die Stadt seiner Forderung auf Rückzahlung nicht nachkommt, schlägt Unkel gemeinsam mit Syndikus Heinkele vom Gelsenkirchener Haus- und Grundbesitzerverein den Weg des „Verwaltungsstreitverfahrens“ ein, um sein Geld zurückzubekommen. Laut Heinkele sei entscheidend, „ob der „Pfändungsüberweisungsbeschluß wirke oder nicht32“. Es entwickelt sich ein längerer Rechtsstreit, der nach den Stationen Landgericht Essen und Oberlandesgericht Hamm noch bis zum Preußischen Oberverwaltungsgericht (OBG) in Berlin gehen wird. Parallel wird Fritz Unkel in dieser Zeit Witwer. Und er legt auch den Vorsitz des Turnvereins nieder33. Die Kriegsjahre sind für Unkel traurige, bedrückende Zeiten.
Im Fußball sorgt der Krieg durch die zahlreichen Einberufungen und Freiwilligenmeldungen für spielarme Zeiten. Nicht jeder will sich mit dieser Fußballzwangspause anfreunden. Der aus Essen-Kray stammende Bankangestellte Robert Schuermann versucht es 1915 mit einer Westfalia-Neugründung. Er wirbt neue Spieler an, meist Jugendliche und ältere Männer, und bringt den Fußballbetrieb wieder in Schwung. Schuermann gelingt es sogar, mit der neuen Westfalia kurzfristig Aufnahme im WSV zu finden. So gibt es am Nikolaustag 1915 ein Spiel an der Grenzstraße zwischen dem Turnverein 1877 und der neuen Westfalia, das die Westfalia mit 5:2 für sich entscheidet. Weitere Spiele gegen die „Rothosen“ von SC Germania Herne, den Lokalrivalen SuS Schalke 96, den Spielverein Eickel, den Essener SV 1899 sind verbürgt.
Als Robert Schuermann Ende 1916 selber eingezogen wird, kümmert sich Ehefrau Christine, Tochter des Vereinswirts Friedrich Wilke in der Viktoriastraße 60 (Ecke Grenzstraße), um die Aufgaben des Vereinsvorsitzenden und hält die Westfalia über Wasser. Anfang 1918 stirbt Christine Schuermann; der Verein bleibt ein Jahr lang ohne Führung. Nach dem Krieg übernimmt Robert Schuermann wieder den Westfalia-Vorsitz.
Am 24. Juli 1919 erfolgt eine erneute, dieses Mal verbindlicher angelegte Fusion des Schalker Turnvereins mit der neugegründeten Westfalia zum Turn- und Sportverein Schalke 1877. Erster Vorsitzender wird Fritz Unkel34. Forciert wird die Fusion durch den Streit um die künftige Nutzung des Sportplatzes an der Grenzstraße, bei dem die Fußballer die Pistole der Turner, dem eigentlichen Pächter des Platzes, auf der Brust spüren. Eher widerwillig stimmt Schuermann der Fusion zu. Allerdings kommt ein Zusammenschluss auf Basis einer solchen Konstellation nie über den Status einer lieblosen Zweckgemeinschaft hinaus, der auch keine lange Dauer beschieden sein wird.
Im Jahre 1920 stoßen die Brüder Friedrich „Fred“ und Hans Ballmann zu den Schalker Fußballern. Fred und Hans Ballmann sind gebürtige Dortmunder (5. November 1894 und 24. November 1896), verbringen aber ihre Kindheit bereits in Großbritannien, wo ihr Vater in einer Zinkhütte35 arbeitet, und wo sie selbst den Beruf des Bergmanns erlernen. Nach der Niederlage des Deutschen Reichs im WK I werden die internierten Ballmanns von der Insel verwiesen und kehren ins Ruhrgebiet zurück. Zielort ist Gelsenkirchen-Schalke, denn der ehemalige Westfalia-Spieler Fred Kühne, den die Brüder im Internierungslager kennenlernen, dient sich ihnen als Lotse an.
Die Ballmann-Brüder sind keine professionellen, aber doch ambitionierte Fußballer, die auf der Insel alles mitbekommen haben, was die damals führende Fußballnation an Rüstzeug mitgeben kann. Allerdings sind sie eher dem schottischen Flachpassspiel zugetan als dem englischen Kick and Rush. Mit dieser Philosophie treffen sie in Schalke auf eine hochmotivierte, lernbegierige Mannschaft, die zu dieser Zeit mit Thomas Student bereits einen Ausnahmefußballer in ihren Reihen hat. Der Verein besorgt den Brüdern Arbeitsplätze bei der F. Küppersbusch & Söhne AG, neben Consol der größte Arbeitgeber in Schalke, und eine Wohnung in der Olgastraße. Eine Zeit lang hilft auch Fritz Unkel mit Kost und Logis aus.
Das von den Ballmanns mitgebrachte schottische Flachpassspiel36 findet rasch Eingang in das Mannschaftstraining und schließlich auch in die Meisterschaftsspiele. Der Ball läuft schnell und direkt von Spieler zu Spieler. Das damit eng verbundene, systematische Freilaufen sichert permanente Anspielstationen und lange Ballbesitzphasen. Dieser Spielstil lässt die Gegenspieler kaum noch an den Ball, was für Feldüberlegenheit sorgt und den Gegner demotiviert. Veredelt wird das System mit technischen Verbesserungen: elegante Ballannahmen, Doppelpässe, Scherenschläge, Dropkick-Schüsse. Schalke 04 unterscheidet sich schon bald von seinen Wettbewerbern durch einen dominanten, attraktiven und auch sehr erfolgreichen Spielstil. 1921 steigen die Fußballer in die Emscher-Kreisliga auf und benötigen einen besseren Sportplatz. Unkel organisiert über Consol einige Waggons mit Asche, um die Spielfläche von Unebenheiten zu befreien. Auch das Drumherum, der Zaun, die Kabinen, erfahren eine Aufwertung.
Die reaktionären Kräfte in der Deutschen Turnerschaft geben auch in der Weimarer Zeit keine Ruhe. Am 5. Januar 1924 führt die sogenannte „Reinliche Scheidung“37 zur endgültigen Trennung von Turnern und Fußballern. Der Weg ist jetzt frei für einen Fußballclub „FC Schalke 04“ mit blau-weißen Vereinsfarben. Die Neugründung findet bei Oeldemann, Ecke Wilhelminen-/Grenzstraße, statt. Erster Vorsitzender wird der zu den Fußballern wechselnde Fritz Unkel. Unkel, der seit einigen Jahrzehnten dem Turnverein angehört, wird sich die Entscheidung nicht leicht gemacht haben. Denn für ihn als 58jährigen Funktionär geht es um die Frage: Schlägt sein Herz aus Tradition stärker für das Turnen oder fühlt er sich noch jung und offen genug für die aufstrebende Welt der Fußballer? Zumal es nicht wenige Nörgler und Schwarzmaler im Umfeld gibt, die dem Fußballverein ein schnelles Ende prophezeien.
Am 5. Januar 1924 erklärt sich Unkel bereit, den FC Schalke 04 zu führen. Er wird mit seinem Netzwerk in verschiedene Milieus hinein und mit seinen guten Verbindungen zur Zeche Consol dem Verein bald neue Möglichkeiten verschaffen. Bereits zwei Wochen nach Gründung erfolgt das erste Gesellschaftsspiel38 gegen den SC Gelsenkirchen 07. Schalke gewinnt mit 4:2.
Der Schalker Kreisel bittet zum Tanz
Mit der Neuaufstellung des Vereins geht ab Mitte der Zwanzigerjahre ein deutlicher sportlicher Aufwärtstrend einher. In der Saison 1924/1925 holt Schalke 04 die Emscher-Kreismeisterschaft durch einen 3:0-Sieg gegen die Sportfreunde Essen 07 sowie die Ruhrgau-Kreismeisterschaft durch Siege über Preußen 07 Bochum (4:0) und – man höre und staune – Borussia Dortmund (4:2). Das Spiel in Herne ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Vereine, aber in dieser Zeit noch ein Spiel unter vielen.
Der „Essener Anzeiger“ vom 4. Mai 1925 berichtet:
„Selbst ein Reichsbannertag konnte nicht verhindern, daß etwa tausend Zuschauer den in tadelloser Verfassung befindlichen Platz der Herner Westfalia umsäumten. […] Lebhaft begrüßt betraten die Mannschaften den Platz. Borussia ist körperlich den Schalkern überlegen. Das Charakteristische des Spieles war: harter Kampf auf beiden Seiten, dabei aber durchaus fair. […] Schalke hat als die bessere Mannschaft verdient gewonnen.“
Schließlich wird Schalke 04 noch Westdeutscher Kreismeister durch Erfolge über SV Bielefeld 06, TSV Eller 04 (Düsseldorf) und RSV 1900 Hagen. Nur ein allgemeiner Aufstiegsstopp des Verbandes verwehrt Königsblau in diesem Erfolgsjahr den Zugang zur nächsthöheren Klasse.
Abb. 8: Erstes Revierderby am 3. Mai 1925 in Herne. Schalke siegt mit 4:2 und wird Ruhrgau-Kreismeister. // Bild: „Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung“, 4. Mai 1925 - zeit.punktNRW; CC BY-SA 4.0
1925 stößt Heinz Ludewig, Ex-Nationalspieler des Duisburger Spielvereins (SpV), als Trainer zu den Königsblauen. Ludewig ist vom Flachpassspiel überzeugt und tritt an, um dieses auf Schalke weiter zu veredeln. Ein Jahr später wird Ludewig den FC Schalke 04 in die damals höchste Liga, die Bezirksklasse Ruhr, führen, auch wenn die Kreisel-Pioniere aus England, die Ballmänner, inzwischen nicht mehr an Bord sind. Hans Ballmann wandert im Oktober 1923 in die Vereinigten Staaten aus. Sein Bruder Fred zieht sich vom Fußball zurück. Das Gelsenkirchener Adressbuch führt ihn 1927 noch als Fuhrmann in der Schalker Straße 145, also mitten im „Hauptquartier Unkel“. Vermutlich ist er zu dieser Zeit wie der ebenfalls genannte Fuhrmann Heinrich Wegner für die unter gleicher Adresse firmierende Kohlenhandlung Joseph Unkel tätig.